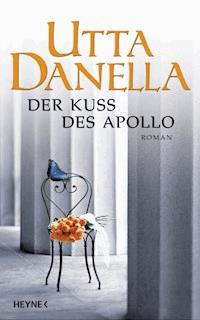6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zunächst scheinen Stella Termogens Chancen auf ein sorgenfreies und glückliches Leben denkbar schlecht zu stehen. Das Mädchen mit dem ungewöhnlichen Namen wird zwischen den beiden Weltkriegen geboren. Aber Stella ist eine Kämpferin. Aus dem traurigen Kind wird ein unbeschwertes, fröhliches Mädchen. In Berlin endet für Stella die vielleicht schönste Zeit, aber dafür beginnt ein aufregendes Leben: Sie arbeitet als Mannequin für ein Berliner Modehaus, wird zur Weltenbummlerin. Doch von einem entfernt sie sich immer mehr: von der Liebe des Mannes, bei dem sie eine Heimat finden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1567
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Utta Danella
Stella Termogen
oder die Versuchungen der Jahre
Roman
Die Insel der Jugend
Jene Schiffe, welche verließen den Hafen, einem unbekannten Geschick entgegen, haben sie sich voneinander entfernt?
1
Ein unmöglicher Name, fand die Nachbarin Lehmann, die als einziger familienfremder Gast der Taufe beiwohnte. Stella, sei das überhaupt ein christlicher Name? Sie habe ihn noch nie gehört.
»Ich habe ihn ausgesucht«, erwiderte kurz Schwester Marie, die Taufpatin. Sie trug den Säugling auf dem Arm und wies die ungebetene Fragerin mit einem kühlen Blick zurecht.
Die Witwe Lehmann verzog geringschätzig den schmalen Mund. Das sieht dir ähnlich, schien ihre Miene auszudrücken. Eine alte Jungfer in Schwesterntracht. Weil Krieg ist, bildet sie sich ein, sie sei unentbehrlich. Stella! Was kann aus einem Kind werden, das solch einen Namen trägt? Meine Kinder hätten vernünftige Namen bekommen.
Aber sie hatte keine Kinder. Frau Lehmann war nicht betrübt darüber. Jetzt schon gar nicht mehr. Früher hatte sie sich einen Sohn gewünscht. Heute hätten sie ihn ihr wahrscheinlich schon totgeschossen. Besser so.
Ist ja auch egal, was das Wurm für einen Namen hat, dachte sie weiter, als sie in das Steckkissen blickte. Lange lebt es doch nicht. Das winzige Gesicht war totenbleich, nicht rot wie bei einem gesunden Säugling. Die Augen waren geschlossen. Vielleicht war es schon tot. Es schien kein Leben mehr in dem kaum geborenen Körper zu sein. Wer bekam schließlich auch ein Kind in diesen Zeiten. Mitten im Krieg, wo keiner genug zu essen hatte. Und die Leute waren ohnedies schon immer Hungerleider gewesen. Der Mutter sollte es schlecht gehen, sie lag in der Klinik, wohin man sie nach der Geburt eilig gebracht hatte. Ein Kind in dieser Zeit, und die Frau war schon über vierzig. So etwas konnte nicht gut gehen.
Durch das hohe Kirchenfenster fiel ein breiter Streifen der Junisonne in den dämmrigen Raum. Wie eine goldene Brücke sah es aus, in der Mitte von einem blutroten Pfad geteilt, da, wo sich das Sonnenlicht in dem Purpur einer roten Scheibe brach. Direkt vor den Füßen der Schwester berührte die Brücke den Steinboden. Eine Brücke in den Himmel. In das Leben? In den Tod? Keiner achtete darauf.
Die Geschwister des Täuflings blickten gleichgültig um sich. Lotte, die Älteste, kratzte sich am Arm, der voll roter Flecken war. Sie hatte schon seit Wochen diesen brennenden, juckenden Ausschlag. Das komme von der schlechten Ernährung, hatte der Arzt in der Klinik gesagt, als sie dort die Mutter besuchten. Es sei Vitaminmangel, und sie solle dem Neugeborenen nicht zu nahe kommen.
Unter Vitaminmangel konnte sich Lotte nichts vorstellen. Aber was Hunger war, wusste sie umso besser. Im Übrigen hatte sie sowieso nicht die geringste Lust, dem kleinen Kind nahezukommen. Sie hasste es vom Tag seiner Geburt an. Ein Kind, wozu denn das? Sie hatten selber nichts zu essen. Der Vater im Feld, die Mutter krank. Vermutlich würde sie den Balg sowieso ganz auf dem Hals haben. Aber die sollten sich wundern! Sie würde sich weigern, ganz einfach weigern, das Kind herumzuschleppen. Sie war zwölf und hatte anderes zu denken und zu tun. In zwei Jahren würde sie, Gott sei Dank, in die Lehre kommen, zu der Schneiderin Borgmann. Das stand fest. Dann hörte die Arbeiterei zu Hause auf. Wenn die unbedingt Kinder haben wollten, sollten sie sich selbst darum kümmern.
Fritz, der Junge, bohrte gelangweilt in der Nase. Er blickte niemanden an und dachte nichts. Er war träg und faul. Hunger hatte er allerdings auch. Ob Tante Marie ihnen nachher eine Suppe kochen würde? Sie hatte es versprochen. Natürlich wieder Kohlrüben. Wenn er daran dachte, wurde ihm übel.
Wilhelm Brandt, der Bruder der Kindesmutter und somit der Onkel des Kindes, strich sich verlegen über den grauen Schnurrbart. Er war nur widerwillig gekommen. Ohne viel zu fragen, hatte man ihn als zweiten Paten des Kindes bestimmt. Was sollte man da machen? Man konnte schlecht Nein sagen, obwohl seine Frau das von ihm verlangt hatte. Amalie mochte ihre Schwägerin nicht und erst recht nicht deren Mann. Unnütze, unvernünftige Leute seien die beiden. Sie habe es schon immer gesagt, und dies sei der beste Beweis. Ein Kind in dieser Zeit und in dem Alter, in dem die beiden schon waren! Aus Protest war sie nicht mit zur Taufe gekommen. Das machte Wilhelm erst recht verlegen. Wenn sie auch schimpfte und er kein leichtes Leben bei ihr hatte, so war sie ihm doch unentbehrlich. Ohne sie fühlte er sich unsicher. Hier erst recht, unter lauter Weibern.
Frau Lehmann blickte ungeduldig zur Tür der Sakristei. Wo der Pfarrer nur blieb? Wenn er nicht bald kam, gab es hier nichts mehr zu taufen. Das Kind rührte sich nicht. Wenn sie sich nicht täuschte, atmete es gar nicht mehr. Außerdem hatte sie es eilig, nach Hause zu kommen. Ihr Bruder hatte ihr am Abend zuvor ein halbes Pfund Schweinefleisch vom Lande mitgebracht. Das würde sie essen, heute Mittag. Ganz allein. Gestern Abend hatte sie es angebraten, mit dem letzten Rest Fett, der da war. Ein paar Kartoffeln hatte sie auch noch. Das Wasser lief ihr im Munde zusammen, wenn sie daran dachte. In einer Stunde würde sie essen können, falls der Pfarrer bald käme. Und was für ein Essen! Sie hätte gar nicht kommen sollen zu der Taufe dieses halb toten Kindes. Aber sie versäumte keine Taufe, keine Beerdigung in der Nachbarschaft, auch keine Hochzeit, wenn es sich irgendwie machen ließ, eingeladen zu werden. Sie hatte viel Familiensinn. Vielleicht weil sie keine eigene Familie besaß. Wenn man allein lebt, muss man an fremdem Glück und fremdem Leid sein Herz beteiligen.
Schwester Marie als Einzige war voll Ruhe und Frieden. Sie neigte ihr müdes, früh gealtertes Gesicht über das kleine Bündel in ihrem Arm. Dieses Kind! Noch lebte es. Auch sie bangte darum, dass der kaum spürbare Atem endgültig verwehen würde. Als es geboren wurde, vor zehn Tagen, hatte keiner gedacht, dass es am Leben bleiben würde. Eine schwere Geburt. Die Mutter verbraucht und ausgehungert und voller Widerstand und Hass gegen das keimende Leben in sich. Neun Monate lang Hass und Widerstand und vielleicht auch einige Versuche, das Kind loszuwerden. Schwester Marie zweifelte nicht daran, dass es so gewesen war. Es war sogar zu verstehen. Dann war die Frau beinahe gestorben an der Geburt. Dass das Kind leben würde, hatte sowieso keiner geglaubt. Die Ärzte hatten sich auch nicht viel Mühe damit gegeben. Es gab Wichtigeres in dieser Zeit, als sich um ein kaum lebensfähiges Kind zu kümmern. Das Sterben war eine Alltäglichkeit geworden. Und was versäumte ein Mensch schon, der starb, ehe er gelebt hatte? Nichts. Und wovon sollte dieses Kind leben? Die Mutter hatte keine Nahrung, die Menschen in der großen Stadt hungerten.
Vielleicht war es dieses Ausgeliefertsein, dieses winzige, hilflose Herz in der erbarmungslosen Welt, auf dessen Schlagen keiner lauschte, dieses unerwünschte, ungeliebte kleine Leben, das da vom Himmel gefallen war und das keiner haben wollte – vielleicht war es all dies und eine verschüttete, nie benötigte Mütterlichkeit und Liebesfähigkeit, die Schwester Marie veranlasst hatten, in jeder freien Stunde, die ihr die schwere Arbeit im Lazarett ließ, quer durch Berlin zu fahren und nach dem Kind zu sehen. Jedes Mal hatte sie befürchtet, es nicht mehr lebend anzutreffen. Obwohl der Verstand ihr sagte, dass es am besten sei, wenn es sterben würde, bangte sie um das Leben des Kindes.
Sie hatte auch auf der Taufe bestanden, sobald das Kind etwas gekräftigt erschien. Und sie hatte sich selbst erboten, Patin zu sein. Die Kranke in ihrem Bett hatte nichts dazu gesagt. Es war ihr gleichgültig, was mit dem Kind geschah. Ihr war alles gleichgültig, selbst das eigene Leben, der Mann, die anderen Kinder. Sie war müde. Endlich einmal durfte sie müde sein.
Auch als Schwester Marie, eine entfernte Cousine von ihr, sie fragte, ob ihr der Name recht sei, den sie für das Kind ausgesucht hatte, nickte die Frau nur gleichgültig. Sie hatte gar nicht zugehört, wie der Name lautete. Stella. Sicher hatte sie ihn noch nie gehört.
»Es ist nach einem Schauspiel von Goethe«, hatte Schwester Marie eifrig erklärt. »Die Titelheldin heißt so. Ein wunderbares Stück.« Die Frau im Bett nickte wortlos. Es war ihr gleichgültig, und sie war müde. Stella war ihr kein Begriff. Goethe auch nicht. Mochten sie tun, was sie wollten mit dem Wurm. Sie wünschte, sie brauchte es nie wiederzusehen.
»Stella«, flüsterte Schwester Marie über dem Kopf des Kindes. Die goldene Sonnenbrücke war weitergewandert, glänzte auf der weißen Schürze ihrer Tracht und glitt über ihre Hände, die das Kind hielten.
»Stella.«
Sie liebte den Namen. Und sie war eine Goetheverehrerin. Zweifellos hätte sie bei Goethe andere Namen finden können. Klärchen oder Gretchen hätten sicher Frau Lehmanns Zustimmung gefunden. Warum es Stella sein musste, war Schwester Maries Geheimnis. Stellas Schicksal glich ihrem eigenen. Es war ein verbotenes und schweres Schicksal gewesen, geheim gehalten vor jedermann. Genau wie jene unglückselige Stella hatte sie einen Mann geliebt, der verheiratet war. Der einzige Mann ihres Lebens. Die Leiden von Goethes Heldin waren ihre Leiden gewesen, ausgekostet bis ins Letzte. Allerdings glich ihr ferneres Schicksal nicht dem der Bühnenfigur. Weder der Urfassung, noch der zweiten. Sie hatte keine verständnisvolle Rivalin gehabt, die mit einer Ehe zu dritt einverstanden war. Und sie hatte auch nicht ihr Leben beendet. Sie hatte verzichtet und weitergelebt. Sie war Schwester geworden, eine gute Schwester, die in ihrem Beruf Erfüllung fand und keine weiteren Ansprüche an das Leben stellte.
Endlich. Der Pfarrer. Frau Lehmann atmete auf. Der Schweinebraten rückte in greifbare Nähe. Lange würde es nicht dauern. Sie blickte dem Geistlichen entgegen, der eilig durch den breiten Mittelgang auf die Taufgesellschaft zukam. Dann warf sie einen Blick auf das Kind. Lebte es noch? Schwer zu sagen.
Als sie dann den vollen Namen aus dem Mund des Pfarrers hörte, gefiel er ihr auf einmal. Es klang gar nicht schlecht: Stella Maria Wilhelmina. Wenigstens waren zwei vernünftige Namen dabei. Maria klang zwar etwas katholisch, aber Wilhelmina war gut patriotisch. Das brauchte man in dieser Zeit.
Auch Wilhelm Brandt nickte befriedigt vor sich hin. Es war sein Name und der Name Seiner Majestät. Damit hatte alles seine Richtigkeit.
Als der Geistliche die Stirn des Kindes mit Wasser benetzte, schlug es die Augen auf. Augen von einem tiefen, dunklen Blau. Reglos und blicklos standen sie in dem kleinen, weißen Gesicht. Eine tiefe, nie empfundene Zärtlichkeit erfüllte Schwester Maries Herz. – Du sollst leben, dachte sie. Du sollst leben. Und du sollst ein glückliches Leben haben.
»Amen«, murmelte der Pfarrer.
»Gott schütze dich!«, flüsterte Schwester Marie.
Die Augen schlossen sich wieder. Weiß und leblos wie zuvor lag das kleine Gesicht in den Kissen.
So begann das Leben von Stella Termogen.
2
Karl Termogen bekam seine jüngste Tochter nie zu sehen. Er fiel im September 1917 bei Cambrai. »Noch ein Mädchen«, hatte er geschrieben. »Wenn es schon sein musste, konnte es wenigstens ein Junge sein. Und warum habt ihr dem Kind so einen komischen Namen gegeben?«
Aber auch ihm war es im Grund gleichgültig. Sein Dasein im Schlamm der Schützengräben ließ ihm keine Zeit, an seine jüngste Tochter zu denken. Peinlich genug, dass ihm das passiert war. Aber das kam alles von diesem verdammten Krieg. Wenn man mal auf Urlaub kam, da passierten solche Dinge. An sich waren sie über das Alter hinaus, seine Frau auf jeden Fall, das war seine Ansicht gewesen, als er von dem Missgeschick erfuhr.
Gott mochte wissen, wie das weitergehen sollte, mit drei Kindern und der kränkelnden Frau. Aber Gott wusste es sicher auch nicht. Zu viele verzweifelte Fragen wurden an ihn gestellt in dieser verzweifelten Zeit. Karl Termogen jedenfalls brauchte sich den Kopf über die Zukunft nicht mehr zu zerbrechen. Er starb den sinnlosen Tod auf dem Felde der Ehre. So nannten es die Leute. Es klang gut. Es hängte dem schmutzigen Sterben ein feierliches Kleid um. Den Toten konnte es egal sein.
Wer es ernst mit den leeren Worten nahm, der hätte sagen können, es sei das einzig Ehrenvolle in Karl Termogens Leben gewesen, dieses ehrenvolle Sterben. Seine Schwägerin Amalie hatte nicht ganz unrecht mit ihrem Wort, dieser Mann, den die Schwester ihres Mannes geheiratet hatte, sei ein unnützer Vagabund. Sie sagte es nie mehr nach seinem Tode. So etwas schickte sich nicht. Aber ihre Meinung änderte sie nicht.
Stella Termogen aber, das Kind, das niemals lernte, Vater zu sagen, erfuhr auch in ihrem späteren Leben wenig über ihren Vater. Doch sie lernte die Termogens kennen, alle Variationen dieser Männer: den starken Stamm der Mitte, einen Mann, wie ein Baum so fest gegründet, gerade und aufrecht, mit dem großen Herzen, dem frohen Lachen und dem hellen Blick der Augen, die immer das Meer suchten; dann die Träumer, die Vagabunden, die Abenteurer. Alle waren sie Termogens. Sie selbst war eine Mischung aus allem: das unruhige Herz, die tiefe Treue, die ewige Sehnsucht, der unbändige Heißhunger nach dem Leben, der Leichtsinn und dennoch der Traum nach Heimat und Frieden.
Die Termogens waren Seefahrer oder Bauern. Oder beides zugleich. Karl Termogen hingegen wollte Künstler werden, Musiker. Er hatte ein hohes Ziel. Er sah sich als Virtuose auf dem Podium stehen, berühmt und gefeiert. Doch er opferte diesem hohen Ziel keine Arbeit und keinen Fleiß. Keinen ernsthaften Schritt tat er auf dem ersehnten Weg, er irrte ab, ehe er ihn betreten hatte. Kein starker Baum – ein wenig Träumer, ein großer Vagabund. Eine dunkle Seite in der stolzen Chronik der Termogens. Mit achtzehn Jahren bestahl er seinen Vater und lief in die Welt hinaus. Er ging nicht allein. Eine Kellnerin aus einem Saisonhotel ging mit ihm. Sie war die erste der Frauen, die sein Leben begleiteten. Frauen, immer Frauen, eine nach der anderen. Eine Zeit lang lebte er mit ihr zusammen in Hamburg, in einer dunklen Bude in Barmbek, dann verließ sie den dummen Jungen. Zu der Zeit spielte er in einem billigen Lokal auf der Reeperbahn. Als er einmal Hunger hatte, stahl er einem Gast einen Taler aus dem Mantel. Einen einzigen, lumpigen Taler. Sie verprügelten ihn und warfen ihn hinaus.
Zu der Zeit erwog er ernsthaft, ob er nach Hause zurückkehren solle. Es war das einzige Mal, dass er daran dachte. Doch die Angst vor seinem Vater war größer als die vor einem ungewissen Schicksal. Er ging stattdessen nach Berlin und verließ die Hauptstadt nie wieder, bis der Krieg ihn für immer in eine unbekannte Ferne führte.
Er war hochbegabt, aber er wurde kein Meister, denn er hatte seinen Beruf nie ordentlich erlernt. Da er vom Ruhm nur geträumt hatte, keinen wirklichen Ehrgeiz besaß, litt er nicht unter seinem Versagen. Er war ein hübscher Junge, schlank, hochgewachsen, mit leichtsinnigen Augen und einem weichen Lächeln. Wenn er geigte, fiel ihm eine dunkle Locke in die Stirn. Und er konnte geigen wie der Teufel, ganz von selbst brach es aus ihm hervor, wenn er in Stimmung war. Dann verschlangen ihn die Mädchen und Frauen mit ihren Blicken, er konnte wählen unter ihnen, wie er wollte. Was es eben so zu wählen gab in den Kreisen, in denen er verkehrte, in den Kneipen und Bumslokalen der Vorstadt. Einmal gab es eine Ausnahme: eine reiche, gelangweilte Dame, die ihn eine Zeit lang wie ein Schoßhündchen verwöhnte und ihn dann wegen eines Tenors von der Oper hinauswarf. Sie war sehr musikalisch, die Dame.
Er war achtundzwanzig, als er Lene Brandt kennenlernte. Damals ging es ihm schlecht, er hatte kein Engagement. Seine ewigen Liebesaffären machten ihn unzuverlässig, nie blieb er lange an einem Platz. Außerdem hatte er begonnen zu trinken. Kein Kapellmeister mochte gern mit ihm arbeiten.
Lene war vier Jahre älter als er. Unverheiratet, hungrig nach Liebe, wenn sie sich auch dessen nicht bewusst war. Sie stammte aus einfachen, bürgerlichen Kreisen, arbeitete als Näherin, und ihre Familie sah in ihr eine alte Jungfer. So sah sie sich auch selbst. Keiner hatte sie haben wollen, und es würde wohl auch keiner mehr kommen.
Und dann kam dieser Schöne, dieser Junge, dieser Einmalige. Mit seiner Geige und mit seinen blauen Augen, mit seinen schmalen Händen und seinem kecken Lachen. Sie vergaß die Welt, Herkunft, Erziehung, Anstand und Sitte. Als sie schwanger war, fiel sie aus allen Wolken. Und war sofort entschlossen, ins Wasser zu gehen. Der Vater würde sie totschlagen, die Mutter sterben vor Gram. Ein kurzer, süßer Traum war es gewesen, doch es schien ihr wert, dafür zu sterben.
Der Geiger lachte sie aus und sagte, er würde sie heiraten. Er war ein Termogen, trotz allem Leichtsinn. Er war verkommen, aber er ließ keine Frau im Stich. Und seltsamerweise mochte er dieses stille, unbeholfene Mädchen, das den Jahren nach eine Frau war und in seinen Armen gelegen hatte wie ein staunendes Kind, das in den Himmel blickt. Erinnerte sie ihn nicht an seine Mutter? Daheim, auf dem Hof, wenn sie still und bescheiden ihrer Arbeit nachging, geduldig wartete, bis der Mann heimkehrte, die Kinder versorgte und immer wieder wartend und suchend aufs Meer hinausblickte.
Sie heirateten, das Kind wurde geboren, zwei Jahre darauf ein anderes. In Karl Termogens Leben kam ein wenig Ordnung. Nicht viel, denn was Lene ordnete, zerstörte er wieder mit leichten Händen. Sie hatten immer wenig Geld, nie richtig satt zu essen, er hatte oft keine Arbeit und bemühte sich nicht einmal sehr darum. Er trank, und er betrog seine Frau. Sie wurde zeitig alt und verbittert. Das mädchenhafte Lächeln, das sie sich so lange bewahrt hatte, verschwand. Aus dem süßen Traum war eine bittere Wirklichkeit geworden. Aber er verließ sie nie. War es um ihretwillen, der Kinder wegen – darüber gab er sich keine Rechenschaft. Er konnte seine Frau nicht glücklich machen, doch er blieb bei ihr. Im tiefsten Winkel seines treulosen Herzens wohnte die alte Treue der Termogens. Seine Kinder liebten ihn heiß und innig. Für sie war er ein strahlender Held, der mit ihnen lachte und spielte und immer Zeit für sie hatte. Mehr als jeder andere Vater für seine Kinder Zeit hatte.
Vielleicht hätte auch Stella ihn geliebt, wenn sie Gelegenheit gehabt hätte, ihn kennenzulernen. Denn sie war ihm am ähnlichsten. Sie war eine echte Termogen, auch in ihr lebten der Leichtsinn, das Abenteuer und die Unbeständigkeit. Und sie war so schön wie er. Davon allerdings war in ihrer ersten Kindheit nichts zu bemerken.
Es war eine armselige Kindheit. Lange schien es zweifelhaft, ob sie über die ersten Monate, die ersten Jahre hinauskommen würde. Eine Kindheit ohne Liebe, ohne Sonne. Keiner kümmerte sich um das kleine Wesen. Lene kränkelte lange Zeit nach der späten Geburt, die ihren vom Hunger ausgehöhlten Körper, ihre von Enttäuschungen ermüdete Seele weit überfordert hatte. Sie musste viel liegen, als sie wieder zu Hause war. Aber sobald sie auf den Beinen war, nahm sie ihre frühere Tätigkeit wieder auf. Sie ging in die Häuser nähen. Sie hatte eine Anzahl von Kunden, die sie nicht wagte zu verlieren. Erst recht nicht, als sie wusste, dass ihr Mann nicht zurückkehren würde. Viel hatte er ja zum Unterhalt der Familie nie beigetragen. Nun lag die Verantwortung allein auf ihren Schultern. Die Rente, die ihr als Kriegerwitwe zustand, reichte nicht aus, um drei Kinder großzuziehen. Karls Tod hatte keinen großen Eindruck auf sie gemacht. Sie war ihm ergeben gewesen bis zuletzt. Wenn man es noch Liebe nennen konnte, dann war es eine Liebe, die stetig und nagend alle Lebenskraft in ihr getötet hatte. Ein kurzes Glück, und viele Jahre Sorgen, Not und Mühe. Sie trug es ihm nicht nach. Nur eins konnte sie ihm nicht verzeihen: dass er ihr dieses letzte Kind noch aufgebürdet hatte, das nichts als eine Last für sie war. Sie hatte kein Gefühl für dieses Kind. Und wenn sie es auch vielleicht nie bis zur letzten Konsequenz zu Ende dachte, sie hätte den Tod des Kindes als Erleichterung empfunden.
Da sie durch ihre Arbeit oft ganze Tage von zu Hause fort war, hätte die Sorge für das kleine Kind allein bei der älteren Schwester gelegen, die sich dieser Aufgabe höchst widerwillig und säumig unterzog, wenn nicht wie ein guter Schutzengel eine Fremde über das Leben des Kindes gewacht hätte.
Nicht Schwester Marie. Sie war der erste gute Engel gewesen, das erste Auge voll Liebe, das Stellas Leben behütet hatte. Doch das dauerte nur zwei Monate. Dann wurde sie in ein Feldlazarett im Osten versetzt. Schweren Herzens trennte sie sich von dem Kind, das immer noch so winzig und leblos in seinem Körbchen lag, niemals schrie, nur manchmal leise vor sich hin weinte. Meist jedoch lag es stumm da, schlafend oder die dunkelblauen Augen weit geöffnet. Augen, die noch kein Leben, kein Erkennen spiegelten. Schwester Marie konnte immer wieder in Entzückensrufe ausbrechen über diese Augen. »Wie zwei blaue Sterne«, pflegte sie zu sagen. »Tief dunkelblau. Ich habe solche Augen noch nie gesehen.«
»Das haben kleine Kinder oft«, sagte Lene gleichgültig. »Lotte hatte auch blaue Augen. Später wurden sie braun.«
»Aber rote Haare hab’ ick nie jehabt, nich, Mutter?«, fragte Lotte. »Rote Haare sind schrecklich.« Mit einer verächtlichen Kopfbewegung zum Kinderkorb hin: »Die wird sich wundern später. Wir haben eine mit roten Haaren in der Klasse. Was die sich anhören muss. Und allet hat se voller Sommersprossen.«
Schwester Marie strich mit zartem Finger über den roten Flaum auf dem Kopf des Kindes. »Rote Haare können etwas sehr Schönes sein«, meinte sie, allerdings gegen ihre Überzeugung. »Außerdem kann sich das auch noch ändern.«
»Det jloob ick nich«, sagte Lotte. »Rot bleibt rot, det ändert sich nich. Frau Lehmann meent det ooch.« Befriedigt warf sie einen Seitenblick in den kleinen Spiegel über der Kommode, der ihr die eigene dunkelbraune Lockenpracht zeigte. Sie trug das Haar jetzt mit einem Band am Hinterkopf zusammengebunden, sehr gegen den Willen ihrer Mutter, die nach wie vor für ordentlich geflochtene Zöpfe plädierte. Aber Lotte mit ihren zwölf Jahren wusste schon ganz gut, wo ihre Reize lagen.
Schwester Marie ermahnte beide Kinder, gut auf Stella aufzupassen, ihr zur rechten Zeit die Mahlzeiten zu geben, sie auszufahren. Zum Ausfahren hatten weder Lotte noch Fritz Lust. Sie stellten einfach den Korb mit dem Kind in den engen, lichtlosen Hinterhof und gingen ihre eigenen Wege.
Dort lag das Kind ganze Tage lang, meist still und stumm, nur wenn der Hunger es gar zu sehr plagte, fing es kläglich an zu weinen. Mauz, der Kater aus dem Parterre, strich vorbei, betrachtete das seltsame Wesen zunächst misstrauisch, dann mit Interesse, bis er entdeckte, dass es sich in dem Körbchen besser liegen ließ als auf dem harten Boden. Zufrieden rollte er sich auf der niemals ganz sauberen Decke zusammen und schnurrte. Das Kind schwieg, wenn er bei ihm war. Manchmal blickte eine der Frauen aus dem Fenster, schüttelte wohl den Kopf, sagte vielleicht: »Det arme Wurm. Bin bloß neugierig, wie lange es det noch machen wird.«
Aber sie kannten schließlich die Verhältnisse, da ließ sich nichts daran ändern. Sie hatten selber Kinder, die sie nicht satt kriegen konnten. Sie konnten das Kind bedauern, sie konnten sich auch darüber empören, dass es da so einsam und verwahrlost lag, aber helfen konnten sie ihm nicht. Menschenliebe und Barmherzigkeit gediehen nicht in den engen Hinterhöfen. Schon gar nicht in dieser Zeit.
Bis der gute Engel kam. Er gehörte nicht in dieses Häusergeviert, er wohnte um die Ecke, in der nächsten Straße, und er konnte nicht in diesen Hof blicken. Aber beim Kramer, wo Frau Lehmann einen guten Teil ihrer Tage verbrachte, um einen regen Gedankenaustausch mit den Frauen der Nachbarschaft zu pflegen, hörte er von dem Kind.
»Man muss sich wundern, dass det Wurm noch lebt«, sagte Frau Lehmann. »Zu fressen kriegt et nischt, trockengelegt wird et nich, und eines Tages wird ihm die Katze die Gurgel zudrücken.«
Die Frauen murmelten Zustimmung. Der gute Engel sagte mitleidig: »Aber das ist ja schrecklich.« Als sich ihm die Gesichter rundherum zuwandten, errötete er und schwieg. Der gute Engel war noch jung, in den Zwanzigern. Er hieß Hanna, war jung verheiratet, hatte selbst keine Kinder, und der Mann war natürlich im Feld. Das Leben der jungen Frau war unausgefüllt und traurig, belastet von der Sorge um den geliebten Mann.
Als Frau Lehmann mit ihrem halben Pfund Kartoffeln und den Kohlrüben nach Hause ging, lief Hanna ihr nach.
»Ach, entschuldigen Sie«, sagte sie atemlos und errötete wieder.
»Wat ’n los?«, fragte Frau Lehmann misstrauisch. Das war eine Feine, die junge Frau. Sie tratschte nicht, redete nie ein Wort und hatte ein schmales, hübsches Gesicht mit großen, dunklen Augen. »Das Kind, von dem Sie eben erzählt haben, das Kind bei Ihnen da im Hof … Kann ich es nicht mal sehen?«
»Klar doch. Warum denn nicht? Wenn Sie noch nie ’n Kind gesehen haben. Ist kein hübsches Kind. Rote Haare hat es auch.«
»Ich möchte es gern mal sehen«, bestand Hanna auf ihrem Wunsch.
»Na, denn komm’ Se eben mit.«
Und Hanna sah das Kind. Es war genauso, wie Frau Lehmann berichtet hatte. Das Kind lag in seinem Körbchen, der Kater quer über ihm. Die dunkelblauen Augen des Kindes waren weit geöffnet, eine Fliege flog um sein Gesicht.
Hanna stand einen Augenblick stumm. Sie fühlte einen jähen, tiefen Schmerz. Wenn sie so ein Kind hätte! Dann wäre sie nicht so allein. Und hier lag ein Kind, genauso einsam wie sie selbst.
»Aber das ist ja – das ist ja ungesund«, stammelte die junge Frau. »Die Katze, meine ich.«
Sie verscheuchte das Tier, und dann, ehe sie wusste, was sie tat, kniete sie neben dem Körbchen nieder.
»Kleines«, flüsterte sie mit tiefer, zärtlicher Stimme, »Kleines, Armes. Was tust du so allein? Kleines …«
Frau Lehmann blickte überrascht auf die Kniende nieder. »Nu haben Se sich man nich so. Det is nu mal hier nich anders. Die Frau geht arbeeten. Der Mann is nämlich gefallen. Na, und die beeden anderen Fratzen sind ja selber noch Kinder. Und zwee richtige Rotzneesen dazu.«
»Kümmert sich denn niemand um das Kind?«
»Se hören doch, was ich ebent gesagt hab’. Wer soll sich denn kümmern? Hier hat jeder mit sich selbst zu tun.«
Und dann begann sie weitschweifig über die Familie Termogen zu berichten, und da sie gut im Zuge war, gleich über die anderen Hausbewohner auch noch, deren Lebensumstände ihr wohlbekannt waren.
Hanna hörte nicht zu. Sie hatte den Zeigefinger ausgestreckt und damit vorsichtig die winzigen Händchen des Kindes berührt. Es dauerte eine Weile, bis das Kind reagierte. Aber dann kam ein wenig Leben in die Augen.
»Es sieht mich an«, sagte Hanna beglückt.
»Na, da sind Sie der erste Mensch«, stellte Frau Lehmann gleichmütig fest.
Von da an kam Hanna jeden Tag in den Hof. Mauz, der Kater, kannte sie schon und sprang jedes Mal davon, wenn er sie sah. Sie nahm das Kind aus dem Korb, legte es sich vorsichtig in den Arm und ging leise summend im Hof mit ihm auf und ab.
Die Frauen schauten aus den Fenstern. Sie sagten: »Die hat es nötig, scheint es. Zeit, dass ihr mal einer ein Kind macht.«
Einmal kam Lotte dazu und schaute verwundert die Fremde an.
»Ist das dein Schwesterchen?«, fragte Hanna.
»Ja.«
»Hast du was dagegen, wenn ich sie ein bisschen spazieren trage?«
»Nee, gar nich. Ick hab’ sowieso keene Zeit. Wir ham ooch ’n Wagen. Wenn Se spazieren fahrn wolln.«
Hanna wollte. Gemeinsam mit Lotte trug sie den alten wackligen Kinderwagen auf die Straße, und von da an fuhr sie das Kind jeden Tag spazieren. Man kannte sie nun schon in den Häusern und wandte nicht mehr den Kopf nach ihr.
Nach einer Woche etwa, als sie wieder einmal kam, hatte sich der Himmel bezogen, und als sie unterwegs waren, fing es an zu regnen. Einen Moment lang blieb sie zögernd stehen. Doch dann, ohne weiteres Überlegen, fuhr sie zu ihrem Haus und nahm das Kind mit in ihre Wohnung.
Von dieser Zeit an hatte Stella so etwas wie eine Mutter. Im Herbst und im folgenden Winter war sie meist bei Hanna. Sie bekam jetzt regelmäßig ihre Mahlzeiten, wurde mit Liebe und wachsender Sachkundigkeit gepflegt und versorgt.
Hanna hatte sich natürlich die Einwilligung Lenes geholt. Die hatte bald von der Fremden gehört, die sich so liebevoll um das Kind kümmerte, und hatte nichts dagegen, das Kind ihrer Obhut zu überlassen.
»Wenn es Ihnen Spaß macht«, sagte sie müde. »Ich hab’ wenig Zeit. Ich muss arbeiten.«
»Ja, ich weiß«, sagte Hanna. »Frau Lehmann hat es mir schon erzählt. Sie können ganz beruhigt sein, ich passe gut auf. Und wenn es jetzt kälter wird, kann es doch nicht mehr draußen stehen.«
»Da haben Sie recht.« Lene betrachtete die junge Frau neugierig. Auch sie war von dem feinen, zarten Gesicht beeindruckt. So etwas sah man selten hier in der Gegend. »Sie haben selbst keine Kinder?«, fragte sie.
»Nein, noch nicht. Mein Mann … Sie wissen ja. Ich habe ihn schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Aber er ist jetzt in Gefangenschaft. Gott sei Dank!«
»Da können Sie von Glück reden. Meiner kommt nicht mehr zurück.«
»Das tut mir leid«, flüsterte Hanna.
»Na ja, es ist eben so. Da kann man nichts machen.«
»Also, ich darf mir die Kleine dann manchmal holen? Wenn Ihre Tochter keine Zeit hat? Sie wissen ja, wo ich wohne.«
»Schon gut.«
Ehe Hanna ging, blieb sie noch einmal stehen. »Wie – wie heißt sie denn?«
»Wie? Ach so: Stella.«
»Stella«, wiederholte Hanna leise.
»Is ’n komischer Name, ich weiß, ’ne Cousine von mir, die ist Patin, die hat ihn ausgesucht.«
»Es ist ein sehr hübscher Name«, meinte Hanna. »Man hört ihn selten.«
»Er ist von Goethe«, sagte Lene, nun doch mit einem gewissen Stolz.
Von nun an war Stella die meiste Zeit bei Hanna. Jeder war mit dieser Lösung zufrieden. Hanna sah ihr erstes Lächeln, brachte ihr die ersten Worte bei, führte sie bei den ersten Schritten und litt mit dem ersten Zahn.
»Hamma«, lernte das Kind. Es klang fast wie Mama.
Als der Krieg zu Ende war, konnte Stella laufen und schon allerlei sprechen. Sie war anderthalb Jahre alt, immer noch zart und klein, ein gutwilliges, artiges Mädchen, das selten weinte, niemals schrie und ihrer Pflegemutter ans Herz gewachsen war wie ein eigenes Kind. Sie hatte ein zartes, weißes Gesicht, aber die Augen waren so tiefblau geblieben, und das Haar war immer noch rot, vom metallischen Rot einer Kupfermünze.
Als Stella zwei Jahre alt war, kehrte Hannas Mann aus der Gefangenschaft zurück. Nun hatte sie nicht mehr so viel Zeit für Stella, jetzt war der Mann ihr Kind, um den sie sich kümmern, den sie pflegen und verwöhnen musste. Im Jahr darauf bekam sie selbst ein Kind. Der gute Engel verschwand aus Stellas Leben, sie verlor eine Mutter. Immerhin war es wohl Hanna zu verdanken, dass sie am Leben geblieben war.
Aber nun war Schwester Marie wieder da. An ihrer Zuneigung zu dem Patenkind hatte sich nichts geändert. Sie hatte nicht so viel Zeit wie Hanna, aber in jeder freien Minute kümmerte sie sich um das Kind.
Stella war daran gewöhnt, allein zu sein. Allein zu spielen, sich mit sich selber zu unterhalten. Auch Kater Mauz hatte seine Anhänglichkeit bewahrt. Zusammen saßen sie im Hof auf der Mauer und führten lange Gespräche.
Lotte war in der Lehre und hatte schon einen Verehrer. Die dunkelbraunen Locken machten es und der kleine Busen, der sich entwickelt hatte und den sie durch Taschentücher, die sie in den Ausschnitt steckte, unterstützte. Sie war heiter und gesprächig, lachte gern und verstand es, ihre braunen Augen blitzen zu lassen. Fritz dagegen war noch immer dick und träg und meist schlecht gelaunt. Für die kleine Schwester hatten alle beide nicht viel übrig, nur selten bequemte sich einer von ihnen, die Kleine einmal hinter sich herzuziehen.
Auf solch einem Spaziergang war es, dass Lotte einmal ihrer früheren Lehrerin, Fräulein Trunck, begegnete.
Fräulein Trunck blieb stehen, Lotte machte einen widerwilligen Knicks. Die Lehrerin blickte auf den kleinen Rotschopf hinunter.
»Wen hast du denn da?«
»Det is meine kleene Schwester«, antwortete Lotte.
»Du hast noch so eine kleine Schwester«, wunderte sich die Lehrerin.
»Ja, leider.«
»Das wusste ich gar nicht.«
Stella und Fräulein Trunck blickten sich an. Stumm das Kind, die Augen in dem zarten Gesicht weit geöffnet.
»Was für schöne Augen sie hat«, stellte auch Fräulein Trunck fest. »Wie heißt sie denn?«
»’n komischer Name«, sagte Lotte. »Stella heeßt se.«
»Heißt sie«, verbesserte die Lehrerin. »Das ist ein sehr hübscher Name.«
»Find’ ick nich«, sagte Lotte. »So heeßt keen Mensch.«
»Es bedeutet Stern«, sagte die Lehrerin. »Und man spricht es S-tella aus, nicht Schtella. Ein sehr hübscher Name. Und er passt gut zu diesen Augen.«
»Aber rote Haare hat se«, wies Lotte auf den verhängnisvollen Fehler ihrer kleinen Schwester hin.
»Hat sie«, verbesserte die Lehrerin geduldig. »Ja, das sehe ich. Mir gefallen sie aber.«
»Mir nich.«
Fräulein Trunck lächelte. »Du liebst wohl deine kleine Schwester nicht besonders?«
»Nee, gar nich. Hab’ ick bloß Arbeet mit.«
»Hm.« Fräulein Trunck blickte nachdenklich in die blauen Kinderaugen. Dann beugte sie sich herab und streckte dem Kind die Hand hin. »Auf Wiedersehen, Stella. Später kommst du auch zu mir in die Schule.«
Stella nickte und legte ihre kleine Hand vertrauensvoll in die angebotene Hand der Lehrerin.
»Det hab’ ick hinter mir«, stellte Lotte befriedigt fest.
Fräulein Trunck wurde der dritte Mensch in Stellas Leben, der sich liebevoll ihrer annahm. Sie hatte vom ersten Augenblick an eine Zuneigung zu dem Kind gefasst, das so ganz anders war als die anderen Kinder, die die erste Klasse der Volksschule besuchten. Artig, die Hände gefaltet, in einer nicht ganz sauberen blauen Schürze, saß sie auf ihrem Platz und schaute ernsthaft zu der Lehrerin auf. Sie war so dünn und blass, dass es Fräulein Trunck jedes Mal bekümmerte, sie anzusehen. Als sie bemerkte, dass Stella oft kein Frühstücksbrot dabei hatte, packte sie immer extra eines ein und steckte es ihr zu. Das musste heimlich geschehen, die anderen Kinder durften es nicht merken. Sie tat es in der Pause, wenn die Kinder auf dem Hof oder im Gang waren. Stella wusste genau, von wem das Brot kam.
Sie war eine gute Schülerin, ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester und ihrem Bruder, die faul und nachlässig gewesen waren. Sie lernte leicht und schnell und begriff sofort alles.
Im zweiten Schuljahr musste Fräulein Trunck die Klasse an einen anderen Lehrer abgeben. Sie legte ihm ihre Lieblingsschülerin warm ans Herz.
»Was ist denn Besonderes los mit dem Kind?«, fragte der erstaunt.
»Was, weiß ich auch nicht«, sagte Fräulein Trunck. »Aber etwas Besonderes eben. Sie ist sehr zart und empfindlich.«
»Das sind viele Kinder heute«, meinte der Kollege ungerührt. Und zurechtweisend fügte er hinzu: »Ich bin nicht dafür, dass man ein Kind bevorzugt.«
Fräulein Trunck errötete ärgerlich. »Ich habe Stella nie bevorzugt. Ich habe sie nicht anders behandelt. Aber sie ist ein besonderes Kind. Und sehr intelligent. Sie lernt spielend.«
»Das ist nicht immer ein Vorteil«, erwiderte der Kollege im Schulmeisterton. »Fleißige Schüler sind mir lieber.«
Fräulein Trunck gab ihm einen wütenden Blick und ließ ihn stehen. Sie ahnte, dass sie Stella keinen guten Dienst erwiesen hatte. So war es auch. Der neue Lehrer war auf Stella nicht gut zu sprechen. Obwohl sie ihm anfangs keinen Anlass zu Ärger gab, hatte er immer etwas an ihr auszusetzen. Er fand nichts Besonderes an ihr, fand sie nicht klüger als die anderen und sprach ihren Namen wieder wie Schtella aus.
Und wirklich schien Stella nicht klüger als die anderen zu sein. Sie lernte auch nicht mehr leicht und spielend, sie ging ungern zur Schule, war säumig und nachlässig mit den Schularbeiten, verträumt und unaufmerksam im Unterricht. Zum ersten Mal in ihrem Leben zeigte sich ein typischer Zug ihres Wesens. Nur wenn sie geliebt wurde, lebte sie auf. Nur wer ihr Herz ansprach, machte sie lebendig. Wenn sie Gleichgültigkeit spürte, Kälte oder Abneigung, verkroch sie sich wie eine kleine Schnecke in ihr Haus, verblasste und erlosch.
Natürlich lagen auch keine Frühstücksbrote mehr in ihrer Tasche. Einige Male versuchte es Fräulein Trunck, ihr in der Pause ein Päckchen zuzustecken. Aber das war schwierig, ließ sich kaum unbeobachtet bewerkstelligen. Dafür nahm sie jede Gelegenheit wahr, mit Stella ein paar Worte zu sprechen.
Einmal, zwei Monate nach Beginn des neuen Schuljahrs, erlebte sie dabei etwas, was ihr tage- und wochenlang Kummer bereitete und was sie nie wieder vergaß: Sie hatte Stella etwas gefragt, das Kind antwortete, brach mitten im Satz ab, schlang beide Arme um die Lehrerin, drückte sein Gesicht in ihren Rock und weinte. Nein, es war kein Weinen, ein paar trockene, harte Schluchzer, die unendlich verzweifelt klangen.
»Aber Stella«, murmelte Fräulein Trunck und strich behutsam über den roten Schopf. »Was ist denn? Was hast du denn?« Sie schob das Kind behutsam von sich fort, denn ringsherum war man aufmerksam geworden.
Stella richtete sich auf. Sie presste die Lippen zusammen, das kleine weiße Gesicht war verschlossen.
»Fehlt dir etwas?«, fragte Fräulein Trunck.
Stella schüttelte den Kopf. Doch dann sagte sie: »Ich will Sie wiederhaben.«
»Aber Herr Krüger ist doch sehr nett.«
Stella schüttelte entschieden den Kopf. »Nein.« Und sie wiederholte bestimmt: »Ich will Sie wiederhaben.«
Haben, sagte sie. Und: Ich will. Besitzergreifend klang es und entschieden. Ohne Kompromiss, ohne Umweg. Sie liebte die Lehrerin. Sie war der erste Mensch, den sie bewusst liebte. Und wenn sie liebte, kannte sie weder Kompromiss noch Umweg.
Fräulein Trunck schwieg, geradezu verwirrt. Sie konnte nicht wissen, dass dies Termogen-Art war, dass die Termogens so liebten: besitzergreifend, entschieden, ohne Kompromiss, ohne Umweg. Was sollte sie dem Kind sagen? Etwas Zurechtweisendes, etwas Ablenkendes?
Sie strich Stella flüchtig durch das Haar. »Geh wieder zu den anderen, Kind«, murmelte sie. Und dann sagte sie, eilig, fast gegen ihren Willen: »In der vierten Klasse, da kriege ich euch wieder.«
Langsam ging Stella über den Hof. Das war ein magerer Trost. Die vierte Klasse schien unendlich weit entfernt. Die zweite hatte erst begonnen.
Ein einsames, verlorenes Kind, das niemand liebte. Sehnsüchtig suchten ihre Augen in jeder Pause die Lehrerin, die sich in Zukunft zurückhaltender verhielt. Man durfte die Sonderlichkeit des Kindes nicht unterstützen, es erschwerte ihm nur die Schulzeit.
3
Die entscheidende Wende in Stellas Leben sollte das nächste Jahr bringen. Es geschah jedoch nicht von heute auf morgen. Im Winter wurde Stella zunächst einmal krank. Es begann mit einer Erkältung, entwickelte sich dann zu einem besonders schweren und endlos dauernden Keuchhusten, der ihre ohnedies schwache Gesundheit nachhaltig erschütterte.
Schwester Marie sorgte dafür, dass sie in die Klinik kam. Doch als Stella die Krankheit endlich überstanden hatte, war sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Durchsichtig und geschwächt, kaum fähig, wieder die Schule zu besuchen und dem Unterricht zu folgen. Ein harter Husten war zurückgeblieben, angegriffene Bronchien, und eine nervöse Erschöpfung, die zu häufigen, plötzlichen Tränenausbrüchen führte. Bei der geringsten Schwierigkeit in der Schule, bei einem gar nicht ernst gemeinten unfreundlichen Wort zu Hause begann Stella zu weinen und konnte lange nicht mehr aufhören. Die Geschwister lachten sie aus, spotteten über sie, erst recht natürlich die Mitschülerinnen. Die Lehrer verloren die Geduld mit ihr, und die Mutter, selbst gereizt und überarbeitet, fand erst recht nicht den richtigen Ton im Umgang mit dem schwierig gewordenen Kind. Stella befand sich in einer größeren Isolierung als je zuvor.
Schwester Marie betrachtete Stellas Zustand mit wachsender Besorgnis. Sie sprach ernsthaft mit Lene, konnte aber nicht viel ausrichten. Lene war eine alte Frau geworden. Sie brauchte alle Kraft, um ihre Arbeit zu leisten. Ein krankes und nervöses Kind zu betreuen, überstieg ihre geringen Kräfte. Außerdem hatte sie auch Sorgen mit den beiden anderen Kindern. Fritz ging nun zu einem Schlosser in die Lehre. Er war faul und träge geblieben, mit seinen Leistungen war man keineswegs zufrieden. Dazu hatte er eine dummfreche Art, die ihn bei allen unbeliebt machte. Als einige Male Werkzeug verschwunden war und dann auch eine kleinere Geldsumme, bezichtigte man ihn sogar des Diebstahls, und sein Meister wollte ihn kurzerhand hinauswerfen.
Schwester Marie brachte die Angelegenheit in Ordnung. Sie sprach mit dem Schlossermeister, und ihrer ruhigen Sicherheit gelang es, Fritz die Stellung zu erhalten. Man wolle es noch einmal mit ihm versuchen. Falls aber noch einmal etwas vorkomme, auch nur der geringste Ärger, dann sei Schluss, teilte man ihr mit. Sie redete Fritz kräftig ins Gewissen, was dieser mit trotzigem Schweigen über sich ergehen ließ.
Mit Lotte gab es anderen Ärger. Sie hatte sich zu einem ausgesprochen hübschen Mädchen entwickelt, ein wenig keck, sehr selbstbewusst und, im Gegensatz zu Fritz, sehr tüchtig in ihrem Beruf. Sie war Gesellin in einem guten Schneideratelier, wo man an ihrer Arbeit nichts auszusetzen fand. Höchstens an ihrem gar zu raschen Mundwerk. Ihr schwacher Punkt waren Männer. Schon als ganz junges Ding hatte sie sich mit den Jungen der Nachbarschaft herumgetrieben. Mit achtzehn hatte sie eine Liebschaft mit einem weit älteren Mann, dessen Frau in dem Modeatelier arbeiten ließ, in dem sie beschäftigt war. Natürlich verlor sie ihre Stellung, als es herauskam. Schlimmer war es, dass sie eines Tages schwankend nach Hause kam und bewusstlos zusammenbrach. Eine pfuscherhaft vorgenommene Abtreibung war der Grund. Sie war eine Zeit lang krank. Ihre Jugend überwand jedoch die Folgen schnell.
Nun aber hatte sie eine neue Liebe. Es war ein junger Mann, nur wenige Jahre älter als sie, der überzeugter und vor allem sehr aktiver Kommunist war. In seinem Fahrwasser verwandelte sich auch Lotte in eine begeisterte Kommunistin. Sie besuchte Versammlungen, kam mit Flugblättern und wilden Drohreden nach Hause, propagierte die freie Liebe, die Emanzipation der Frau und den Untergang der bestehenden Gesellschaftsordnung. Da sie viel zu dumm war, um die Dinge, die sie so begeistert nachplapperte, wirklich zu begreifen, bestand eigentlich kein Anlass, sie ernst zu nehmen. Aber der Einfluss ihres Freundes war so groß, dass mit der Zeit ihr ganzes Leben davon bedroht wurde. Es sah ganz danach aus, als würde sie demnächst wieder ihre Stellung verlieren; denn immerhin bestand die Kundschaft aus meist wohlhabenden Damen, die Lottes aggressives Geschwätz nicht hören wollten. Nur ihre wirklich gute Arbeit hatte sie bisher vor einem Hinauswurf bewahrt.
Während der Zeit, als Stella krank war, kam es auch in der Familie zu einer heftigen Auseinandersetzung. Lottes Freund war da gewesen, hatte unverschämte Reden gehalten und große Töne gespuckt, und Lene war ganz unvermutet recht energisch geworden. Sie hatte sich den Unsinn verbeten. In ihrer Wohnung wolle sie nichts von dem Lumpengesindel hören. Lumpengesindel sagte sie, klar und deutlich, und anschließend wies sie dem jungen Mann die Tür.
»Dann gehe ich auch«, erklärte Lotte mit flammenden Wangen.
»Das würde ich mir an deiner Stelle überlegen«, sagte ihre Mutter.
Doch Lotte fuhr hitzig fort, dass es da nichts zu überlegen gäbe. Sie lasse die Partei nicht beleidigen, schon gar nicht von ihrer Mutter, die ja keine Ahnung habe, was in der Welt vorgehe. Und was Kurt beträfe – so hieß ihr Kommunistenfreund –, den liebe sie und lasse ihn erst recht nicht beleidigen.
»Warum heiratest du ihn nicht, wenn du ihn liebst?«, fragte ihre Mutter ruhig.
Lotte zog verächtlich die Luft durch die Nase. »Heiraten! Auch so ein bürgerlicher Quatsch. Wir sind freie Menschen. Und überhaupt – ich habe es hier schon lange satt. Hier bei euch, in dieser kläglichen Bude«, sie schaute sich missmutig um, »das habe ich die längste Zeit mitgemacht. Du bist ein Kapitalistenknecht, Mutter, und wirst es immer bleiben. Nähen gehen zu den verdammten Bourgeois«, sie sagte Burschos, »dein ganzes Leben lang, bis du krumm und grau geworden bist, damit hast du dich zufriedengegeben. Ich nicht. Wenn wir erst dran sind, hört das auf. Dann werden die für uns nähen.«
Lotte zog aus. Es war für Lene, obwohl sie nicht darüber sprach, ein großer Kummer. Denn wenn sie eins ihrer Kinder wirklich liebte, dann war es Lotte, das erste, das Kind ihrer kurzen, glücklichen Liebe. Außerdem war sie immer stolz auf Lotte gewesen, auf das hübsche, frische Gesicht, die braunen Locken und die schlanke, anmutige Gestalt des Mädchens. Und auch, nicht zuletzt, auf ihre Leistungen im Beruf. Sie selbst war nur eine kleine Näherin, die in die Häuser ging und Änderungen vornahm, alte Sachen trennte und wendete und höchstens mal ein Kinderkleidchen schneiderte. Lotte war in einem feinen Atelier in der Tauentzienstraße, wo nur reiche Leute arbeiten ließen.
Stella, die zu der Zeit, als diese Auseinandersetzung stattfand, fiebernd im Bett lag, hatte alles mit angehört und war tief verstört davon.
Schwester Marie, die sich nun mal für die Termogen-Kinder verantwortlich fühlte, hatte versucht, Lotte zur Rückkehr zu bewegen. Vergebens. Auch sie hatte sich einige Unfreundlichkeiten anhören müssen, obwohl Lotte gewiss keinen Grund hatte, gerade gegen Schwester Marie ungezogen zu sein. Wenn es jemals in ihrer Kindheit eine Tafel Schokolade gegeben hatte oder ein Geschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten, dann war es von Marie gekommen.
Aber das hatte Lotte vergessen. Sie fühlte sich jetzt erwachsen und lebte ihr eigenes Leben. Zum Teufel mit Familie und Verwandten. Diese Sentimentalitäten hatte sie hinter sich. Das jedenfalls erklärte sie temperamentvoll, den hübschen Kopf zurückgeworfen, die Augen blitzend vor Erregung.
»Kind, du weißt nicht, was du sagst. Und du weißt erst recht nicht, was du tust«, sagte Schwester Marie traurig.
»Ich weiß es sehr gut«, fuhr Lotte sie an. »Besser als ihr alle. Ihr seid ja von gestern. Aber euch werden wir schon noch fertigmachen.«
Zu Ehren des jungen Mannes Kurt muss gesagt werden, dass er diesem Gespräch mit Unbehagen beiwohnte. Lotte lebte ja jetzt bei ihm, in seiner engen, dunklen Bude in Berlin-Wedding.
Er liebte Lotte, daran war nicht zu zweifeln. Und wenn er sie so vor sich sah, mit ihrem Temperament und dem roten Mund, der so leichtfertig urteilte, liebte er sie erst recht. Aber dass sie so mit ihrer Tante sprach oder wer immer diese komische Schwester war, die ihm in ihrer ruhigen Würde eine widerwillige Bewunderung abnötigte, das fand er nicht ganz richtig. Leute von gestern, natürlich, damit hatte Lotte schon recht. Aber man musste das auch irgendwie verstehen. Die kannten es eben nicht anders. Sie waren in dieser komischen Monarchie aufgewachsen, man hatte sie geknechtet und geknebelt und immer unten gehalten. Man musste sie belehren und befreien, aber nicht beleidigen, so dachte er. Außerdem ahnte er, dass auch in einem kommunistischen Weltreich eine Krankenschwester nicht ganz zu entbehren sein würde. Sie war ja keine Kapitalistin, sie war ein armes Luder wie sie alle. Wenn es so weit war, würde sie schon erkennen, wie viel besser die Welt geworden war. Die war nicht dumm, diese Schwester mit ihrem schmalen, ruhigen Gesicht unter dem weißen Häubchen, das sah er wohl. Und schließlich – wusste sie nicht genug vom Leben und von den Menschen, gerade sie? Sogar mehr als jeder andere? Das versuchte er Lotte klarzumachen, als Schwester Marie gegangen war. Er hatte sie übrigens zur Haustür begleitet und hatte entschuldigend gelächelt.
»Sie meint es nicht so«, sagte er und streckte zaghaft die Hand aus. »Nichts für ungut. Ich – ich würde mich freuen, wenn Sie uns wieder mal besuchen.«
Schwester Marie hatte ihn prüfend betrachtet. Dann nahm sie seine Hand. »Lotte ist sehr jung«, sagte sie. »Sie auch, Herr, Herr …«
»Krausmann«, sagte der Kommunist und brachte sogar so etwas Ähnliches wie eine kleine Verbeugung zustande.
»Herr Krausmann. Ich nehme an, Sie sind sich darüber klar, dass Sie eine Verantwortung übernommen haben. Ich weiß nicht, ob es in Ihrer Welt diesen Begriff noch gibt. Aber ich glaube, es wird ihn immer geben. Auch in der neuen Weltordnung, die Sie anstreben. Oder meinen Sie nicht, dass ein Mann einer so jungen Frau gegenüber immer eine Verantwortung übernimmt? Wenn er sie ihrer Familie wegnimmt, ihrer Mutter entfremdet? Lotte ist noch ein Kind.«
Kurt, der Kommunist, kam nicht dazu, nachzudenken. Er nickte. »Doch«, sagte er, »das ist schon so. Ich werde auf Lotte aufpassen. Ich liebe sie.« Etwas stockend kam die altmodische Formel über seine Lippen. Aber er sprach es aus: »Ich liebe sie.«
Da lächelte Schwester Marie.
»Liebe ist etwas Wunderschönes«, sagte sie. »Und ohne Liebe kommen wir nicht aus, wir Menschen. Auch ihr nicht. Sie ist der Herzschlag, der die Welt zusammenhält und die Menschen erst zu Menschen macht. Was auch immer ihre politische Überzeugung sein mag.«
Kurt nickte wieder. »Ja«, sagte er. »Ja.« Er sah der schmalen aufrechten Gestalt nach, die die Straße entlangging, sich von ihm entfernte. Er hatte das Gefühl, er müsse ihr nachlaufen, müsse sie festhalten, um noch weiter in dieses stille, beherrschte Gesicht blicken zu können, in diese warmen, gütigen Augen. Er hatte keine Erklärung für das Gefühl, das sein Herz zusammenpresste und alles andere plötzlich nichtig erscheinen ließ. Liebe? Was war das? War es vielleicht doch mehr als die glühende Umarmung in der Nacht?
Was wusste er denn von Liebe. Ihn hatte niemand geliebt. Er hatte keinen Vater gekannt, keine Mutter. Er war immer allein gewesen, überall eine Last, herumgestoßen, überflüssig. Die Partei war seine Heimat geworden, Vater und Mutter zugleich. Liebe – das war jetzt das Mädchen oben in seinem Zimmer. Bisher hatte er nicht darüber nachgedacht. Liebe bedeutet Verantwortung, hatte die Schwester gesagt. Die Partei sagte auch, dass sie alle eine große Verantwortung trügen, der Welt, der Menschheit gegenüber. Warum nicht auch einem einzelnen Menschen gegenüber? Das war durchaus plausibel. Und vielleicht war es wirklich nicht ganz richtig, wie sich Lotte benahm, ihrer Mutter und dieser Schwester gegenüber.
Er vergaß diese Begegnung mit Marie nicht. An seinen politischen Idealen änderte sich nichts. Doch er hielt treu an Lotte fest. Zwei Jahre später, als sie schwanger wurde, heirateten sie.
Als Stella aus der Klinik kam, schlief sie nun allein mit ihrer Mutter in dem Schlafzimmer mit den Doppelbetten. Früher hatten sie zu dritt hier geschlafen. Fritz schlief in der kleinen Kammer, die noch zur Wohnung gehörte. Nachts hörte Lene das Kind neben sich husten, würgend und endlos, noch immer.
Als Stella wieder zur Schule ging, gab es neuen Ärger. Nach einiger Zeit kam ein Brief von der Schule. Stellas Leistungen entsprächen auch nicht mehr den geringsten Ansprüchen, sie sitze nur noch apathisch herum, nehme kaum teil am Unterricht. Frau Termogen möge sich doch einmal in die Schule zu einer Rücksprache bemühen.
Lene zeigte den Brief Schwester Marie, als sie das nächste Mal zu Besuch kam.
Marie las schweigend, hörte sich die klagenden Worte Lenes eine Weile an und betrachtete dann nachdenklich Stella, die mit großen, ängstlichen Augen dem Gespräch lauschte. Wie immer gab es Marie einen Stich ins Herz, zu sehen, wie elend das Kind war.
»Ich hab’ ihr gehörig die Meinung gesagt«, fuhr Lene weinerlich fort, »aber es hilft ja nichts. Sie will nicht. Sie ist vertrotzt.«
»Geh ein bisschen hinaus spielen, Stella«, sagte Marie statt einer Antwort.
»Ich mag nicht spielen«, antwortete Stella leise aber entschieden.
»Dann geh ein Stück spazieren. Die frische Luft tut dir gut. Oder weißt du was? Lauf zum Bäcker und kaufe uns drei Stück Kuchen. Dann können wir uns nachher Kaffee kochen.« Die Schwester kramte in ihrem Portemonnaie und zog ein paar Groschen heraus. »Hier. Such dir aus, was dir schmeckt.«
Als Stella gegangen war, sagte Marie ruhig: »Das Kind ist nicht vertrotzt. Es ist krank. Immer noch. Und übernervös. Dieser Husten macht mir Sorgen.«
»Ja, der Husten ist schrecklich«, gab Lene zu. »Ich kann oft nachts nicht schlafen deswegen.«
»Sie müsste Luftveränderung haben. Ich habe schon mehrmals daran gedacht.«
Lene lachte bitter. »Arme Leute wie wir fahren nicht zur Erholung, das weißt du ganz genau.«
»Es gibt doch Kinderlandverschickungen. Ich muss mich mal erkundigen.«
»Für uns doch nicht«, beharrte Lene störrisch.
»Für wen denn sonst«, sagte Marie ungeduldig. »Lass mich mal machen. Und in die Schule werde ich auch gehen. Ich werde mit dem Lehrer sprechen.«
Ihren nächsten freien Tag benutzte Schwester Marie, um in die Schule zu gehen. Sie sprach mit dem Lehrer Krüger, fand aber wenig Verständnis.
»Schön, schön, zugegeben«, sagte er, »sie war lange krank und sieht wirklich nicht gut aus. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, es war schon vorher nicht leicht mit ihr. Sie ist ein schwieriges Kind.«
Marie betrachtete ihn nachdenklich. Er sah auch nicht gut aus, ungesund gelb im Gesicht. Eine angegriffene Leber, konstatierte sie. Für einen Lehrer eine unmögliche Krankheit.
Während sie im Gang standen und miteinander sprachen, kam zufällig Fräulein Trunck vorbei. Als sie Stellas Namen hörte, blieb sie unwillkürlich stehen.
»Verzeihung«, sagte sie, »handelt es sich um Stella Termogen?« Herr Krüger zog unwillig die Brauen hoch. Er hatte Fräulein Truncks einleitende Bemerkungen über diese Schülerin nicht vergessen.
Er schwieg, aber Schwester Marie blickte der jungen Lehrerin ins Gesicht und wusste gleich, wen sie vor sich hatte: »Sie müssen Fräulein Trunck sein.«
Die Lehrerin lächelte. »Ja. Hat Stella von mir erzählt?«
»Sehr viel. Sie hängt sehr an Ihnen. Und …« Sie brach ab, als sie Herrn Krügers missbilligende Miene bemerkte. Nein, besser nicht erzählen, mit welcher Begeisterung Stella von Fräulein Trunck gesprochen hatte und wie gern sie im ersten Jahr zur Schule gegangen war.
»Sie ist ein sehr sensibles Kind«, sagte sie nur noch.
»Ich weiß«, sagte Fräulein Trunck. »Aber ich will nicht länger stören. Es ist ja dieses Jahr nicht meine Angelegenheit.« Sie neigte leicht den Kopf und ging weiter.
Das Gespräch mit Herrn Krüger währte nicht mehr lange. Schwester Marie bat ihn um Verständnis und Geduld.
»Selbstverständlich«, bemerkte Herr Krüger steif, »das ist schließlich mein Beruf.«
Als Marie zum Ausgang ging, kam plötzlich kurz vor dem Schulportal Fräulein Trunck auf sie zu.
»Es ist sehr schade, dass Sie die Klasse nicht behalten haben«, sagte Marie.
»Ja, ich weiß. Das Schlimme ist, ich habe Stella versprochen, dass ich sie in der vierten Klasse wiederbekomme. Aber nun werde ich versetzt. Ich verlasse die Schule zu Ostern.«
Schwester Marie war ehrlich erschrocken. »Das ist schlimm«, meinte sie. »Ich weiß gar nicht, wie ich Stella das sagen soll.«
»Ich mache mir Sorgen um Stella«, sagte Fräulein Trunck. »Sie sieht so schlecht aus. Ich spreche ja jetzt selten mit ihr. Absichtlich, wissen Sie. Sie muss es lernen, sich auch an andere Lehrer zu gewöhnen. Es geht nun mal nicht anders. Den meisten Kindern fällt es nicht schwer. Es gibt manchmal eine schwere Trennung, wenn man eine Klasse abgeben muss; aber Kinder vergessen so leicht. Mit Stella ist es anders. Ich komme mir vor, als hätte ich ihr etwas getan. Wenn sie einen so anschaut mit ihren großen Augen …«
Schwester Marie nickte. »Ich weiß. Es geht mir genauso. Man hat immer das Gefühl, man müsse ihr helfen, müsse sie beschützen. Sie ist so liebebedürftig und hat so wenig Liebe bekommen.«
»Ja. Das Gefühl hatte ich auch immer. Die Eltern – nein, der Vater ist ja wohl gefallen, soweit ich mich erinnere. Und die Mutter?«
»Eine Frau, der die Verhältnisse über den Kopf gewachsen sind. Es war nicht leicht für sie in den vergangenen Jahren. Der Krieg, die Nachkriegszeit, die Inflation. Und Stellas Mutter ist nicht mehr jung. Als sie das Kind bekam, war sie schon über vierzig.«
»Ach? Ich verstehe. Und sonst ist niemand …«
»Nur ich. Aber meine Arbeit lässt mir nur wenig Zeit. Ich habe einmal in der Woche frei. Dann sehe ich immer nach Stella. Aber das ist zu wenig.«
»Viel zu wenig«, bestätigte die Lehrerin mit Nachdruck.
Eine Weile schwiegen die beiden Frauen nachdenklich.
»Es muss etwas geschehen«, meinte dann Fräulein Trunck entschieden. »Stella muss vor allem richtig gesund werden. Und kräftiger. Dann wird auch die Nervosität verschwinden. Ein labiler Mensch wird sie immer bleiben. Ich kenne diesen Typ. Aber im Gegensatz zu Herrn Krüger bin ich von ihrer Intelligenz überzeugt. Sie war die beste Schülerin meiner Klasse. Und gerade am Anfang merkt man am besten, ob ein Kind schnell begreift und aufnimmt. Könnte man denn nicht …«
»Ja?«, fragte Schwester Marie.
»Ich habe mir gedacht, dass Stella einmal zur Erholung aus der Stadt hinaus müsste. Frische Luft und kräftige Ernährung und vor allem eine andere Umgebung.«
Schwester Marie strahlte die Lehrerin an. »Dass Sie das sagen … Genau daran habe ich auch gedacht.«
»Es müsste natürlich die richtige Umgebung sein. Die richtigen Menschen, meine ich. Dass sie auch innerlich, ich meine seelisch, gut aufgehoben ist. Hat die Familie keine Verwandten auf dem Land?«
»Nicht, dass ich wüsste«, sagte Schwester Marie. »Alles, was an Verwandtschaft vorhanden ist, lebt hier in der Stadt.«
»Das ist schade.«
»Ich dachte an eine Kinderlandverschickung. Wenn man ein Attest bekäme …«
Fräulein Trunck hob zweifelnd die Schultern. »Sicher, das bekäme sie schon. Aber ob Stella sich dabei wohlfühlen würde? Ich glaube es nicht.«
Doch auf dem Weg zu Lene hatte Schwester Marie eine Idee.
Lenes Angehörige lebten in Berlin, das stimmte. Aber die Angehörigen des Vaters, Karl Termogens Familie? Sie wusste nicht viel darüber. Nur, dass er seine Familie in jungen Jahren verlassen hatte und nie mehr zurückgekehrt war. Und wie Schwester Marie Karl Termogen kannte, den sie nicht sonderlich geschätzt hatte, war da irgendetwas vorgefallen, was ihm wohl nicht gerade zur Ehre gereichte.
Aber manchmal, so erinnerte sie sich dunkel, besonders, wenn Karl etwas getrunken hatte, begann er mit seiner Familie zu prahlen. »Die Termogens, das sind Burschen! Alte Seefahrer. Und unsere Schafzucht. Was habt ihr für eine Ahnung davon. Wenn der Wind über die Dünen pfeift und das Meer braust, das ist richtiges Leben! Da wisst ihr nichts davon.«
Eine Insel musste es sein, eine Insel in der Nordsee, daran konnte sich Marie noch erinnern. Lene wusste auch nicht viel. Sie war ganz und gar dagegen, sich an die Familie ihres Mannes zu wenden.
»Was willst du denn von denen? Die haben sich nie mehr um Karl gekümmert. Und genauso wenig um seine Kinder. Warum soll man betteln gehen zu fremden Leuten?«
Sylt habe die Insel geheißen, das wusste Lene noch.
Schwester Marie blickte zu Stella hinüber, die am Küchentisch saß und lustlos in ihrem Schulheft herumkrakelte.
»Sylt«, sagte Marie, »doch, das ist mir ein Begriff. Eine große Insel, ziemlich oben im Norden. Viele Leute verbringen dort ihre Ferien.«
»Lass es bleiben«, sagte Lene, »die wollen von uns nichts wissen.« Aber Schwester Marie ließ es keineswegs bleiben. Sie dachte einige Tage darüber nach, dann besorgte sie sich einen Reiseführer von Sylt; und dann, weil sie jeden danach fragte, den sie kannte, bekam sie eine begeisterte Schilderung der Insel vom Oberarzt Dr. Möller, dem Stationsarzt der Internen.
»Dreimal habe ich schon meinen Urlaub dort verbracht. Menschenskind, Schwester, dort ist noch der liebe Gott zu Hause. Dort werden Tote wieder lebendig. Himmel, Meer und endloser Strand. Und eine Luft wie am ersten Tag der Menschheit. Wollen Sie dort keine Ferien machen?«
»Ich nicht. Aber mein kleines Patenkind möchte ich gern hinschicken.« Sie gab einen kurzen Bericht über Stellas Zustand.
»Hm«, meinte Dr. Möller. »Bringen Sie mir die Kleine doch mal her. Kommt natürlich ganz drauf an. Wenn die Lunge angegriffen ist, muss man vorsichtig sein. Es ist ein Reizklima, nicht für jeden geeignet. Immerhin hat man auf verschiedenen Nordseeinseln Kinderheime, gerade für gesundheitlich schwache Kinder. Kommt halt immer auf den Fall an. Bringen Sie die Kleine mal mit. Wie heißt sie? Stella? Ein seltener Name.«
»Ich habe ihn ausgesucht«, sagte Schwester Marie mit hörbarem Stolz.
»Sehr apart. Schwester Marie hat eben ihren eigenen Kopf. Sag’ ich den Kollegen immer.«
Stella wurde von Dr. Möller gründlich untersucht. Er stellte fest, dass das Kind unterernährt, blutarm, übernervös und leicht rachitisch sei. Sonst aber organisch gesund. Und außerdem stellte er fest, dass dieses Kind Stella ein ganz seltsames, besonderes Wesen sei. Der erste Mann in Stellas Leben, der zu dieser Erkenntnis kam.
»Die Kleine müssen wir unbedingt hochpäppeln«, sagte er nach der Untersuchung zu Schwester Marie. »Das ist ein besonderes Gewächs. Glieder wie aus Elfenbein und so anmutig in der Bewegung. Und die Augen, und dazu das rote Haar. Die Kleine wird einmal apart, darauf können Sie sich verlassen. Wie die einen heute schon angucken kann … Nee, die müssen wir gesund kriegen. Wie ist das mit der Sylter Verwandtschaft?«
»Ich werde schreiben«, erklärte Schwester Marie entschieden. »Mehr als ablehnen können sie nicht.«
»Und wenn sie ablehnen, werden wir was anderes finden. Verlassen Sie sich drauf.«
»Ich bin Ihnen so dankbar, Herr Doktor, ich kann Ihnen gar nicht sagen …«
»Nur langsam«, wehrte der Arzt ab. »Keine Lobgesänge. Tu’ ich alles für die Menschheit. Wo das ganze Kroppzeug heutzutage blüht und gedeiht und alles überwuchert, da soll man so eine zarte kleine Blume«, er hob den Finger und steigerte sich poetisch, »so eine kleine Orchidee verkommen lassen? Nee, machen wir nicht. Kommt nicht infrage. Ihre kleine Stella kriegen wir hin. Das ist edle Rasse, und da ist auch Zähigkeit drin und gutes Blut, das seh’ ich mit einem Blick. So was muss man behüten und pflegen. Sind wir der Menschheit schuldig.«