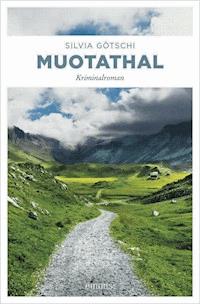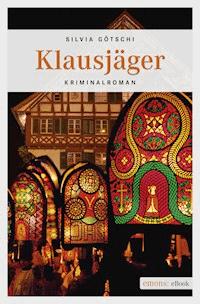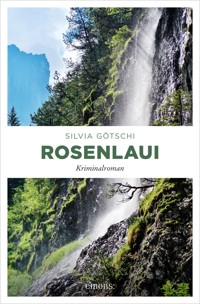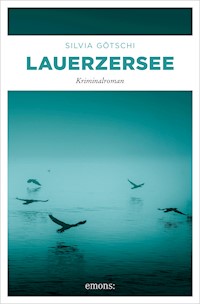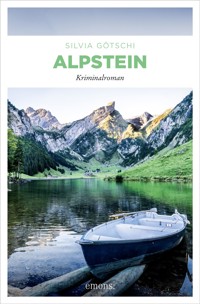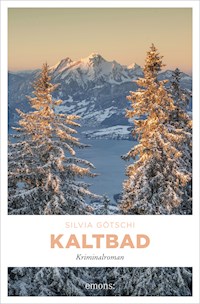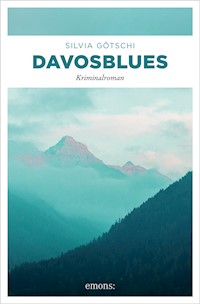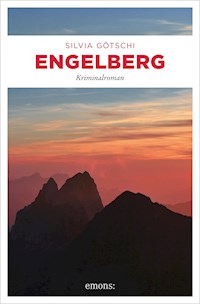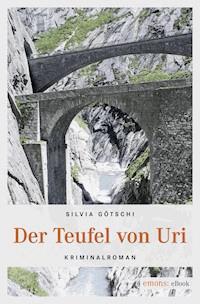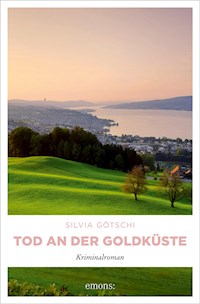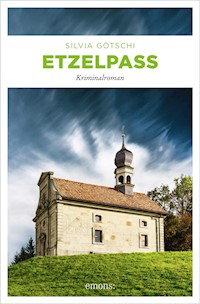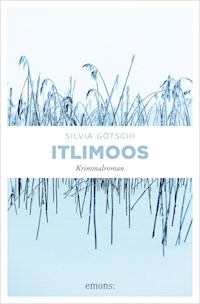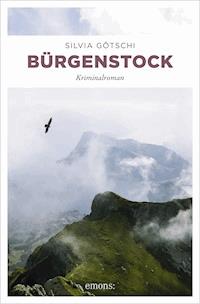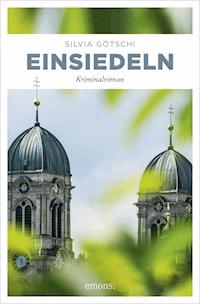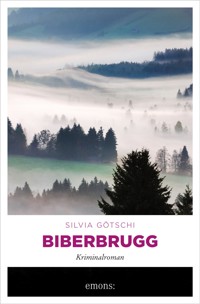Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Festliche Krimispannung von der Schweizer Queen of Crime! Ausgerechnet an Heiligabend liegt Clothilde Anthamatten, die Grande Dame des herrschaftlichen Hauses Winterstern, leblos im Schnee – und alles deutet auf einen Mord hin. Die Verdächtigen: ihre gesamte Verwandtschaft, die im Laufe der Adventszeit angereist ist. Welcher der vierundzwanzig Gäste wollte die reiche Witwe aus dem Weg räumen? Während das abgelegene Anwesen nahe dem Matterhorn langsam im Schnee versinkt, begibt sich die Enkelin der Verstorbenen auf eine turbulente Mörderjagd in ihrer eigenen Familie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Silvia Götschi, Jahrgang 1958, zählt zu den arriviertesten Krimiautorinnen der Schweiz; 2023 war sie die erfolgreichste Schweizer Autorin. Ihre Krimis landen regelmäßig auf den vordersten Plätzen der Schweizer Belletristik-Bestsellerliste. Für zwei ihrer Krimis wurde sie mit dem GfK No 1 Buch Award ausgezeichnet. Sie hat drei Söhne und zwei Töchter und lebt heute mit ihrem Mann im Kanton Aargau.
www.silvia-goetschi.ch
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang finden sich Rezepte.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-227-7
Ein Weihnachtskrimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Advent
Eine Kerze sendet Schweigen
In die dunkle Nacht hinaus
Vorbei das Sommerfest der Reigen
Ruhe kehret ein ins Haus
Des Herbstes satte Farben weichen
Verschwommener Kontur
Vorbei die Sinfonie des Reichen
Kühl weitet sich des Nebels Spur
Nächte klirrend kalt, die Winde
Verstummt der Vögel hell Gesang
Eisdiamanten schwirren linde
Umhüllen schweren Glockenklang
Des Winters Atem berührt uns sacht
Es silberweiß vom Himmel schneit
So fern der Tag, so nah die Nacht
Taucht ein in die mörderische Zeit
FIDELIO MARIA FERRARO
Personenregister
Die Gastgeberin:
Clothilde Anthamatten von Winterstern (82),verwitwet, geschiedene Imhof, geborene Meier
Ihre Gäste:
Clothildes Bruder Wolfgang Meier (80), ledig
Clothildes erste Tochter Martina Henderson-Imhof (60) und deren Mann Thomas Henderson (67)
Enkelin Stephanie Anderhub-Henderson (38)und deren Mann Alexander Anderhub (38)mit Tochter Vanessa (16) und Sohn Niklas (14)
Clothildes zweite Tochter Barbara Stoller-Imhof (57)und deren Mann Ralph Stoller (56)
Enkel Tobias Stoller (34) und dessen Frau Annika (33)mit den Zwillingen Alpha und Beta (11)
Enkelin Laura Stoller (32) und deren Freund Dr. Tim Kramer (36)
Clothildes erster Sohn Frank Imhof (54) und dessen Frau Nicole (50)
Enkelin Anna Imhof (24), Ich-Erzählerin
Clothildes zweiter Sohn Oliver Imhof (52) und dessen Frau Julie (42)mit ihren Söhnen Jonas (17) und Jannik (16)
Clothildes jüngste Tochter Evamarie Imhof (45)mit deren Verlobtem Fidelio Maria Ferraro (36)
Ihr Personal:
Butler: Arthur
Koch: Pierre
Zimmer und Service: Elvira
24. Dezember
Heiligabend im Haus Winterstern
Es war seltsam ruhig an diesem Morgen. Kein Geräusch, nicht das leiseste Knarzen wie üblich, wenn Oma über mir in ihrem Zimmer umherschritt. Heute schien sie länger schlafen zu wollen, damit sie den Abend körperlich und geistig fit angehen konnte. Zudem pflegte sie ihre Rituale.
Ich vergewisserte mich auf dem Zifferblatt des Weckers, wie spät es war. Acht Uhr achtzehn. Ich strampelte die Decke ans Fußende und stieg aus dem Bett. Ich schlich auf den Zehenspitzen zum Fenster, schlug den schweren Vorhang zur Seite und versuchte, einen Blick nach draußen zu erhaschen. Die Scheiben waren beschlagen von der frostigen Kälte. Ich hauchte darauf und wischte mit der Hand ein Guckloch frei.
Es war, als hielte die Welt ob so viel Schönheit den Atem an. Wo in der Nacht der Wintersturm um die Hausecken gebrüllt und Eiskristalle durch die Luft gewirbelt hatte, lag alles unter einer kompakten Schneedecke. Das Dach beim Pferdestall hatte eine achtzig Zentimeter dicke Haube, der Hang bis zum Waldrand lag im Schatten, und dahinter erhob sich majestätisch das Matterhorn, dessen Gipfel die ersten Sonnenstrahlen streichelten. Was für ein Bild! Heute war Heiligabend, und er hätte nicht schöner beginnen können. Ganz hinten standen die schneebedeckten Tannen wie Pilaster Spalier, bei der schrägen Dachrinne neben meinem Zimmerfenster hatten sich Eiszapfen gebildet.
Madame Clothilde Anthamatten von Winterstern hatte Ende November um eine persönliche Gesellschafterin gebeten. Sie wollte eine junge Frau, die ihr zur Hand ging, nicht fremd und ihr gegenüber mit Liebe erfüllt war. Eine Verwandte hatte sie gewünscht, Anna Imhof, mich. Ich sei ihr ähnlich, sagte sie jeweils, und ich hätte das Temperament von ihr geerbt, denn sie war meine Großmutter. Ich war mit ihr verbunden, wir verstanden uns und kommunizierten ohne viele Worte. Außer uns musste es niemand verstehen. Ich hatte mir einrichten können, den ganzen Dezember aufgrund zu vieler Überstunden freizunehmen. Oma kam dies gelegen.
Der Morgen dämmerte, aber es würde noch dauern, bis die Sonne vollständig über den Bergen aufgegangen war und die Riffelalp erreicht hätte. Es war wie Magie. Der Himmel über mir glühte. Was versprach der Rotton? Nichts Gutes? Nach dem Schneesturm in vergangener Nacht braute sich wahrscheinlich ein neues Wintertief zusammen. Ich riss mich von diesem traumhaften Anblick los und ging ins Badezimmer. Alles hier war exquisit, vom Lavabo aus Emaille mit den Kreuzhähnen bis zur Toilette, deren Spülkasten oberhalb der Schüssel hing. Um die Spülung zu betätigen, musste man an einer Kette ziehen. Die frei stehende Badewanne mit Füßen erinnerte an eine längst vergangene Zeit. Oma hatte seit dem Tod ihres zweiten Mannes vor zwölf Jahren immer wieder in das Anwesen investiert. Geld war da; wie viel, wusste ich nicht. Aber wenn ich mir die Verwandtschaft ansah, die Jahr für Jahr im Advent an den abgelegenen Ort oberhalb von Zermatt pilgerte, musste es ein ansehnliches Kapital sein. Das Geld lockte, war ich mir sicher, nach dem, was ich in den letzten Tagen erlebt hatte.
Oma hatte sich von meinem Großvater nach dem achtzehnten Geburtstag ihrer jüngsten Tochter getrennt und einen Monat darauf Maxim Anthamatten, den reichen Grundstücksbesitzer, Immobilienmakler und Eigentümer des Herrschaftshauses Winterstern, geheiratet. Aus Omas Erzählungen hatte ich erfahren, wie alle ihre fünf Kinder gegen diese Heirat gewesen waren. Aber als sie den Reichtum gewittert hatten, änderten sich ihre Haltungen. Maxim war mir in bester Erinnerung. Er war ein lebensfroher Mann gewesen, der nicht bloß dem Reichtum, sondern auch den sinnlichen Genüssen zugetan war. Und er hatte wunderbar Geige gespielt. Er war ein Virtuose gewesen, ein von der Muse Geküsster, der jeweils an den Weihnachtstagen im Haus Winterstern die Gäste musikalisch unterhalten hatte. Mein Stiefgroßvater.
Ich duschte mich, zog mich an und machte mich bereit, um Oma in ihrem Zimmer abzuholen. Meistens war sie bereit, wenn ich bei ihr anklopfte.
Komisch, noch immer herrschte eine gespenstische Ruhe im ganzen Haus. Der Schnee der letzten Tage schien das historische Gebäude wie in Watte gepackt zu haben. Ich zog die Tür hinter mir ins Schloss und betrat die Galerie, von der aus eine Anzahl Türen weggingen und man über eine breite Wendeltreppe hinunter ins Foyer sah. Dort stand prominent der eine von drei Weihnachtsbäumen und strahlte mit dem Lüster um die Wette. Ich konnte den Geruch der Nadeln bis nach oben riechen. Eine würzige Note von Harz. Früher hatten keine elektrischen Lämpchen am Baum gehangen. Jede echte Kerze war von Hand angezündet worden. Sie hatten einen besonderen Duft nach Bienenwachs verbreitet. Nachdem der Weihnachtsbaum einmal fast in Vollbrand gestanden und die Treppe wegen des Feuers großen Schaden erlitten hatte, entschied sich Oma für die elektrischen Lämpchen.
Die Stille übte eine bedrohliche Wirkung auf mich aus. Ich war es nicht gewohnt, nach dem Aufstehen in diese absolute Geräuschlosigkeit zu treten. An den vorhergehenden Tagen war um diese Uhrzeit bereits viel los gewesen. Allein die Jüngsten in der Familie verstanden es, die prächtigen Räume in eine Villa Kunterbunt zu verwandeln. Wenn die Feierlichkeiten vorbei waren, ließ Oma jeweils ihre Handwerker kommen, damit diese die Schäden behoben.
Ich ging über die Treppe nach unten. Zugegeben, Omas Haus erinnerte im Innenbereich ein wenig an die viktorianischen Häuser der Südstaaten von Amerika. Es war Treffpunkt für Familienfeiern, Begegnungsstätte für Kaffee- und Teekränzchen, oft auch für politische Zusammenkünfte, luxuriöser Ort für die unvergesslichen Dinners, wo schon mal ein Haubenkoch sein Rendezvous hatte oder das Hotel Riffelalp wegen Überbuchungen an seine Tür anklopfte. In der Vergangenheit hatte sich eine illustre Gesellschaft hier eingefunden. Oma fand, man müsse dem »Kasten« Leben einhauchen.
Alles still. Wollte ich nicht Oma abholen? Aber ja. Deswegen war ich aufgestanden. Ihr Zimmer lag in der zweiten Etage. Bevor ich nach oben ging, ging ich nach unten und öffnete die schwere Eingangstür. Auf dem Vorplatz schaufelte Butler Arthur den Zugang von Schnee frei. Ich rief in seine Richtung, aber er war dermaßen in die Arbeit vertieft, er nahm mich nicht wahr. Vor meinem Mund bildete sich ein feiner Nebel, wenn ich ausatmete. Eine Weile blieb ich stehen und sah über den fast unberührten Schneeteppich.
Ich kehrte um, stieg zwei Treppen hoch, schritt über den Korridor und stand vor Omas Zimmertür. Angespannt lauschte ich auf dem Türblatt, ob ich von drinnen etwas vernehmen würde, ein kleines Lebenszeichen. Zaghaft klopfte ich an.
Ich hörte ihre resolute Stimme – nicht so resolut wie gewohnt. Mir fiel trotzdem ein Stein vom Herzen. Sie war wohlauf.
»Komm rein, meine Liebe. Warum so schüchtern?«
Ich drückte die Klinke, öffnete die Tür und schob mich ins Zimmer. Offensichtlich hatte Oma auf mich gewartet. Mit Verweis auf meine Armbanduhr hauchte ich ein »Guten Morgen« in die Luft.
Sie breitete die Arme aus. »Ach, Kindchen, was für ein Freudentag. Dass ich das erleben darf. Zweiundachtzig Jahre auf dem Buckel, und noch immer gelingt es mir, an Heiligabend und Weihnachten meine ganze Familie an einen Tisch zu bringen. Unter uns gesagt, nicht jedermann ist willkommen. Aber was soll ich machen? Familie ist Familie, und Tradition ist Tradition. Ach, wenn ich dich nicht hätte, ich wüsste nicht, wo mir der Kopf stände. Es war in den letzten Tagen nicht ganz einfach für dich. Zu viele Charaktere treffen aufeinander, und die Teenager, Gott bewahre, sind so was von ungezogen. Nun, übermorgen reisen die meisten ab. Ich werde ihnen keine Träne nachweinen.«
Ich erzählte ihr nicht, wie sehr es mich angestrengt hatte, den Familienmitgliedern gerecht zu werden und auf ihre individuellen und speziellen Wünsche einzugehen. Zum Glück war mir Omas langjähriger Butler Arthur zur Seite gestanden. Er war ein weiser Mann und Menschenkenner und wahrte stets eine vorbildliche Ruhe, auch wenn man ihn mit Worten angriff. Unlängst hatte er mir verraten, er fühle sich manchmal wie ein Blitzableiter. Aber das sei schon früher so gewesen. In der Adventszeit brauche er einen besonders breiten Rücken. Nicht alles lasse er sich gefallen. Ich verstand ihn, hatte ich selbst doch schon miterlebt, wozu und für wen er überall hinhalten musste.
Ich umarmte Oma und stieß sie darauf sanft von mir, um sie mir näher anzusehen. Sie hatte sich bei ihrer Garderobe heute besonders Mühe gegeben. Sie trug ein rotes Kleid, das ihre zarte Figur betonte. Erstaunlich, wie fit sie sich gehalten hatte. Das liege in den Genen, sagte sie jeweils, wenn man sie auf ihre Physis ansprach. Schon ihr Vater sei schlank und rank und voller Energie gewesen. Dass sie heimlich Yoga machte, wusste nur ich. Sie begann den Tag mit dem Sonnengruß und widmete eine halbe Stunde den verschiedenen Übungen. Oma war beweglicher als meine Mam, auch geistig war sie ihr überlegen. Ob sie sich auch gesund ernährte, das blieb ein Geheimnis. Oma trank gern und aß viel Süßes. Sie war exzessiv in allem, was sie tat.
Ich bewunderte sie. Sie hatte sich wie immer geschminkt und hielt sich an den Glamour der fünfziger Jahre, in denen das Make-up genauso zur Frau gehörte wie der Bleistiftrock. Mit wenigen Ausnahmen hatte sie das Flair dieser Zeit und den Stil vom Scheitel bis zu den Fußsohlen bewahrt.
»Wollen wir nach unten gehen?« Ich bot ihr meinen Arm an. »Du siehst wirklich zum Anbeißen aus.«
»Ha, ha.« Sie warf den Kopf in den Nacken. Ihr kinnlanges, noch immer dichtes, jedoch schlohweißes Haar fiel in sanften Wellen auf den Kragen. »Wenn ich dreißig Jahre jünger wäre, könntest du mich damit beeindrucken. Weißt du, meine Liebe, hat eine Frau die fünfzig erreicht, wird sie unsichtbar oder verschwindet allmählich aus dem Blickfeld der Gesellschaft. Die Jungen machen sich lustig über sie, holen Bilder aus ihrer Vergangenheit und vergleichen sie mit den heutigen, als müsste man sich dafür schämen, alt zu werden.« Oma atmete tief durch. »Mit sechzig macht es ihr nichts mehr aus, denn dann hat sie sich daran gewöhnt. Siebzig ist eine doofe Zahl, und wenn sie die achtzig überlebt hat, macht es wieder richtig Spaß, Wert auf das Äußere zu legen. Ich kann heute anziehen, was ich möchte. Ich würde sogar mit dem Babydoll durchs Wohnzimmer gehen, ganz zum Ärger meiner beiden Schwiegertöchter …« Sie sah in mein erstauntes Gesicht. »Deine Mutter ist die Ausnahme. Aber schau dir doch Julie an. An ihr ist nur der Name schön. Von nichts kommt nichts.« Während Oma es sagte, strahlte sie, und ich konnte nur ahnen, dass sie es nicht so meinte, wie es klang. Ihre sarkastischen Züge verzieh ich ihr. »Also gut, betreten wir die Kampfarena.«
Im Parterre angekommen, hörte ich etwas nuscheln und rascheln. Ein Gemisch aus Flüstern und Papierknistern. Ich schaute mich um, vergewisserte mich, ob da nicht irgendwo Mäuse herumrannten. Vor zwei Jahren war der Kammerjäger hier gewesen und hatte ihre Nester ausgehoben. Die Nager hatten sich in der Wand zwischen Speisekammer und Küche niedergelassen und von dort aus ihre Streifzüge durchs ganze Haus unternommen. Bevor das Übel an der Wurzel gepackt war, hatte man über einen Geist gemunkelt.
Das Geräusch kam aus der Wohnküche.
»Glaubst du, alle sind schon auf?« Ich legte die Hand auf den Türgriff.
»Jetzt sollten sie wach sein.« Oma lächelte. »Ich habe ihnen gestern nahegelegt, heute keinerlei Lärm zu verursachen. Nach den lauten Tagen sollte es doch möglich sein, wenigstens über die Feiertage etwas stiller zu sein.« Sie seufzte, wie mir schien, resigniert.
»Und die Mädchen?« Ich konnte mir nicht vorstellen, die elfjährigen Zwillinge Alpha und Beta könnten heute den Mund halten, nachdem sie seit ihrem Eintreffen täglich mindestens einmal für einen Riesenradau gesorgt hatten. Auch ihre schon etwas älteren Cousins hatten ein lautes Organ.
Oma schmunzelte. »Hast du schon einmal meine Hausapotheke gesehen? Dort gibt es für jedes Wehwehchen eine Pille oder ein Wässerchen.«
Diese Apotheke kannte ich. Sie war grenzwertig. Der weiße Kasten mit dem roten Kreuz hing vor der Kellertür, für alle sichtbar, hatte ein Schloss. »Du willst nicht sagen, du hast ihnen etwas aus deinem Giftschrank verabreicht.«
»Die heiße Ovomaltine haben sie gestern, ohne zu meckern, ausgetrunken.« Oma warf mir einen neckischen Blick zu. Ihre Lachfältchen verästelten sich niedlich auf ihrem Gesicht.
Ich drückte den Griff nieder und stieß schmunzelnd die Tür auf. Wenn Oma etwas sagte, durfte man es nicht immer für bare Münze nehmen.
In der Küche wurde es augenblicklich ruhig. Was erst noch geraschelt und getuschelt hatte, erstarb. An dem langen Tisch saß die gesamte Gesellschaft. Ich hätte mich täuschen müssen, jemanden von denen nicht zu sehen, die während der Adventszeit hier eingetroffen waren. Oma hatte sich eine Sitzordnung gewünscht, die man offensichtlich einhielt. Lediglich der Platz am Tischende, derjenige gegenüber und der Stuhl neben meiner Mutter waren leer. Vis-à-vis von Oma war seit zwölf Jahren an jedem Heiligabend und an Weihnachten ein Gedeck aufgetischt, welches nach dem Fest ungebraucht abgeräumt wurde. Dort saß, in der phantasiereichen Vorstellung aller Anwesenden, Maxim Anthamatten von Winterstern, der Nichterzeuger von Omas drei Töchtern und zwei Söhnen. Ein Konterfei neben dem Platzteller bezeugte seine geistige Präsenz.
Oma setzte sich unter meinem Geleit auf ihren pompösen Sessel, den einzigen in der Küche. Ich wartete, bis sie sich die Serviette auf den Schoß gelegt und Arthur sowie Elvira das Zeichen für den Service gegeben hatte. Vierundzwanzig Augenpaare waren auf Oma gerichtet, nachdem die Bediensteten sich abgewandt hatten.
Ich ließ mich neben meiner Mutter links und rechts meines Vaters nieder. Dass ich seit Jahren eine Art Schutz- und Schallmauer zwischen den beiden Elternteilen verkörperte, störte mich nicht mehr. Sie gingen seit geraumer Zeit getrennte Wege und machten nur während der Feiertage bei Oma auf glückliche Eheleute. Oma war darüber ahnungslos. Mein Vater war ihr Lieblingssohn, und er war der Meinung, sie würde es ihm nie verzeihen, nähme er das Wort Scheidung bloß in den Mund. »Weißt du«, hatte mein Dad mir anvertraut, »Oma lebt nicht mehr so lange. Sie soll an ihrem Lebensabend nicht enttäuscht werden.« Dass sie vielleicht hundert Jahre alt werden würde, behielt ich für mich.
»So dann«, sagte Oma. »Ich wünsche euch allen ein wunderbares Christfest. Traditionsgemäß beginnen wir den Heiligabend mit einem ausgiebigen Frühstück. Das weckt die Lebensgeister.« Sie sah ihre Zwillingsurenkelinnen an, die still vor sich hin brüteten. Ich vermutete, ihnen hatte die gepanschte Ovomaltine nicht so gutgetan, wie Oma behauptet hatte. Noch immer befanden sie sich in einer Art Delirium. »Über den Mittag gibt’s das traditionelle Schneemannbauen vor dem Haus. In der vergangenen Woche beschenkte uns Frau Holle im Überfluss. Wir haben also genug Material.«
»Es könnte noch mehr Schnee geben«, gab mein Dad zu bedenken. »Schon ziehen Wolken wieder auf.«
»Ach, Frank, den nehmen wir auch noch«, sagte Oma leichthin und griff nach einem Brötchen. »Schön, sind die Winter wieder richtige Winter, so wie früher, als man selbst im Unterland schlitteln konnte.« Sie seufzte ein wenig, als erinnerte sie sich an ihre eigene Kindheit. »Nach dem Aufenthalt im Freien werden wir die letzten Vorbereitungen für heute Abend treffen. Die Geschenke könnt ihr schon mal unter den Baum im Wohnzimmer legen. Ha, wenn es denn welche gibt.« Sie sah wiederum kurz zu ihren Urenkelinnen. »Das Mahl nehmen wir vor der Bescherung im Salon ein.«
Ich lächelte. Oma überließ nichts dem Zufall. Sie war eine perfekte, wenn auch chaotische Gastgeberin.
Ihr rotes Kleid gab Anlass für jedwede Bemerkung. Meine Mam fand es wegen der Knallfarbe übertrieben, und Tante Martina pflichtete ihr mit der Bemerkung, der viel zu tiefe Ausschnitt sei überdies eine Zumutung, ausnahmsweise bei. Ansonsten benahmen sich die beiden Frauen wie neidische Zicken. Keine gönnte der anderen ein wenig Glück.
Nach dem Frühstück, welches sich über zwei Stunden dahingezogen hatte, rief Arthur zum Schneemannbauen auf. Meine männliche Verwandtschaft dislozierte mit Schaufeln, Rechen und Eimern ausgerüstet nach draußen. Unter den fünf Familien samt Anhang galt es, den originellsten Schneemann zu bauen. Frauen und Mädchen bekamen den Auftrag für die Feinarbeit, was Oma so beschlossen hatte. Während zweier Stunden schippte man Schnee in die Eimer, trug diese zu den zugeteilten Plätzen und baute Unter- sowie Mittelteil und Kopf auf. Mit Schaufel, Rechen und Wasser wurden die Schneemänner in Form gebracht, Arme angesetzt und zuletzt die Utensilien angebracht. Da weder mein Dad noch meine Mam mit viel Phantasie gesegnet waren, hatte ich allein keine Lust, aus dem Schneehaufen ein Kunstwerk zu fertigen. Dass wir im Gegensatz zu Tante Barbara mit ihrem siebenköpfigen Anhang nur zu dritt waren, war noch nie zum Thema geworden, aber ein großer Nachteil. Ich war nicht bei der Sache und bestaunte lieber die fertigen Figuren der anderen. Oma befand, zusammen mit ihren drei Bediensteten, die Gruppe vier, die Familie von Onkel Oliver, habe den phantasievollsten Schneemann kreiert. Kein Wunder: Eigentlich hatten sie eine Schneefrau gefertigt, mit all ihren weiblichen Merkmalen. Typisch Mann, wieder einmal. Julie hatte gegen ihre drei Typen nichts auszurichten, und ich fand ihr Kunstwerk sexistisch.
Der Nachmittag zog sich dahin mit Schneeballschlachten, Glühweintrinken und Small Talk. Um vier Uhr war der Himmel bedeckt, und Wind kam auf. Was mit dem Morgenrot so schön begonnen hatte, endete mit dichten Flocken, die eine auberginefarbene Wand vor sich herschoben. Die Schneemänner verschwanden allmählich, auch die Schneefrau tauchte unter. Ab und zu blitzte ein Knopf, eine Karotte oder ein Taschentuch aus dem weißen Puder.
»Ich hab’s ja gesagt.« Dad brüstete sich mit seiner Wettervorhersage, während Annika ihren Töchtern Alpha und Beta befahl, sich für das Weihnachtsessen bereit zu machen. »Zankt euch nicht beim Baden. Ich kenne euch. Letzthin hat K-I-1 K-I-2 fast ertränkt.«
»Für die, die es nicht wissen«, informierte Cousin Tobias. »K-I steht für ›K-i-nd‹, nicht dass jemand auf falsche Gedanken kommt.«
»Ich bin ganz deiner Meinung«, flachste Martina. »Künstlich sind sie bloß erzeugt worden, aber mit der Intelligenz ist es weit her.«
Immer diese Sticheleien. Ich hörte nicht mehr hin. Ich suchte Oma und fand sie nicht auf Anhieb. Weder war sie in ihren Gemächern noch im Wohnzimmer, weder in der Küche noch im Keller, wo ich sie bei der Wahl des Weins vermutete. Auf der Treppe ins Erdgeschoss begegnete mir Arthur.
»Gut, treffe ich Sie. Haben Sie zufällig meine Großmutter gesehen?« Mit Arthur war hier jedermann per Sie. Oma meinte, es zeuge von Anstand und Respekt, spreche man die Hausangestellten in der Höflichkeitsform an.
»Ach, Miss Anna.«
Miss. Ich lächelte. Arthur hatte halt auch so seine Eigenheiten.
»Vorher war sie im Salon und hat den Weihnachtsbaum und die vielen Geschenke begutachtet und sich wahrscheinlich ihre Gedanken gemacht. Mit Verlaub, es werden jährlich mehr. Unter uns gesagt, Madame Anthamatten regt sich immer über die Berge von Geschenkpapier auf.« Arthur machte mit den Händen eine ausschweifende Bewegung. »In meinem Alter muss man nicht mehr alles verstehen. Aber früher gingen wir sparsamer damit um und verwendeten das Papier ein Jahr darauf wieder.« Er hüstelte vor sich hin. »So, ich sollte nachschauen, ob draußen alles in Ordnung ist.«
Ich sah ihm nach. Seit letztem Jahr war er gebrechlicher geworden. Er ging gebeugter, und wenn er müde war, schlurfte er, als würde es ihn anstrengen, die Füße vom Boden zu heben. Er hatte seinen Stolz, was aber seine Körperhaltung widerlegte.
Ich ging in den Salon, der das Ausmaß eines Saales hatte. Darin standen fünf runde Tische mit je sechs Stühlen. Sie waren festlich aufgedeckt. Mit weißen Tischtüchern und fünfarmigen Kerzenleuchtern, Silberbesteck und erlesenem Porzellan sowie Kristallgläsern von seltener Eleganz. Vom fast drei Meter hohen Weihnachtsbaum ging ein besonderer Duft aus. Arthur hatte wegen der Geschenke übertrieben. So viele, wie er behauptete, waren es nicht. Im Gegensatz zu anderen Jahren sah man die geschmückte Tanne gut. Ich konnte mich gerade noch beherrschen, meine Nase nicht in die Geschenkanhänger zu stecken. Ich umrundete den Baum und schritt zu einem der großzügigen Sprossenfenster. Draußen schneite es stärker als zuvor. Dicke Schneeflocken wirbelten durch die Luft, und matt schimmerten kleine Lichtpunkte durch sie hindurch, als fiele ein Vorhang aus Gold auf die Erde.
Von Oma keine Spur. Vielleicht befand sie sich doch in ihrem Zimmer, hatte sich ein wenig zurückgezogen. In ihrem Alter war es legitim.
Aber ich kannte sie nicht von dieser Seite. Ich begab mich vom Salon zur Küche, wo Pierre mit den Vorbereitungen für das Dinner beschäftigt war. Es roch angenehm nach angebratenem Fleisch. Was immer der Koch kredenzte, die Vergangenheit hatte es gezeigt: Seine Menüs ließen keine Wünsche offen. Ich getraute mich fast nicht, ihn bei seiner Arbeit zu stören, wandte mich nach langem Überlegen trotzdem an ihn. Er rührte in der Pfanne. Ich sah ihm über die Schulter. »Oh, eine Sauce?«
Er sah kurz auf. »Anna, wie schön, dich zu sehen. Eine Rotweinreduktion, um die Fruchtnoten des Weins abzuschwächen.« Er lächelte mich an.« Was führt dich zu mir?« Pierre bekochte meine Oma, seit sie Witwe geworden war. Ich kannte ihn seit meinem dreizehnten Lebensjahr. Schon als Kind hatte ich mich zu ihm in die Küche geschlichen. Pierre hatte mich die Suppen schmecken lassen, die feinen Dessert-Cremen und süßen Kreationen, von Kuchen bis Pralinen. Bevor er ins Haus Winterstern gekommen war, hatte er in Fünf-Sterne-Hotels rund um die Welt gearbeitet. Ein körperliches Leiden hatte ihn zur Ruhe gezwungen. Der Job bei Oma war exakt auf ihn zugeschnitten. Frühstück, Mittag- und Abendessen waren keine große Herausforderung, und wenn mehrere Gäste erwartet wurden, ging ihm Elvira zur Hand. Das war im Dezember und über die Feiertage bis zum 1. Januar der Fall.
»Ich suche meine Oma.« Ich griff nach einem sauberen Teelöffel neben dem Herd und zeigte auf die Pfanne, in der der Sud köchelte. »Darf ich?«
»Vor etwa einer halben Stunde hat Madame Anthamatten das Gleiche gefragt.«
»Sie war hier?«
»Nur kurz.«
»Hat sie gesagt, wohin sie geht?« Ich tauchte den Löffel in den Sud.
»Nein, hat sie nicht. Aber sie trug ein Geschenk mit sich, wollte es vielleicht unter den Weihnachtsbaum legen.«
»Wie sah das Geschenk aus?« Ich sagte nicht, dass ich soeben aus dieser Richtung gekommen war. Oma hatte ich nicht angetroffen. Aber in einer halben Stunde konnte sie überall gewesen sein.
»Der Form zu urteilen nach war es eine rechteckige Schachtel.«
»Wie war sie?« Ich schöpfte ein wenig von der Reduktion auf den Löffel und kostete. »Hm … Sie haben sich wieder einmal übertroffen.«
»Oma?«
Ich nickte.
»Du fragst Sachen.« Pierre schmunzelte. »Schön, wenn es dir schmeckt … Madame Anthamatten schien gut gelaunt. Aber etwas anderes kennt man nicht von ihr. Sie ist meistens, wenn nicht immer, gut drauf.«
Gut gelaunt und zynisch, ging mir durch den Kopf. Oma behandelte ihr Hauspersonal besser als ihre Familienmitglieder. Das hatte natürlich einen Grund.
»Okay, ich lasse Sie dann wieder.« Ich warf einen Blick zu Elvira, die ein Kuchenblech in den Backofen schob. Ich hatte hier nichts mehr verloren. »Ich freue mich auf das Dinner«, sagte ich beim Verlassen der Küche, was nur Pierre mit einem Augenzwinkern quittierte.
Aus der Bibliothek, die sich neben dem Salon befand, erklang Klaviermusik. Ich folgte den Tönen und traf auf meine Cousine Laura und ihren Freund Tim. Sie saßen in trauter Zweisamkeit am Flügel und spielten vierhändig »Jingle Bells«. Ich sah ihnen an, wie verliebt sie waren. Einmal mehr erinnerte ich mich, Tim vor einem Jahr nicht gesehen zu haben. Laura war allein zum Fest angereist, nachdem sie sich von ihrem Langzeitfreund getrennt hatte.
»Wow, das ist wunderbar.« Ich schenkte Laura meine volle Aufmerksamkeit. »Ich wusste nicht, dass du Klavier spielst.«
»Ach, meine Liebe, das wusste ich vor einem Jahr auch nicht.« Sie nahm ihre Finger von den Tasten. »Tim hat es mir beigebracht, also nur dieses eine Stück. Wir üben noch ein wenig, damit wir es heute Abend Oma vortragen können.«
»Apropos: Weißt du zufällig, wo sie ist?«
»Keine Ahnung.« Laura sah auf ihre Armbanduhr. »Es ist halb sechs. Sie wird sich für ihren Auftritt bereit machen.« Sie wandte sich an Tim. »Großmutter ist eine große Nummer, wenn es darum geht, sich in Szene zu setzen.«
Tim erwiderte nichts. Es hätte mich gewundert. In den dreizehn Tagen seiner Anwesenheit war er noch immer ein Fremdkörper, was ihn der Rest der Familie unverblümt wissen ließ. Tim war anständig genug, sich im Hintergrund zu halten. Aber meistens verbrachte das frisch verliebte Paar seine Zeit auf dem Zimmer.
»Ich will euch weiter nicht stören«, sagte ich an Tim gewandt. Irgendwie tat mir der scheue Mann etwas leid. Vielleicht wunderte er sich gerade, worauf er sich mit unserer Familie eingelassen hatte.
Ich drehte mich zu der Tür um und erschrak. Arthur stand dort, kreideweiß im Gesicht und außer Atem.
»Arthur?« Ich ging auf ihn zu, nahm ihn beim Arm, spürte, wie er zitterte. »Ist Ihnen nicht gut?«
Er brachte kein Wort heraus.
»Was ist passiert?« Ich versuchte, an ihm vorbei in den Saal zu schauen, und bemerkte erst jetzt, Arthur trug seinen Wintermantel, die Haare waren nass und die Schuhe mit Schneeresten bedeckt, die sich in der Wärme auflösten und kleine Pfützen auf dem Parkettboden hinterließen. Kleine rote Pfützen. »Waren Sie draußen?«
Natürlich war er vor dem Haus gewesen. Seit zwei Stunden pfiff der Wind wieder um die Ecken und durch die undichten Ritzen bei den Fensterrahmen. Der Schneesturm von vergangener Nacht war zurückgekehrt, er tobte schlimmer.
»Madame Anthamatten …« Arthurs Augen waren weit aufgerissen. In ihnen spiegelten sich Angst und Schrecken. »Sie liegt im Schnee.« Er wies in Richtung Entrée und Haupteingang. »Alles ist rot, alles ist voller Blut, und sie atmet nicht mehr.«
Laura und Tim schossen gleichzeitig von ihren Stühlen auf. »Tim, jetzt bist du dran.« Laura warf mir einen verstörten Blick zu. »Mein Verlobter ist Arzt am Unispital in Zürich. Das ist auch der Grund, weshalb er morgen wieder abreisen muss. Überall herrscht Personalmangel.«
Ich fand keine Zeit, Lauras Bemerkung zu hinterfragen. Ich lief an Arthur vorbei durch den Salon, wo Alpha und Beta die Geschenke gierig betrachteten und die Welt um sich vergessen hatten. Ich rannte durch das Entrée, riss die Tür auf den Vorplatz bis zum Anschlag auf und wurde augenblicklich von einer Böe erfasst. Es stellte mir fast den Schnauf ab. Millionen von Eiskristallen schleuderten auf mein Gesicht.
Der Schein der Laterne unterhalb der zwei Stufen, die zum Eingang führten, kämpfte gegen eine Wand von Schneeflocken und verkümmerte mit jedem Meter mehr, den ich durch den Schnee stakste. An der Grenze zur Dunkelheit erkannte ich schemenhaft meine Mam und Onkel Oliver. Sie beugten sich über einen Körper, den ich aufgrund des Niederschlags nicht gleich erkannte.
Ich spürte Mams Blick auf mir. Ich ging in die Knie, stieß Mam zur Seite. »Was ist geschehen?«
Mam schluchzte auf, derweil Onkel Oliver versuchte, mich von ihr wegzuzerren.
»Lass mich los!«, schrie ich ihn an und betastete den leblosen Körper im Schnee. »Hat jemand eine Taschenlampe?« Ich war verzweifelt.
Laura erreichte uns mit ihrem Handy. Sie hatte die Lampe eingeschaltet, leuchtete jetzt an meiner Mam vorbei auf den Boden, wobei das ganze Ausmaß des Dramas ersichtlich wurde.
Da lag sie, Oma, wie ein Embryo mit angezogenen Beinen und dicht an sich herangedrückten Armen. Neben ihrem Kopf sickerte Blut in den Schnee, die Menge vermochte ich wegen der grotesken Lage nicht zu sehen. Ich ergriff ihre eine Hand. Sie war eiskalt.
Tim kniete an meine Seite, bemerkte wohl das Gleiche wie ich, fuhr mit dem Finger an Omas Hals, ertastete ihren Puls. »Da ist keiner mehr«, flüsterte er.
Ich sackte vornüber. Ich spürte die Kälte des Schnees. Mein Hals verengte sich, und ich bekam kaum Luft. Alles, was sich in meinem Magen befand, drängte nach außen. Ich schaffte es gerade noch, mich zu erheben und zwei Schritte zur Seite zu treten, bevor ich mich übergab.
Meine Großmutter, Clothilde Anthamatten von Winterstern, war tot.
23. Dezember
Wolfgang und der letzte Zug aus Zermatt
Wolfgang Meier schaffte es mit Müh und Not, vom Trittbrett des Zugs über den Bahnsteig zu waten. Nach jedem Schritt fiel er einen halben zurück und fluchte. Er war demoralisiert. Schnee und Sturm verunmöglichten ein zügiges Vorwärtskommen. Zu allem Übel hatte der Zug abrupt anhalten müssen, weil eine entwurzelte umgestürzte Tanne die Gleise unmittelbar bei der Station Riffelalp blockierte. Wer weiterreisen wollte, musste zwangsläufig den Zug verlassen. Die späten Gäste standen dicht gedrängt unter dem Dach der Station und warteten auf einen Ersatztransport. Der direkte Weg von der Station Riffelalp zu den Hotels und weiter zum Haus Winterstern verschwand unter einer Unmenge von Schnee. Drei Motorschlitten standen bereit, zu wenige, um alle Gäste auf einmal zu den Unterkünften zu führen.
Wolfgang klemmte den Koffer zwischen die Beine, krempelte den Kragen an seinem Mantel hoch und hauchte in die vor Kälte klammen Hände. Die Schneeflocken in seinem Haar lösten sich auf und rannen über das Gesicht. Himmel, warum musste seine Schwester auch so abgelegen wohnen? Bis zum Resort Riffelalp würde man ihn mit einem Ski-Doo mitnehmen können, hatte ein Bahnbegleiter gesagt, weiter müsse er zu Fuß gehen oder im Hotel übernachten. Da das Hotel jedoch wissentlich ausgebucht und kein freies Bett mehr übrig sei, müsse er sehen, wie er die Nacht verbringe.
In den letzten Jahren hatte es in keinem Winter so viel Schnee auf einmal gegeben wie heuer. Das Wetter spielte verrückt. Am Morgen war eine Lawine niedergegangen und hatte Teile der Strecke zwischen Randa und Zermatt verschüttet. Am Mittag hatte Wolfgang einen befreundeten Skilehrer bestellt, der ihn, in seinem Jeep mit Schneeketten, bis Zermatt brachte. Auf die Gornergratbahn hatte er in der Folge vier Stunden warten müssen. Ach, wäre er doch nur zu Hause geblieben. Mit seinen achtzig Jahren war er nicht mehr so agil wie früher. Aber das verstand seine Schwester nicht. Clothilde war zwei Jahre älter als er und in der Reihe zuvorderst gestanden, als der liebe Gott die Energien verteilt hatte. Energien, die Wolfgang in seinem ganzen bisherigen Leben nie besessen hatte. Bereits als kleines Mädchen hatte Clothilde die Marschrichtung angegeben und ihren jüngeren Bruder wann immer möglich zur Schnecke gemacht.
»Sind Sie Herr Meier?«, fragte jemand neben ihm. Ein mit einer Daunenjacke ausgerüsteter Mann stupste ihn am Arm.
»Wer will das wissen?« Eigentlich war es Wolfgang egal. Hauptsache, er kam noch vor dem Eindunkeln zum Haus Winterstern. Vor ihm stand Clothildes Lakai. »Ach, Butler Arthur. Fast hätte ich Sie nicht wiedererkannt.« Er reichte ihm die halb verfrorene Hand zum Gruß. »Sie schickt der Himmel.« Er räusperte sich. »Oder meine Schwester?«
Arthur schüttelte Schnee von der Kapuze und überging die Frage geflissentlich. »Ich bin mit dem Pferdeschlitten hier. Ich musste den Weg über das offene Gelände nehmen. Die Lage gestaltet sich äußerst prekär. Wir müssen uns beeilen. Die Lawinengefahr nimmt stündlich zu. Haben Sie viel Gepäck?«
»Den Ballast hier.« Wolfgang bückte sich und nahm einen altertümlichen Stoffkoffer mit Beschlägen auf. Diesen besaß er seit seinen Jugendjahren. Logos aus aller Herren Länder klebten auf dem Deckel. »Wo steht Ihr Schlitten?«
»Dort drüben neben der Ausschilderung. Bis zum Hotel Riffelalp nehme ich noch vier andere Gäste mit. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus.«
»Oh nein. Ich bin froh, wenn ich möglichst bald ans Ziel gelange; wie, ist mir so was von wurscht.« Wolfgang schleppte den Koffer über einen Platz, den man ob des vielen Schnees nicht mehr wirklich sah. Vor ihm tauchten zwei Pferde mit Scheuklappen auf. Dahinter zeichnete sich der Schlitten ab. Der Wind brauste ihm um die Ohren. Es war bitterkalt. »Darf ich mich auf den Bock setzen?«
»Nur zu, wenn Ihnen die Kälte nichts ausmacht.« Arthur wuchtete den Koffer neben die Sitzfläche. »Eine Wolldecke liegt bereit. Packen Sie sich warm ein. Wir werden durch die Hölle fahren.«
Daran zweifelte Wolfgang keinen Moment. Seit er aus dem Zug gestiegen war, schien der Sturm zugenommen zu haben. Die Schneeflocken fühlten sich wie Geschosse an, die gegen sein Gesicht peitschten. Er brauchte zwei Anläufe, bis er auf dem Schlitten und dem Sitz war. Er wickelte sich in die Wolldecke ein. Der Stationsunterstand versank in einem diesigen Licht, der Himmel über ihm war verschwunden.
Minuten verstrichen, ehe sich Arthur neben Wolfgang setzte und die Zügel in die Hand nahm. »Wir fahren, bevor die Schneemobile unterwegs sind. Wir müssen uns beeilen.«
Wolfgang sah nach hinten, wo die vier Mitfahrer sich in Schaffelle gekuschelt hatten. Auf ihren Gesichtern zeichnete sich pures Entsetzen ab. Wolfgang winkte ihnen zu und versuchte, ihnen durch eine lockere Geste die Angst zu nehmen. Dabei fürchtete er sich selbst am allermeisten. Als sich der Schlitten in Bewegung setzte, schloss er einen Moment die Augen und harrte der Dinge. Schlimmer konnte es nicht werden. Er hatte sein Schicksal in Arthurs Hände gelegt.
»Wie schaffen es die Pferde, den Weg durch den Schneesturm zu finden«, fragte er, »wenn die Bahn es nicht mal mehr bewerkstelligt?«
»Auf die Pferde ist Verlass«, sagte Arthur und zwickte mit der Longierpeitsche auf deren Rücken. »Hüa-hü! Der Weg hierher bedurfte größter Aufmerksamkeit. Wenn der Schlitten zu schnell ist, rutscht er ab. Das war auch der Grund, weshalb ich nicht früher da sein konnte.«
Die Kufen glitten durch und über den Schnee, während der Wind ununterbrochen Schneeflocken vom Himmel spie. Wolfgang folgte mit seinem Blick der schmalen Straße, die ins Nirgendwo führte. Die Sicht auf die Bäume nahm ab. Die Laternen am Rand wiesen als einzige Orientierungshilfe den Pfad. »Wie geht es meiner Schwester?«
»Sie kann es kaum erwarten, bis der Letzte ihrer Gäste im Haus Winterstern eintrifft.«
Das war nicht die Antwort auf seine Frage. »Bin ich der Letzte?«
»Ja.« Arthur sah zu ihm herüber. »Den Letzten beißen die Hunde.«
Wolfgang nickte ein. Er hatte die Kapuze mit dem Pelz bis über die Stirn gezogen. Er träumte von weißen Sandstränden und Sonnenuntergängen am Meer. Die Reise von Montreux bis Zermatt hatte ihn ermüdet.
Nach einem heftigen Ruck war er hellwach. »Was war das?«
»Keine Bange, wahrscheinlich ein Stein. Von denen gibt es hier einige, unter dem Schnee sieht man sie nicht.« Arthur knurrte etwas vor sich hin.
Wolfgang glaubte, ihm seine Konzentration anzusehen. Er wies den Hang nach oben, ohne konkret etwas auszumachen. »Sind die Schneefahrzeuge nicht unterwegs?«
»Sie meinen die Pistenbullys?« Er wartete eine Erwiderung nicht ab. »Diese sind weiter oben im Einsatz.«
»Wäre etwas sicherer, wenn die Gäste damit transportiert würden.« Wolfgang war angst und bang.
»Nichts gegen unsere Pferde. Zudem ist der Weg zu schmal.«
Der Schlitten wurde langsamer. Sie erreichten das Chaletdorf Riffelalp, welches mit Tausenden von Lämpchen weihnachtlich geschmückt war. Zwei ebenso beleuchtete Tannen verschwanden fast gänzlich im Schnee. Arthur brachte den Schlitten zum Stehen, arretierte die Bremse, stieg vom Bock und half den Hotelgästen auf den Boden. Bis Leute und Gepäck abgeladen waren, dauerte es einige Minuten, in denen Wolfgang zunehmend nervöser wurde. Noch mussten Pferde und Schlitten an den abgelegenen Ort gelangen. Langsam zweifelte Wolfgang an der Machbarkeit. Er schloss wieder die Augen und versuchte zu schlafen.
Vage nahm er Arthurs Rückkehr auf den Schlitten wahr, sein lautes »Hüa-hü«, den Laut der Peitsche und das Dröhnen des Sturms. Es gab Situationen, da musste man sich den Gegebenheiten anpassen. »Es kommt, wie’s kommt«, hätte Clothilde gesagt.
Sie passierten offenes Gelände. Die Pferde stapften schnaufend durch den Schnee, während es den Schlitten Richtung Abhang zog. »In vergangener Nacht ging eine Lawine nieder«, sagte Arthur schwer atmend. »Es ist fast ausgeschlossen, dass innerhalb von zwanzig Stunden eine zweite runterkommt. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel.«
Wolfgang musste sich anstrengen, um etwas zu sehen. Noch immer wirbelten Schneeflocken durch die Luft. Durch den dichten weißen Vorhang zeichneten sich die mit Lämpchen versehenen Umrisse des Herrschaftshauses Winterstern ab. Den alten Kasten hatte Wolfgang nie gemocht. Zu protzig, zu kalt, irgendwie auch zu unpersönlich. Er zog romantische Chalets dem Luxus hier vor. Aber er hatte Clothilde nicht enttäuschen wollen und war im letzten Moment ihrer Einladung gefolgt. Geschwisterliebe musste man pflegen.
Der Schneesturm verwandelte die Landschaft um das Haus wie in ein gespenstisches Gemälde. Clothilde stand mit Anna beim Eingang. Wolfgang atmete auf. Wie durch ein Wunder hatte Arthur ihn als den letzten Gast des Abends hierhergefahren, bei diesem Wetter eine wahre Leistung.
»Brr!« Der Schlitten kam zum Stehen, die Pferde hoben und senkten ihre Köpfe, schnaubten Nebel in die Luft. »Eine Stunde später«, sagte Arthur, »und wir wären von der Riffelalp nicht mehr hierhergelangt. Gütiger Gott, was für ein Wintersturm. Die Schienen sind nach der Bahnstation nicht mehr befahrbar.«
Clothilde kämpfte sich gegen die Schneewand und die Böen auf den Schlitten zu. »Willkommen, mein liebes Bruderherz. Ich bin froh, hast du es auch in diesem Jahr zu mir geschafft.« Sie streckte ihre Arme aus und empfing ihn herzlich, fiel ihm um den Hals und küsste ihn auf die Wangen. »Somit wären wir komplett.«
Anna grüßte ihn, trug seinen Koffer ins Haus, stellte ihn neben der Treppe zum oberen Stockwerk ab und musterte ihn schweigend.
Clothilde dagegen sprach aus, was sie dachte. »Seit dem letzten Jahr hast du dich kaum verändert. Du bist der verbitterte Alte geblieben.« Sie lächelte dabei. »Deine Art ist nicht greifbar, du bist ein Globetrotter, ein Mann, der von der Hand in den Mund lebt. Aus dem Reichtum hast du dir nie etwas gemacht, oder du hast es mich nicht wissen lassen.«
Wolfgang musste sich zusammenreißen, um seiner Schwester gegenüber nicht ausfällig zu werden. Ihr Zynismus in Ehren, aber manchmal ging sie zu weit. »Als ich jung war, habe ich meine Brötchen als Handlanger verdient, mal einen Job da, mal eine minderwertige Arbeit dort. Ich habe angepackt, wo andere sich weigerten. Hoch hinausgekommen bin ich nicht. Ja, das kannst du mir vorwerfen. Ich bin aber in Südamerika gewesen, in Guatemala, in Kanada und auf Spitzbergen, habe dort mit den Einheimischen gelebt, während du kaum über den Horizont geschaut hast.«
Clothilde lachte. »Und du hast dich in Russland verliebt, verlobt, aber nicht geheiratet.«
»Ich bin mit der Schwester meiner Lebenspartnerin getürmt.« Ob er Kinder hinterlassen hatte, war ihm nicht bekannt, er konnte es sich aber durchwegs vorstellen.
»Unsere Verwandten befinden sich alle im Salon«, sagte Clothilde. »Wir wollten gerade essen. Das Zimmer muss ich dir nicht zeigen. Du weißt, wo du schläfst.«
Er nickte schweigend. Sein Zimmer. Wie immer war seine Schwester konsequent. Es lag gegen Südosten und beglückte ihn jeweils mit unvergesslichen Sonnenaufgängen.
Anna öffnete die Tür zum Salon. Aller Augen waren auf Wolfgang gerichtet. »Das ist Wolfgang«, sagte sie. »Vorstellen muss ich ihn euch nicht. Viele unter euch kennen ihn länger als ich.« Sie führte ihn zum Tisch, und er fühlte sich zum ersten Mal an diesem Tag geschmeichelt. Er nahm neben Jonas Platz.
»Sei nett zu ihm«, sagte Anna zu ihrem Cousin, dass auch Wolfgang es hörte.
Jonas sah sie verächtlich an. »Ob er weiß, dass er einmal erben wird?«
»Was soll denn diese Bemerkung, Jonas?« Anna zwang sich zu einem Lächeln, weil sie Wolfgangs Blick auf sich spürte.
»Ach, nichts.« Jonas boxte ihn in die Seite. »Hey, Wolfgang, auf einen schönen Abend. War nicht so gemeint. Du weißt, Sarkasmus liegt in der Familie.«
Auf den Tischen standen Caquelons und jede Menge Gemüse, Dips und Platten voll rohem, zart geschnittenem Fleisch. Clothilde hatte zum traditionellen Fondue chinoise geladen, damit auch ihr Personal mitessen und mitfeiern konnte. Das Mise en Place hatte man Stunden vorher gemacht.
Die Stimmung war ausgelassen, mit den üblichen Diskussionen, was bei einer achtundzwanzigköpfigen Gesellschaft nicht zu vermeiden war. Wolfgang kam seine Schwerhörigkeit zugute. Er widmete sich den kulinarischen Köstlichkeiten, trank über den Durst viel Wein und blendete alles aus, was um ihn herum geschah. Ja, ja, dachte er, die Letzten werden die Ersten sein.
Heiligabend
im Haus Winterstern
Mittlerweile hatte sich die ganze Verwandtschaft um die tote Oma versammelt. Jedermann glotzte, niemand getraute sich, etwas zu sagen. Meine Familie war in Schock und Eis erstarrt. Lediglich Tim schien klar denken zu können. Er schlug vor, Oma ins Haus zu bringen und dort aufzubahren. Er fungierte als Arzt, bekam erst jetzt die Aufmerksamkeit, die ihm seit seiner Ankunft zugestanden hätte. Tim, der bis heute von niemandem richtig wahrgenommen worden war, stand plötzlich im Mittelpunkt. Er würde die Fragen beantworten und alles erklären können. Hoffte man.
»Woran ist sie denn gestorben?« Tante Martina hatte sich ein wenig gefasst. Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, wobei der schwarze Kajal zerfloss und sie wie eine Eule aussehen ließ.
»Das kann ich im Moment nicht sagen.« Tim sah in die Runde. »Es könnte ein Schlaganfall gewesen sein, ein Herzinfarkt, oder sie ist unglücklich gestürzt, liegen geblieben und verfroren. Mich irritiert im Moment das viele Blut. Am besten, wir bringen ihren Körper ins Haus.«
»Stopp«, fuhr ich Tim an. »Was, wenn sie umgebracht wurde?«
»Du glaubst, da hat jemand nachgeholfen?« Tim sah mich konsterniert an, während Schneeflocken auf sein Gesicht rieselten und an seinem Dreitagebart hängen blieben.
»Seht ihr das Blut im Schnee?« Ich wies auf die dunklen Flecke, war mir nicht sicher, ob es sich dabei um Blut handelte oder Oma womöglich etwas ausgeleert hatte.
»… so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz«, zitierte Fidelio den magischen Spiegel aus dem Märchen »Schneewittchen« der Gebrüder Grimm.
»Untersteh dich«, fauchte Tante Martina. »Wie kannst du über den Hinschied meiner Mutter Witze reißen?«
Ein Raunen ging durch die Anwesenden. Man sah zuerst Fidelio, dann mich an, als erwartete man von mir eine Bemerkung.
»Vielleicht waren es Außerirdische«, fuhr Fidelio unbekümmert fort, »welche die Erdbewohner mit einer grotesken Tat aus dem Gleichgewicht bringen. Es hat im Augenblick die gleiche Wirkung wie ein intergalaktisches Ereignis, als würde der Mond aus der Umlaufbahn des blauen Planeten geschleudert.«
»Erfunden?«, fragte Tante Evamarie.
»Soeben gedichtet.« Fidelio griff sich in die Haare und wuschelte sie durcheinander.