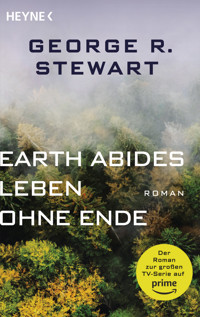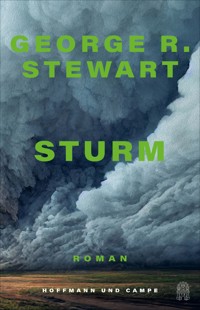
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kalifornien wird seit Monaten von einer verheerenden Dürre geplagt, als ein Schiff aus dem fernen westlichen Pazifik eine ungewöhnliche Messung meldet. Ein junger Meteorologe in San Francisco nimmt die Anomalie zur Kenntnis und tauft sie insgeheim Maria. Mit rasanter Geschwindigkeit wächst Maria zu einem gewaltigen Sturm heran, entwickelt ein Eigenleben und bahnt sich ihren Weg von der Pazifikküste in die Sierra Nevada und darüber hinaus. Meteorologen, Schneepflugfahrer, ein General, ein Liebespaar und eine unglückliche Eule verfolgen Marias zerstörerischen Weg durch die USA mit ebenso großer Sorge wie Faszination. Der Sturm fegt durch die Staaten, bringt lang ersehnten Regen, überflutet Täler, vergräbt ganze Bergketten im Schnee, und macht den Menschen unbestreitbar bewusst, wie sehr das Wetter ihr Leben bestimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
George R. Stewart
Sturm
Roman
Jürgen Brôcan | Roberta Harms
Die Figuren dieses Buchs – einschließlich »Maria« – sind fiktiv. Auch wenn eine Titulierung oder Behörde, wie im Fall des »Chefs« und des »Lastverteilers«, an bestimmte Personen zu erinnern scheint, ist eine Darstellung aktueller Amtsinhaber vermieden worden. Der Roman spielt zwar überwiegend in Kalifornien, seine Handlung ist jedoch keine Studie voller Lokalkolorit; aus Gründen der Vereinfachung wurden ein paar Veränderungen an den Schauplätzen vorgenommen.
In Dankbarkeit für großzügige Unterstützung
ist dieses Buch gewidmet:
California Division of Highways
California Division of Water Resources
California Highway Patrol
City of Berkeley Police Department
Pacific Gas and Electric Company
Pacific Telephone and Telegraph Company
Pan American Airways Company
Southern Pacific Company
Transcontinental & Western Air, Inc
United Air Lines
United States Coast Guard
United States Engineers
United States Weather Bureau
University of California
Western Pacific Railroad Company
Inhalt
Vorwort des Autors
»Wie kamen Sie dazu, Sturm zu schreiben?« Seit dem Tag, an dem das Buch erschienen ist, hat man mir diese Frage gestellt. Obwohl sie ein Kompliment für die Originalität des Themas und dessen Ausführung bedeutet, klingt sie doch allmählich eintönig, und ich habe sogar damit angefangen, das Leuchten im Auge des Fragenden zu erkennen, das ihr stets vorausgeht. Ich hätte wohl diese Neugier befriedigt und mir manchen Verdruss erspart, hätte ich sofort ein Vorwort geschrieben. Jetzt, da ich die Gelegenheit dazu habe, will ich diese Frage zu beantworten versuchen.
Selbstverständlich gibt es keine erschöpfende oder endgültige Erklärung. Kein Schriftsteller erinnert sich vermutlich an sämtliche Ursprünge seiner Einfälle oder kann sie vollständig benennen. Um jedoch auf einer bewussten Ebene zu bleiben, sollte ich zunächst erwähnen, dass ich fünfzehn Jahre lang am Hang der Beverley Hills gewohnt habe. Von dort hatte ich einen Blick nach Westen zur San Francisco Bay und durch das Golden Gate auf die Horizontlinie des Pazifiks. Auf diesem günstigen Aussichtsposten beobachtete ich, wie die Wintersturmfronten in ihrer ganzen Erhabenheit aus dem Westen hereinfegten. Kein aufmerksamer Betrachter lebt an einem solchen Ort, ohne ein Bewusstsein für Stürme zu entwickeln.
Noch konkreter gesagt: Im Winter 1937/38 wohnte ich in Mexiko. Die dortigen Zeitungen berichteten über einige der Stürme, die in Kalifornien tobten. Als ich auf Spanisch las, was in meinem Land passierte, war ich gleich doppelt beeindruckt von den dramatischen Qualitäten eines kalifornischen Sturms. Zweifellos kam mir damals die – allerdings noch vage – Idee zu einer Geschichte, die sich um dieses Thema dreht. Nach sattsam bekanntem Muster sollte sie ursprünglich die Erlebnisse etlicher Leute erzählen, die sich nicht oder nur lose kennen und zufällig mit demselben Ereignis zu kämpfen haben.
Nach meiner Rückkehr nach Kalifornien begann ich tatsächlich über Meteorologie zu schreiben und erkannte, dass noch mehr darin steckte. Ein Sturm als solcher besaß viele Eigenschaften eines Lebewesens. Ein Sturm konnte ein Protagonist, ja sogar die Hauptfigur sein. In Sir Napier Shaws vierbändigem Manual of Meteorology las ich gebannt, dass ein gewisser Meteorologe die Stürme als dermaßen personenhaft empfand, dass er ihnen Namen gegeben hatte.
Tatsächlich nahm der Roman damals jene Gestalt und Eigentümlichkeit an, die viele Leute später dazu veranlasste, mich über die Anfänge auszufragen. In früheren Büchern ähnlicher Art lag der Schwerpunkt eindeutig bei den menschlichen Charakteren; auf dem Zentrum, um das sie wirbelten, lag jedoch kein besonderer Akzent. In Sturm hingegen sollte »Maria« die alles bestimmende Figur sein. Mehr als jeder menschliche Protagonist, stärker vielleicht als sämtliche Protagonisten zusammen, sollte sie im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ihre Geburt, ihr Heranwachsen, ihre Erlebnisse und schließlich ihr Tod sollten der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte sein, während sich die verschiedenen Menschlein mit ihren Freuden und Leiden nur hier und dort isoliert am Rande befanden.
An dieser Stelle muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich nicht genauer werden kann. Da ich kein Tagebuch führe und meine Notizen nicht datiere, sehe ich mich ganz außerstande mitzuteilen, wann mir dieser wesentliche Einfall kam, geschweige denn, welche Lektüren, welche Gespräche oder welche Beobachtungen den Anstoß dafür gaben, dass er mir, wie bei solchen Ideen üblich, plötzlich in den Sinn schoss.
Sobald ich begriffen hatte, welchem Plan der Roman folgen sollte, war die Arbeit daran ebenso interessant wie strapaziös. Wenn ein heftiger Sturm losbrach, machte ich mich sofort auf den Weg: Ich fuhr hoch zum Pass oder mit der Highway-Patrouille über Land oder durchs überflutete Sacramento Valley. Ich redete mit den Männern, beobachtete sie bei ihren Tätigkeiten und fror, durchnässt und hungrig, so manches Mal mit ihnen gemeinsam. Die Briefe von Männern, die das Vorbild für Rick oder Johnny Martley hätten abgeben können, und ihre Kommentare, dass sie das Buch für authentisch hielten, gehörten später zu meinen nicht geringen Freuden.
Bei der erneuten Lektüre fallen mir heute etliche Dinge ein, die ich über das Buch sagen könnte, aber es besteht keine Notwendigkeit, den Leser am Gängelband zu führen. Wem die Ansichten etwas düster erscheinen, der möge sich daran erinnern, dass der Text zum größten Teil in jenen düsteren und schrecklichen Monaten von Dünkirchen und der Niederlage Frankreichs geschrieben wurde.
Noch eine Kleinigkeit: Obwohl es eigentlich keine besondere Rolle spielt, habe ich den Namen »Maria«, wenn ich an ihn dachte, stets auf die altmodische englische und amerikanische Weise ausgesprochen. Die weiche spanische Aussprache passt zu einigen Heldinnen, unsere Maria ist jedoch zu groß, als dass ein Mann sie umarmen könnte, und auch viel zu ungestüm. Man spreche den Namen also »Meraia« aus.
George R. Stewart, 1947
Jede Theorie über den Lauf von Ereignissen in der Natur beruht notwendigerweise auf einer Vereinfachung
der Phänomene und ist deshalb bis zu einem gewissen
Grade ein Märchen.
Sir Napier Shaw, Manual of Meteorology.
Erster Tag
1
Eingehüllt in den gasförmigen Schleier der Atmosphäre, zur Hälfte bedeckt mit einer Haut aus Wasser, die die Meere bildete, drehte sich die gewaltige Erdkugel um ihre Achse und wanderte unerbittlich auf ihrem Weg um die Sonne. In der steten Abfolge von Tag auf Nacht, Sommer auf Winter, Jahr um Jahr hatte die Erde Wärme von der Sonne empfangen und dieselbe Wärmemenge wieder an den Weltraum verloren. Diese Balance des Erdballs insgesamt galt nicht für dessen einzelne Teile. Der Äquatorialgürtel empfing in jedem Jahr viel mehr Wärme als er wieder abstrahlte, und die Polarregionen verloren viel mehr, als sie empfangen hatten. Trotzdem wurde der eine nicht immer heißer, während die anderen nicht gegen den absoluten Nullpunkt fielen. Durch einen gigantischen komplexen Kreislauf, in dem gleichzeitig die kosmischen Extreme gemäßigt wurden und das Gleichgewicht mit der Sonne aufrechterhalten, kühlten die Pole ständig die Tropen und wärmten die Tropen umgekehrt die Pole.
Bei diesem Prozess beförderten kalte Strömungen Eisberge in Richtung des Äquators, und warme Strömungen zogen polarwärts. Doch selbst diese gewaltigen Meeresflüsse trugen nur einen kleinen Teil zum notwendigen Ganzen bei.
Die Atmosphäre übernahm die Hauptarbeit bei diesem enormen Transportwesen, obwohl sie dünn und unbeträchtlich war im Vergleich mit der ungeheuer großen Erde. Innerhalb der Atmosphäre waren wichtigste Wärmeausgleicher die bedeutenden Winde – die Passate und Antipassate, die Monsune, die tropischen Hurrikane, die Ostwinde und (am bemerkenswertesten) die riesigen Wirbelstürme der gemäßigten Zonen, die in prächtigsten Erdprozessionen auf ihren gewundenen Pfaden unentwegt wandern, über Meere und über Kontinente, von Sonnenuntergang zu Sonnenaufgang.
2
Früh im November setzten die »Wahltagsschauer« ein. Kühl wehten nach der Oktoberwärme tief hängende Wolken aus dem Südwesten herein, vollgesogen mit Feuchtigkeit vom Pazifik. Die braungoldenen Hügel der kalifornischen Küstengebirge verdunkelten sich unter Regenfällen. Im Great Valley führten die im Sommer ausgetrockneten Bäche wieder Wasser. In der Sierra schneite es ununterbrochen. Die sechsmonatige Dürrezeit war vorbei.
Zwischen den Regengüssen schien die Sonne hell und erwärmte die Erde. Plötzlich waren Tausende Hänge grün durch das hervorgesprossene Gras. In den Tälern verwandelten sich die Quadratmeilen der Sommerbrache über Nacht in frische Weizen- und Gerstenfelder. Viehzüchter redeten fröhlich miteinander: Ein gutes Jahr! Die Farmer in den bewässerten Gebieten dachten beruhigt an steigende Grundwasserspiegel und gefüllte Speicher. In den Städten gaben die Kaufleute umfangreichere Bestellungen bei den Großhändlern auf.
Der November endete mit zwei Wochen guten Wachstumswetters. Gras und Getreide sogen Feuchtigkeit aus dem Boden und streckten saftige Halme ins Sonnenlicht.
Der Dezember brach an – die Tage noch immer warm und sonnig, die Nächte klar, nur in den Tälern und auf den höheren Bergen ein Frosthauch. Die Farmer sahen jetzt des Öfteren nach Süden – da waren jedoch keine Wolken. Die Viehzüchter liefen nicht mehr herum und klopften sich gegenseitig auf die Schultern; sie erkundigten sich stattdessen heimlich bei den Mühlen in Fresno nach dem Preis von Baumwollsaatschrot. Im Laufe der Wochen wurden die Ladenbesitzer knauserig bei der Gewährung von Krediten.
Zu Weihnachten zeigten das grüne Weideland und die breiten Kornfelder einen blassen Anflug von Gelb. An günstigen Stellen war das Gras sechs Zoll hoch; allerdings krümmten sich die Halme etwas, und die Ränder waren rotbraun. Wo das Vieh gegrast hatte, blieben noch die abgefressenen Spitzen sichtbar.
Die Leute aus der Stadt beglückwünschten sich weiterhin zum schönen Wetter. Der Tourismus blühte. Im Rundfunk sprachen die Sportkommentatoren bei den Footballspielen am Neujahrstag fast genauso viel vom schönen Wetter wie vom Passspiel.
Doch unmittelbar nach Jahresbeginn trugen die pessimistischen Getreideberichte aus Kalifornien dazu bei, dass der Preis für Gerste an der Chicagoer Börse um einen halben Cent stieg. Am selben Tag schnauften sechs Laster, die Anhänger schwer mit Baumwollsaatschrot beladen, über den Highway von Fresno. Die wohlhabenderen Viehzüchter hatten angefangen, Futter zu kaufen.
So versetzte eine Winterdürre in den ersten Wochen des neuen Jahres das Land in Anspannung.
3
Aus Sibirien rauschte der breite Luftstrom südwärts – vom eiskalten Werchojansk, vom frostigen Lenabecken, vom dick zugefrorenen Baikalsee. Der große Wind ergoss sich über die Wüste Gobi. Selbst die abgehärteten Nomaden schauderten; die langhaarigen Kamele des Nordens zitterten unruhig; die struppigen Ponys schlotterten. Erstickt war jedes Geräusch von rinnendem Wasser. Oben in den Lüften trieb der aus der Wüste aufgewirbelte Staub. Über den von Bergen zerklüfteten Rand der Hochebene strömte der Wind, durch alle Klüfte und Pässe des Chingan-Gebirges, die Schlucht des Gelben Flusses hinab. Er stürmte über die Große Mauer, wie schon in den vergangenen Jahrhunderten, und bat keinen Kaiser um Erlaubnis. Schneller als die Tataren, schrecklicher als die Mongolen, erbarmungsloser als die Mandschuren fegte er über die Ebenen Chinas.
Als der Wind vom Hochland herabstieg und in eine wärmere Gegend kam, verlor er ein wenig von seiner arktischen Kälte; trotzdem drang der Frost den Menschen in der alten Hauptstadt des Nordens bis ins Blut. Tagsüber schien eine Sonne, die angelaufenem Messing glich, ohne zu wärmen durch die gelben Staubwolken. Nachts sahen die Augen nichts, doch Trockenheit und Staubgeruch stachen in der Nase. Die Fremden fluchten (wie es ihr angeborenes Recht war) in ihren Pelzmänteln auf das Wetter; die dünn bekleideten, zitternden Kulis gingen stoisch ihrer Arbeit nach. Jede Nacht erfroren einige Dutzend der Armen, zusammengekauert in den Winkeln von Hütte und Torweg, langsam zu Tode.
Nach Süden, die chinesische Küste entlang, floss dieser Luftstrom. In den Hügeln von Shandong war der Sturm noch immer kalt wie Eisen, doch auf der Ebene des Jangtse ließ seine Kraft nach. In Nanking und Shanghai bildete sich Eis nur in den etwas ruhigeren, flacheren Teichen.
Schließlich wandte sich die Luft von der Küste ab und zog hinaus aufs Meer; mit jeder über dem Wasser zurückgelegten Meile wurde sie feuchter und milder. Durch einen allmählich dünneren gelben Schleier stach die Sonne immer wärmer. Der Wind war jetzt nicht länger ein Sturm, ja kaum noch eine steife Brise. Die polare Wut hatte sich ausgetobt. Aber der Luftstrom floss weiterhin von Osten nach Süden über das Chinesische Meer zu den fernen Horizonten des Pazifiks.
4
Mitten am Nachmittag schob sich die Front der sibirischen Luftmasse langsam über den inselübersäten Ozean, der sich östlich von China und südlich von Japan erstreckt. Ihre schwere kalte Luft hing dicht über der Wasseroberfläche. Während sie als Brise aus dem Nordosten voranschritt, zwang sie die vor ihr liegende leichtere Warmluft zum Rückzug und stieß zuweilen so heftig unter diese Schicht, dass sie einen Regenguss bewirkte.
Diese Warmluft, die sich entgegenstellte, hatte sich vor einigen Tagen noch über dem tropischen Meer in der Nähe der Philippinen befunden. Ein Sturm hatte sie mit Regenschauern nach Nordosten bis dicht vor die Küste Japans getrieben; dort wich sie langsam vor dem Druck der Kältewelle zurück. Durch diesen Vorstoß nach Norden hatte sie ihre extreme Feuchte und Wärme verloren und nahm eher einen gemäßigten als tropischen Charakter an. Trotzdem blieb sie wärmer und nasser als die Luft, die aus Sibirien herabfegte.
Der Vormarsch der nördlichen Luft und der entsprechende Rückzug der südlichen hingen, wie sämtliche Bewegungen in der Atmosphäre, mit Verhältnissen zusammen, die überall auf der Erde zur selben Zeit auftreten. Die Verhältnisse an diesem Tag waren so beschaffen, dass jener Vormarsch an Kraft verlor und sich verlangsamte.
Eine Stunde vor Sonnenuntergang erreichte ein Abschnitt der Front eine kleine Insel – nichts weiter als eine Bergspitze überm Meer. Ein todmüder Mann stolpert vielleicht über einen Kieselstein und fällt hin; dann ist der Grund dafür seine Erschöpfung, nicht aber unbedingt der Kieselstein. In ähnlicher Weise wäre eine kraftvoll vorstoßende Front einfach über und um die Insel herumgezogen. Diesmal jedoch bewirkte das Hindernis eine merkliche Unterbrechung, sodass sich zaghaft ein Wirbel von ungefähr einer Meile Durchmesser zu bilden begann, sich abschwächte, wieder Gestalt annahm. An einem bestimmten Punkt gab die Luft aus dem Süden nicht länger passiv der Luft aus dem Norden nach, sondern strömte voll Tatendrang deren Flanke hinauf wie einen allmählich steiler werdenden Hügel. Beim Aufstieg kühlte sich diese Luft ab, sodass ein leichter Nieselregen zu fallen begann. Diese Kondensation des Wassers erwärmte ihrerseits die Luft noch mehr und bewirkte, dass sie sich durch weitere Kondensation stetiger die Flanke emporschob. Auf diese Weise setzte sich der Prozess von selbst fort und nahm an Stärke weiter zu.
Der Vormarsch der warmen Luft glich nun einer leichten Brise von Südwest, während der Luftstrom zuvor von Nordosten gekommen war. Mit dieser neuen Brise zogen Luftmassen, die wärmer und noch viel feuchter waren, aus dem Süden längs eines benachbarten Abschnitts der ursprünglichen Front herein, belebten ihre Kraft und verursachten einen kleinen Schauer. All diese neuen und erneuerten Aktivitäten – Winde, Nieselregen und Schauer – organisierten sich jetzt in komplexer, aber geordneter Weise um einen einzigen Punkt.
Wie ein Leben aus der Verschmelzung zweier gegenteiliger Keimzellen entsteht, so entsprang dem Kontakt der nördlichen Luft mit der südlichen etwas, das es zuvor nicht gegeben hatte. Wie jedes neue Leben, Brennpunkt von Aktivität, sich gemäß seiner Art zu entwickeln und durch Nahrung zu wachsen anfängt, so begann sich in der Luft jener Kräftekomplex zu entwickeln und an Stärke zuzunehmen. Ein neuer Sturm war geboren.
5
Das Schiff hielt fast genau westlichen Kurs. Seine Position befand sich etwa dreihundert Meilen südöstlich von Yokohama, der Zielhafen jedoch war Fuzhou an der chinesischen Küste, noch vierzehnhundert Meilen entfernt.
Um sieben Uhr abends kam der Funker an Deck und bemerkte, dass sich das Wetter verändert hatte. Er registrierte Lücken in der hohen Wolkendecke, unter welcher das Schiff seit einigen Tagen gefahren war. Die Luft schien im Vergleich zur halbtropischen Milde kühl und trocken zu sein. Ganz automatisch warf er einen Blick auf die nach achtern wehende Rauchfahne. Da er den Kurs des Schiffs kannte, schätzte er, dass der Wind in der letzten Stunde etwa vier Striche von Westsüdwest auf Westnordwest umgesprungen war.
Weil das Ablesen der Instrumente und der Bericht an die Küstenstationen zu seinen Aufgaben gehörten, verspürte der Funker ein mehr als gewöhnliches seemännisches Interesse am Wetter. Er ging unter Deck, um nach dem Barometer zu sehen; es war leicht gefallen, nicht genug jedoch, um von Bedeutung zu sein. Im Januar war ein Taifun unwahrscheinlich. Abgesehen davon zeigten die internationalen Wetterberichte keine Störung in dem Gebiet, das sie gerade durchquerten.
Trotzdem begann es gegen acht Uhr leicht zu nieseln. Dies steigerte sich zu einem milden Dauerregen; die Luft indes hatte sich weiter erwärmt. Der sanfte Wind war abrupt zurückgesprungen und wehte nun aus Südwest. Der Rauch stieg beinahe senkrecht empor. Nach einigen Minuten ließ der Regen nach, das Schiff fuhr jedoch noch immer unter einer niedrigen Wolkendecke. Die Luft war wieder so warm und schwül wie an den vorherigen Tagen.
Eine Viertelstunde später wechselte das Wetter abermals. Ein Windstoß, nicht heftig genug, um ihn als Böe zu bezeichnen, rief ein paar Schaumkronen hervor. Gleichzeitig, doch kaum zehn Sekunden lang, bespritzte ein plötzlicher Schauer das Deck mit dicken Regentropfen. Sofort schien die Temperatur um mindestens 5 Grad zu sinken.
»Komisches Wetter!«, sagte der Funker zum Zweiten Offizier und bemerkte im selben Augenblick den Rauch. Der zog nach Backbord und zeigte wieder Nordwind an. Zudem lag er dicht über der Oberfläche des Ozeans, anstatt aufzusteigen.
»Da braut sich was zusammen«, sagte der Zweite Offizier. »Hoffentlich nicht für uns.«
Es gab jedoch keine weitere auffällige Veränderung. Um neun Uhr – zwölf Uhr Mittag nach Greenwich-Zeit – begann der Funker mit seinen Beobachtungen, ehe er sie der nächsten Küstenstation meldete. Er verzeichnete einen Barometerstand von 1011, nur geringfügig höher als während des Regenschauers. Er notierte eine Temperatur von 13°C, über 5 Grad kälter als am vorigen Abend. Der Wind wehte als stete Brise von Nordwest. Die Wolkendecke brach auf, und eine tief im Westen stehende Mondsichel schien über die Meeresoberfläche.
Das Schiff pflügte stetig nach Westen zur chinesischen Küste. »Durch was immer wir gerade gefahren sind«, sagte der Funker, »wir haben’s hinter uns.« Dann schnupperte er neugierig. »Das ist seltsam – Hunderte Meilen auf See, und ich könnte schwören, ich rieche Staub!«
6
Der neue Juniormeteorologe (zweitausend Dollar Jahresgehalt) arbeitete an seinem Tisch. Das Telefon läutete, und er meldete sich mechanisch: »Wetteramt … Heute Abend und am Mittwoch heiter, keine Temperaturveränderung, mäßiger Wind aus Nordwest … Nichts zu danken.« Er legte den Hörer unnötig heftig auf, ein Anzeichen seiner Gereiztheit. In den fünf Wochen, die er jetzt beim Amt arbeitete, hatte das Wetter verrücktgespielt. Manchmal wollte er das Telefon nehmen und hineinbrüllen: »Schneestürme, Gewitter und Hurrikans!« Doch als er sich wieder über seinen Tisch beugte, verflog die Gereiztheit. Stattdessen blühte in ihm die Freude des Arbeiters, des Wissenschaftlers, ja sogar des Künstlers auf. Denn das hatte er sich selbst oft gesagt: Die derzeitige Aufgabe war die einzige von all seinen täglichen Pflichten, an der er mit einer gewissen Ruhe und Distanz arbeiten konnte. Nicht zu vergleichen mit der hastigen Erstellung der frühmorgendlichen Karte, auf der die Vorhersagen beruhten. Seine derzeitige Arbeit war von Nutzen, jedoch lag dieser nicht allein in der unmittelbaren Gegenwart.
Auf dem Tisch befand sich eine große Karte, die er beinahe fertiggestellt hatte. Groß war sie nicht nur in ihren Abmessungen, sondern auch, weil sie ungefähr die Hälfte der nördlichen Hemisphäre erfasste. Am oberen Rand lagen die arktischen Gebiete. Die beiden Kontinente liefen von dort schräg nach unten – rechts Nordamerika, links der östliche Teil Asiens. In der Mitte der Karte erstreckten sich die weiten Räume des Nordpazifiks. Die Küstenlinie von Land und Meer, die Breitenkreise und Meridiane, die Namen und Nummern der Wetterstationen bildeten den gedruckten Hintergrund. Auf dieser Karte hatte der Juniormeteorologe die aktuellen Wetterdaten eingetragen, so wie sie vor einigen Stunden über Funk und Telegraph international übermittelt worden waren.
Besucher des Wetteramts fanden eine solche Karte verwirrend und unverständlich, doch ihr Schöpfer hielt sie für schlicht, wunderschön und inspirierend. Eben nahm er die letzte Korrektur vor; mit der Umsicht eines Dichters, der an einem Vierzeiler feilt, radierte er zwei Zentimeter der einen Linie aus, um sie mit leicht veränderter Krümmung neu zu zeichnen.
Dann legte er Radiergummi und Farbstifte beiseite, lehnte sich zurück und betrachtete sein Werk. Unwillkürlich atmete er etwas tiefer durch. Wie einem Erzengel, der im neunten Himmel schwebt, enthüllte sich ihm das Wetter. Wenn jetzt das Telefon läuten und eine Stimme nach dem Wetter in Kamtschatka, auf der Insel Laysan oder in Aklavik im zugefrorenen Delta des Mackenzie fragen würde, könnte er nicht nur beantworten, wie das Wetter gegenwärtig ist, sondern auch, wie es mit ziemlicher Sicherheit in nächster Zukunft sein würde.
Der erste schweifende Blick überzeugte ihn, dass nichts Ungewöhnliches oder Unvorhergesehenes in den letzten vierundzwanzig Stunden geschehen war, seit er die letzte ähnliche Karte erstellt hatte. Antonia hatte sich so bewegt, wie er das erwartet hatte. Cornelia und die anderen entwickelten sich normal. Unter keinen Umständen hätte der Juniormeteorologe seinem Chef offenbart, dass er diesen riesigen umherziehenden Tiefdruckgebieten Namen verlieh – und dann noch Frauennamen! Im Stillen rechtfertigte er diesen sentimentalen Anflug durch die Erklärung, dass jeder Sturm tatsächlich ein Individuum war und dass es ihm leichter fiel, »Antonia« zu sagen (natürlich nur zu sich selbst) als »der Tiefkern, der gestern bei 175 östlicher Breite und 42 nördlicher Länge lag«.
Das Spiel lief sich jedoch allmählich tot. Zuerst hatte er jeden Sturm nach einem Mädchen, das er gekannt hatte, getauft – Ruth, Lucy, Katherine. Dann hatte er diese kleinen Stürme gespannt beobachtet in der Hoffnung, dass sie sich ordnungsgemäß entwickeln und Regen bringen würden. Doch einer nach dem anderen hatte ihn enttäuscht. Schließlich waren ihm die Namen ausgegangen, sodass er sich hauptsächlich auf jene längeren mit der Endung -ia verlegt hatte, die eher an Schauspielerinnen und Romanheldinnen als an seine früheren Bekanntschaften erinnerten.
Auf der gegenwärtigen Karte harrten vier solcher Stürme tapfer aus – konzentrische Bleistiftlinien um Zentren, die als TIEF markiert waren. Diese Kurven spitzten sich dort zu Winkeln, wo sie bestimmte rote, blaue oder violette Linien schnitten. Sylvia war ein heftiger Sturm mit Zentrum über Boston; er – oder vielmehr sie – hatte den Staaten im Nordosten soeben kräftigen Schneefall beschert und zog nun hinaus aufs Meer, wobei sie einen Kälteeinbruch zurückließ. Felicia war eine schwache Störung; sie hatte fast keine Vergangenheit und wahrscheinlich keine große Zukunft. Cornelia war ein ausgewachsener Sturm mit einem Zentrum vierhundert Meilen über dem Meer südöstlich von Dutch Harbor. Antonia, jung und weiterhin im Wachstum, zog etwa zweitausend Meilen hinter Cornelia mitten auf den Ozean hinaus. Trotz der Entfernungen zwischen ihnen, überlappten sich die Stürme, sodass sich ein Störungsgürtel in gebogener Linie von Nova Scotia bis unmittelbar nach Japan erstreckte.
Im Westen der Vereinigten Staaten und im benachbarten Teil des Pazifiks schnitten die schwarzen Kurven jedoch nirgends die farbigen Linien oder spitzten sich zu Winkeln; sie lagen weit voneinander entfernt und waren durch Punkte mit der Bezeichnung HOCH gezogen. Für den Juniormeteorologen waren sie allesamt deutliche Anzeichen für klares, ruhiges Wetter. Im Jargon seiner Zunft war diese Region von einem »semipermanenten Pazifikhoch« bedeckt. Er blickte übellaunig darauf. Dann lächelte er, weil er entdeckte, dass das Hoch heute zufällig die Gestalt eines gigantischen Hundekopfs angenommen hatte. Aus den Wassern des Pazifiks steigend, starrte er dümmlich über den Kontinent. Seine stumpfe Nase berührte gerade eben Denver; der obere Teil des Kopfs befand sich in Britisch-Kolumbien. Ein schmaler Kringel über dem südlichen Idaho lieferte ein Auge. Drei konzentrische Ovale, die von der kalifornischen Küste nach Südwesten zeigten, ergaben ein passables Ohr.
Hundekopf hin, Hundekopf her – das Pazifikhoch war für Kalifornien alles andere als lustig. Solange es verharrte, wurde jeder Sturm, der kühn vom Pazifik einrückte, südostwärts abgelenkt. Strömender Regen ergoss sich dann über den Süden der Küste von Alaska und über Vancouver Island. Ein andauerndes Nieseln in Seattle und Portland. San Francisco und das Great Valley bekamen nur Wolken, Los Angeles weiter südlich schmorte dagegen nach wie vor in der Sonne. In Wirklichkeit unsichtbar für das menschliche Auge, lag das Pazifikhoch auf der Karte so deutlich wie eine Gebirgskette – und hatte nicht weniger Einfluss als die Sierra Nevada auf die Bevölkerung Kaliforniens.
Weit von der amerikanischen Küste entfernt, in der oberen linken Ecke der Karte, zogen lange Linien dicht beieinander und fast parallel von Zentralasien südwärts nach China, dann bogen sie nach Osten in den Pazifik hinein. Dem Juniormeteorologen war dies altbekannt – ein sichtbares Zeichen für den gewaltigen Windstrom des Wintermonsuns bei seiner Arbeit, die kalte Luft aus Sibirien zu verteilen. Flüchtig bemerkte er, dass die Temperatur in Peiping bei -22°C lag. Mit mehr fachmännischem Interesse folgten seine Augen jenen gekrümmten Linien, die in den Pazifik führten.
Hier und dort in dieser Region, wie auch anderswo im Ozean, sah er kleine Gruppen von Eintragungen, welche die Wetterberichte darstellten, die von den Schiffen gefunkt wurden. Über einer davon verweilte er. Das Schiff, dreihundert Meilen südöstlich von Yokohama, hatte einen Barometerdruck von 1011 gemeldet, aber bei seiner Position auf der Karte hätte es eher 1012 melden müssen. Er überlegte, dass eine Differenz von einem Millibar unerheblich war und bloß von einem ungenauen Barometer oder einer sorglosen Instrumentenablesung herrühren könnte. Aus diesen Gründen hatte er sich zunächst erlaubt, den speziellen Bericht zu ignorieren. Doch jetzt dachte er noch einmal darüber nach.
Die Position des Schiffs befand sich ungefähr auf halber Strecke zwischen den Inselwetterstationen Hatidyosima im Norden und Titijima im Süden, die etwa zweihundert Meilen auseinander lagen. Die Lufttemperatur auf dem Schiff betrug nur ein Grad mehr als in Hatidyosima, war aber fast 7 Grad kälter als in Titijima. Dies war ein deutliches Anzeichen dafür, dass das Schiff bereits von kühlerer Luft umschlossen war, die mit dem Monsun hinauswehte, und dass die aus dem Norden kommende kühlere Luft irgendwo zwischen dem Schiff und der Insel im Süden gegen die wärmere Luft im Süden drückte. Er hatte diesen Umstand bereits selbst erkannt und eine blaue, auf eine »Kaltfront« hindeutende Linie vom Zentrum Antonias nach Westen und Süden bis zur chinesischen Küste eingezeichnet. Entlang einer solchen Grenze von kalter und warmer Luft bildete sich mit ziemlicher Sicherheit irgendwo ein neuer Sturm.
Keine anderen Schiffe hatten aus dieser Gegend berichtet. Beim Blick auf die Windpfeile der beiden Inselstationen entdeckte er, dass sie der Ablesung des Schiffsbarometers eher widersprachen, als sie zu bestätigen. Hatidyosima meldete einen Nordost- statt einen Nordwestwind, Titijima einen Westwind statt einen Süd- oder Südwestwind. Eigentlich hielt er die ganz Sache für belanglos, doch er fühlte das Zwicken wissenschaftlicher Neugier und die Herausforderung eines schwierigen Problems.
Methodisch überprüfte er die Karten der letzten zehn Tage und kam zu dem Schluss, dass es vorher nie Anlass gegeben hatte, die Korrektheit der Berichte von besagtem Schiff anzuzweifeln. Er zögerte einen Moment, wobei er sein Radiergummi über der blauen Linie hielt. Die Barometerablesung des Schiffs könnte, in Anbetracht der wahrscheinlichen Gesamtwetterlage, auf einen beginnenden Sturm hindeuten. Dass ihn die Inselberichte nicht bestätigt hatten, würde nur bedeuten, dass die Störung bisher zu klein war, um einen Einfluss auf sie zu haben. Dies allein schon verlieh der Sache eine Pikantheit, denn selten war es möglich, einen Sturm so kurz vor seinem Anfang aufzuspüren.
Er radierte ein kurzes Stück der blauen Linie aus und zeichnete eine rote Linie in einem Winkel hinein, der eine flache Welle andeutete. Um das Zentrum des Wellenkamms zog er eine schwarze Linie in Form eines kleinen Footballs; er beschriftete sie mit 1011 und setzte in winzigen Druckbuchstaben TIEF hinein. Als das erledigt war, musterte er sein Werk noch einmal und lächelte.
So wie ein Säugling alle Körperteile des Erwachsenen besitzt, so zeigte der Babysturm ein Zerrbild der Merkmale eines ausgewachsenen Sturms. Die rote Linie symbolisierte die »Warmfront«, an der entlang die Luft aus dem Süden vorstieß und über die Luft aus dem Norden glitt. Die blaue Linie symbolisierte die »Kaltfront«, woran die nördliche Luftmasse vorrückte und sich unter die südliche schob. Die schwarze Linie in Form eines Footballs war eine Isobare und zeigte einen Barometerstand von 1011 um das Tiefdruckzentrum an, außerdem symbolisierte sie den vollständigen Umlauf der Winde rings um diesen Punkt. So wie ein Säugling keine Zähne hat, so fehlten dem Sturm einige Eigenschaften des Erwachsenen. Doch genau wie ein Säugling ein menschliches Wesen ist, so war die Neuentdeckung des Meteorologen ein Sturm in reizendem Kleinformat – immer vorausgesetzt, dass er die Lage richtig analysiert hatte.
Einen Augenblick lang blickte er zufrieden auf seine Schöpfung, dann sah er flüchtig über den Pazifik und dachte an die Zukunft. Die allgemeine Lage deutete darauf hin, dass der neue Sturm in den nächsten vierundzwanzig Stunden rasch nach Osten ziehen würde. Dabei konnte er an Umfang und Intensität zunehmen; seine Winde konnten heftiger, seine Regenfälle stärker werden.
Plötzlich juckten ihm die Finger nach einem Rechenschieber. Er entsann sich seines Studiums bei Professoren, die das Wetter als einen Zweig der Physik betrachteten. Die eigene Doktorarbeit – fast nur komplizierte Gleichungen – hatte ihm ein Summa cum laude eingebracht. Derartige Gleichungen blitzten jetzt mit fotografischer Genauigkeit in seinem Geist auf. Sie behandelten Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, die Corioliskraft und die reibungslose horizontale gradlinige Strömung. Sie umfassten so herrliche Terme wie ½Ait2, ΔΤ0,0 und 2mvω sin φ. Für einen mathematisch geschulten Meteorologen waren sie schöner als griechische Vasen.
Er zuckte mit den Schultern. Das hiesige Wetteramt musste sich mit unmittelbar praktischen Angelegenheiten befassen; für mathematische Abstraktionen gab es wenig Bedarf und keine Zeit. Und zudem – das musste er sich eingestehen – war die Anwendung äußerst verfeinerter Methoden bei Daten von bloß einem Schiff und von Wetterstationen, die zweihundert Meilen vom Zentrum der Aktivität entfernt lagen, kaum zu rechtfertigen.
Resigniert wandte er seine Aufmerksamkeit wieder der Karte zu und betrachtete die einsame Gruppe von Notationen mitten im Ozean. Er vermutete, dass besagtes Schiff soeben das Störungsgebiet durchquert hatte. Innerhalb weniger Stunden hatte es die Grenze zwischen warmer und kalter Luft wahrscheinlich mehr als einmal gekreuzt und dabei wechselhaftes, jedoch nicht sehr markantes Wetter erlebt. Das Schiff fuhr nach Westen; der Sturm bewegte sich, wie alle derartigen Stürme, nach Osten. Schiff und Sturm würden sich nicht noch einmal begegnen, trotzdem verweilten beide für einen Augenblick gemeinsam in seinen Gedanken. Für Seeleute war das Schiff zweifellos von Interesse, ihm jedoch erschien es gänzlich langweilig – eine Maschine. Es mochte eines von zwanzig derselben Bauweise sein, unterscheidbar von den anderen erst, wenn man nahe genug war, um den Namen lesen zu können. Aber der Sturm! Er fühlte, wie ihm ein Kribbeln plötzlich über den Rücken lief. Ein Sturm lebte und wuchs. Keine zwei Stürme glichen einander jemals.
Dieser eine – dieser anfängliche kleine Wirbel, der südöstlich von Japan das Licht der Welt erblickt hatte – würde sein eigenes Dasein haben, zum Guten wie zum Schlechten, so wie jedes Menschenkind, das zur selben Stunde geboren wurde. Unter günstigen Bedingungen würde er glücklich aufwachsen, gedeihen und ein hübsches Sturmalter erreichen; doch ebenso war es möglich, dass er dahinsiechen oder plötzlich ausgelöscht werden konnte.
Es blieb nur noch eine Kleinigkeit zu tun, und die erforderte keine Eintragungen auf der Karte. Der Juniormeteorologe musste dem Kind einen Namen geben. Er dachte kurz über weitere Namen auf -ia nach und kam auf »Maria«. Das war schlichter als Antonia oder Cornelia; es klang sogar ganz anders als sie. Doch es war ein schöner Name. Und wie ein Geistlicher, der soeben einen Säugling getauft hatte, lächelte er mild und wünschte ihm liebevoll, unausgesprochen viel Freude und Wohlergehen. Alles Gute, Maria!
Zweiter Tag
1
So wie die Krabbe auf dem Meeresboden läuft, aber zum Wasser gehört, so stellt der Mensch seine Füße auf die Erde – und lebt in der Luft. Der Mensch hält die Krabbe für ein Wassertier, nennt sich selbst aber seltsamerweise und gegen die Logik einen Landbewohner.
So wie das Wasser die Krabbe umschließt, so umgibt, durchdringt und belebt die Luft den Körper des Menschen. Mischen sich Spuren giftigen Gases hinein, dann hustet er, und seine Haut färbt sich aschfahl. Ist sie mit Wassertröpfchen übersättigt, tappt er hilflos im Nebel umher. Bewegt sie sich zu schnell, wird er zu einem kläglichen, windgepeitschten Geschöpf, das in Kellern und Gräben kauert. Selbst für den Regen ist er abhängig von der Luft. Schneidet man ihm die Luft ab, stirbt er sofort.
Physiker beschreiben die Luft als geschmacklos, geruchlos und unsichtbar. Anders könnte es nicht gut sein. Aber das sind weniger ihre Eigenschaften als Anpassungen des Menschen daran. Denn würde die Luft unsere Sinne in Beschlag nehmen, überdeckte sie, da sie zur gleichen Zeit alldurchdringend ist, sämtliche andere Geschmäcker, Gerüche und Anblicke.
Die Luft ist so eng mit dem Leben des Menschen verknüpft, dass er sich nur unter Schwierigkeiten ihre eigenständige Existenz vorstellen kann. Für einen Wilden ist sie ebenso abstrakt wie das Bewusstsein; ein Kind kann den Wind als bewegte Luft begreifen, nicht jedoch die Luft selbst. In unserer Sprache sind Wind, Nebel und Regen sehr alte Worte. Das englische air hingegen ist ein jüngeres, gelehrtes Lehnwort aus dem Griechischen, das ursprünglich wiederum Wind bedeutete.
Tatsächlich ist der Mensch in den Monaten vor seiner Geburt aquatisch. Doch einmal hinaus in die Atmosphäre gestoßen, winzig und rot, saugt er krampfhaft den ersten Atemzug ein und bleibt der Luft treu. Siebzig Jahre später steht die Pflegerin am Bett eines Alten und wartet auf den »letzten Atemzug«.
Selbst unter den Landtieren ist der Mensch weniger als die meisten anderen an die Erde gebunden. Seine auf den Bäumen lebenden Vorfahren mögen heimlich auf den Boden herabgestiegen sein wie in fremdes, feindliches Land, in der Zivilisation jedoch verbringen die Leute den größten Teil ihrer Zeit auf erhöhten Ebenen, die man Stockwerke nennt.
Genau wie einzelne Menschen durch eine allzu vertraute Landschaft laufen, ohne ihre Charakteristika zu bemerken, so nimmt die Menschheit – fälschlicherweise – die alldurchdringende Luft als selbstverständlich hin. Die Historiker beschäftigen sich mit dem Land und dem Meer, aber die Ursache der meisten Völkerwanderungen war nicht die Suche nach besserem Gelände, sondern nach besseren atmosphärischen Bedingungen. »Ein Platz an der Sonne« erklärt viele historische Ereignisse genauer, als uns gewöhnlich bewusst ist, wenn man davon absieht, dass es oft heißen müsste: »ein Platz im Regen«. Ein Gewitter in der Erntezeit kann eine Regierung stürzen, ein leichtes Steigen oder Sinken der Durchschnittstemperatur kann einen Thron ins Wanken bringen und die abweichende Bahn eines Sturms ein Weltreich zugrunde richten. Im 20. Jahrhundert hat eine kurzzeitige Veränderung des Niederschlags Hunderttausende Menschen in Oklahoma auf die Straße getrieben, so wie im 3. Jahrhundert eine ähnliche Abweichung in einem einzigen Jahr die Hunnen an die chinesische Grenze trieb und die blaubemalten Kaledonier gegen den Hadrianswall schwärmen ließ. In der Masse wie auch als Individuum ist der Mensch weniger ein Landbewohner als ein Geschöpf der Luft.
2
Morgens fünf Minuten vor vier gab es im Januar bislang nie eine Spur von Dämmerung. Nur wenige Gebäude waren beleuchtet, sodass der Chef, noch im Halbschlaf, von Laterne zu Laterne steuerte wie der Kapitän eines Küstendampfers seinen Kurs von einem Leuchtturm zum nächsten nimmt. Gelegentlich raste ein Laster vorbei, ein Zeichen dafür, dass die Stadt selbst zu dieser Stunde nicht jegliche Aktivität aufgegeben hatte.
Ein Vorteil, so früh zur Arbeit fahren zu müssen, war zumindest, dass man keine Probleme bei der Parkplatzsuche hatte. Während er zu Tom’s Nachtcafé hinüberlief, nahm der Chef die Wetterbedingungen fachmännisch in den Blick. Kein Mond, überall sternklar, wolkenlos; frische Brise von Nordwest; die Temperatur deutlich überm Gefrierpunkt – ein für San Francisco typischer Wintermorgen.
»Heiter und wärmer«, begrüßte ihn Tom.
»Falls es nicht regnet«, erwiderte der Chef, indem er die Floskel ergänzte, die ihren Ursprung vor so vielen Jahren hatte, dass sie sich nicht mehr an den anfänglichen Witz erinnerten.
»Orangensaft, Kaffee, Schnecke.«
»Geht klar, Chef«, sagte Tom und legte eine Morgenzeitung auf den Tresen.
Der Chef überflog die Schlagzeilen ohne große Begeisterung – Kriegsgerüchte, Arbeiterkrisen, politische Konflikte. Er spürte aufkeimenden Stolz auf den eigenen internationalen Beruf, in dem man gegen Naturgewalten kämpfte, nicht gegen seine Mitmenschen. Bei dieser Vorstellung blickte er aus dem Fenster. Eine Reihe elektrischer Lampen leuchtete jetzt hell vom Flachdach des Amtsgebäudes gegenüber; einer von den Jungs musste soeben hinaufgestiegen sein, um die Instrumente abzulesen. Die Uhr im Café zeigte vier – das bedeutete zwölf Uhr Mittag nach Greenwich-Zeit. Überall schauten in dieser Minute die Beobachter in den Wetterstationen auf die Thermometer und Barometer und blickten in den Himmel, um zu prüfen, wie stark wolkenverhangen er war.
Unvermittelt stellte er sich sämtliche Beobachter überall auf der Welt vor. In Paris und London lasen sie die Instrumente ab und hatten noch viel Zeit bis zum Mittagessen. In Rio war es neun Uhr morgens, in New York sieben Uhr. Hier an der Pazifikküste wälzten sich die Männer zu einer überaus lästigen Stunde schläfrig aus dem Bett. In Alaska war es allerdings schlimmer. In Neuseeland blieben die Beobachter um diese Zeit höchstwahrscheinlich noch auf, bis sie ihre Instrumente abgelesen hatten, und gingen erst danach zu Bett. Die Japaner hatten die passendste Zeit – neun Uhr abends. In Bombay ging wohl gerade die Sonne unter; in Athen und Kapstadt war es früher Nachmittag. Schiffe auf See stellten die Stunden während ihrer Fahrt. Doch die arktischen Stationen? Dort war ohnehin den ganzen Winter über Nacht, vielleicht richtete man sein Privatleben nach der Zeit, die einem am bequemsten schien.
Als Tom ihm das Frühstück hinstellte, kam er von seiner Weltbetrachtung zurück.
»Was hamse denn heute Schönes für uns, Chef?«
»Hmm-n? Heute nicht viel, denke ich, Tom.«
»Höchste Eisenbahn, dass Sie ma’ was für uns aufstöbern. Könnten sicher Regen brauchen.«
Tom wandte sich einem neuen Gast zu. Die Dürre war tatsächlich schlimm, überlegte der Chef, wenn schon der Besitzer eines Nachtcafés davon zu reden anfing.
Unten am Tresen erzählte Tom dem Neuankömmling offenbar, um wen es sich bei dem anderen Kerl handelte. Seit langem wusste der Chef, dass er Toms Vorzeigegast war. Er konnte die nicht sonderlich gedämpfte Stimme hören.
»Stimmt, das is’ der olle Wettermann höchstpersönlich.«
»Nicht zu fassen!« Der Chef bemerkte die Mischung aus Überraschung und Ehrfurcht. Aus Erfahrung wusste er, dass viele Leute keinen Unterschied sahen zwischen Wettervorhersage und Wettermachen.
Toms Kaffee wärmte noch immer seinen Bauch, als der Chef den beleuchteten Korridor im obersten Stockwerk des Amtsgebäudes entlangging. Auf der rechten Seite lagen die Büros der Verwaltung, auf der linken befand sich die Klimatologische Abteilung. Alles war noch dunkel. Nur vorne konnte er Licht durch eine Glastür scheinen sehen; sie trug die Aufschrift VORHERSAGE-ABTEILUNG. An dieser Stelle fühlte der Chef regelmäßig das Kribbeln des Stolzes auf seinen Beruf. »Verwaltung« – das bedeutete Stenographen, Adresslisten und Gehaltsschecks, dasselbe, was man in Tausenden Büros in der Stadt vorfand. »Klimatologie« – das bedeutete nichts als endlose Statistiken über totes Wetter. »Vorhersage« hingegen – das war die Frontlinie.
»Hallo, Whitey! … Alles klar, Jungs? … Schon irgendwelche Berichte reingekommen?«
»Noch nichts, Sir«, sagte Whitey.
Im Kartenraum stand ein langer, in vier Plätze abgeteilter Tisch, vor jedem ein Zeichenhocker. Auf dem vordersten Hocker saß der neue Juniormeteorologe, der die Schallhöhenmessungen der letzten Nacht von verschiedenen Stationen an der Pazifikküste fast zu Ende eingetragen hatte. Der Chef betrachtete die Diagramme. Phoenix, San Diego, Burbank. Die Linien liefen aufwärts und bogen nach links ab; hier und dort hatten sie Knicke; eine deutliche Umkehrung der Richtung markierte den Punkt, an dem jeder der Ballone in die Stratosphäre eingedrungen war. Oakland, Medford, Spokane. Innerhalb einer Minute hatte sein geübter Verstand resümiert, was soeben in der oberen Luftschicht des Bezirks geschah.
Die nächste Graphik stellte die Winde im Westen der Vereinigten Staaten in Abständen von zweitausend Fuß dar, von der Erdoberfläche bis hinauf in vierzehntausend Fuß Höhe. Auf der ersten Karte zeigten die Pfeile in viele verschiedene Richtungen, an der Oberfläche waren nämlich die lokalen Verhältnisse von Bergen und Tälern oft die bestimmenden Faktoren. Die Zwei- und Viertausend-Fuß-Karten waren größtenteils leer, denn die Gebirgsstationen befanden sich oberhalb dieses Niveaus. Bei sechs- und achttausend Fuß füllte sich die Karte allmählich, und ein ziemlich einfaches Windmuster zeichnete sich ab. Bei zehntausend Fuß und darüber wehten alle Winde kräftig und von Westen.
Der Chef hatte seinen Überblick kaum beendet, als der Fernschreiber aus dem Nebenraum zu ticken begann. Unwillkürlich lächelte er. Es war wie ein Trompetensignal. Innerhalb der nächsten Stunde würde sich sein Leben im Eiltempo abspielen.
»Wer ist heute Morgen Kartenmann?«, fragte er.
»Das bin ich, Sir«, sagte Whitey.
»Gut.«
Der Chef wandte sich von dem großen Tisch ab und dem kleineren zu, der in einer Fensternische stand. Sein eigener Stuhl befand sich mit dem Rücken zum Fenster in der Nische. Gegenüber, hinter einem breiten Tisch, war der Platz des Kartenmanns. Auf dem Tisch lag eine große Übersichtskarte von Nordamerika und den angrenzenden Gewässern, auf der winzige Kreise die jeweiligen Wetterstationen darstellten. Bis jetzt war jedoch nur der örtliche Bericht eingetragen. Der Windpfeil und kleine Zahlengruppen in der Nähe von San Francisco standen einsam und auffällig vor der Weite des Kontinents und des Ozeans.
Jetzt tickten bereits mehrere Fernschreiber. Whitey kam mit dem ersten Schwung Berichte herein, setzte sich auf seinen Stuhl und begann, mit einem spitzen Füllfederhalter die Daten einzutragen. Ein Pfeil deutete graphisch die Windrichtung an und die Anzahl seiner Fiedern die Windstärke. Der Umfang und die Art der Schattierung innerhalb des winzigen Kreises verwies auf die Wolkenbedingungen. Zahlen und andere Symbole dienten dazu, Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und bei Bedarf weitere Bedingungen zu dokumentieren. North Platte, Concordia, Omaha, Sioux City. Die Karte erschien in der Gegend des Missouri Valley nicht mehr so leer. Knoxville, Charlotte, Atlanta, Charleston. Whitey arbeitete mit dem Tempo und der Genauigkeit einer Maschine. Pittsburgh, Cleveland, Washington.
Bevor die Karte nicht annähernd fertig war, konnte der Chef mit seiner Arbeit nicht beginnen. Er ging zum Fernschreiberraum. Als er eintrat, schien sich das Crescendo der Geschäftigkeit noch zu steigern. Die Maschinen tickten wie verrückt gewordene Stenotypisten; ihre Glocken klingelten; Büchsen plumpsten aus den Rohrpostleitungen in die Körbe.
Einem Außenstehenden mochte alles wie eine irre Konfusion vorgekommen sein, für den Chef war es der geordnete Rhythmus des Lebens. Jene Maschine, die fast pausenlos Meldungen hinaustickte – der Chef wusste, dass ihre Impulse aus einem Büro in Chicago kamen, das als Abwicklungsstelle für die Wetterberichte des halben Kontinents fungierte. Ein anderer Apparat klickte kontinuierlich und ließ dazu, gleichsam aus lauter Überschwang, alle paar Sekunden eine Glocke ertönen. Dies war der eigene Draht des Wetteramts, welcher die Stationen entlang der Fluglinien miteinander verband. Die übrigen vier Maschinen, die die örtlichen Telegraphen- und Radiostationen versorgten, schwiegen bisweilen, dadurch wirkten die Ausbrüche ihrer Geschäftigkeit im Kontrast noch fieberhafter. Zur Konfusion trug auch einer seiner Männer bei, der mit dem Zuschneiden eines Fernschreiberstreifens beschäftigt war, denn San Francisco musste im richtigen Moment zur Sendestation werden und die lokalen Wetterbedingungen dem Rest der Welt melden.
Trotz jahrelanger Routine spürte der Chef eine tief im Inneren schwelende Erregung: Der Moment kam näher. Bleibt ein guter Priester gelassen, wenn der Messeritus dem Höhepunkt zusteuert? Nimmt ein echter Schauspieler selbst nach tausend Abenden das Stichwort, das ihm die Bühne für seinen großen Auftritt überlässt, als selbstverständlich hin? Für den Chef war dies nicht bloß ein Ritual oder Drama, das unausweichlich auf ein feststehendes Ende hinauslief. Es war ein Wettkampf, ein Gefecht, bei dem sich die gewaltigen Kräfte der Luft auf unerwartete Angriffe und Hinterhalte gegen ihn vorbereiteten. Er eilte zurück, um zu sehen, wie sich die Karte entwickelte.
Whitey arbeitete noch immer wie eine hochtourige Maschine. Winnipeg, The Pas, Qu’Appelle, Swift Current. Der Großteil der Vereinigten Staaten und Kanada waren jetzt ausgefüllt. Ein Dutzend Schiffe zwischen Kalifornien und Hawaii hatten ihre Meldungen gesendet. Whitey griff sich einen neuen Schwung Radioberichte, schwenkte Tausende Meilen nach Süden und begann mit den Schiffen vor der mexikanischen Westküste. Diese Arbeit ging etwas langsamer vonstatten, denn er musste Längen- und Breitengrade bestimmen. Nansu, Olaf Maersk, San Roque, City of Brownleigh. Einen Augenblick später war er wieder am Polarkreis im Nordwesten Kanadas, wo Stationen, die einsamer als Schiffe waren, die Ablesungen ihrer Instrumente mittels Funk hinaus in die arktische Nacht sandten. Coppermine, Aklavik, Fort Norman, Chesterfield Inlet.
Aus dem Fernschreiberraum drang etwas weniger Lärm. Nur die Glocken läuteten dann und wann. Der Draht nach Chicago schwieg. Gelegentlich brach noch die eine oder andere Maschine plötzlich in Geschäftigkeit aus mit einem verspäteten Bericht, einer fehlgeleiteten Meldung oder einer Korrektur. Whitey entspannte sich so weit, dass er seinen ersten Fehler machte. Er fluchte leise und griff nach einem Tintenlöscher. Mr. Ragan und der Juniormeteorologe arbeiteten kontinuierlich an ihrem Tisch und trugen die Temperatur- und Druckveränderungen seit den letzten Berichten ein.
Der Chef hatte nicht bemerkt, wie viel Zeit seit dem Beginn der Meldungen vergangen war, doch jetzt sah er, dass die Uhr auf Viertel nach fünf stand. Das elektrische Licht brannte noch im Büro; die nackten Fenster zeigten nur die Dunkelheit draußen.
»Wie sieht’s aus, Whitey?«
»Ziemlich gut gefüllt, Sir! Ich glaube, Sie können anfangen.«
Der Chef glitt auf seinen Stuhl. Er saß Whitey gegenüber und sah die Karte überkopf. Er hatte sich jedoch längst auf diese Position eingestellt, sodass er vermied, dem Kartenmann am Arm zu ruckeln oder ihm über die Schulter zu blicken. Schließlich ließ sich, wie er mit Bleistift und Papier gerne demonstrierte, 5 genauso leicht lesen wie genauso leicht lesen wie 5, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hatte.
Aus welcher Richtung man sie auch betrachtete, die Karte stellte bislang nur ein Durcheinander dar. Für jede der mehrere hundert Stationen und Schiffe hatte Whitey mindestens ein halbes Dutzend gesonderte Vermerke eingetragen. Die gesamten Vereinigten Staaten waren auf der Karte beinahe vollständig mit Zahlen und scheinbar kabbalistischen Symbolen bedeckt. Sogar für den Chef war eine derartige Karte nur eine Aufzeichnung von Daten, in die er wieder Ordnung hineinbringen musste.
Zuerst machte er sich daran, die gegenwärtige Position des Sturms zu bestimmen, der bis vor die Küste des südlichen Alaskas gerückt war. Starker Regen und ein drastisch sinkender Barometerdruck in Sitka zeigten, dass die Front noch nicht vorübergezogen, sondern wahrscheinlich in der Nähe war. Mit seinem violetten Stift zeichnete der Chef eine Linie, die unmittelbar westlich von Sitka anfing, in leichtem Bogen verlief und zweihundert Meilen westlich der Küste von Washington endete.
Da keine weiteren Stürme von Bedeutung für seinen Bezirk angezeigt zu sein schienen, begann er mit den Isobaren. Zuversichtlich arbeitete er sich durch das Labyrinth von Zahlen. Weil Denver einen Luftdruck von 1016 und North Platte einen von 1012 meldete, fing seine 1014-Isobare ungefähr in der Mitte zwischen beiden an. Er zeichnete sie langsam in einer Kurve nach Nordwesten ein. Gemäß den Luftdruckmeldungen ließ er Rapid City, Miles City und Havre zusammen mit North Platte auf der einen Seite der Linie, während Cheyenne, Billings und Helena gemeinsam mit Denver auf der anderen blieben. Er zog die Linie weiter, umfuhr Kamloops in British Columbia und bog dann scharf nach Südwesten ab, wobei Vancouver und Victoria gerade eben noch innerhalb des Bogens lagen. Vor der Küste traf sie auf die violette Linie, die er südlich von Alaska gezogen hatte. Obwohl kein Schiff in der Nähe dieses Treffpunkts gefunkt hatte, führte der Chef seine Isobare in scharfem Winkel über die andere Linie, um den plötzlichen Druckabfall darzustellen, der eine vorbeiziehende Front begleitet. Dann hielt er inne: Vor seinem Buntstift erstreckte sich die weite Meeresfläche ohne jegliche Vermerke.
»Was ist mit der Byzantion? Sie muss irgendwo hier draußen sein.«
»Kein Bericht von ihr, Sir.«
»Hmm-n. Muss ein Schrottkahn sein! Hat sie gestern was gemeldet?«
»Gestern schon. Aber vorgestern nicht.«
»Wahrscheinlich verspätet sie sich und ruiniert mir die Karte. Nun ja …« Mit einem weiteren missbilligenden Grunzen zog der Chef die Linie nach Südwesten über die leeren Weiten des Pazifiks. Sie mochte gut und gerne einige hundert Meilen danebenliegen, aber gegen fehlende Informationen besaß er kein Mittel. Geschickt führte er die Isobare in einer Schleife um Hawaii herum und ließ sie zurück zum Kontinent laufen. Er zeichnete sie über das Nordende von Niederkalifornien, nahm Tucson gerade noch in dem Bogen mit und verband sie mit ihrem Ausgangspunkt östlich von Denver.
Als er mit einer weiteren Linie begann, folgte er demselben Prozedere. Nach zehn Minuten hatte die Karte Gestalt angenommen.
Während der Arbeit verspürte der Chef eine leichte Traurigkeit. Er dachte an Tom, der gesagt hatte: »Könnten sicher Regen brauchen.« Leider war kein Regen in Sicht. Dieser Sturm an der Küste Alaskas mochte allenfalls ein Nieseln bringen, nicht weiter südlich als bis nach Oregon. Der Chef wünschte, er könnte Toms Vertrauen entlohnen und irgendwo aus dem Nichts einen Sturm heraufbeschwören. Doch das große Hochdruckgebiet erstreckte sich dreitausend Meilen nach Westen. Jedes Schiff auf der Fahrt nach Honolulu meldete schwachen Wind und klaren Himmel. Auf der Großkreisroute von San Francisco nach Japan mangelte es an Fahrzeugen, nur das Linienschiff Eureka, sechzehn Stunden hinter San Francisco, meldete einen Druck von fast 1020, was entmutigend hoch war. Gerade als er über die Eureka nachdachte, kam Whitey herein.
»Also, hier ist sie, Chef – die Byzantion. Sehen wir mal, ob sie Ihre Karte ruiniert.«
Der Chef zuckte mit den Schultern und sah Whitey zu, wie er die Position bestimmte – 40° Nord, 143° West. Unter welcher Flagge und für welches Unternehmen sie auch fahren mochte, sie befand sich ein Stück südlich der Japanroute. Der Chef vermutete, dass sie Kurs auf Shanghai nahm, er wusste jedoch sehr wenig über die verschiedenen Schiffe und ihren Güterverkehr. Er beurteilte sie nach der Regelmäßigkeit und Vollständigkeit ihrer Berichte. Aufgrund der Neigung von Whiteys Schultern erkannte er, dass die Byzantion ihn dumm dastehen ließ.
Whitey war fertig und richtete sich auf. Ja, das Schiff hatte 1015 gemeldet. Mit der resignierten Miene eines Mannes, der mit Tatsachen handelt, radierte er ein langes Stück der einen Isobare aus und zeichnete sie durch die angegebene Position zweihundert Meilen weiter nördlich neu ein. Whitey grinste nicht ohne Mitgefühl. Der Witz ging jedenfalls auf Kosten des Chefs.
Die Verschiebung einer einzelnen Isobare hatte wenig Bedeutung für die Gesamtlage. Der Chef betrachtete die fertige Karte und fühlte Enttäuschung. Die tägliche Aufregung war vorüber, und zum Schluss stellte sich wie so oft Ernüchterung ein. Auf der heutigen Karte konnte sich selbst ein ziemlich intelligenter Affe nicht verirren. Er wandte sich seiner Schreibmaschine zu. »Hätte den ganzen letzten Monat«, dachte er, »genauso gut einen Stempel verwenden können.« Ohne zu zögern, schrieb er:
BUCHT VON SAN FRANCISCO: HEUTE UND AM DONNERSTAG HEITER; KEINE TEMPERATURVERÄNDERUNG; WIND AUS WEST BIS NORDWEST.
Dann tippte er die Vorhersagen für die anderen Gebiete. Es mussten noch verschiedene weitere Arbeiten erledigt werden. Soweit es den Chef betraf, war der beste Teil des Tages vorbei. Der Stundenzeiger der Bürouhr ging auf sechs zu. Draußen hatte ein schwaches Licht begonnen, die Dunkelheit zu durchdringen.
3
Der einen Tag alte Sturm zog ostwärts an der Krümmung der Erde entlang, wobei er Asien hinter sich ließ. Auf der gegenüberliegenden Erdhalbkugel schien jetzt die Sonne; der Sturm aber wirbelte über verdunkelte Gewässer. Obwohl man ihn unter seinesgleichen zu den kindlichen und kleinen zählen musste, war er doch so schnell herangewachsen, dass er bereits ein Gebiet von tausend Meilen Durchmesser beherrschte.
Um sein Zentrum bliesen die Winde in einem großen Kreislauf – gegen den Uhrzeigersinn. Im gesamten Sturmgebiet nördlich des Zentrums gab es nur wenig Wolken und Regen; trockene, kalte Winde bliesen von Osten und Norden. Die stärkste Wetteraktivität befand sich im Süden entlang der beiden Fronten, der Grenzen zwischen kühlerer und wärmerer Luft. Vom Sturmzentrum aus erstreckten sich Warmfront und Kaltfront ähnlich den zwei Schenkeln eines weit geöffneten Zirkels und bewegten sich rasch ostwärts. Das Sturmzentrum folgte ihnen. Wie eine Welle durchs Wasser läuft, ohne das Wasser mitzunehmen, so wanderten Sturmzentrum und die beiden Fronten durch die Luft, wobei sie allerdings eine geschlossene Einheit blieben.
Die südwestliche Brise, die zuerst vor dreißig Stunden in der Nähe jener Felsinsel südlich von Japan aufgekommen war, hatte sich nun zu einem gewaltigen Luftstrom von fünf Meilen Tiefe und fünfhundert Meilen Breite ausgewachsen. Oberhalb des tropischen Meeres verströmte er seine feuchtwarme Luft. Dann traf er auf die Flanke der zurückweichenden nördlichen Luft, als stieße er auf eine sanft ansteigende Gebirgskette, und schraubte sich aufwärts wirbelnd in ihr Zentrum. Beim Aufstieg kühlte er sich ab; die Feuchtigkeit verwandelte sich zuerst in Wolken, dann bald in Regen. Wie ein großes, lang gestrecktes Komma – der Kopf im Sturmzentrum, der Schweif fünfhundert Meilen nach Südosten gerichtet – fegte der durchgängige Regengürtel der Warmfront über die Meeresoberfläche.
Nicht die gesamte südliche Luftmasse erklomm jene Flanke. Ein Teil davon fiel zurück und wurde von der heranrückenden Linie der kälteren nördlichen Luft eingeholt, welche den anderen Schenkel des Zirkels, die Kaltfront, bildete. Hier schob sich die nördliche Luft gewaltsam unter die südliche. Da der Winkel viel steiler war, schoss die Warmluft empor, und die Auswirkung war nahezu explosiv. (Die alten Navigatoren der Segelschiffe kannten dergleichen als »Böenlinie«; sie fürchteten insbesondere ihre abrupte heimtückische Richtungsänderung, die so manches gute Schiff, aller Seemannskunst zum Trotz, entmastet hatte.) Über einer fünfhundert Meilen langen Schaumkronenlinie raste die Kaltfront dahin. Finstere Gewitterwolken türmten sich darüber empor. Anders als die sanfte, regenbringende Warmfront brachte ihr Durchzug die Schrecken des Sturms: Böen, prasselnde Wolkenbrüche, Hagel, Blitz und Donner, das gefürchtete Umspringen des Winds. Ihr Durchzug war heftig, aber auch schnell vorüber. Nach ein paar Minuten war die Front ostwärts weitergerollt; dahinter fielen hier und dort Starkregen, aber die Wolkendecke brach vor einem kalten, stetigen Nordwind auf, sodass sich immer größere blaue Lücken hell und klar zeigten.
4
Man hätte meinen können, die große Clipper hinge reglos zwischen Himmel und Meer. Obwohl die entfesselte Kraft von vier Motoren das Flugboot mit fast zweihundert Meilen pro Stunde vorwärtsschleuderte, bot die Weite des einförmigen Raums ringsum keinen Anhaltspunkt für die Bestimmung der Geschwindigkeit. Tief unten, viel zu tief, als dass sich einzelne Wellen abgezeichnet hätten, erstreckte sich der blaue Ozean, und kein Schiff und keine Insel unterbrach diesen Anblick. Auch das ganze Himmelsgewölbe war wolkenlos blau. Man konnte sich nur an der Sonne orientieren, jedoch bewegte sie sich schneller als das Flugzeug; richtete man sich nach der Sonne, ließ dies nur den Schluss zu, dass das Flugzeug rückwärts flog.
Obwohl sich der Navigator zuweilen dieser Täuschungen bewusst war, verwirrten sie seinen Wirklichkeitssinn niemals. In jedem Moment kannte er seine Position auf der festgelegten Route von San Francisco nach Honolulu haargenau. Zwar erstreckte sich sein Blickfeld theoretisch rund hundert Meilen in jede Richtung und deckte ein Gebiet so groß wie Irland ab, trotzdem verließ er sich nicht auf seine Sicht. Innerhalb dieses Radius befanden sich auf jeden Fall mindestens drei Schiffe, allerdings in Entfernungen, die sie dem bloßen Auge wahrscheinlich entzögen. Mit einem Fernrohr nach ihnen zu suchen, wäre genauso mühsam, wie einen verlorenen Penny auf einer Landebahn aufzuspüren. Selbst wenn er sie ausmachen würde, könnten sie ihm keine neuen Informationen liefern. Dennoch zeichnete er seinen Kurs ohne unmittelbare Hilfe des Auges vertrauensvoll auf – durch Messinstrumente und Funk.
Gleichwohl setzte der Navigator eine besorgte Miene auf. Ein Passagier hätte bei seinem Anblick vielleicht gedacht, er fürchte drohendes Unheil. Tatsächlich sorgte sich der Navigator, wie viele andere Sterbliche auch, um die monatlichen Rechnungen. Gestern Abend hatte er, anstatt epischen Gedanken über den morgigen Flug durch den leeren Raum nachzuhängen, mit seiner Frau am Esszimmertisch gesessen und mehrere Stunden über dem Familienbudget verbracht. Drei kleine Kinder mit unbestreitbarer Tendenz zu großen Mandeln und kleinen Nasennebenhöhlenöffnungen konnten einen Mann im Ungewissen lassen. In diesem Monat hatte es allerdings keine Arztrechnungen gegeben. Dafür war die Wasserrechnung hoch.
Dann lächelte er plötzlich, weil ihm einige Zusammenhänge klar wurden, die ihm am Vorabend entgangen waren. Für einen Mann seines Berufs hätte das simpel sein müssen. Solange das Pazifikhoch stabil blieb, herrschte trockenes Wetter in Kalifornien. Der Garten brauchte das Wasser, aber die Kinder benötigten keinen Arzt, um ihre Nasennebenhöhlen zu reinigen. Und noch wichtiger für die Familie war, dass sein Flug von vierzehnhundert Meilen übers offene Meer kaum gefährlicher als eine Straßenbahnfahrt war, solange sich diese Bedingungen hielten.
Er schaute nicht auf die Wetterkarte – er sah sie im Geiste deutlich vor sich. Von San Francisco zeigten die großen konzentrischen Ovale des Hochs nach Südwesten. Ein stetiger Wind wehte im Uhrzeigersinn um die Ovale. Heute verlief der Kurs südlich des Hochs, deshalb war er sicher, dass ein günstiger Rückenwind das Flugzeug mit angenehm vollen Benzintanks nach Honolulu bringen würde. Wenn die Glückssträhne anhielt, könnte er auf der Rückreise einen Kurs nördlich des Hochs mit demselben stetigen Rückenwind nehmen.
Das Nest von Ovalen auf der Wetterkarte sah öde und wenig inspirierend aus. Da er eigentlich kein Meteorologe war, hatte er keine klare Vorstellung davon, was ein »Hoch« im großen kosmischen Plan bedeutete. Doch er verfügte über ein lebhaftes Gespür für die Auswirkungen dieser Ovale auf seine Flugstrecke. Sie schoben die Stürme nach British Columbia und schenkten dem Flug nach Honolulu allgemein schönes Wetter. Außerdem erzeugten sie einen großen wohltätigen Luftwirbel, den man mit gewissem Geschick paradoxerweise sowohl für den Hin- als auch für den Rückflug nutzen konnte. Eine andere Sache war es, wenn das Hoch sich auflöste.
Vor sich erblickte der Navigator jetzt ein Schiff. Bei der Geschwindigkeit, mit der es scheinbar auf ihn zuraste, wurde ihm wieder die eigene rasche Fortbewegung des Flugzeugs bewusst.
5
Seit das Gletschereis begonnen hatte, von den Bergen zu schmelzen, sodass die Felsschroffen ihre Gestalt enthüllten, lag der stille See am Fuße der Schlucht. Niemand weiß, wer den Pass zuerst überquert hatte.