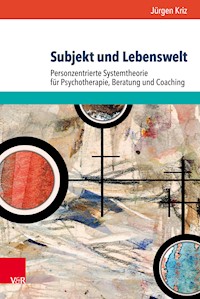
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Personzentrierte Systemtheorie von Jürgen Kriz ist eine Mehr-Ebenen-Konzeption zum Verständnis von klinischen, psychotherapeutischen, beraterischen und auf Coaching bezogenen Prozessen unter besonderer Berücksichtigung des Zusammenwirkens unterschiedlicher Ebenen (u. a. körperliche, psychische, interpersonelle und gesellschaftliche Prozesse). Es geht dabei im Kern um Fragen, •wie wir Menschen aus der unfassbaren Komplexität einer physikalisch-chemischen und informationellen Reizwelt unsere Lebenswelt mit hinreichend fassbarer, sinnhafter Ordnung erschaffen, •wie diese sich typischerweise an stets neue Bedingungen und Herausforderungen (»Entwicklungsaufgaben«) anpasst, •warum diese Adaptation aber auch partiell misslingen und sich insbesondere als überstabil und inadäquat erweisen kann – was für Probleme und viele Symptome typisch ist, •wie professionelle Hilfe unter Nutzung von Ressourcen und Selbstorganisationspotentialen gestaltet werden kann. Obwohl die Personzentrierte Systemtheorie seit 1985 in mehreren Dutzend Beiträgen für jeweils bestimmte Fragen ausgearbeitet und publiziert wurde, liegt nun erstmal eine Gesamtdarstellung vor, in welcher sowohl die systemischen Prinzipien als auch die vier zentralen Prozessebenen in ihrer Interaktion ausführlich erläutert werden. Der Ansatz versteht sich als ganzheitlich und schulenübergreifend. Allerdings wird der humanistischen Perspektive, den Menschen als Subjekt zu begreifen, ein zentraler Stellenwert eingeräumt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Gila
Jürgen Kriz
Subjekt und Lebenswelt
Personzentrierte Systemtheoriefür Psychotherapie, Beratung und Coaching
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit 54 Abbildungen und 8 Tabellen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99845-9
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
Umschlagabbildung: AZdesign/shutterstock.com
© 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen /Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.deAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlichgeschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällenbedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
Inhalt
Vorwort
1Einführung in Grundfragen der Personzentrierten Systemtheorie
1.1Zum Anliegen der Personzentrierten Systemtheorie
1.2Die Vierfalt der Verstehensperspektiven
1.2.1Der individualistisch-psychodynamisch-humanistische Fokus
1.2.2Der interpersonell-systemdynamische Fokus
1.2.3Der organismisch-körperliche Fokus
1.2.4Der gesellschaftlich-kulturelle Fokus
2Leben als Zeichenprozess – die Perspektive der Biosemiotik
2.1Die Objektivität der »Subjektivität« – oder: Die Subjektivität der »Objektivität«
2.2Der Mensch in seiner Umwelt
2.3Die Grenzen der Subjektivität
2.4Der Mensch als »Animal Symbolicum«
3Systemische Prinzipien
3.1Selbst reguliertes Missgeschick – oder: Missgeschick bei der Selbstregulation
3.2Systemtheoretische Essentials: Ein erster Überblick
3.3Prozesse: Die dynamische Sicht auf unsere dinghafte Lebenswelt
3.3.1Grundlegende Aspekte
3.3.2Die Schwierigkeit, in unserer Kultur über Prozesse zu sprechen
3.3.3Was ist eine angemessene Problemmetaphorik?
3.4Exkurs: Selbstorganisierte Strukturen in Systemen – das Konzept der Trivialisierung
3.4.1Vorbemerkung
3.4.2Erster Argumentationsschritt: Unterscheidung in »triviale Maschinen« und »nichttriviale Maschinen«
3.4.3Zweiter Argumentationsschritt: Unterscheidung in »Fremdtrivialisierung« und »Eigentrivialisierung«
3.5Rückkopplung: Die unterschätzte Wirkung im abendländischen Denken
3.5.1Grundlegende Aspekte
3.5.2Rückkopplung, Attraktor, Schema, Gestalt
3.5.3Exkurs: Attraktoren und Sinnattraktoren
3.6Bottom-up und top-down – das Verhältnis zwischen Mikro- und Makroebene
3.6.1Grundlegende Aspekte
3.6.2Gestalthafte Ganzheitlichkeit des Bottom-up
3.6.3Bottom-up- und Top-down-Dynamiken als Aspekte eines Feldes
3.6.4Komplettierungsdynamik: Die Zielgerichtetheit der Dynamik des Feldes
3.6.5Selbstorganisation und Nichtlinearität der Felddynamik
3.7System versus Umgebung und Umwelt: Worüber reden wir eigentlich?
3.8Fazit: Das Welt- und Menschenbild auf der Grundlage der systemischen Prinzipien
4Die vier zentralen Prozessebenen
4.1Die interpersonelle Prozessebene
4.1.1Exkurs: Das biosemiotische Nadelöhr der Interaktion
4.1.2»Sender« und »Empfänger« gibt es nicht bei Paaren, Familien oder Teams
4.1.3»Teufelskreise« sind keine Kreise
4.1.4Die verborgene Täterschaft in den Opfer-Narrationen
4.2Die psychische Prozessebene
4.2.1Ordnungsbildung beim Erinnern: Bartlett und sein Szenario
4.2.2Überstabilität, Ordnungs-Ordnungs-Übergänge und Hysterese bei Sinnattraktoren
4.2.3Wie Sinnattraktoren Vieldeutigkeit reduzieren
4.3Die gesellschaftlich-kulturelle Prozessebene
4.3.1Sinnattraktoren in der Kultur
4.3.2Exkurs: Genogramm – Bindeglied zwischen mikro- und makrosozialen Sinnattraktoren
4.3.3Synlogisation und Bedeutungsfelder: Die gemeinsame Kreation von Sinn
4.4Die körperliche Prozessebene
4.4.1Der Körper als Integrator von Fühlen und Denken
4.4.2Der Körper als biologische Basis unserer Lebenswelt
4.4.3Der Körper als Ort ganzheitlicher Organisation
5Die Welt des Bewusstseins
5.1Die Komplementarität von subjektiver und objektiver Sicht auf Bewusstseinsprozesse
5.2Das Subjekt in seiner phänomenalen Welt
5.3 Exkurs: Kognitive und affektive Strukturaspekte des (phänomenalen) Bewusstseins
5.4Zur Intersubjektivität und Stabilität der Lebenswelt
5.5Die »Person« in der Personzentrierten Systemtheorie
5.5.1»Person« ist nicht angeboren – aber das evolutionär vorstrukturierte Potenzial dazu
5.5.2Die »Person« bedarf gerade in ihrer Subjektivität der Kulturwerkzeuge
5.5.3»Person« als Brennpunkt unterschiedlicher Perspektiven und Prozessebenen
6Personzentrierte Systemtheorie im Kontext der Praxis
6.1Grundaspekte des praktischen Umgangs mit »Problemen«
6.1.1Was ist überhaupt ein »Problem«?
6.1.2Ein Loblied auf die Ordnung und Struktur der Alltagswelt
6.1.3Die Notwendigkeit von Ordnungs-Ordnungs-Übergängen
6.1.4Was die Ordnungs-Ordnungs-Übergänge behindert
6.1.5»Schreckliche« Instabilität als Problemüberwindung
6.1.6Berater als Begleiter durch die »Schrecken der Instabilität«
6.1.7Konsequenzen für die »Therapeutische Beziehung«
6.2Die Bühne des Bewusstseins
6.2.1Arbeit mit den formativen Kräften
6.2.2Vom Sinn zur Sinnlichkeit
6.3Von der Zukunft her denken: Intuition, Imagination und Kreativität
6.3.1Die Teleologie der Intuition
6.3.2Planen versus Imaginieren
6.3.3Zum Einsatz imaginativer Vorgehensweisen
6.3.4Über Kreativität
6.3.5Dezentrierung als Spiel-Raum für Kreativität
6.4Die Kunst angemessener Verstörung
Literatur
Verzeichnis der Abbildungen, Tabellen und Merkkästen
Personenregister
Sachregister
Vorwort
Nach über drei Jahrzehnten Arbeit an der Personzentrierten Systemtheorie wird mit diesem Buch erstmals eine Gesamtdarstellung vorgelegt. Das Erscheinen des Werkes ist nicht zuletzt vielen freundschaftlich-hartnäckigen Nachfragen und Ermunterungen aus den letzten Jahren zu verdanken. Nachdem ich rund fünfzig Artikel und Buchkapitel zur Personzentrierten Systemtheorie veröffentlicht habe – allerdings fokussiert auf jeweils bestimmte Aspekten und Fragestellungen – war ich selbst im Zweifel, ob Kraft und Aufwand für ein solches Buchprojekt wirklich gerechtfertigt wären.
Hinzu kommt, dass es für die eher an Praxis ausgerichteten Bedürfnisse, etwas über systemisches Denken und Arbeiten zu erfahren, ausgezeichnete Werke gibt – allen voran das Lehrbuch von von Schlippe und Schweitzer (2016), das in vielen Auflagen seit zwei Jahrzehnten fundiert über das Spektrum systemischer Ansätze informiert, ferner der stark an einer synergetischen Sicht der Systemtheorie orientierte Band von Haken und Schiepek (2010) sowie ein Buch von Rufer (2012), das systemische Theorie und konkrete Fallpraxis verbindet.
Doch trotz vieler weiterer guter und informativer Werke ist es wohl keine Anmaßung zu behaupten, dass dem zentralen Anliegen der Personzentrierten Systemtheorie bisher nicht hinreichend konsequent nachgegangen wurde: Es geht darum, die für Psychotherapie, Beratung und Coaching relevanten Prozesse ohne vorschnelle Reduktion auf einzelne Aspekte möglichst in ihrer Ganzheitlichkeit nachzuzeichnen und so deren Verständnis zu erhöhen. Die Personzentrierte Systemtheorie versteht sich dabei nicht »integrativ« – denn es wird nichts zusammengefügt –, sondern sie bemüht sich, in einem ohnedies ganzheitlichen Geschehen möglichst wenig systematisch auszublenden, auch wenn in der Darstellung aufgrund der Komplexität dieses ganzheitlichen Geschehens jeweils einzelne Perspektiven fokussiert werden müssen.
Es geht in diesem Buch somit um eine Einladung, sich auf die Komplexität des Geschehens einzulassen, das nun einmal unser Leben als Subjekt in der heutigen Lebenswelt ausmacht. Ich bin überzeugt davon, dass eine größere Bereitschaft, sich auf diese Komplexität einzulassen, nicht nur die inhaltlichen und theoretischen Grabenkämpfe zwischen »Richtungen« befrieden könnte, weil die Würdigung für die Perspektiven der anderen dann leichter fällt. Aus einer solchen ganzheitlichen Sicht lässt sich zudem leichter jene Vorgehensweise im jeweils konkreten Fall entwickeln, die jenseits von »Schulengrenzen« der spezifischen Situation (aus Patient- bzw. Klienten-, Problem- bzw. Störungs- und Beschwerdelage, Entwicklungsmöglichkeiten, eigenen Vorlieben und Ressourcen usw.) gerecht wird.
Es ist dies ein Buch, das der Informationsstruktur von 160-Zeichen-Einheiten (SMS) und dem Lernerfolg in Form von reproduzierbaren Sätzen, die sich zum Training in Tutorien für das Bestehen eines Multiple-Choice-Tests eignen, zuwiderläuft. Es ist vielmehr gedacht für Menschen, die wie ich das Anliegen haben, dem Geschehen in Psychotherapie, Beratung und Coaching tiefer auf den Grund zu gehen und die komplex verwobenen Teilaspekte in ihrem Zusammenwirken besser zu verstehen.
Dass dies möglich ist, wurde an etlichen Leserinnen und Lesern, die sich darauf eingelassen haben, erprobt – und beruht letztlich auf intensiven Diskussionen über die Art der Darstellung. Ich fühle mich daher nicht nur zahlreichen Menschen, von denen ich auf diese und andere Weise lernen konnte, zu Dank verpflichtet, sondern auch jenen, die hartnäckig und unermüdlich zur Verbesserung und Erhöhung der Lesbarkeit des Textes beigetragen haben. Besonders hervorheben möchte ich neben meiner Frau Gila und Tochter Sarah – beide als Journalistin bzw. Redakteurin für diese Aufgabe bestens geeignet – Jörg Clauer, Wolfgang Loth und für seine vielen langen Mails um den halben Erdball mit Hunderten Anmerkungen aus der Sicht eines Topmanagers, aber therapeutisch Fachfremden, Ralf Lisch.
Es hat sich gezeigt, dass die etwas ungewöhnliche Struktur für einen Text aus dem Bereich der Psychologie im Interesse der Leser hilfreich ist: Üblicherweise sind viele Fußnoten höchst unwillkommen – entweder man sagt es im Text oder lässt es. Um allerdings trotz der Komplexität der Anschlussstellen an zahlreiche relevante Diskurse den Text gut leserlich zu halten, wurde hier von dieser Regel abgewichen und vieles in Fußnoten ausgelagert. Diese sind zum Verständnis der Hauptargumentationslinien nicht unbedingt wichtig. Allerdings wäre es für viele eine Verarmung – wie mir bestätigt wurde –, diese ganz wegzulassen. Dies soll den unterschiedlichen Bedürfnissen von Lesern (gegebenenfalls zu unterschiedlichen Zeiten) entgegenkommen.
Ein Hinweis zum Thema Gender: Ich bin mir der Unzulänglichkeit unserer Sprache bewusst, zwischen geschlechtsunspezifischen und sogenannte »männlichen« Bezeichnungen zu differenzieren. Trotz Bemühen um eine neutrale Ausdrucksweise (z. B. »Angehörige beratender Berufe«), ist dies nicht überall möglich, weshalb auch hier gelegentlich von »Beratern«, »Klienten« etc. gesprochen bzw. geschrieben wird. Alle mir bekannten Alternativen – von denen ich bisweilen Gebrauch mache – erscheinen mir gestelzt und gekünstelt. »Berater«, »Klienten« etc. sind als geschlechtsneutrale Bezeichnungen gemeint – d. h. »Frauen« sind nicht »mitgemeint«, weil eben auch keine »Männer« gemeint sind (und es geht auch um keine anderen, nicht genannten, biologischen, sozialen, ökonomischen oder sonstigen Eigenschaften, Rassen oder Ethnien): Es geht um Menschen, die Bestimmtes tun, denken, meinen und dabei gegebenenfalls bestimmte Rollen einnehmen – oder eben auch nicht.
1Einführung in Grundfragen der Personzentrierten Systemtheorie
1.1Zum Anliegen der Personzentrierten Systemtheorie
Die Personzentrierte Systemtheorie ist aus dem Bedürfnis heraus entstanden, die vielfältigen Prozesse und Einflüsse, welche in den unterschiedlichen Ansätzen zu Psychotherapie, Beratung und Coaching jeweils thematisiert werden, in ihrer wechselseitigen Vernetzung zu verstehen.1 Denn wer professionell im Bereich von Psychotherapie, Beratung und Coaching tätig ist, der erlebt die Komplexität eines Geschehens, das durch vielfältige, miteinander verschränkte Einflüsse bestimmt ist. Selbst wenn er nur einen einzelnen Menschen ins Auge fasst, der ihn um Hilfe bittet, sieht er sich schnell mit einem schwer durchschaubaren Spektrum von interagierenden Wirkaspekten konfrontiert. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Entstehung und Aufrechterhaltung von Symptomen oder Problemen als auch hinsichtlich der von ihm zu unterstützenden Veränderungsmöglichkeiten.
Kommt beispielsweise eine junge Frau wegen einer »Magersucht«2 zu ihm, so stellen sich Fragen über ihr Essverhalten, über ihr inneres Körperschema, über Art und Ausmaß des Leidendrucks, über das körperliche Erleben und dessen Bedeutung, über den Beitrag der Familie (u. a. Vater, Mutter, Freund) zur Entwicklung und Aufrechterhaltung dieses Verhaltens, über ihre eigene Sicht dieser Zusammenhänge sowie über die Konzepte von »Krankheit«, »Gesundheit«, »Körperideal«, »Therapie« und darüber, was diese Konzepte in der Familiengeschichte und der Subkultur bedeuten – um nur weniges zu benennen.
Diese Vielfalt an Fragen wird gewiss nicht geringer, wenn man mit Familien oder Teams arbeitet. So stellen sich zwar inhaltlich andere Fragen, wenn man überlegt, was alles mit dem Problem »Mobbingverhalten« in einem kleinen Team, das um Coaching bittet, zusammenhängt. Doch diese Fragen führen zu einem ebenso komplexen Gesamtbild wie oben bei der »Magersucht«. So geht es um das Verhalten des »Gemobbten« und die der anderen, um die unterschiedlichen Sichtweisen des Geschehens, um die dahinterstehenden Bedürfnisse nach Anerkennung, Achtung, Gleichheit, Gerechtigkeit, Macht, Solidarität und Kooperation, um das betriebliche Gesamtklima, die Tradition des Teams und der Firma, die Arbeitsvorgaben, die wirtschaftliche Konkurrenzsituation und ihre Bedeutung, um Stress, Krankheitstage und Fehlzeiten – um wieder nur wenige Aspekte zu nennen.
Wenn man diese (und viele weitere) Aspekte des ganzheitlichen Zusammenwirkens ordnen will, macht es Sinn, zumindest zwischen vier Prozessebenen zu unterscheiden, die man grob als körperliche, psychische, interpersonelle und kulturelle Prozessebene kennzeichnen kann. In der praktischen Arbeit wird man zwar primär auf die psychischen und interpersonellen Prozesse und deren wechselseitige Einflüsse fokussieren. Doch es sollte klar sein, dass diese Vorgänge durch Prozesse sowohl auf der kulturellen als auch auf der körperlichen Ebene erheblich mitbeeinflusst werden: Zum einen geht es dabei um gesellschaftliche bzw. makrosoziale Strukturen, die über formale Regeln, z. B. in Form von Gesetzen, hinaus vor allem als informelle Ordnungen in Form von Metaphern, Erklärungsprinzipien, Anstandsregeln, Geschichten, Verstehensweisen etc. unser tägliches Leben mitstrukturieren. Zum anderen geht es um die Einflüsse von Affekten, Stimmungen, Befindlichkeiten, Bedürfnisse und weiteren vom vegetativen System moderierten Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensstrukturen auf unser Erleben.
Auch wenn man in der praktischen Arbeit kaum direkt die makrosozialen Strukturen beeinflussen kann oder – mit Ausnahme der Körperpsychotherapeuten – direkt auf den Körper als Organismus einwirken wird: Die Einflüsse aus kulturellen sowie aus körperlichen Prozessen gestalten in jedem Augenblick – quasi als Rahmung – das psychische und interpersonelle Geschehen mit. Und es sollte andersherum ebenso klar sein, dass der Mensch mit seinen psychischen und interpersonellen Prozessen in seine ihn umgebenden kulturellen Strukturen hineinwirkt – etwa durch die Wahl seiner Wohnung, Möbel und Bilder, seiner Kleidung, Literatur und Informationsmedien, seiner Arbeitswerkzeuge und Fahrzeuge usw. Und genauso gehen ständig vom psychischen und interpersonellen Geschehen formierende Einflüsse auf die Körperprozesse und -strukturen aus.
Welche Prozessebene man daher auch immer aus dem komplexen Gesamtgeschehen für die Betrachtung analytisch ausgliedert: Es ist zu berücksichtigen, dass die Prozesse der jeweils anderen Ebenen ihre Einflüsse ausüben und damit zur Stabilisierung oder zur Veränderung der als symptomatisch oder problematisch empfundenen Strukturen beitragen. Zwar ist klar, dass man diese nur andeutungsweise skizzierte Komplexität miteinander verwobener Wirkungen im Gesamtgeschehen nicht »im Kopf haben« oder im Detail berücksichtigen kann. Es sollte aber genauso klar sein, dass eine systematische Ausblendung einzelner Bereiche schwerlich dem Geschehen gerecht werden kann.3
Neben der Konfrontation mit der Komplexität des Geschehens machen professionelle Helfer die Erfahrung, dass die Abläufe und Veränderungen sowohl grundsätzlich als auch in Form von Wirkungen auf ihre Vorgehensweisen typischerweise nichtlinear verlaufen. Stellen wir uns die Aufgabe vor, Additionen vierstelliger Zahlen (z. B. in der Buchhaltung) durchzuführen: Sofern man in zehn Minuten fünfzig Additionen schafft, kann man davon ausgehen, dass man grob nach einer Minute fünf, nach zwei Minuten zehn und nach sieben Minuten 35 erledigt hat. Bei der Lösung eines komplizierten Problems, bei dem einem nach zehn Minuten plötzlich – mit einem inneren »Aha!« – die Lösung einfällt, war es ganz sicher nicht so, dass nach einer Minute 1/10, nach zwei Minuten 2/10 und nach sieben Minuten 7/10 der Lösung »im Kopf« war. Vielmehr war lange Zeit nichts bzw. spannungsreiche Verwirrung, aus der dann plötzlich die Lösung deutlich wurde (Weiteres in Abschnitt 3.6.5). Weder Therapien, Beratung oder Coaching noch sonstige Entwicklungen im menschlichen Leben verlaufen linear wie die Abarbeitung der Rechenaufgaben, sondern meist nichtlinear wie die Problemlösung.
Das oben anhand von zwei Phänomenen – »Magersucht« und »Mobbing« – nur grob skizzierte komplexe Geschehen in Psychotherapie, Beratung und Coaching erfordert noch eine weitere Differenzierung. Es geht um die Perspektive, die wir einnehmen, wenn wir »die Welt« beschreiben, im Kontrast zur Perspektive, die wir einnehmen, wenn wir »die Welt« unmittelbar erleben.4 Wie immer wir auch im obigen Beispiel das Geschehen »objektiv« beschreiben, das mit der »Magersucht« zu tun hat: Dies ist ein deutlich anderer Blickwinkel als das »subjektive« Erleben der Patientin, »magersüchtig« zu sein oder sich von der Mutter bevormundet zu fühlen. Das wird schon daran deutlich, dass ein Arzt zwar auf Gewichtstabellen und objektive Körperbefunde als Zeichen ihrer »Magersucht« verweisen kann – trotzdem fühlt und sieht sich die Patientin als »zu dick« und nimmt dafür ihr wahrgenommenes Spiegelbild und inneres Körperschema ebenfalls als Zeichen. Analog gilt dies für das innere, »subjektive« Erleben des »Gemobbten« im Unterschied zu allen »objektiven« Beschreibungen. Was er als Zeichen für »Missachtung« und »Mobbing« erlebt, ist für die Kollegen vielleicht ein Zeichen für übergroße »Empfindlichkeit«, »Realitätsverlust« oder mangelnde Einsicht in »Notwendigkeiten« des Betriebsablaufes. Für den »objektiven« Beobachter von außen schließlich mag alles ein Zeichen für fehlende »Kohärenz« im Team und mangelnde »Führungskompetenz« des Teamleiters sein.
Will man das komplexe Geschehen in Psychotherapie, Beratung und Coaching besser verstehbar und durchschaubar machen, so muss man die skizzierten drei zentralen Aspekte hinreichend berücksichtigen:
1.die vier Prozessebenen in ihren Interaktionen zur Stabilisierung bzw. zur Veränderung von Symptomen bzw. Problemen,
2.den typisch nichtlinearen Verlauf von Entwicklungen,
3.die Komplementarität von »subjektiven« und »objektiven« Perspektiven.
Ein dafür schlüssiges und umfassendes Konzept zur Verfügung zu stellen, ist das Hauptanliegen der Personzentrierten Systemtheorie.
Gerade der zuletzt genannte, 3. Aspekt hat dazu beigetragen, dass dieses Buch »Subjekt und Lebenswelt« betitelt wurde. Im Kontrast zur vorherrschend naiv-realistischen, vermeintlich »objektiv« richtigen Erfassung und Beschreibung des Geschehens im bio-psycho-sozialen Bereich wird hier versucht, gerade auch der Perspektive des Menschen als Subjekt Rechnung zu tragen. Dazu gehört auch, die biosemiotische Sicht zu berücksichtigen – wo immer dies möglich und angesagt erscheint. Diese biosemiotische Sicht wird in Kapitel 2 ausführlich erläutert und besonders in Kapitel 5 weiter ausgeführt. Dazwischen liegen zwei Kapitel, in denen die grundlegenden systemischen Prinzipien (Kapitel 3) und deren Bedeutung für die vier Prozessebenen (Kapitel 4) dargestellt werden. Schließlich wird in Kapitel 6 exemplarisch diskutiert, wo diese Konzepte im Rahmen von Praxis eine Rolle spielen.
In der Komplementarität aus subjektiver und objektiver Sichtweise betont somit der Titel »Subjekt und Lebenswelt« die subjektive Perspektive; unter einer objektiven Perspektive würde man von »Person und Kultur/Gesellschaft« sprechen.
Manche Leser lieben es, möglichst zu Beginn zumindest eine kurze explizite Definition der Hauptbegrifflichkeit zu finden – hier also von »Personzentrierter Systemtheorie«. Obwohl beide Teilbegriffe später noch ausführlich erläutert werden – »Person« in Unterkapitel 5.5 und »Systemtheorie« in 3.2 – soll diesem Bedürfnis mit einer kurzen Kennzeichnung nachgekommen werden. Diese ist notwendigerweise sehr kompakt und setzt die Kenntnis einiger Termini und Konzepte voraus (weshalb man bei Verständnisschwierigkeiten diese Definitionen zunächst gerne überspringen darf).
Definition
Personzentrierte Systemtheorie
Mit dem ersten Begriffsteil »Person« betont die Personzentrierte Systemtheorie ihre humanistische Perspektive auf den Menschen, der als »Person« immer nur und immer schon im Zusammenwirken des Individuums mit seiner sozialen Mitwelt in einem Kontext evolutionärer, bio-psycho-sozialer und soziogentischkultureller Entwicklungsdynamik gesehen werden kann und muss. Zentrale Aspekte wie Sinn, Bedeutung oder Kohärenz finden auf der Ebene personaler Prozesse statt – auch wenn diese ganz erheblich durch soziale Prozesse in ihrer biografischen und historischen Dynamik beeinflusst werden.
Mit dem zweiten Begriffsteil »Systemtheorie« verweist die Personzentrierte Systemtheorie darauf, dass die Beschreibung und Erklärung dieser hochkomplexen Interaktion vor allem Prinzipien folgt, wie sie – ausgehend von der Gestaltpsychologie der Berliner Schule vor rund hundert Jahren – heute für die interdisziplinäre Systemtheorie6 typisch ist: Im Gegensatz zu klassischen Ursache-Wirkungs-Modellen, die auf unabhängigen versus abhängigen Variablen, linearer Kausalität und instruktivem Interventionismus durch externe Ordnungen beruhen, geht es hier um vernetzte Variablen, die selbstorganisiert Strukturen bilden und verändern, wobei nichtlineare Entwicklungssprünge typisch sind. Im Zentrum steht die Förderung inhärenter Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, indem die Bedingungen verändert werden, welche die leidvollen Strukturen stabilisiert haben.
1.2Die Vierfalt der Verstehensperspektiven
In diesem Unterkapitel soll die Wichtigkeit der Berücksichtigung aller vier Prozessebenen der Personzentrierten Systemtheorie weiter erläutert werden. Beginnen wir dazu mit drei fiktiven, aber prototypischen Vignetten, wie sie typischerweise in Therapie (A), Beratung (B) und Coaching (C) zu finden sind:
Fallvignette
ABettina (7) wird von ihrer Mutter »wegen Angst« in der psychotherapeutischen Ambulanz vorgestellt: Bettina geht seit drei Monaten zur Schule. Sie fühlt sich zunehmend unwohl und beginnt inzwischen schon auf dem Schulweg, auf dem sie von ihrer Mutter begleitet wird, zu zittern – und zwar so stark, dass die Mutter mit ihr gelegentlich umkehren muss. Der Arzt habe vor einigen Wochen bereits »Oxazepam«7 verschrieben, aber es sei nicht wirklich besser geworden, sagt die Mutter.
BEin Elternpaar kommt mit ihrem Sohn Julian (12) in die Beratungsstelle. Grund ist, nach Aussage des Vaters, die »Verhaltensstörung« von Julian. Dauernd stelle er irgendetwas an, ärgere permanent seine Schwester (9), und auch der Klassenlehrer beschwert sich, dass Julian als »Klassenclown« zunehmend auffalle.
CManfred (32) wendet sich an einen Coach, weil er sich »nahe an einem ›Burnout‹ fühle«. Seit 15 Monaten sei er im gehobenen Management einer Firma tätig, mit vielen Überstunden, aber eigentlich nicht mehr als bei seiner Firma zuvor. Im Team aber »stimmt es einfach nicht«. Man arbeite dort eher gegeneinander. Wenn überhaupt Gemeinsamkeit da sei, dann eher die anderen gegen ihn – das sei schon fast »Mobbing«. Sein Arzt habe nichts gefunden und tippe auf eine leichte Depression. Allerdings sehe er sich nicht als Fall für eine Psychotherapie: Allein schon, weil er befürchten müsse, dass er dann mit einem hohen Risikozuschlag bei der privaten Rentenversicherung zur Kasse gebeten werde.
Für eine wirklich differenzierte Fallerörterung bräuchte man sicherlich mehr Information, als in diesen kurzen Vignetten skizziert wird. Dass daher Fall 1 der Psychotherapie, Fall 2 der Beratung und Fall 3 dem Coaching zugeordnet wird, ist ein wenig willkürlich – dies entspricht aber durchaus den Überlappungen der Berufsfelder, die sich bio-psycho-sozialen Problemen widmen. Alle drei Vignetten könnte man einerseits so um Symptome bereichern, dass eine ICD-Diagnose »Psychotherapie« indiziert wäre. Andererseits könnte in allen drei »Fällen« auch (zumindest zunächst) eine Beratungsstelle aufgesucht werden. »Coaching« bleibt allerdings für Vignette 3 vorbehalten, weil dieser Begriff meist auf berufliche Kontexte bezogen wird und beispielsweise die Arbeit mit Kindern recht untypisch für Coaching wäre.8
Für die folgende Diskussion kommt es allerdings nicht darauf an, in welchem Ausmaß sich Psychotherapeuten, Berater und Coaches vor allem durch ihre spezifische Ausbildung und Stellung im professionell und institutionell strukturierten psychosozialen Bereich unterscheiden. Im Gegenteil: Es geht darum, zu zeigen, dass jeweils in allen drei Bereichen unterschiedliche Perspektiven zum Verständnis des Geschehens herangezogen werden können. Obwohl je nach genauerer Fragestellung und Präzisionsgrad der Analyse recht viele unterschiedliche Perspektiven dienlich sein können (Kriz, 2010c), werden in diesem Buch immer wieder vier zentrale Prozessebenen hervorgehoben: die psychische Ebene (1.), die interpersonelle Ebene (2.), die beide typischerweise in die Arbeit einbezogen werden. Doch diese sind, wie ausführlich gezeigt werden wird, einerseits in (3.). organismische bzw. körperliche und andererseits (4.) in makrosoziale bzw. kulturelle Prozesse eingebettet.
Da es hier zunächst um eine einführende Darstellung geht, werden die Perspektiven zur Verdeutlichung mit Mehrfachbegriffen belegt. Damit soll auch eine unangemessene begriffliche Überpräzisierung vermieden werden, d. h. die Fixierung auf einen »richtigen« Begriff in einer noch keineswegs trennscharfen kognitiven und diskursiven Landschaft.
1.2.1Der individualistisch-psychodynamisch-humanistische Fokus
Unter einer solchen Perspektive würde man besonders darauf schauen, ob und wo zwischen unterschiedlichen Motiven, Wünschen und Bedürfnissen bedeutsame Konflikte bestehen. Deren Ursprung wird meist in der (frühen) Biografie vermutet, wo der Mensch unterschiedliche Entwicklungsschritte zur Anpassung an die Anforderungsstruktur seiner sozialen und materiellen Umwelt leisten muss.
Fallvignette
Dies könnte – als jeweils ein Aspekt und sehr verkürzt skizziert – bei Bettina im Fallbeispiel das Bedürfnis sein, noch umsorgt und behütet zu werden, aber gleichzeitig der Mutter darin gefallen zu wollen, schon ein großes Mädchen zu sein, das autonom zur Schule geht, und »die Zähne zusammenbeißen« kann, um mit dem Problem fertigzuwerden. Bei Julian könnte es der Wunsch nach Aufmerksamkeit sein und die Idee, etwas Besonderes sein zu wollen, ohne die entsprechenden Leistungen bringen zu wollen oder zu können. Und bei Manfred könnte es vor allem die erfahrungsbedingte »Leid«-Idee sein, nur dann gemocht zu werden, wenn er sich im Beruf und auch sonst für andere aufopfert – egal wie ausgepowert er selbst ist. Die fehlende Anerkennung im neuen Job lässt ihn mehr des Gleichen tun, wobei er seine Überforderung und Erschöpfung ignoriert oder zumindest herunterspielt.
In der detaillierten therapeutisch-beraterischen Arbeit würden sich dann gegebenenfalls jeweils weitere und differenziertere Aspekte ergeben, aufgrund derer die Berater entsprechend ihren schulenspezifischen Konzepten helfende Kompetenzen entfalten.
Doch selbst in dieser eher oberflächlichen Kurzform wird deutlich, dass auch ganz andere Begründungen möglich wären, als nur auf die Person und ihre inneren Konflikte zu schauen. Denn jedes menschliche »Individuum« ist mit all seinen Strukturen des Wahrnehmens, Erlebens und Verhaltens stets auch in soziale Interaktionen eingebettet. Diese können, im Guten, sowohl die Veränderung unpassender (Er-)Lebensstrukturen und Bewältigung eines anstehenden Entwicklungsschrittes unterstützen als auch, im Schlechten, zu deren Aufrechterhaltung beitragen.
1.2.2Der interpersonell-systemdynamische Fokus
Blickt man aus dieser Perspektive auf die drei Vignetten, so könnte man – wieder als jeweils nur ein Aspekt und sehr verkürzt – skizzieren:
Fallvignette
Bei Bettina wird das Problem dadurch stabilisiert, dass die Mutter sie quasi damit belohnt, indem sie mit ihr umkehrt. Bettina erfährt so die Fürsorge der Mutter, spürt vielleicht auch ihre Macht in dieser Situation und braucht sich der Herausforderung durch die Schule nicht zu stellen.
Bei Julian könnte es sein, dass seine Auffälligkeiten oft Gegenstand gemeinsamer Gespräche über Maßnahmen und gegebenenfalls sogar Bestrafungen zwischen den Eltern sind, während diese sonst einen subtilen Ehekrieg führen. Ärger mit den Eltern und vielleicht gar Strafen sind zwar für Julian schlimm, aber noch schlimmer ist es, den zermürbenden Streit zwischen den Eltern hilflos miterleben zu müssen. Endlich kann er durch sein Verhalten bei diesen etwas Gemeinsames erleben und sehen, wie sie an einem Strang ziehen. Vielleicht wird auch Julians Befürchtung, dass die Familie auseinanderfallen könnte, durch diese Gemeinsamkeit etwas gedämpft.
Manfred schließlich wurde sicherlich für sein »aufopferndes« Verhalten bisher von vielen anderen Menschen beachtet, gelobt und gemocht: Jemand, der stets nett, hilfsbereit und ohne große eigene Ansprüche daherkommt, ist für viele ein angenehmer und »praktischer« Mitmensch. Bisher konnte er dies auch für seine Karriere nutzen. In der neuen Firma bzw. im aktuellen Team aber herrschen andere Strukturen vor. Vielleicht ist einigen auch die als merkwürdig empfundene Betriebsamkeit von Manfred suspekt und sie fühlen sich selbst in ihren bisherigen Arbeitsabläufen bedroht. Statt also Anerkennung zu zollen, reagieren sie unwirsch und tauschen sich über das merkwürdige Verhalten aus (was Manfred als »Fast-Mobbing« beschreibt). Doch obwohl Manfred in den aktuellen Arbeitsbeziehungen kaum noch durch Lob und Anerkennung in seinem »aufopfernden« Verhalten bekräftigt wird, ist es in solchen Konstellationen nicht selten, dass er sich nun noch mehr anstrengt, die Menschen durch besondere Leistungen und besonderes Zuvorkommen gewinnen zu wollen: Denn dies ist das einzige Muster, das er kennt. Er greift zur ebenso bekannten wie erfolglosen Strategie: »mehr des Gleichen«. Dies aber vergrößert die eigene Überforderung und führt, bei gleichzeitiger Nichtanerkennung durch die anderen, zum Grundmuster eines Burn-out: chronisch überforderter Verschleiß eigener Ressourcen.
Man kann wohl davon ausgehen, dass die meisten Therapeuten, Berater und Coaches mindestens diese beiden Prozessebenen berücksichtigen und dass ihnen klar ist, dass man die eine Perspektive nicht gegen die andere ausspielen kann: Egal was sich noch an detaillierten Informationen ergeben würde, die Prozesse auf beiden Ebenen, der psychischen und der interpersonellen, spielen stets zusammen. Und selbst in der skizzenhaften Kürze der Vignetten wird deutlich, dass eine Veränderung der intrapersonalen Prozesse dadurch erschwert werden kann, dass interpersonelle Prozesse für eine Stabilisierung sorgen. Dies gilt freilich auch umgekehrt: Das für Manfred typisch gewordene Verhalten, mit überschwänglicher Betriebsamkeit und fast übergriffiger Fürsorge Beachtung und Anerkennung gewinnen zu wollen, wird die Interaktionsdynamik in diesem Team nicht abschwächen, sondern eher stabilisieren.
»Mehr des Gleichen« ist eine typische »Leid-Idee«, bei der ehemals erfolgreiche Vorgehensweisen auch dann beibehalten werden, wenn sich die Bedingungen geändert haben. Sie sind nun zwar nicht oder weit weniger erfolgreich, aber statt nach neuen Wegen zu suchen, wird der gleiche Weg nur noch intensiver verfolgt. Die Gründe für eine solche Überstabilisierung werden wir im Abschnitt 4.2.2 genauer untersuchen. Auch Julian würde vielleicht nur noch mehr Energie in seine »Verhaltensstörung« stecken, wenn die Aufmerksamkeit der Eltern nachließe, und Bettina würde sich nun ohne die Mutter vermutlich gar nicht mehr auf den Schulweg begeben.
Geht man nun der Frage nach, welche weiteren Einflüsse auf die psychischen und interpersonellen Prozesse stabilisierend oder aber verändernd wirken könnten, so liegt es nahe, zumindest noch zwei weitere Prozessebenen mitzuberücksichtigen: Zum einen die Ebene der körperlichen Prozesse, zum anderen solche (makro)sozialen Prozesse, welche über die (Mikro-)Prozesse in den Face-to-Face erfahrbaren Interaktionssystemen (Familie, aber auch Firma, Schule, Sportgruppe) hinausgehen. Diese Ebene der makrosozialen Prozesse bezeichnen wir gemeinhin mit Gesellschaft und Kultur.
1.2.3Der organismisch-körperliche Fokus
Bettinas Zittern, Julians Hyperaktivität und Manfreds »Abgeschlagenheit« verweisen bereits bei oberflächlicher Betrachtung auf Prozesse der körperlichen Ebene. Statt von »Körper« werden wir allerdings meist lieber von »Organismus« sprechen, weil in der verheerenden Auswirkung9 der Philosophie von René Descartes (1596–1650) der menschliche »Körper« auch in Medizin und Psychologie allzu lange und zu einseitig als ein mechanistisch funktionierender Apparat aus materiellen Bestandteilen verstanden wurde. Diesem mechanistischen Verständnis von »Körper« wurde bereits im 17. Jahrhundert durch Georg Ernst Stahl (1659–1743) das Konzept des »Organismus« entgegengestellt: Mit Schriften (Stahl, 1695–1714, dt. 1961) wie »Über die Bedeutung des synergischen Prinzips für die Heilkunde« (1695) oder »Über den Unterschied zwischen Organismus und Mechanismus« (1714) betonte er nicht nur ein systemisches Zusammenwirken der Organe im »Organismus«, sondern auch die Wechselwirkung zwischen psychischen und somatischen Prozessen. Stahl kann damit durchaus als ein sehr früher Psychosomatiker gesehen werden.10
Fallvignette
Angesichts der oben angeführten Aspekte auf der psychischen und besonders auf der interpersonellen Prozessebene lassen sich die Prozesse auf der organismischen Ebene – besonders wenn sie von allen Beteiligten wahrgenommenen werden – auch unter dem Aspekt der »Funktionalität« im Gesamtgeschehen betrachten: »Zittern«, »Hyperaktivität« und »Abgeschlagenheit« sind ja nicht nur unmittelbarer Ausdruck innerorganismischer Vorgänge, sondern sie dienen gleichzeitig als Zeichen und Botschaften an andere (und in der Reflexion: auch jeweils an sich selbst): »Schaut her, so hilflos bin ich!«, sagt Bettina mit ihrem Körper. Manfreds Erschöpfung signalisiert gleichzeitig: »So sehr habe ich mich für euch aufgeopfert!« Und Julians »Verhaltensstörung« und »Hyperaktivität« weisen darauf hin: »Nehmt mich wichtig, mit meinem Verhalten, und nicht nur euren Streit, der alles zu dominieren und zu vereinnahmen scheint.«
Dabei sind die Anteile von »rein« organismischem Geschehen einerseits und von Appell an andere sowie an sich selbst andererseits kaum zu trennen. Jeder kennt wohl, wie in unserer Kultur akzeptiert wird, wenn jemand »wirklich« körperlich erkrankt ist – z. B. an Grippe oder schweren Erkältung – und deswegen ein paar Tage zu Hause bleibt. Während hingegen eine Begründung »Ich muss jetzt mal ein paar Tage zu Hause bleiben, weil ich mich überarbeitet fühle und mein Immunsystem wieder auf Trab bringen will, bevor ich mir eine Grippe einfange« deutlich weniger bis gar nicht auf Verständnis stößt. Also gehen viele auch dann zum Arzt und lassen sich krankschreiben, wenn es unter rein somatischen Gründen nicht unbedingt notwendig wäre. Und da es ja nicht um (»subjektive«) Befindlichkeiten, sondern um (»objektive«) Befunde geht, wird man sich auf solche konzentrieren. Dies führt nicht selten dazu, dass man diese dann selbst für bare Münze nimmt. Man gibt sich nicht nur gegenüber anderen als krank aus, sondern fühlt sich gleichzeitig auch selbst so – kränker jedenfalls, als man sich bei der gleichen »somatischen« Konstellation dann fühlen würde, wenn man erfreuliche Tätigkeiten oder einen subjektiv sehr wichtigen Projektabschluss in Aussicht hat.
Auf der anderen Seite kann man gerade auf der organismischen Prozessebene nicht nur die Vernetzung zu Aspekten auf anderen Ebenen gut beobachten, sondern auch deren Eigendynamik: Fühlt sich jemand erst einmal körperlich stark überlastet, geschwächt und beeinträchtigt, so ist durchaus die Tendenz vorhanden, sich »gehen zu lassen«. Gerade bei älteren Menschen kommt es beispielsweise dann nicht selten vor, dass sie ihren Körper zu wenig fordern – wodurch die Muskeln weiter erschlaffen. Das kann so weit gehen, dass sie sich nur noch im Lehnstuhl, Rollstuhl oder gar im Bett aufhalten – obwohl ihnen eigentlich nichts weiter fehlt als eben eine körperlich aufbauende Beanspruchung. Ist die Muskulatur aber erst einmal so massiv geschwächt und abgebaut, so reicht eben nicht mehr die einfache Entscheidung: »Ab morgen will ich wieder laufen.« Solche körperlichen Eigendynamiken finden wir beispielsweise auch bei manchen Substanzabhängigkeiten, die nicht einfach und schlagartig veränderbar sind, selbst wenn die Einsicht in der Beratung, dies ändern zu wollen, sich gegebenenfalls sehr schnell einstellen mag.
Als umfassenderes Beispiel sei die Manifestation biografischer Erfahrung in der kindlichen Entwicklung genannt: So kann das Verbot von starken Gefühlsäußerungen – oder deren Nichtverstehen und Entwertung – dazu führen, dass der Atem flach gehalten und dafür die entsprechende Muskulatur im Brustbereich besonders beansprucht wird. Handelt es sich nicht nur um wenige Situationen, sondern um eine typische Struktur in den Entwicklungsbedingungen des Kindes, so wird es ebenso typisch diese Muskulatur beanspruchen und es kommt zu einer chronischen Ausbildung von dem, was Bioenergetiker seit Reich und Lowen als »muskuläre Panzer« bezeichnet haben. Diese »Panzer« aber halten wiederum auch dann noch den Atem flach und behindern ein intensives emotionales Erleben, wenn sich die eigentliche Konstellation längst verändert und das Kind erwachsen geworden ist und das Elternhaus verlassen hat. Auch hier können somit körperliche Eigendynamiken in ganz andere zeitliche Interaktionszusammenhänge hineinwirken als jene, unter denen sie zunächst entstanden sind.
Die Beachtung solcher Eigendynamiken auf der Ebene des Organismus ist deshalb wichtig, weil eine Veränderung der psychischen und der interpersonellen Prozesse keineswegs immer zeitgleich mit einer Veränderung der organismischen Prozesse einhergeht. Vielmehr können organismische Veränderungen weit beschwerlicher sein und langsamer vonstattengehen als eine Veränderung auf anderen Prozessebenen – auch dann, wenn diese eng miteinander vernetzt sind. Das gilt auch für die drei Fallvignetten: Zittern, Hyperaktivität und Abgeschlagenheit werden nicht gleich verschwinden (besonders, wenn sie schon eine Zeit lang Teil des körperlichen Geschehens waren) – auch wenn sich die Bedingungen, unter denen sich diese Prozessaspekte entwickelt haben und aufrechterhalten werden, geändert haben.
Diese zunächst wenigen Hinweise lassen schon erahnen, dass die organismische Prozessebene eine weit größere Bedeutung hat, als ihr üblicherweise in Psychotherapie, Beratung und Coaching eingeräumt wird. Dort liegt der Fokus immer noch vorwiegend auf psychischen und interpersonellen Prozessen. Im folgenden Kapitel wird darüber hinaus die organismische Prozessebene in einen noch weit größeren Rahmen gestellt.
1.2.4Der gesellschaftlich-kulturelle Fokus
Es war zweifellos ein Verdienst der familientherapeutischen und (später) systemischen Ansätze ab Mitte des 20. Jahrhunderts, die bis dato fast ausschließlich auf die einzelne Person fokussierten psychotherapeutischen Ansätze um die interpersonelle Perspektive bereichert zu haben. Familiäre – und allgemeiner: interpersonelle – Regeln und Muster können Prozesse auf der psychischen Ebene stabilisieren und werden wiederum gegebenenfalls von diesen selbst aufrechterhalten. Zu Recht wird daher gerade aus systemischer Sicht der interpersonellen Dynamik ein hoher Stellenwert in Psychotherapie, Beratung und Coaching eingeräumt.
Doch so wichtig diese interpersonelle Prozessebene auch ist: Die Bedeutungsstrukturen, Verstehensweisen, Welt- und Menschenbilder, welche die interpersonellen Prozesse durchziehen, stehen in einem weit umfassenderen Kontext. Genauso wie die evolutionär mitgebrachten Strukturierungsprinzipien des menschlichen Organismus sind auch diese makroskopischen, übergreifenden Sinnstrukturen längst vorgegeben, wenn ein Mensch die Lebensbühne betritt, eine Partnerschaft eingeht bzw. eine Familie gründet oder wenn Organisationen und Unternehmen entstehen bzw. sich umstrukturieren. Nicht nur mikrosoziale sondern auch makrosoziale Regeln und Muster beeinflussen menschliches Leben in ganz erheblichem Maße.
Fallvignette
So kann die Sorge von Bettinas Mutter auch damit zu tun haben, dass ihr bereits von ihren Eltern (also Bettinas Großeltern) vermittelt wurde, wie zentral es ist, sein Kind zu beschützen: Diese hatten nämlich in den Wirren des Krieges und der anschließenden Flucht zwei Kinder verloren. Nur das dritte, Bettinas Mutter, konnten sie heil durchbringen. Solche intergenerationellen Zusammenhänge werden zwar gewöhnlich von den familientherapeutischen Ansätzen mitthematisiert und könnten daher auf den ersten Blick als eine Erweiterung der interpersonellen Perspektive verstanden werden. Doch auf den zweiten Blick lässt sich nicht verkennen, dass diese Leitidee, den Schutz des Kindes ins Zentrum des Handelns zu stellen, nicht allein in dieser Mehrgenerationenfamilie entstanden ist. Vielmehr können wir davon ausgehen, dass es sich auch um strukturelle Antworten auf die Herausforderungen von Krieg, Vertreibung, Naziherrschaft etc. handelt, die in den Überlebensgeschichten eines ganzen Kontinents (Europa) auf je eigene Weise in den Sinnstrukturen vieler Menschen und den Folgegenerationen verankert sind. In Form von Geschichten, Erziehungsprinzipien, Geboten und Verboten, Wertvorstellungen etc. beeinflussen diese die aktuellen Lebensprozesse der Akteure.
Auch dass Julians Eltern besonders auf die Beschwerden des Lehrers reagieren, dürfte mit der Frage zusammenhängen, welchen Stellenweit »Schule«, »Leistung«, »Ausbildung« und »Lebensweg« bei ihnen und in unserer Kultur haben. Ebenso sind ihre inneren Bilder davon, was Eltern als Erziehungsberechtigte (und -verpflichtete) zu tun haben, weder allein individuell noch ausschließlich mikrosozial interpersonell entstanden, sondern auch über geteilte Vorstellungen und Werte unserer Kultur. Das wird besonders an der Interpretation vielfältig komplexer Situationen als »Verhaltensstörung von Julian« deutlich (vgl. Abschnitt 3.5.3). Gleich, ob eine laienhafte oder gegebenenfalls professionelle Kategorisierung (etwa als »ADHS«) erfolgt: Es handelt sich stets um Zuschreibungen aus makrosozialen Diskursen – auch wenn sie dann mikrosozial (um)gedeutet, angenommen oder verworfen werden.
Und so sehr auch Manfreds Hang, sich übermäßig und ohne angemessene Rücksicht auf eigene Überforderung als »nützlich« zu erweisen, durch biografische Erfahrungen und interpersonelle Bekräftigungen gefördert sein mag: Viele der grundliegenden Ideen für eine solche Entwicklung sind durch kulturelle Leit(und Leid)bilder vermittelt. Das zeigt sich nicht nur wiederum am Gebrauch von Begriffen wie »Burn-out« oder »Depression«, sondern auch in der Einstellung zur »Psychotherapie«, in der Abwägung von Handlungsalternativen etc.
Wie stark wir als Menschen bereits auf der organismischen Ebene in die Strukturen der Kultur eingebunden sind, merken wir beispielsweise, wenn wir am Steuer eines Wagens sitzen und mit unserem Bewusstsein ganz in einem intensiven Gespräch mit dem Beifahrer vertieft sind oder einfach nur intensiv über ein Problem nachdenken. Unser Organismus verarbeitet dann nämlich gleichzeitig komplexe Information in Form von Verkehrszeichen, dem Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, kleinere Veränderungen der ansonsten bekannten Wegstrecke (z. B. Sperrung einer Straßenseite) etc. – ein Aspekt, auf den wir noch in Abschnitt 4.4.2 genauer zurückkommen werden.
Am deutlichsten nehmen wir die Einbettung unserer Lebensprozesse in die Kultur anhand von deren »Werkzeugen« wahr: Die meisten Dinge des täglichen Lebens, die Gesetze und Regeln des gesellschaftlichen Miteinanders, die massenmediale Durchdringung und kommunikative Vernetzung (Handy, Internet) der Alltagswelt – all dies sind ja Errungenschaften, die im Laufe vieler Generationen hervorgebracht worden sind. Sie werden als Kulturwerkzeuge an die jeweils nachfolgenden Generationen weitergegeben – auch wenn viele stetiger Veränderung in Form von Anpassung an neue Gegebenheiten unterworfen sind.
Bei den genannten kulturellen Werkzeugen ist uns zwar gewöhnlich deren Bedeutsamkeit mehr oder minder bewusst, wir haben aber gleichwohl die Vorstellung, dass diese uns in unserem »eigentlichen Menschsein« nur als etwas »Äußeres« gegenüberstehen.
Dies ist bei einem anderen Kulturwerkzeug, nämlich der »Sprache«, deutlich anders: Wir können die »Welt«, die anderen Menschen und auch uns selbst nur verstehen, indem wir Sprache verwenden. Natürlich können wir auf organismischer Ebene Empfindungen haben, wahrgenommene Objekte und Situationen als für uns nützlich oder schädlich bewerten. Wir können uns sogar sachgerecht und angemessen in der Umgebung bewegen sowie uns aufgrund von Beziehungen zu anderen sozial verhalten – beispielsweise für diese sorgen, mit ihnen gemeinsam etwas unternehmen oder uns sexuell mit ihnen vereinen. All dies sind Fähigkeiten, zu denen unser Organismus auch ohne jede Sprache in der Lage ist. Und auch sehr viele Tierarten verfügen über weitgehend ähnliche Fähigkeiten. Um aber zu verstehen, welche Empfindungen wir haben – ob also z. B. ein drückendes Gefühl im Magen auf Sättigung, Anspannung oder aber etwas nicht gut Verträgliches hinweist –, benötigen wir sprachliche Bezeichnungen. Ebenso dafür, um anderen zu beschreiben oder zu erklären, wie und warum wir uns in einer bestimmten Umgebung und Situation gerade so verhalten, wie wir das tun. Und dies gilt auch dann, wenn ich selbst derjenige bin, dem ich diese Sachverhalte beschreibend oder erklärend nahebringen will. Sprache benötigen wir auch dafür, wenn wir in unseren sozialen Beziehungen entsprechend den verinnerlichten »Regeln« nicht nur handeln wollen – wie Ameisen in einer Kolonie oder Wölfe beim Jagen im Rudel –, sondern wenn wir uns selbst und/oder anderen dieses Verhalten (und erst recht die Gedanken und Empfindungen dabei) erklären wollen.
Es geht bei der Sprache also keineswegs nur um eine Verständigung mit anderen, sondern genauso um ein Verstehen von uns selbst. Sogar für ein Verstehen unserer intimsten, ureigenen, individuell-subjektiven Empfindungen benötigen wir den kulturellen Werkzeugkasten, den wir »Sprache« nennen – eine wichtige Erkenntnis, auf die wir öfter noch zu sprechen kommen werden (vgl. Unterkapitel 5.5).
Beim Kulturwerkzeug »Sprache« handelt es sich keineswegs nur um die grammatische Abfolge von Sprachlauten oder um die semantische Bedeutung von Wörtern oder um deren situativ angemessene Verwendung. Dies ist fraglos wichtig. Aber genauso bedeutsam sind die mit der Sprache »selbstverständlich« vermittelten Bedeutungsbilder, Prinzipien, Regeln, Verstehensweisen, Appelle, Lebens- und Handlungsanweisungen. Doch obwohl diese innerhalb einer bestimmten Kultur typisch sind und zwischen unterschiedlichen Kulturen (und partiell auch zwischen Subkulturen, Familien, Organisationen usw.) stark differieren können, werden sie im Alltag üblicherweise nicht nur nicht hinterfragt, sondern meist auch gar nicht bemerkt.
Wenn man die Diskussion der drei Fallvignetten nochmals hinsichtlich der vier zentralen Prozesseben resümiert, so ergibt sich die Zusammenstellung in Tabelle 1.
In der obigen Darstellung der vier unterschiedlichen Perspektiven werden zunehmend auch die Interaktionen zwischen den Prozessen auf den unterschiedlichen Ebenen mit herangezogen, diese einzelnen Perspektiven sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Grau hervorgehoben werden die psychische und die interpersonelle Prozessebene, weil diese heutzutage wohl immer in Psychotherapie, Beratung und Coaching berücksichtigt werden. So gesehen bilden die beiden anderen Prozesseben – die somatische und die kulturelle – quasi die kontextuelle Rahmung für die psycho-interpersonellen Prozessaspekte.
Es steht außer Frage, dass weder die Vignetten noch gar die herausgearbeiteten Aspekte auf den vier Prozessebenen irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Vielmehr geht es um jeweils exemplarische Verdeutlichungen der unterschiedlichen Perspektiven bzw. Fokusse. Was aber klar werden sollte, ist, dass sich die Prozesse auf den vier Ebenen in komplexer Weise gegenseitig beeinflussen und daher für ein Verständnis der Vorgänge keine dieser Prozessebenen ausgeblendet werden sollte.
Wenn man unter diesem Aspekt wichtige Ansätze im psychosozialen Bereich ansieht, so wird deutlich, dass dort im Gegensatz zur Personzentrierten Systemtheorie bestimmte Ebenen vernachlässigt werden. Sowohl der personzentrierte Ansatz von Rogers (1961) als auch der von Stern (2005) arbeiten zwar hervorragend individuelle und interpersonelle Aspekte (besonders die Mutter-Kind-Dyade und deren Bedeutung für die therapeutische Arbeitsbeziehung) heraus, die Einflüsse aus den familiären Strukturen oder gar den kulturellen bzw. gesellschaftlichen Prozessen sind aber kaum oder gar nicht thematisiert. Andersherum hat die Familientherapie (von Schlippe u. Schweitzer, 2016) zwar die Bedeutsamkeit interpersoneller und familiärer Prozesse sehr detailliert ausgearbeitet – auch bestimmte kulturelle Aspekte sind dabei und werden z. B. über Genogrammarbeit (vgl. Abschnitt 4.3.2) berücksichtigt –, die psychische und organismische Prozessebene ist (mit Ausnahme der »Symptome«) jedoch weitgehend unterbelichtet.
Tabelle 1: Perspektiven auf die drei Fallvignetten
_____________________
1Das Projekt, die vier zentralen Richtungen – psychodynamisch, behavioral, humanistisch und systemisch – und ihre wichtigsten Ansätze in ihren »Grundkonzepten« darzustellen (Kriz, 2014a), war vor 35 Jahren sicher ein bedeutsamer Auslöser. Die Frage: »Wie passt das alles zusammen?« trat damit nur noch schärfer und drängender hervor. Erste, vorläufige Skizzen der Personzentrierten Systemtheorie sind denn auch bereits im letzten Kapitel der 1. Auflage 1983 von Kriz (2014a) zu finden.
2Die Anführungszeichen bei manchen Wörtern sind als Hinweiszeichen zu verstehen, dass die damit verbundenen Konzepte eigentlich ausführlicher und differenzierter erörtert werden müssten, als es hier in einer solchen begrenzten Darstellung möglich ist (die zudem eine notwendig lineare Abfolge von eigentlich vernetzten Konzepten erfordert).
3Die Personzentrierte Systemtheorie war sich daher immer schon mit Klaus Grawe (2000, 2004) in dem Anliegen einig, ein schulenübergreifendes Modell von Psychotherapie zu entwickeln. Allerdings war es nie meine Idee, daraus einen eigenen Ansatz für die Praxis zu machen, sondern das reiche Spektrum der Praxis mit einem solchen Modell besser nutzen zu können.
4Wie noch in Kapitel 5.5 herausgearbeitet wird, ist das freilich nicht einfach trennbar, wie das auf den ersten Blick erscheint und auch in der kontrastierenden Debatte um die sogenannte »Erste-Person-Perspektive« und die »Dritte-Person-Perspektive« in der Psychotherapie unterstellt wird.
5Es sei aus Kapitel 2 schon vorweggenommen, dass die Biosemiotik grundsätzlich für Lebewesen deren Subjektivität betont, mit der sie in ihrer Umwelt existieren. Indem diese Welt der Zeichen für den Menschen durch seine neuronale Ausstattung und intersubjektiven Vereinbarungen zu einer Welt der Symbole erweitert wird – was die »Umwelt« zu einer »Lebenswelt« macht (was Husserl 1936 ausgearbeitet hat: Husserl, 1936/2007) –, finden wir die Verbindung von körperlichen und kulturellen Prozessaspekten, die auch für die Personzentrierte Systemtheorie wichtig ist, ebenso in der Biosemiotik.
6Gemeint ist damit immer das von Hermann Haken (1992) initiierte Programm interdisziplinärer Systemtheorie unter dem Namen »Synergetik«, zu dem inzwischen weit über 5.000 Publikationen aus zahlreichen Wissenschaftsdisziplinen und Anwendungsbereichen vorliegen.
7Wirkstoff, der unter diversen Handelsnamen als Arznei u. a. gegen Ängste und Depression verschrieben wird.
8Eine Ausnahme ist der Begriff »Elterncoaching« (Omer u. von Schlippe, 2016), bei dem es sich aber eigentlich auch eher um Beratung handelt und man den Begriff »Coaching« verwendet, um die Vorstellung zu umgehen, dass jemand der Beratung (oder gar Therapie) bedürfe.
9In Kriz (1997/2011, S. 68 f.) wird ausgeführt, wie an der cartesianischen Schule von Port-Royal Tiere nicht nur mit Maschinen verglichen, sondern letztlich als nichts anderes als Maschinen behandelt wurden und daher an ihren vier Pfoten auf Bretter genagelt wurden, um sie bei lebendigem Leibe zu sezieren. Ihre Schmerzensschreie verstanden die Forscher lediglich als »Lärm von Federn in Uhrwerken«. Darüber hinaus machte man sich auch noch über jene lustig, die »unwissenschaftlich« den Tieren Schmerzen unterstellten.
10Die Berechtigung einer solchen Sicht auf das Werk von Stahl, aber auch eine kritische Herausarbeitung der Unterschiede gegenüber heutigen psychosomatischen Vorstellungen findet sich in Bauer (2000).
2Leben als Zeichenprozess – die Perspektive der Biosemiotik
Wenn man den Begriff oder gar das Konzept »System« verwenden will, muss man sich gleichzeitig der Frage stellen, was nicht zum System gehören soll, sondern zur »Umgebung«. Als vor gut siebzig Jahren die Familientherapie entstand – was allgemein auch als Beginn der systemischen Therapie gesehen wird –, beantwortete man diese Frage recht »hemdsärmelig«, pragmatisch und praktisch-gegenständlich: Die Umgebung für eine Person – einen »Indexpatienten (IP)« oder »Symptomträger«, wie es hieß – war »die Familie«, bestehend aus den weiteren im Haushalt lebenden Personen. Wesentlich für das Aufkommen von systemischer Therapie war allerdings nicht, dass nun diese weiteren Personen mit in die Therapie einbezogen wurden. Der entscheidende Schritt zu Neuem lag vielmehr darin, dass nun deren Interaktionen ins Zentrum des therapeutischen Interesses rückten. Daher sprach man vom »System Familie«.
Was man sich als Umgebung eines solchen Systems vorstellen sollte, wurde zunächst selten und bestenfalls vage thematisiert: Irgendwie war klar, dass Einflüsse von Schule, Nachbarn, Freunden, Arbeitsplatz – und allgemeiner: der Gesellschaft – bedeutsam sind. Aber solche Aspekte, so meinte man, würden dann eben gegebenenfalls als Repräsentationen in den Interaktionen auftauchen. Und obwohl schon in den 1950er Jahren mit Konzepten wie »Selbstwert« (Satir, 1990) den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder ein wichtiger Einfluss auf die systemische Interaktion eingeräumt wurde, ging es in den Beschreibungen von »Familie« letztlich um »menschliche Organismen im physikalischkonkreten Raum« und beschränkte »systemisch« auf soziale Interaktionen.11
Heute bezieht man sich mit dem Begriff »Familie« auf das komplexe, mehr oder minder regelhaft ablaufende Interaktionsgeschehen zwischen den Mitgliedern sowie auf die Muster aus komplexen Bildern, Erwartungen etc. in deren Köpfen. Daher kann man auch »familientherapeutisch« arbeiten, wenn nicht alle Mitglieder physisch anwesend sind (sondern gegebenenfalls sogar nur eine Einzelperson). Klar ist auch, dass sowohl die Interaktionen als auch die inneren Bilder mit körperlichen Prozessen der Personen sowie mit Sinnstrukturen in der Kultur zusammenhängen. Es geht also letztlich wieder um die gegenseitigen Einflüsse zwischen Prozessen auf den vier Ebenen – der somatischen, psychischen, interpersonellen und kulturellen –, die von der Personzentrierten Systemtheorie besonders ins Auge gefasst werden.
Wenn man diese gegenseitigen Beeinflussungen konzeptionell schärfer fassen will, stößt man allerdings schnell auf ein zentrales Problem, welches die gesamten Beschreibungen von Psychotherapie, Beratung und Coaching durchzieht, aber oft einfach ignoriert wird – nämlich die Unterscheidung bzw. das Verhältnis zwischen »subjektiver« und »objektiver« Sicht auf die »Welt«. Diese Problematik wird anhand folgender Fragen deutlich.
Wenn man die Dynamik eines Elternpaares mit ihrem Kind im Teenageralter verstehen und nachzeichnen will: Geht es da um die Beziehung zwischen diesen Dreien aus der Sicht eines »objektiven« Beobachters (repräsentiert z. B. durch den Therapeuten oder gar durch einen Lehrbuchautor oder jemanden, der eine Anleitung schreibt)? Oder geht es um die »subjektiven« Sichtweisen, jeweils des Teenagers, des Vaters und der Mutter? Im ersten Fall würde man vielleicht eine »anklagende Haltung« der Mutter herausarbeiten oder gar von »Triangulation« (vgl. Abbildung 32 in Abschnitt 4.1.4) sprechen. Im letzten Fall würde man sich auf die direkten und zirkulären Beschreibungen der einzelnen Mitglieder sowie deren Beschreibungen beim Hören der Beschreibungen der anderen beziehen.
Das mag für konkrete Arbeit noch angehen, wo es aus systemischer Sicht sogar erwünscht ist, dass die Vielfältigkeit der Verstehensweisen zur Sprache kommt und vielleicht etwas Neues daraus entstehen kann. Doch wen meinen wir, wenn wir über die »Mutter« in diesem Fall sprechen: ihre eigene Sicht, die das Vaters, die des Teenagers oder die des Beobachters? Dies wird noch weit komplizierter, wenn wir über die »Umgebung« dieses Systems reden wollen. Es kommen ja nicht nur vier jeweils subjektive Sichtweisen zusammen – etwa in Bezug auf den »überaus stressigen Arbeitsplatz« des Vaters, der das Familienleben »stark beeinträchtigt« (so würde vielleicht die Beschreibung aus der Beobachterperspektive lauten). Sondern es kommen ganz unterschiedliche Mengen an Bezügen zusammen: Dem Teenager ist vielleicht der genervte Vater ziemlich egal im Vergleich zu den Problemen mit seiner Freundin – wovon aber gegebenenfalls weder die Eltern noch der Beobachter überhaupt etwas wissen.
Es sollte klar sein, dass man die »subjektive(n)« Perspektive(n) der Betroffenen nicht einfach gegen die »objektive« Perspektive des Beobachters ausspielen kann – und etwa nur die »subjektive« Sicht für relevant erklärt. Denn dann würde man beispielsweise in der Analyse einer Familiendynamik jene Macht- und Ungleichheitsstrukturen ignorieren, die gegebenenfalls zwar großen Einfluss haben, aber von den Betroffenen nicht (explizit) wahrgenommen werden.
Dass die Problematik »subjektiver« versus »objektiver« Perspektive keineswegs auf systemische Erörterungen beschränkt ist, zeigt sich an einem Konzept wie »Stress«. Einerseits wird betont, dass es eher ein Phänomen »subjektiven« Empfindens ist – weil die gleichen »objektiven« Gegebenheiten von Menschen recht unterschiedlich erlebt werden. Andererseits versucht man, Bedingungen hinsichtlich »objektiver« »Stressoren« zu erfassen, um diese zu verringern. Ein anderes Beispiel ist die Relation von (»objektiven«) Befunden medizinischer Diagnostik und (»subjektiven«) Befindlichkeiten der Patienten bei vielen komplexen Krankheiten. Beides sind wichtige Perspektiven, sofern man weder die Befindlichkeit des Patienten noch die medizinischen Daten ignorieren will. Allerdings ist der statistische Zusammenhang zwischen beiden oft erstaunlich gering (Kriz, 1994).
Ein letztes Beispiel: Was ist im Coaching die relevante Umgebung für die Interaktionsdynamik eines Teams? Sind es die »objektiven« Gegebenheiten des Unternehmens (so wie sie beispielsweise aus Daten und Reports entnommen werden können? Oder sind es jene Bedingungen, die von »objektiven« Beobachtern12 feststellbar sind? Oder aber sind es die »subjektiven« Wahrnehmungen dieser Bedingungen durch die Teammitglieder selbst? Wieder lässt sich auf keine Perspektive verzichten.
Wichtig ist auch, sich klar zu machen, dass die sogenannte »objektive« Perspektive des Beobachters auf letztlich »subjektiven« Wahrnehmungen beruht – allerdings solchen, die zwischen vielen Subjekten explizit verhandelt wurden und daher Intersubjektivität beanspruchen können. Sofern wir allerdings nicht nur diese (abstrakt) intersubjektive Perspektive meinen, sondern einen konkreten Beobachter bzw. Wissenschaftler oder Lehrbuchautor meinen, ist dies wiederum mit (reflektierter) Subjektivität in der Auswahl und Interpretation der vorliegenden Erkenntnisse verbunden.
Diese hier zunächst nur einleitend aufgeworfenen problematisierenden Fragen sollen deutlich machen, was ohnedies fast selbstverständlich ist:13 Wir können »die Welt« niemals einfach »objektiv« erkennen und beschreiben, »wie sie ist«, sondern nur so, wie wir sie »subjektiv« mit unseren Sinnen wahrnehmen und handelnd erfassen. Es sind stets Subjekte, die den Phänomenen in ihrer Welt Bedeutungen zuteilen. Das tun sie nicht beliebig, sondern aufgrund ihrer biologischen Ausstattung. Wobei für uns Menschen auch die kognitiv-affektiven Formierungen dieser Erfahrungen sowie die intersubjektive Verständigung vor dem Hintergrund kulturell aufgetürmten und materiell manifestierten Wissens wesentlich sind. Gleichwohl wäre es ebenso vermessen wie naiv, zu unterstellen, dass alle Menschen, welche um Psychotherapie, Beratung und Coaching nachsuchen, »die Welt« so erleben, wie dies die »objektiven« diagnostischen Kategorien, Therapiemanuale oder Kontrollgruppendesigns vorgeben.
Da die Personzentrierte Systemtheorie die Komplementarität von »objektiven« und »subjektiven« Perspektiven – je nach Fragestellung und Fokus – berücksichtigt, ist es wichtig, diesen Prozess der Bedeutungszuteilung etwas genauer ins Auge zu fassen. Es ist die Sichtweise der Biosemiotik, die »Leben« grundsätzlich als Zeichenprozesse versteht.
2.1Die Objektivität der »Subjektivität« – oder: Die Subjektivität der »Objektivität«
In Kapitel 1 wurden anhand der Fallvignetten die praktischen Argumente diskutiert, warum für das Verständnis psychosozialer Vorgänge alle vier zentralen Prozessebenen der Personzentrierten Systemtheorie – die somatische, psychische, interpersonelle und kulturelle – zu berücksichtigen sind. Neuere Diskurse zur Biosemiotik liefern noch weit grundsätzlichere Argumente. Denn diese legen eine untrennbare Verwobenheit von psychischen und interpersonellen Phänomenen mit körperlich-evolutionären sowie kulturell-makrosozialen Prozessen nahe. Auch wenn der Fokus in Therapie und Beratung also berechtigterweise auf den psychischen und interpersonellen Prozessen liegt, gibt die Perspektive der Biosemiotik erst jene umfassendere Rahmung, welche die Dynamik der so zentralen Sinnprozesse psychosozialen Geschehens verständlich macht. Dies soll im Folgenden etwas entfaltet werden.
Biosemiotik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die biologische Prozesse mithilfe der Semiotik – also der Wissenschaft von den Zeichen und ihrer Verwendung – untersucht und »Leben« grundsätzlich als biologische Zeichen- und Kommunikationsprozesse versteht. So lautet beispielsweise die zentrale Programmatik des »Jakob von Uexküll-Archivs für Umweltforschung und Biosemiotik«, das 2004 an der Universität Hamburg eröffnet wurde, dass »Lebewesen (Menschen eingeschlossen) nicht als beziehungslose Reflexmaschinen zu verstehen sind. Die wundervollen Wechselbeziehungen und Anpassungsleistungen in der Natur können erst sinnvoll gedeutet werden, wenn man Organismen als aktive Subjekte begreift, die nur eine ihren Sinnesleistungen, Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechende Umwelt wahrnehmen und gestalten.«
Aus unserem üblichen alltagsweltlichen Verständnis »der Welt« heraus mag es zunächst erstaunlich sein, in Bezug auf Organismen – vielleicht sogar »niedere« Tierarten – von »Subjektivität« zu sprechen. Doch gibt es gute Gründe, die den Biologen und Zoologen Jakob von Uexküll (1864–1944) bereits vor über hundert Jahren in Schriften wie »Umwelt und Innenwelt der Tiere« (von Uexküll, 1909/2014) dazu führten, Subjektivität als einen zentralen Aspekt der Biosemiotik zu entwickeln.14 Dies ist natürlich für das Verständnis menschlicher Lebenswelten noch bedeutsamer. Doch beginnen wir zunächst der Einfachheit halber beim Tierreich. Denn auch der Mensch ist ja fraglos auch als Organismus zu sehen – eine Perspektive, die zwar in Beratung und Therapie nicht ignoriert, aber wohl doch in ihrer Bedeutsamkeit unterschätzt wird.
Ein zentraler Grundgedanke der Biosemiotik wird an der – durch von Uexküll eingeführten – Unterscheidung zwischen »Umwelt« und »Umgebung« deutlich: Betrachtet man eine Sommerwiese, so leben die vielen Tiere dort in derselben Umgebung – beispielsweise Ameisen, Blattläuse, Bienen, Spinnen, einige Frösche und Fische im nahen Tümpel und sogar Fledermäuse15 in der Scheune. Damit sind die objektiven Gegebenheiten dieser Sommerwiese gemeint.
Doch was bekommt ein Lebewesen von diesen objektiven Gegebenheiten wahrnehmungsmäßig überhaupt mit? Und auf was kann es mit seinen Organen einwirken? Geht man diesen beiden Fragen nach, so ist klar, dass keines dieser Tiere die Umgebung genau so wahrnimmt, wie ein Tier der jeweils anderen Art. Und jede Art wirkt auch in seiner spezifischen Weise auf die Umgebung ein. Dies wird schon daran deutlich, dass die Bienen ultraviolettes Licht sehen können und Honig produzieren, die Fledermäuse aber Ultraschall hören können. Fische bleiben – abgesehen von kurzen Luftsprüngen – unter Wasser, Frösche quaken und fangen Fliegen – und dies auf ganz andere Weise als die Spinne, die zwischen Zweigen ein Netz spinnt, in dem die Fliegen hängen bleiben.
Will man das Verhalten eines dieser Lebewesen verstehen, so sind nicht so sehr die objektiven Gegebenheiten seiner Umgebung relevant, sondern das, was es davon überhaupt merken und auf was es einwirken kann. Dies kennzeichnet jeweils – in der Terminologie von Uexkülls – die Umwelt eines Tieres. Diese ist somit nach ihm bestimmt durch die jeweilige Merkwelt – die Art, wie das Lebewesen mit seinen spezifischen Rezeptoren des Merkorgans die Welt wahrnimmt – und die Wirkwelt – die Art und die Möglichkeiten, wie es mit seinen Effektoren des Wirkorgans in die Welt hineinwirkt. Sein Merken und Wirken bezieht sich damit auch immer nur auf bestimmte Merkmale eines Objekts und nicht auf das »Objekt an sich«. Die unterschiedlichen Tierarten in derselben Umgebung, der Sommerwiese, leben somit in unterschiedlichen Umwelten. Wie Abbildung 1 zeigt, lässt sich diese Beziehung des Lebewesens zu seiner Umwelt über das Merken und Wirken in einer Art Kreislauf darstellen – diesen nannte von Uexküll »Funktionskreis«.
Dass Lebewesen in unterschiedlichen Umwelten agieren, bedeutet nicht, dass diese isoliert wären und nichts miteinander zu tun hätten: Manche Tierarten sind sogar in symbiotischer Weise eng aufeinander bezogen – beispielsweise die Ameisen und Blattläuse, die an den Pflanzen auf der obigen Wiese herumkrabbeln: Die Blattläuse benötigen nur die Aminosäuren des Pflanzensaftes, den sie aufsaugen. Zucker und Wasser scheiden sie hingegen in Form von sogenanntem »Honigtau« aus. Dieser ist eine beliebte Nahrung für Ameisen, welche die Blattläuse mit ihren Fühlern berühren und zur Ausscheidung des Honigtaus stimulieren (»melken«). Dafür verteidigen sie die Blattläuse gegen Fressfeinde, wie Spinnen und Insekten, und greifen diese an, wenn sie sich der Blattlauskolonie nähern.
Abbildung 1: Funktionskreis als Regelkreis auf der vegetativen Stufe (nach von Uexküll, 1920)
Doch selbst bei solch symbiotischer Bezogenheit zwischen Tieren, die in derselben Umgebung leben, hat jedes seine eigene Umwelt: Wirkwelt und Merkwelt von Ameisen sind von denen der Blattläuse wesentlich unterschieden. Die Grundmuster ihrer Verhaltensweisen haben sich evolutionär herausgebildet und dabei waren die Verhaltensweisen der anderen Art durchaus wechselseitig förderlich – man spricht daher von Ko-Evolution. Aber Ameisen und Blattläuse nehmen weder Gleiches wahr noch wirken sie in gleicher Weise auf die gemeinsame Umgebung ein.
Die Betonung der Subjektivität ergibt sich aber nicht nur aus der Unterscheidung von (objektiver) Umgebung und (subjektiver) Umwelt. Vielmehr hat von Uexküll einen zweiten zentralen Aspekt der Subjektivität hervorgehoben: Dass nämlich selbst für Tiere im Rahmen ihrer Merk- und Wirkorgane keineswegs die objektive (physische) Beschaffenheit der Umgebung allein relevant ist, sondern die Bedeutung, welche diese für das Tier hat. Zur Demonstration dieses Aspektes verwendete er u. a. die Symbiose zwischen Einsiedlerkrebsen (Pagurus bernhardus) und Seeanemonen (Anemonia sulcata):
Die Anemone setzt sich auf dem Schneckenhaus eines Krebses fest und wird damit von diesem sowohl zu neuen Futterplätzen transportiert als auch mit dessen Beuteresten versorgt. Der Nutzen für den Krebs besteht darin, dass ihn die Anemone vor Fressfeinden schützt. Die Anemone ist somit Teil der Umwelt des Krebses. Allerdings hängt deren Bedeutung für den Krebs nicht nur von seiner biologischen Ausstattung mit Merkorganen ab, sondern auch von seiner »Gestimmtheit«: Findet der Krebs über längere Zeit kein Futter, so nimmt er die Anemone als Futter wahr. Hat der Krebs hingegen längere Zeit keine Anemone »zu Gast« und genügend Futter, so nimmt er sie als Hilfe zur Verteidigung wahr. Hat der Krebs sein Schneckenhaus mit der Anemone verloren, so bekommt die Anemone für ihn einen »häuslichen« Charakter, was sich darin äußert, dass er – vergeblich – versucht, ins Innere der Anemone zu gelangen.
Nach von Uexküll erhält somit ein und dasselbe Objekt in der Umgebung eine unterschiedliche biologische Bedeutung bzw. »Tönung« in der Umwelt, je nach den Trieben und Bedürfnissen des Lebewesens.
Allerdings geht das Spektrum dieser Tönungen und damit der Verhaltensmuster, von denen der Krebs Gebrauch machen kann, auf ein evolutionär vorstrukturiertes Set an Möglichkeiten zurück. Das heißt, »zum Schutz aufpflanzen«, »Fressen«, und »Hineinschlüpfen« sind eben stammesgeschichtlich erworbene Dispositionen, mit denen ein Krebs über seine Merkorgane einerseits und seine Wirkorgane andererseits die Möglichkeiten der Beziehung zu Anemonen in seiner Krebswelt umsetzen kann. Von welchen er davon in einer spezifischen Situation Gebrauch macht – das heißt, welche wahrgenommene Bedeutung die Anemone für ihn in seiner Merkwelt hat und wie er dementsprechend auf die Anemone einwirkt – hängt eben von seinen inneren Zuständen ab (die wiederum von den Gesamtgeschehnissen bestimmt werden). Wie auch immer wir (als Menschen) eine »Anemone« in unseren biologischen Lehr- oder Bestimmungsbüchern »objektiv« beschreibend definieren und erfassen mögen: Für den Krebs wird dieses Objekt entsprechend seiner eigenen Möglichkeiten (seiner Merkorgane) und seiner aktuellen Bedürfnisse als etwas – »Schützendes«, »Fressbares« oder »Bewohnbares« – interpretiert. Die wahrgenommenen Merkmale dieses Etwas (für uns: Anemone) werden also als Zeichen für etwas genommen und entsprechend dieser Bedeutung (und der Möglichkeiten der Wirkorgane) wird auf dieses Etwas eingewirkt. Da dies zudem von den »Stimmungen« des Krebses abhängig ist, muss offen bleiben, ob überhaupt von einer Beziehung des Krebses zur Umwelt gesprochen werden kann, oder ob es sich nicht vielmehr um drei handelt – nämlich eine Beziehung zu etwas Schützendem, eine andere zu etwas Fressbarem und wieder eine andere zu etwas Bewohnbarem.16
Die Relevanz dieser inneren Zustände für das Verständnis des Verhaltens eines Lebewesens wird noch deutlicher, wenn man beispielsweise die unterschiedlichen »Stimmungen« vieler Tierarten in Phasen der Partnerwerbung bzw. Paarung, der Jagd, des Kampfes, des Fütterns von Nachwuchs etc. berücksichtigt. Hier eröffnen sich offensichtlich recht unterschiedliche Umwelten für die Tiere trotz derselben »objektiven« Objekte in derselben »objektiven« Umgebung. Die dazugehörigen evolutionären Verhaltensprogramme können durchaus recht komplex und beispielsweise bei Paarungs- oder Kampfverhalten in vielen, genau aufeinander abgestimmten Sequenzen ablaufen. Im Internet sind viele Filme zum Balzverhalten von Fischen oder Vögeln zu sehen, in denen deutlich wird, in welch komplizierten, umfangreichen und gegenseitig abgestimmten Aktionen beide Partner ihre Annäherung und Paarung durchführen. Auch hier sind wieder die Stimmungen relevant, denn trotz der Signale eines Partners in Form von Bewegungen oder Körperfärbungen regiert der andere nur dann entsprechend, wenn bei ihm die entsprechende Stimmung bzw. innere Bereitschaft vorhanden ist. Diese wiederum ist von vielen Faktoren abhängig – beispielsweise von den im Blut kreisenden Sexualhormonen, Jahreszeit und Temperatur, Anwesenheit von Konkurrenten oder Feinden etc.





























