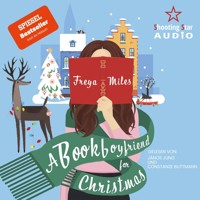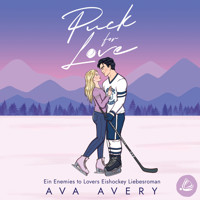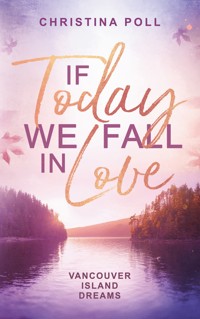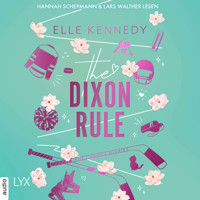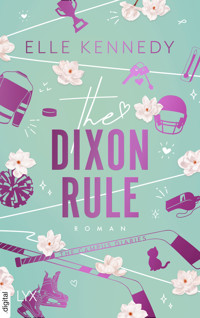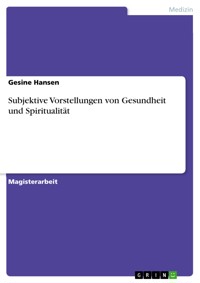
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Gesundheit - Sonstiges, Note: 2,0, Europa-Universität Flensburg (ehem. Universität Flensburg) (Institut für Psychologie- Abteilung Gesundheitspsychologie und Gesundheitsbildung), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bearbeitung erfolgt vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstandes von Spiritualität und Gesundheit, welcher hauptsächlich die Zusammenhänge zwischen Glauben und Gesundheit thematisiert und in dieser Verbindung auch gesundheits-psychologische Themen wie das der subjektiven Gesundheitsvorstellungen streift. Der Fragestellung wird in Form einer qualitativen Erhebung nachgegangen, in deren Rahmen fünf problemzentrierte Interviews ausgewertet und interpretiert werden. Die Interviewpartner sind ausschließlich Frauen mittleren Alters, deren Leben sowohl auf privater, als auch auf beruflicher Ebene eine Affinität zu spirituellen Inhalten und alternativen Heilmethoden aufweisen. Es wird insbesondere der Frage nachgegangen, inwiefern die subjektiven Vorstellungen von Gesundheit und Spiritualität Einfluss auf die Lebensweise der Frauen nehmen und wie sie sich konkret auf ihr Alltagshandeln auswirken. Zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass unter Einbezug spiritueller Sichtweisen Gesundheit als ein Individuationsprozess verstanden werden kann, in den Krankheit als mögliches Entwicklungspotential eingebunden ist. Das rückt den subjektiven Aspekt von Gesundheit in den Mittelpunkt und kann als Beitrag zur Individualisierung des Gesundheitsbegriffes verstanden werden. Das bewusste Beschreiten dieses persönlichen Entwicklungsweges erfordert die Fähigkeit der Selbstreflexion und kennzeichnendes Merkmal ist die Kommunikation mit einer 'Inneren, wissenden Instanz', der eine transzendente (göttliche) Dimension zugesprochen werden kann. Die These, die ich daraus ableite, ist, dass es in jedem Menschen einen maßgeblichen individuellen Entwurf eigener Gesundheit (gesunden Kern) gibt. Vor diesem Hintergrund stellt es sich als eine Teilaufgabe von Gesundheitsförderung dar, den Menschen in der Entwicklung eines Bewusstseins für seine innere 'Kerngesundheit' zu unterstützen und ihm eine autarke Kommunikation mit diesem inneren Wissen zu ermöglichen. Die zentralen Thesen fassen sich wie folgt zusammen: · Gesundheit ist ein Individuationsprozess, der unter Einbezug einer 'Inneren, wissenden Instanz' stattfindet. · Krankheit ist ein Teil von Gesundheit und stellt ein Entwicklungspotential dar. · Bewusst-Sein fördert Gesundheit: eine Aufgabe der Gesundheitsförderung ist es, den Menschen im Zugang zu seiner 'Inneren, wissenden Instanz' zu unterstützen und ihn so dazu zu befähigen, sein größtmögliches Gesundheitspotential zu verwirklichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Page 1
1. Einleitung und Problemstellung
Das gegenwärtig vorherrschende Verständnis von Gesundheit und Krankheit beruht auf einer 200 Jahre alten Geschichte der naturwissenschaftlich geprägten Medizin. Es ist vor allem eine Geschichte der Reduktion, in der der Mensch in all seinen Einzelteilen erforscht und verstanden wurde sowie lebensrettende Techniken durch die Forschung entwickelt wurden. Die vorrangig pathogenetische Ausrichtung fokussiert das körperliche Symptom, seine Bekämpfung und die Aufdeckung der Ursachen. Die immaterielle Seite und somit auch die religiöse, spirituelle Seite mit der Frage nach der Sinnhaftigkeit von Gesundheit und Krankheit ist in den Hintergrund gerückt. Seit geraumer Zeit ist eine Rückkehr zu dieser erweiterten Schau in Form der modernen Komplementärmedizin zu beobachten. Viele der Angebote entziehen sich einer wissenschaftlichen Validierbarkeit und unterliegen somit nur weichen Qualitätskriterien, da sie aus ihrem Wesen heraus dem Prinzip der Einzigartigkeit folgen und ihre Wirkungsweisen über klar benennbare und somit messbare Zusammenhänge hinausgehen. Nefiodow beschreibt in seinem Werk 'Der sechste Kondratieff' (1999) das derzeitige Gesundheitswesen als ein Krankheitswesen, in dem 98% der Finanzmittel dafür verwendet werden Krankheiten zu erforschen, zu diagnostizieren und zu verwalten. Diese einseitige Ausrichtung auf Krankheit bezeichnet er als zu teuer, schädlich und als nicht mehr zeitgemäß. Diese Situation erfordert, so Nefiodow, eine sozialverträgliche Transformation, die den Menschen mit seinem vollen Potential in den Mittelpunkt rückt. Innovative Auslöser werden Veränderungen in der modernen Biotechnologie sein und ein weiterer Motor der steigende Bedarf nach psychosozialer Gesundheit bzw. Gesunderhaltung. Er betrachtet Krankheit und Gesundheit als Systemeigenschaften, die vom ganzen Menschen und seiner natürlichen und sozialen Umgebung abhängig sind, und betont, dass es auf diese ganzheitliche Sicht, körperlich, seelisch, geistig, sozial und ökologisch und spirituell, in Zukunft ankommt. Nach seiner Auffassung wird die körperliche Gesundheit durch die Biotechnologie revolutioniert werden und das weite Feld der seelischen, sozialen und spirituellen Potenziale des Menschen wird durch psychosoziale und psychotherapeutische Kompetenzen erschlossen werden. (Nefiodow, 2008).
Page 2
So kann der Einbezug einer spirituellen Dimension in die Gesundheitsförderung und die Gesundheitsbildung ein Beitrag zur Erschließung dieser vielfältigen Potenziale eines Menschen sein. Inwieweit Spiritualität und Gesundheit in subjektiven Gesundheits-vorstellungen miteinander verwoben sind, soll in dieser Arbeit untersucht werden. Spiritualität wird als bestmöglicher zusammenfassender Begriff für die menschliche Affinität zu einer geistigen, transzendenten Dimension gewählt. Mit der Frage, wie sich eine unmittelbar erleb- und erfahrbare Dimension von Gesundheit und Spiritualität mit erforschtem Wissen in Einklang bringen lässt, bewegt sich diese Arbeit an der Schnittstelle zwischen zwei wertvollen Wissensquellen. Der Mensch wird als Subjekt in den Mittelpunkt gerückt; sein Merkmal ist es verbunden zu sein, und zwar auf allen Ebenen des menschlichen Seins: auf biologischer, psychischer, sozialer und vor allem auch auf geistiger Ebene. Sich verbunden fühlen ist nach Bucher (2007) kennzeichnend für spirituell beeinflusste Lebensauffassungen.
Dieser Beobachtung liegt ein Menschenbild zugrunde, das über die körperlichen Grenzen hinausgeht und den Menschen vielschichtig und multidimensional begreift. So ist der Mensch zum einen durch die Körperlichkeit an Materie gebunden, zum anderen wird er getragen und inspiriert durch das Verbundensein mit einer geistigen Dimension. Diese Verbundenheit des Menschen ist in spiritueller Hinsicht beobachtbar als eine Rückverbindung mit individuell gewählten Bezugsgrößen wie Gott, Engel oder anderen transpersonalen Konzepten. Sie dienen als Informationsquellen, mit denen z. B. über das Gebet oder eine meditative Innenschau die Kommunikation gesucht wird. Die Informationswege verlassen zwar den fassbaren Rahmen, können aber als handlungsleitender Impuls in ihren Auswirkungen zu sehr fassbaren Ergebnissen führen und so den Verlauf von Gesundheit und Krankheit konkret beeinflussen.
Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist es, zu eruieren, ob und inwiefern spirituelle Aspekte in den subjektiven Vorstellungen mit persönlicher Gesundheit verbunden werden und inwiefern sie ihren Ausdruck im Alltagshandeln finden.
Um den Gesundheitsbegriff für Gedanken und Ansichten zu öffnen, die ihren Ursprung in spirituellen Fragen haben, kommt man nicht umhin, einen Blick auf den historischen Hintergrund unseres heutigen Verständnisses von Gesundheit und Krankheit zu werfen.
Page 3
Im folgenden Kapitel 2 wird daher der Gesundheitsbegriff im geschichtlichen Kontext, der älter ist als 200 Jahre, zusammenfassend dargestellt (Kap.2.1). Anschließend erfolgt eine Betrachtung von Gesundheit im salutogenetischen Bezugsrahmen (Kap.2.2). Als Träger des Bedürfnisses nach Sinnhaftigkeit kommt dem Kohärenzgefühl unter dem Aspekt der Identitätsbildung ein besonderes Augenmerk zu. Das zweite Kapitel abschließend wird der subjektive Ansatz in Hinblick auf den Gesundheitsbegriff vor gesundheitspsychologischem Hintergrund verortet (Kap.2.3).
In Kapitel 3 wird als erstes der Begriff der Spiritualität in dem Feld zwischen persönlicher Erfahrung und Religion beleuchtet. Es wird des weiteren der Frage nachgegangen, wie sich spirituelle Inhalte und die Wissenschaft zueinander verhalten (Kap. 3.1). Nachfolgend werden die Aspekte der Verbundenheit und des Suchens als für diese Arbeit relevant herausgestellt (Kap.3.2) und Spiritualität in den Gesundheitsbezug gesetzt (Kap.3.3).
Kernstück dieser Arbeit ist der Forschungsteil (Kap.4). Hier wird die Arbeit im Rahmen der qualitativen Sozialforschung verortet und die angewendeten Methoden vorgestellt (Kap.4.1). Im Anschluss werden die geführten Interviews dokumentiert und ausgewertet (Kap.4.2).
Kapitel 5 umfasst die Diskussion der Ergebnisse: Der Begriff Spiritualität (Kap. 5.1) und die Begriffspaarung Gesundheit und Spiritualität (Kap.5.2) werden im Querschnitt analysiert und miteinander verbunden. Es folgt eine Darstellung des Gesundheitsbegriffes als ein Individuationsprozess, der sich auf das Kohärenzgefühl und die Identitätsbildung auswirkt (Kap.5.3). Anschließend wird ein Entwurf ganzheitlicher Gesundheitsförderung auf personeller Ebene skizziert (Kap. 5.4).
Page 4
2. Gesundheit
"Gesundheitund Krankheit sind wie Geburt und Tod Grundphänomene des menschlichen Lebens, sie beziehen sich auf Natur und Kultur, sind Biologie und Geist, stellen immer deskriptive und normative Begriffe dar, sind Beschreibung und Bewertung"(Engelhardt,1995).2.1. Das Gesundheitsverständnis im historischen Wandel
Um den Gesundheitsbegriff für Gedanken und Ansichten, die ihren Ursprung in spirituellen Fragen haben und somit auch immer Fragen unserer menschlichen Existenz streifen, zu öffnen, kommt man nicht umhin einen Blick in den historischen Hintergrund unseres heutigen Verständnisses von Gesundheit und Krankheit zu werfen. Im Rückblick auf die europäische Geschichte des Gesundheitsbegriffes wird eine vielschichtige Verwobenheit sowohl mit der menschlichen Kulturgeschichte als auch mit der Geistesgeschichte deutlich: In der Antike wurden Gesundheit und Krankheit kosmologisch und anthropologisch verstanden, im Mittelalter dominierte die Perspektive der Transzendenz und erst die Neuzeit folgte dem Prinzip der Säkularisierung (Engelhardt, 1995). Seit ca. 500 v. Chr. fällt immer wieder der Diätetik eine besondere Rolle zu. Die Kunst der gesunden Lebensführung beschränkte sich nicht nur - wie heute oft verstanden - auf eine Lehre der ausgewogenen Ernährung, sondern stellte ein weit gespanntes Netzt der gesunden Lebensführung dar, das in erster Linie der Gesunderhaltung und nicht der Krankheitsbekämpfung diente. Aus ursprünglicher Sicht teilte sich die Diätetik in sechs Bereiche auf: Luft und Licht (aer), Essen und Trinken (cibus et potus), Schlafen und Wachen (somnus et vigilia), Bewegung und Ruhe (motus et quies), Ausscheidungen (secreta et excreta) und Affekte (affectus animi). Diese über die Jahrhunderte vielfach variierende Lehre bildete im Kern eine Anleitung zum geordneten Leben, getragen von der Bemühung um ein vitales Gleichgewicht in allen grundlegenden Lebensbereichen und der Ermahnung zu eigenverantwortlichem Handeln in Gesundheitsfragen (Bergdolt, 1999). Angesichts der steten Zunahme von chronisch degenerativen Erkrankungen kommt auch heute der Vorstellung einer gesundheitlichen Selbstverantwortung und der damit einhergehenden Kostenexplosion wieder eine neue, ungeahnte Bedeutung zu
Page 5
(Engelhardt, 1995). Die europäische Geschichte der Diätetik belegt die enge Verflechtung der Gesundheitslehre mit Fragen der Kultur, der Religion und der Philosophie (Bergdolt, 1999).
Sinnliche Vollkommenheit wurde in der Antike noch mit körperlicher Gesundheit gleichgesetzt, welche durch einen Zustand der Harmonie und Balance erreicht wurde. Wesentlich hierfür war die Verbindung des Menschen als kulturelles Wesen mit der Natur und deren Gesetzmäßigkeiten, welche in einem Schema von Elementen, Säften, Organen und Temperamenten angewendet wurden. Diese vorausgesetzte Parallelität von Mikrokosmos und Makrokosmos brachte ein Gesundheitskonzept hervor, in dem Heilung in erster Linie die Wiederherstellung eines harmonischen Gleichgewichtes war. An oberster Stelle der therapeutischen Maßnahmen standen hierbei die Grundsätze der Diätetik, dann folgte das Medikament und zuletzt kam die Chirurgie. Der große antike Mediziner Galen verstand die Wissenschaft der Medizin als eine Wissenschaft der Gesundheit, der Krankheit und der Neutralität, als Zustand zwischen beiden (ne-utrum, keines von beiden). Nach Galen musste die Krankheitsüberwindung der Gesundheitsbewahrung untergeordnet werden (Engelhardt, 1995), eine Vorstellung die aktuell wieder Beachtung in einer Umorientierung zur Prävention und Gesundheitsförderung findet. Ebenso findet die Bemühung Galens, die Dichotomie der Begriffe Gesundheit und Krankheit im Sinne eines Entweder-Oder durch die Einführung des neutralen Zwischenzustands aufzuheben, Anklänge im aktuellen Ansatz der Salutogenese. Im christlichen Mittelalter besaßen Gesundheit, Krankheit und Heilung einen religiösen Sinn und der Körper sollte im diätistischen Sinne als Gefäß der Seele gepflegt werden. Dieheilsgeschichtliche Bedeutungvon Krankheit und Tod spiegelte sich in der Vorstellung einer Urdifferenz zwischen dem Menschen und dem Göttlichen wider, die aus jeder Überwindung von Krankheit einen Akt der Auferstehung werden ließ. Krankheit, und somit auch Gesundheit hatten einen fundamentalen Schöpfungssinn und wurden als notwendiger Bestandteil der menschlichen Existenz akzeptiert. Die antike Gleichsetzung von sinnlich-sittlicher Vollkommenheit mit körperlicher Gesundheit wurde nicht mehr für absolut erklärt (Engelhardt, 1995). Krankheit sollte nicht nur etwas Negatives
Page 6
sein und Gesundheit nicht nur etwas Positives. Krankheit als innerer Akt der Wiederauferstehung im Sinne einer seelischen Reifung, führte zu einer Weitung des Gesundheitsbegriffes auf die Fähigkeit Krankheit auszuhalten oder in das Leben zu integrieren. Und so sprach man genauso von der Kunst des Sterbens (ars moriendi) wie von der Kunst des Lebens (ars vivendi) (Engelhardt, 1995). Hildegard von Bingen, Äbtissin, Naturforscherin und Ärztin, setzte sich für die Natur und den Leib ein, als Träger der menschlichen Seele, ordnete aber das Physische immer dem Geist unter. Charakteristisch für das Mittelalter war das tief empfundene Verständnis von Mitleid und Liebe (caritas), das dem christlichen Barmherzigkeitsgedanken entsprang, und zur Gründung von vielen Hospitälern führte, die sich der Leidenden und der Ausgestoßenen annahmen. Diese christlichen Werke der Barmherzigkeit prägten entscheidend die grundlegenden Ideen der fürsorgenden, sozialen Gemeinschaft in der späteren, staatlich verankerten Gesundheitsfürsorge. Tugenden wie die der Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Bescheidenheit, Liebe, Glaube und Hoffnung sollten sowohl dem Kranken als auch den Ärzten Hilfe und Stütze sein. Der ideale Arzt des Mittelalters hatte ein hohes Maß an Mitgefühl für das körperliche und seelische Leid des Erkrankten, welches über die neutrale, wissenschaftliche Distanz heutiger Mediziner weit hinausgeht (vgl. Engelhardt, 1995).
Schipperges beschreibt in seinem historisch kritischen Panorama 'Gesundheit und Gesellschaft' (2003) das klassische Konzept der Heilkunde, welches über die Jahrhunderte getragen wird von einer kategorialen Dreigliederung, in der Gesundheit als ein Ideal verstanden wird, dem man sich nur annähern konnte, und Krankheit als einkritischer Grenzstandgewertet wurde. Dazwischen lag das riesige Übergangsfeld 'neutralitas', wo man weder richtig krank noch ganz gesund war. Die Einführung der Sozialversicherung in der Neuzeit setzte eine Ökonomisierung der menschlichen Gesundheit als ein Kapital voraus, das ihren Wert aus der Arbeitsfähigkeit des Menschen generierte. Man ließ sich entweder krankschreiben oder man meldete sich wieder gesund und stand so dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung. Diese gesellschaftliche Veränderung in der Gesetzgebung führte zum Verlust des neutralen Feldes (ne-utrum) als der Zwischenbereich, in dem sich der Mensch normalerweise
Page 7
befindet. Nach Schipperges (2003) liegt gerade in diesem riesigen, verloren gegangenen Übergangsgebiet der Kompetenzbereich der Ärzte wie auch der alltägliche Entscheidungsspielraum des Patienten. Diese Kultivierung des Alltags folgte über die Jahrhunderte den Gesetzmäßigkeiten der Diätetik und stellte schon immer eine lebenslange Aufgabe dar (Schipperges, 2003).
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts liefert der mechanistische Blick auf die menschliche Physiologie und Pathologie einerseits die Voraussetzung für viele Errungenschaften der modernen Heiltechnik, auf der anderen Seite verengt sich über dieses 'Reparaturmodell' der Blick auf die Gesundheit des Menschen als einen negativ beschriebenen Zustand, welcher sich in erster Linie durch die Abwesenheit von Krankheit auszeichnet. Schipperges zitiert in seinen Ausführungen Viktor von Weizäcker, welcher bereits Mitte des 20. Jahrhunderts feststellte, dass es der modernen Medizin an einer positiven Formulierung von Gesundheit fehle. Gesundheit ist nach Weizäcker"...ein Ziel, welches den Menschen selbst betrifft, nämlich das, was der Mensch zu werden hat"und weiter:"Gesundheit hat mit Liebe, Gemeinschaft und Freundschaft gemeinsam die eindeutige Richtung, die nicht umgekehrt werden kann"(Weizäcker in Schipperges, 2003, S.106). Der daraus resultierende dynamische Gesundheitsbegriff orientiert sich an der Mittellage des Daseins, die wir allgemein Gesundheit nennen, und Gesundsein beschreibt sich nicht als ein statischer Normalzustand, sondern als ein ständiger Prozess der Veränderung, des Wachsens und Reifens und des Sterbens. So können Gesundheit und Krankheit nicht aus sich selbst heraus verstanden werden, sondern nur aus der Erfahrung des Lebens heraus (Schipperges, 2003).
Subjektive Vorstellungen von Gesundheit finden vor allem im Zwischenbereich, dem oben beschriebenen 'neutralen Feld', zwischen absoluter Gesundheit und absoluter Krankheit statt, und stellen in ihrem lebensgestaltenden Wesen eine Form der persönlichen Kultivierung des Alltags dar. Hier summieren sich die persönlichen Erfahrungen mit Gesundheit und Krankheit, bzw. Gesundsein und Krankwerden zu einem durchlebten Erfahrungswissen, aus dem sich ein subjektives Konzept von Gesundheit und Krankheit extrahiert. Es stellt ein Handwerkszeug für den alltäglichen Umgang mit Gesundheit und Krankheit dar und variiert individuell in seiner Komplexität.
Page 8
Im Hinblick auf denaktuellen Gesundheitsbegriff,erweist es sich auch heute als schwierig Gesundheit zu definieren, da es je nach theoretischer Perspektive ganz unterschiedliche Bestimmungen von Gesundheit gibt. Die Medizin definiert Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit, eine Negativaussage, die immer noch die Frage offen lässt, was genau Gesundheit sei. Die einflussreichste Gesundheitsdefinition stammt aus der Präambel der Charta der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 1948:“Gesundheit ist ein Zustand eines vollkommenen körperlichen, seelischen und sozialenWohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen".Die naheliegende Schlussfolgerung, dass es dann im Verhältnis zur gesamten Weltbevölkerung sehr wenig gesunde Menschen geben muss, da hier ein Idealzustand formuliert wird, der für viele Menschen wohl immer Utopie bleiben wird (Becker, 2006, Bergdolt, 1999), hat für viele kritische Stimmen gesorgt. So sieht Bergdolt (1999) zum einen in der Präambel ein illusorisches Diktum angesichts der rapide wachsenden Weltbevölkerung. Zum anderen würde hier der grundsätzliche Irrtum reflektiert, dass es für den Menschen nur zwei körperliche Befindlichkeiten gäbe: nämlich Krankheit oder Gesundheit (Bergdolt, 1999).
Becker (2006) begrüßt an der WHO-Definition das grundsätzliche Bemühen um einen positiven Gesundheitsbegriff, der mehr beinhaltet als die Abwesenheit von Krankheit und auf die Zusammenhänge zwischen körperlichem, psychischem und sozialem Wohlbefinden hinweist. Das erlaubt eine Perspektiverweiterung im Sinne eines biopsychosozialen Gesundheitsmodells. Er nennt vier Kernkonstrukte, die Gesundheit, ausmachen:xFunktionstüchtigkeit der OrganexLeistungsfähigkeit
xErfolgreiche Anpassung an die LebensbedingungenxWohlbefinden
Faltermaier (2005) verzichtet auf weitere Definitionsbemühungen des Gesundheitsbegriffes und trägt stattdessen Bestimmungsstücke zusammen, die er in seinen gesundheitspsychologischen Auslegungen für wichtig erachtet. Er betrachtet Gesundheit als ein ganzheitliches Phänomen, das sich auf drei Ebenen, der psychischen, physischen und
Page 9
der sozialen, beschreiben lässt. Gleichzeitig ist Gesundheit auch ein Zustand des Individuums, der sich sowohl positiv als auch negativ definieren lässt. Die Messbarkeit von Gesundheit durch objektive Parameter wird ergänzt durch die subjektive Beschreibbarkeit von individuell wahrgenommener Gesundheit, welche sich in körperlichem und/oder seelischem Wohlbefinden ausdrückt. Gesundheit umfasst nach Faltermaier neben der Befindlichkeit einer Person auch immer deren Handlungspotential als Grundlage für Leistungsfähigkeit und soziale Teilhabe. Die gesellschaftlichen Anforderungen an die Person ergeben sich aus ihrem sozialen Kontext, welcher die vorherrschenden, historisch gewachsenen Lebensvorstellungen spiegelt und Gesundheit dadurch auch immer zu einem sozialen Konstrukt werden lässt (Faltermaier, 2005). Gesundheit, so Faltermaier, sei zwar als Zustand beschreibbar, müsse aber vor allem als dynamischer Prozess verstanden werden, den das Individuum in ständiger Interaktion mit seiner Umwelt aktiv mitgestaltet. Dadurch ist ein Organismus aufgerufen, seine Fähigkeit einzusetzen, Balance herzustellen. Auf diese Weise stellt sich, nach Faltermaier, Gesundheit für den Menschen als ein dynamisches Gleichgewicht dar. Die Parameter mit denen Gesundheit gemessen werden können, wurzeln in Normen und Werten, die dem Individuum gleichzeitig als Orientierung dienen. Sie sind an soziale Erwartungen, funktionale Anforderungen oder auch statistische Normen gekoppelt und finden in der WHO-Definition als Ideal ihren Ausdruck (Faltermaier, 2005).2.2. Gesundheit im salutogenetischen Bezugsrahmen