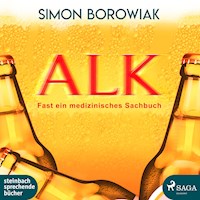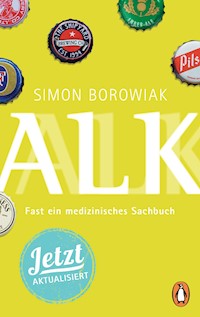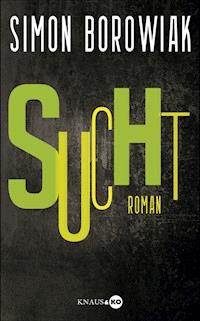
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bitterernst und federleicht – ein Roman über Sucht, wie es ihn noch nie gab.
Cromwell hat sieben Hausärzte am Start, die nichts voneinander wissen und ihm reichlich Aufputsch- und Beruhigungsmittel verschreiben. Das geht natürlich nicht ewig gut, und so beschließen seine Freunde, den Tablettensüchtigen zur Entgiftung in die Klinik einzuweisen.
Simon Borowiak gelingt das Meisterstück, über das Innenleben einer psychiatrischen Notaufnahme, über die Abgründe von Süchtigen und die Schmerzen der Depression so schreiben, dass jede Zeile Spaß macht. Denn Borowiak erzählt von eigenen leidvollen Erfahrungen, weiß aber sehr genau: Die schlimmsten Dinge im Leben kann man nur als Komödie erzählen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Alle Personen sind selbstverständlich frei erfundenund sämtliche Situationen an den Haaren herbeigezogen.
1. Auflage
Copyright © 2014 beim Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-09154-5www.knaus-verlag.de
Meinen geplagten, geliebten Eltern
Kapitel 1
Cromwell Jordan war ein weiches Kind, das viel träumte, nie krank war und weder Gott noch Keuchhusten fürchtete. Damit hätte seine Entwicklung zu einem ebenso prachtvollen wie angstlosen Menschen gebongt sein können. Weil aber so dies und das dazwischenkam, entwickelte Cromwell sich letztlich zu einem brüchig-besonnenen Erwachsenen, der zwar noch manchmal träumte, aber ansonsten mit Kinderkrankheiten beschäftigt war. Und seine Besonnenheit war brüchig, weil sie eine chemische war. Denn eines Tages beschloss er, wann immer ihn Gott, Keuchhusten oder Angst zu zerreißen drohten, Tabletten en gros zu sich zu nehmen. Und schon wurde aus dem Aufgeriebenen ein friedfertiger Phlegmat, der es liebte, sich so weit wie möglich aus der Realität zu entfernen und im Schlaf selbst loszuwerden. Doch auch die Methode mit den Tabletten half nur etwa ein Jahr. Zwar ging Cromwell nicht der Stoff aus, denn er hatte inzwischen sage und schreibe sieben Hausärzte am Start, die nichts voneinander wussten und von denen ihm jeder einmal im Monat reinen Gewissens eine Monatspackung verschrieb.
»Das geht schief«, warnte ich. Aber ein angstfreier, gelöster Cromwell gab chemisch-besonnen zu bedenken, dass es sich bei ihm schließlich nicht um einen charakterschwachen Alkoholiker handle, er kenne da so manche. Immerhin fügte er, bevor ich betroffen aufjaulen konnte, hinzu: »Ich habe nichts gegen charakterschwache Alkoholiker. Mein bester Freund ist einer.«
»Danke. Aber das geht trotzdem schief.«
Ich behielt recht, und bald zirpte in Cromwell die alte biochemische Leier: Mehr nehmen, mehr vertragen, noch mehr einwerfen, nichts mehr spüren und den achten Hausarzt ins Rennen schicken. Schließlich kam der Moment, da Cromwell nach siebzig Stunden der Schlaflosigkeit bereit gewesen wäre, für ein Nickerchen zu töten. Trotz verschärfter Einnahme seiner hochpotenten Mittelchen wollten sich seine Lider nicht in die Ruheposition drücken lassen – er blieb glockenwach. Und als die achtzigste Stunde der Wachheit nahte und noch immer weit und breit kein Hahn krähen wollte, beorderte Cromwell aus Sorge um seinen Geisteszustand unseren Freundeskreis zu sich.
Wir sind das, was eine Marketing-Nutte mit dem Begriff »praktischer Dreierpack« bewerben würde. Cromwell und ich sind alte Kriegskameraden; wir haben uns im Krankenhaus kennengelernt und gemeinsam im Schützengraben der Psychiatrie gelegen. Auf derselben Station unter therapeutischem Beschuss, stellten wir aneinander überraschende Ähnlichkeiten fest, was Humor, Geschmack und Vollmeise angeht. Und so wurden wir einander zu Stütze, Beichtvater, Gouvernante und Consigliere. Eine im Vollsuff vollzogene Blutsbrüderschaft bescherte uns nicht nur den Rauswurf aus besagtem Institut (Therapeuten mögen es gar nicht, wenn sich ihre Klientel mit anderen Drogen als den verordneten andröhnt – und wenn dabei auch noch kichernd mit Rasierklingen hantiert wird), sondern besiegelte eherne Freundschaft und Treue. Später, während eines Urlaubs, stieß Mendelssohn zu uns; er hat zwar keinerlei psychiatrischen Schaden, dafür ist er blind und teilt unsere beinahe pathologische Neugierde an Menschen und den Szenen, die Menschen so fabrizieren. Dieser uns dreien gemeinsame Voyeurismus führte auch zu dem Plan, eine Privatdetektei zu gründen. Denn Mendelssohn ist der geborene Spitzel mit seinem hochempfindlichen Gehör und dem harmlosen Aussehen; nicht nur, dass er in der Lage ist, in einer überfüllten U-Bahn Gespräche aus der letzten Reihe herauszufiltern, auch benehmen sich wildfremde Menschen ihm gegenüber extrem aufgeschlossen, wenn nicht schamlos: Die Gewissheit, dass er sie niemals auf der Straße wiedererkennen könnte, löst ihre Zungen, und ehe er es sich versieht, hat ihm jemand zwischen zwei roten Fußgängerampeln seine ganze Lebensgeschichte erzählt, inklusive intimer Details. Sein gerne zitiertes Paradebeispiel für die Offenherzigkeit des Normalbürgers gegenüber einem Blinden ist das Lebensresümee einer alten Dame, die ihm zwischen zwei Verkehrsinseln anvertraute: »Ich hatte es ja auch nicht leicht: Zweimal ausgebombt und der Mann impotent.« Außerdem besitzt Mendelssohn eine Villa in bester Gegend, die als Headquarter eine Menge hermacht. In unserem Trio nehme ich die Rolle des Pragmatikers ein, oder wie Cromwell sagt: »Du bist der geborene Grobmotoriker.« Cromwell hingegen soll eigentlich als unser Zentralrechner, als koordinierendes Superhirn fungieren. Aber dafür sollte das Superhirn klar sein. Unbenebelt. Einen tablettenabhängigen Chef mit Zuckerwatte im Oberstübchen kann sich kein Geheimdienst leisten.
Ich radelte durch die feuchte Dunkelheit bis zur Kieler Straße, die einem etwa mississippibreiten Strom gleich Eimsbüttel von Altona trennt. Schwerlaster zogen asphaltbetäubend vorbei, nach Stunden wurde die Ampel grün, und ich überquerte diese dröhnende Grenze, fuhr die Große Bahnstraße entlang, vorbei an deplatzierten Einfamilienhäusern, die da rumstehen, als hätte sie jemand aus einem Dorf gestohlen und hier zwischen Stadt und Restindustrie abgesetzt. Städtische Industrie in nasser Herbstnacht ist mir das Größte: Gerade noch ein Vorgarten, eine Mülltonne, ein verprügelter Bungalow mit Imbiss-Schild, dann plötzlich eine schwarze Halle mit Leitungen und Gestänge von innen nach außen. Ein riesiger Organismus, den jemand angeschlossen hat an Kabel, Infusionen, Schrittmacher und Sirenen; mit einem bösartig aufgerissenen Eingangstor, vor dem bei Tag Azubis rauchen und von Montag bis Freitag über Wochenenden schwatzen. Dann mit Anlauf auf die Überführung, unter mir eine Brache mit Wasserstellen – es sieht aus, als ob es in Hamburg Büffel gäbe; alles gesäumt von aufsässigen Birken und schmutzigem Schilf. Vom Zenit der Überführung mit Schwung hinunter in einen Tunnel, wo es immer und zu jeder Jahreszeit aus dem Mauerwerk tropft und wo sich Pfützen und Pisse und Schall so sammeln, dass man jedes Mal überrascht aus ihm auftaucht: Überrascht, dass er überhaupt ein Ende hat und dass es an seinem Ende plötzlich normale Luft gibt mit normalem Sauerstoff. So strampelte ich durch Zeit und Raum in die Schleswiger Straße und klingelte Sturm. Es war vier Uhr am Morgen.
Zur gleichen Zeit hielt dort ein Taxi, dem Mendelssohn entkletterte. Gemeinsam traten wir zur Nachtwache bei unserem inzwischen extrem launischen Kompagnon an: Cromwell öffnete aufgekratzt die Tür, gleich darauf fühlte er sich »wie ein durchgesessenes Sofa«. Gegen fünf Uhr bereitete er laut pfeifend und mit energischen Handgriffen ein überwürztes Gyros zu, doch gleich nachdem er Mendelssohn und mir die Riesenportionen aufgenötigt hatte, versank er in dumpfen Groll. Gegen sich selbst grollte er, gegen die Natur des Hirnstoffwechsels, gegen die aktuelle politische Lage, und gleich darauf lag er den Tränen nahe im Bett. »Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will schlafen. Ich will sterben.«
Mendelssohn, der in der Lage ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit mit großem Appetit ein überwürztes Tellergericht zu sich zu nehmen, legte passend zum Wort »sterben« mitfühlend Messer und Gabel beiseite. Ich beobachtete unseren gefräßigen Freund mit wissenschaftlichem Interesse: »Wie kann sich ein Mensch im Morgengrauen und innerhalb von acht Minuten etwa drei Kilo Geschnetzeltes reindrehen? Hat das mit deinem fehlenden Hell-Dunkel-Rhythmus zu tun? Könnt ihr Blinden eigentlich immer essen?«
»Mumpitz! Ich habe einen Tag-Nacht-Rhythmus wie jeder normale Mensch auch! Bloß dass ich nun mal seit Kindertagen sehr gesegneten Appetits bin«, sagte Mendelssohn und versuchte, seinen leeren Teller auf einem Bücherstapel neben Cromwells Bett zu justieren. Ich nahm ihm den Teller weg: »Scheunendrescher. Aber euch über die Straße helfen lassen, das könnt ihr.« Mendelssohn weiß zwar immer, wann Tag oder Nacht ist, aber nicht immer, wann ich ihn hochnehme. »Wir können uns jetzt gerne über den kalorischen Grundumsatz eines Blinden unterhalten!«, hob er empört an. Doch Cromwells Winseln stoppte ihn: »Willst du es nicht noch mal mit Tabletten versuchen? Ich denke, dein Arzt hat dir solche Extrakracher verschrieben.«
»Das ist es ja!«, wütete Cromwell aus seinen Kissen. »Die wirken nicht mehr! Mein Körper ist schon völlig abgestumpft! Genauso gut könnte ich – Schokomandeln einwerfen! Das hätte denselben Effekt!«
»Hmhm!«, machte Mendelssohn, und es war nicht zu erkennen, ob aus Sorge um den Freund oder wegen der Schokomandeln.
»Auf wie viel pro Tag bist du denn jetzt?«, fragte ich professioneller Suchtberater.
»Hm, auf, etwa, bis zu – sechs oder sieben.«
Ich nahm eine leere Tablettenschachtel: »Von denen hier? Sechs bis sieben à zehn Milligramm?«
»Hm, ja, so circa. Können auch zehn bis zwölf sein.«
»Mein Lieber …«
»Ich weiß.«
Inzwischen lagerte Cromwell nur noch und sah aus wie frisch gekreuzigt.
»Du musst davon los. Du musst entgiften.«
»Ich weiß. Aber ich will nicht.«
»Wir begleiten dich. Du bist nicht allein.«
»Das hab’ ich befürchtet.«
»Willst du in diesem Leben noch mal schlafen? Willst du in diesem Leben noch mal Ruhe haben? Dann sprich mir nach: Ja, ich will.«
»Ich hab’ Angst.«
»Hätte ich an deiner Stelle auch. Aber es nutzt ja nix: Du musst da runter.«
»Okay.«
Auch Cromwells Wohnung sah aus, als hätte sie seit Wochen kein Auge mehr zugetan: Von der üblichen Cromwell’schen Grundordnung war nichts mehr übrig. Auf dem Schreibtisch, dem Esstisch, in der Spüle hatten sich die Sedimente vieler unsortierter Alltage abgelagert. Teller mit angetrockneten Essensresten wackelten auf Aktenordnern, schmutzige Tassen lungerten unter dem Bett, dreckige Wäsche stapelte sich im Bad. Ungeöffnete Post hatte Cromwell direkt neben der Eingangstür auf den Boden geworfen; unter dem Stromzähler lagen Fensterbriefe von amtlich-gewichtigem Aussehen, auf dem Sicherungskasten hockten mehrere Streifbandzeitungen sowie ein halbleeres Gurkenglas. In quasi jeder Wohnungsecke stand ein voller Aschenbecher parat. Und aus unerfindlichen Gründen ruhte eine sich mählich wölbende Pizza auf einer Fensterbank. Überall lag Kleingeld. Es sah beinahe so aus wie in meiner Einraumbutze kurz nach einem Rückfall. Fehlten nur die Batterien von leeren Flaschen. Und dieser trostlose Wodkadunst.
»Aufräumen, packen, anmelden«, schlug ich vor. »Wir bringen ein bisschen Grund rein, packen dir ein Köfferchen, und sobald deine Hausärztin öffnet, holen wir eine Einweisung.«
Cromwell schnorchelte in seine Kissen. Es klang nach einem »Okay« sowie einem »LecktmichamArsch«.
Mendelssohn begann mit einer Predigt über das Leben und die Lebensfreude unter besonderer Berücksichtigung von Depression und Liederlichkeit, und ich knöpfte mir Cromwells Wohnzimmer vor. Auf Grund eigener leidvoller Erfahrungen bin ich inzwischen sehr geschult in der zügigen Beseitigung von Verwahrlosung. Nach zehn Minuten waren Ess- und Schreibtisch wieder zugänglich und in der Küche weichte das Geschirr ein. Post und Geld drapierte ich sorgsam auf Cromwells Schreibtisch. Dort fand ich auch sein Telefon, eine runzlige Bockwurst, einige Haribo-Tütchen sowie zwei Fotos.
Das eine zeigte Heike und versetzte mir gleich zwei Stiche auf Herzhöhe: Erstens versetzt Heike mir grundsätzlich einen Stich auf Herzhöhe, und zweitens wusste ich gar nicht, dass wir ein Foto von Heike besaßen! Scharfes Nachdenken ergab, dass Cromwell damals, bei unserem Ausflug ins Hochgebirge, tatsächlich eine Kamera dabeigehabt hatte. Und mir offensichtlich einen Abzug vorenthielt! Im Hintergrund türmten und dräuten Massive, weiße Endlosigkeit, finsterste Tannen, im Vordergrund saß Heike an einem wurzeligen Holztisch und schien gerade das zu machen, was wir so an ihr lieben: Gesprächspartner filetieren. Von den heikeschen Opfern sah man nur verschattete Hinterköpfe, Heike davor in voller Pracht und Aktion, sprechend, leichte Gestik, und dann ihr spezieller Blick. Heikes Blick ist eine scharfe Waffe. Alles pulverisierend; ein Blick wie ein Laserstrahl. Einmal hat sie – und da bin ich Zeuge! Das habe ich miterlebt! – einen Menschen am anderen Ende eines Saales, also einmal quer durch eine große, mit lauten Partygästen gefüllte Halle hindurch, allein durch zielgerichtetes Anschauen zum Schweigen gebracht. Wenn ich mich recht entsinne, zuckte der derart Angeblickte sogar zusammen, als hätte ihm Heike gerade eine geschallert. Ebenfalls zu ihrem Handwerkszeug gehört eine so präzise wie aufrichtige verbale Deutlichkeit, dass es schon manchmal an Tourette grenzt. Ihre Auffassungsgabe plus das dazugehörige bordeigene Verwertungssystem ist von nicht minderer Schärfe als die Skalpelle, mit denen sie in ihrer Chirurgie Tag für Tag beherzt in Menschen reinschneidet.
Oft habe ich daran denken müssen, dass die einzigen Menschen auf Erden, die offiziell in ihre Mitmenschen hineinschneiden dürfen, entweder die Berufsbezeichnung »Chirurg« oder »krimineller Psychopath« haben. Ob es da denn wirklich keine Schnittstellen gibt?
Seltsamerweise hatte dieses menschliche Geschoss Cromwell und mich damals ins Herz geschlossen – obwohl wir beide uns während dieser Bergsause nicht gerade von unseren psychisch attraktivsten Seiten gezeigt hatten: Cromwell im Begriff, hartherzig eine seiner zahlreichen Teilzeitverlobten abzustoßen, ich mal wieder schlingernd in depressiver Verdunklung, als würde ein heulendes Kind in einer schwarzen Seifenkiste gen Abgrund rollern … Seitdem telefonierten wir regelmäßig, und immer sprang mich dabei der Moment von Heikes Abreise an – ich saß einsam, schief und verkrümelt im erwachenden Tag, und bevor Heike ihr Auto bestieg, küsste sie mich, dass die verdammten Alpen glühten …
Zur Strafe für etwaige Heimlichkeiten zwischen Cromwell und Heike stahl ich das Foto und steckte es in die Hosentasche. Zur Rechenschaft würde ich ihn zu einem späteren Zeitpunkt ziehen.
Das zweite Foto zeigte Cromwells Exgattin Mick. Ich ging damit ins Schlafzimmer und hielt es anklagend hoch: »Sag mal, du elendes Rapunzel! Warum umgibst du Masochist dich mit solchen Fotos? Da ist es ja kein Wunder, dass du kein Auge zumachst!«
»Was für Fotos?«, fragte Mendelssohn. Seine Stimme bekam dabei ein durchaus sensationslüsternes Timbre.
»Aktfotos«, sagte ich. »Sehr, sehr nackige junge Männer in eindeutig nackigen Positionen.«
Ich weiß doch, wie man einen Mendelssohn entflammt.
»Nein! Wirklich?!«, rief Mendelssohn angetan.
»Blödsinn!«, ächzte Cromwell. »Ich hab’ aus Versehen noch ein altes Foto von Mick gefunden. Du kannst es wegwerfen.«
Ich betrachtete das Foto. Mick sah so harmlos aus. Wie ein etwas verunsicherter und etwas trotziger Teenager sah sie in Cromwells Kamera. Nichts ließ ihre destruktiven Kräfte erahnen. Ihre soziale Stellung als dominant-gestörte Ehefrau mit der Lizenz zum Terror sah man ihr nicht an. Ich steckte Mick zu Heike in die Tasche und ging zurück zum eingeweichten Geschirr.
Vor dem Fenster kam Bewegung in die Finsternis. Die Dunkelheit schien zu Boden zu gleiten, während von oben etwas Dunkelgraues nachfloss. Dann kam Hellgrau, und im Haus gab es Geräusche. Eine Wasserleitung, ein Stapfen auf der Treppe, eine Tür. Auch die plattfüßige Mieterin über uns erwachte. Mein Gott! Dieses dumpfe Wummern durch alle Räume! Konnte dieser blöden Kuh nicht endlich jemand Einlagen schenken! In der langen Reihe ihrer Galane, mit denen sie oft einen so ohrenbetäubenden Geschlechtsverkehr ausübte, dass Cromwell behauptete, sie übe wahrscheinlich nur für die Wahl zur »Miss Vorgetäuscht« – also unter all diesen Stechern musste sich doch auch ein Orthopäde finden!
Die Küche war wieder reinlich, vor dem Haus starteten Autos. »Und jetzt wollen wir dem Onkelchen mal eine schöne Reisetasche packen! Ja, wo hat der Onkel denn seine Reisetasche?«
Cromwell zeigte auf seinen Kleiderschrank.
Auf Grund eigener leidvoller Erfahrung bin ich inzwischen sehr geschult im Packen eines Notkoffers, zumal eines Entgiftungskoffers: Das Wichtigste sind Zigaretten. Viele Zigaretten. Es gibt nichts Schlimmeres, als während einer mehrtägigen Ausgangssperre bei den Mitpatienten Zigaretten schnorren zu müssen. Man fühlt sich doch sowieso wie ein Penner. Aber sich dann auch noch sagen zu hören: »Kannst du mir eine Zigarette geben?« – das verleiht dem Selbsthass Flügel.
Sodann braucht man ein Lieblingsbuch, um sich aus der elendigen Situation wegbeamen zu können. Zu empfehlen ist hier ein Kinderbuch. Zum Beispiel »Das Pferd ohne Kopf«. Denn der ganze Ramsch für Erwachsene ist ja meist zu ernst und abstrakt, als dass man sich damit in eine andere Umlaufbahn schießen könnte. Oder hat man schon je davon gehört, dass sich jemand durch ernsthafte Lektüre aus einer ernsten Situation gerettet hätte? Oder dass jemand durch schwerblütigen Singsang aus seiner Schwermut erlöst wurde? Genauso wichtig wie ein das Gemüt erhellendes Buch ist ein gutes Deo. Wegen der zu erwartenden Schweißausbrüche. Was der Mensch auf Entzug so wegtranspirieren kann, ist schier übermenschlich. Auch nicht fehlen sollte ein Stofftier. Letzteres klein und unauffällig, so dass man es ohne größeren Gesichtsverlust in einer tränenreichen Minute kneten kann, bis dass sich wieder so etwas wie Lebensmut einstellt. Ein passables Stofftier ist sogar noch wichtiger als eine Zahnbürste oder Socken. Oder hat man schon je davon gehört, dass jemand Trost fand im Kneten von Socken?
In Cromwells Wohnung war kein Stofftier zu finden. »Sag mal: Du hast wirklich kein Stofftier? Auch kein kleines?«
Cromwell starrte mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Dann wendete er sich resigniert ab: »Tut es auch so was?« Und zog hinter seinem Bett einen melancholisch blickenden Hasen hervor. Kurzer Rumpf, kleiner Kopf, aber Riesenohren über den waidwunden Knopfaugen. Angenehm kurzer Plüsch; in etwa wie der abgeschabte Vorkriegspersianermantel einer Trümmerfrau.
»Name?«
»Sieveking. Frag mich jetzt nicht, warum. Aber er heißt nun mal Sieveking.«
Ich hielt Cromwell das Telefon hin: »Und nachher hole ich die Einweisung ab. Sag schon mal deinem Hausarzt Bescheid.«
»Welchem denn?«, gackerte Cromwell.
»Dem nettesten. Dem sympathischsten. Dem, der möglichst hier um die Ecke wohnt. Nicht dem Bergedorfer, nicht dem Wandsbeker – sag einfach deinem Altonaer Arzt Bescheid.«
Danach rief ich auf der Entgiftungsstation meines Vertrauens an. Ja, ich hätte Glück und könnte noch heute Morgen vorbeikommen. Nein, nein, erwiderte ich stolz, es handle sich um einen Freund. Ich selbst sei so clean und trocken, dass es eine wahre Freude sei! Trocken und rissig wie das schlimmste Brachland, quasi!
Als ich mich auf den Weg zu Cromwells Arzt Nummer fünf machte, startete Mendelssohn eine Predigt zum Thema Berufsunfähigkeit: »Wir zählen auf dich! Wenn unsere Detektei richtig laufen soll, dann müssen alle Mitarbeiter im wahrsten Sinne des Wortes AUSGESCHLAFEN sein!«
»Guter Gott. Ich kann nicht mehr!«, sagte Cromwell.
Wir fuhren mit einem Taxi ins Krankenhaus. Cromwell stöhnte vor sich hin. Mendelssohn drückte seine linke Hand, ich seine rechte.
»Ich will künstliches Koma!«, sagte Cromwell. »Ich will Totenstarre, bis alles vorbei ist.«
Wir nickten wissend.
Kapitel 2
Wenn man auf einer Entgiftungsstation per Handschlag begrüßt wird, ist dies doch eine eher zweifelhafte Referenz. Aber leider verhält es sich so: Ich kenne sie alle, sie alle kennen mich; da ist kaum eine oder einer, der mir noch nie den Blutdruck gemessen oder den Tropf ausgewechselt hätte. Und sie alle sind – ungelogen und ohne Verklärung – prima Menschen. Geduldig, humorvoll, und ich wundere mich immer wieder darüber, dass es auch bei mehrmaligem Scheitern und solchen Beinahe-Drehtürpatienten wie mir niemals zu einer spitzen Bemerkung gekommen ist oder einem Vorwurf oder einem Verdruss. Im Gegenteil: Sie machen Mut. Wenn du auf die Schnauze gefallen bist – steh auf. Jeder Rückfall könnte der letzte sein. Sei achtsam. Kümmere dich um dich.
Unser Verhältnis hat – betrachten wir dieses Miteinander von verzweifeltem, zitterndem Schlomo und einem Pulk helfender, freundlicher Profis – eine bizarre Note: Entweder päppeln sie mich auf, von der Schnabeltasse hoch zum aufrechten Gang, oder ich bringe ihnen in meinen abstinenten Phasen Blumen aus meinem Garten oder backe ihnen Kuchen, weil ich das Bedürfnis habe, sie auch mal ohne Flattermann zu sprechen und ihnen immer wieder mal zu danken. Ich vermute, dass ich sie als eine Art Verwandtschaft adoptiert habe, und fühle mich hin und wieder wie eine Graugans, die den grünen Stiefeln von Konrad Lorenz hinterhereilt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!