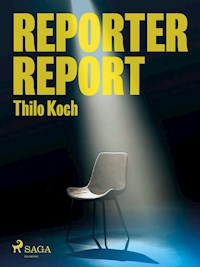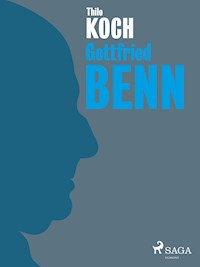Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Tagebuch aus Washington
- Sprache: Deutsch
In dem zweiten Teil dieser Reihe setzt Thilo Koch seine Erzählung im Jahre 1962 fort. Dies war sowohl sein zweites Jahr in Washington, als auch Kennedys zweites Jahr als Präsident. Aus der Sicht des deutschen Reporters, lernt der Leser die Zeit der Kuba-Krise in Beziehung zu Kochs Heimatsland Deutschland kennen. Dabei versucht der Reporter das Gleichgewicht zwischen Distanz und Verständnis zu finden, was ihm in diesem Buch sehr gut gelingt und einen detaillierten Einblick in die Politik jenen Jahres erlaubt.Die Ära Kennedy hatte Thilo Koch vollständig als Journalist begleitet, da er für den ARD Korrespondent in Washington war. In dieser Reihe erzählt Koch über diese Ära aus der Sicht eines deutschen Journalisten. Der Autor bleibt stets sachlich bei seiner Berichtserstattung, jedoch ist gleichzeitig seine eigene Einstellung zu den Geschehnissen in den USA deutlich, was der Buchreihe ihren ganz eigenen Charme verpasst. Der Journalist lädt den Leser ein, in die damalige Zeit einzutauchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thilo Koch
Tagebuch aus Washington 2
Saga
Tagebuch aus Washington 2Cover Bild: Shutterstock Copyright © 1963, 2019 Thilo Koch und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711836101
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
VORWORT
In diesem zweiten Bande des Washingtoner Tagebuchs ist Amerika dem Beobachter nähergerückt. 1962 war mein zweites Jahr in der amerikanischen Hauptstadt; es war zugleich das zweite Kennedy-Jahr. Man hatte sich eingerichtet. Personen und Dinge bekamen vertraute Umrisse. Die Kinder sprachen, dachten, träumten bereits in zwei Sprachen: Berlinisch und Washingtonian.
1962 war ein Jahr wachsender Mißverständnisse zwischen Washington und Bonn. Die schon stockig gewordene Berlinfrage wurde plötzlich in den Hintergrund gedrängt von der ersten unmittelbaren Konfrontation der beiden Weltmächte in der Kubakrise. Die amerikanische Hauptstadt selber mußte sich bedroht fühlen – in der Reichweite der sowjetischen Mittelstreckenraketen auf der Karibischen Insel vor dem amerikanischen Festland.
Die Amerikaner entwickelten eine neue, gesteigerte Aufmerksamkeit für Außenpolitik. Die komplizierten Pflichten ihrer Weltmachtstellung traten problematischer in Erscheinung. Europa mit der deutschen Frage und Berlin verschwand aus dem Zentrum der Besorgnisse; das Grollen der Unzufriedenheit in der amerikanischen Hemisphäre beherrschte die Szene.
Lateinamerika, mit Kuba an der Spitze, beanspruchte den Präsidenten mehr und mehr. Die Priorität der täglichen Nachrichten ging über zu den näherliegenden Problemen an der Südflanke der Vereinigten Staaten. In der Innenpolitik weckte Kuba ebenfalls eine neue, gesteigerte Unruhe. Kennedy hatte es schwer mit dem Parlament, obwohl seine Partei bei den Kongreßwahlen im Herbst 1962 gut abschnitt.
Dieser zweite Band meines Washingtoner Tagebuchs endet mit Berichten von der Bahama-Konferenz. Damit rückt wiederum Europa mit den Fragen der gemeinsamen Verteidigung mehr in den Mittelpunkt der Außenpolitik Washingtons. Als ein deutscher Korrespondent in Amerika hatte ich mich ohnehin bemüht, die amerikanische
Situation immer in Beziehung zu uns, zu den europäischen und deutschen Fragen zu verstehen und zu erklären.
Ich mochte auch in diesem zweiten Jahr nicht der Faszination Amerikas erliegen, mich nicht als Einwanderer fühlen. Distanz und Verständnis sollen einander die Waage halten beim journalistischen Beobachter. Möglich, daß das Verständnis in diesem zweiten Bande stärker ist, daß die Distanz etwas schwand. Dies wurde trotzdem kein amerikanisches Tagebuch in deutscher Sprache, sondern das Tagebuch eines deutschen Korrespondenten in Amerika.
Die Texte sind ebenso wie beim ersten Band – und wie bei einem geplanten dritten – Bearbeitungen der Berichte für den Norddeutschen und Westdeutschen Rundfunk und für DIE ZEIT.
Washington, im Mai 1963
Thilo Koch
2. Januar 1962
Das Beste, was man über das alte Jahr sagen kann, ist: Wir überlebten. Diese einleuchtende Summe zog, wie man hier in Washington hört, ein führender amerikanischer Diplomat zum Jahresende in Moskau. Möglicherweise war es Botschafter Llewellyn Thompson selbst, der das neue Jahr schon heute mit einer ersten amerikanischrussischen Besprechung über Berlin begann. Das Weiße Haus und das amerikanische Außenministerium werden zur Stunde schon einiges wissen über den Verlauf dieses ersten Ost-West-Kontaktes im Jahre 1962. Wir brauchen nicht sehr besorgt darüber zu sein, daß uns der diplomatische Meinungsaustausch zunächst noch verborgen sein wird. Es sind keine dramatischen, grundstürzenden Ereignisse für Mitteleuropa zu erwarten. Beide Seiten haben sich in Berlin so festgebissen, daß nur sehr allmählich und über Umwege eine Lösung denkbar erscheint.
Gerade die Politik des Präsidenten John Kennedy hat sich auf diesen Charakter der Weltsituation eingestellt. Zum Jahreswechsel verlautete einiges aus Palm Beach in Florida, wo Kennedy mit seiner Familie und in der Nähe seines kranken Vaters die Feiertage verbrachte – einiges über die Art, wie John Kennedy das abgelaufene Jahr beurteilt. Er sieht sich bestätigt in seiner Erwartung, daß weder schnelle Siege noch überraschende Niederlagen in den Sternen stehen. Kennedy glaubt auf Grund der umfassenden Informationen, die ihm – und wohl nur ihm – zur Verfügung stehen, daß der Westen wirtschaftlich und militärisch noch immer dem Osten überlegen ist. Aber doch nicht so, daß der Westen auf der Welt tun könnte, was er will. Das Geheimnis des Gleichgewichts der Kräfte liegt nach Auffassung des amerikanischen Präsidenten darin, daß die Machtblöcke ihre vitalen Interessen gegenseitig respektieren. Dazu gehört, daß sie die andere Seite über die genaue Beschaffenheit und auch Lokalisierung dieser vitalen Interessen nicht im un-klaren lassen. Es war infolgedessen das Bestreben Kennedys, die Russen vor allem erst einmal davon zu überzeugen, daß West-Berlin zu der vitalen Interessensphäre der Vereinigten Staaten gehört. Kennedy kam aus Wien von seiner ersten Begegnung mit Chruschtschow verhältnismäßig deprimiert zurück, weil er plötzlich sehr persönlich die Schwierigkeit dieser Aufgabe erkannt hatte. Ein gutes halbes Jahr nach Wien glauben sich aber die führenden Politiker in Washington zu der Annahme berechtigt, daß Moskau inzwischen besser verstanden hat, wie ernst die Vereinigten Staaten ihre vitalen Interessen zu verteidigen bereit sind. Mehr als 150 000 amerikanische Reservisten wurden einberufen, und mehr als 40 000 amerikanische Soldaten verstärkten die NATO-Truppen in Europa. Der amerikanische Steuerzahler mußte im laufenden Haushaltsjahr zusätzliche Verteidigungslasten in Höhe von sechs Milliarden Dollar übernehmen. Das sind 24 Milliarden DM, etwa doppelt soviel, wie die Bundesrepublik Deutschland im vergangenen Jahr überhaupt für Verteidigung aufbrachte. Die gesamten Verteidigungsausgaben der Vereinigten Staaten erreichten die unvorstellbare Größenordnung von 50 Milliarden Dollar, also 200 Milliarden DM, etwa viermal soviel, wie der gesamte Haushalt der Bundesrepublik ausmacht.
Die innenpolitische Kritik am jungen Präsidenten gipfelte im vergangenen Jahr in dem Satz: »Er spricht wie Churchill, aber er handelt wie Chamberlain.« John Kennedy liest aufmerksam die Zeitungen und reagiert auf öffentliche Kritik mehr, als nach außen sichtbar wird, empfänglich und manchmal sogar empfindlich. Der Vergleich mit jenem englischen Premierminister, der Hitler gegenüber diplomatisch kapitulierte, hat ihn – wie man hört – getroffen. Er ist auch ungerecht. Gewiß, der 44jährige Präsident hatte im ersten Jahr bittere Lehren einzustecken. Die Affäre Kuba steht an der Spitze. Es berührt sympathisch, daß Kennedy auch bei seinen Meditationen über das Jahr 1961 sein persönliches Versagen in der Entscheidung über die Kubainvasion nicht beschönigt. Aber tatsächlich kamen viele unglückliche Faktoren zusammen, und auch ein Präsident mit mehr Erfahrung hätte vielleicht der überwiegend falschen Beurteilung der Lage durch die Militärs, die politischen Berater und den Chef des Geheimdienstes nicht kräftig genug widersprochen. Daß die Vereinigten Staaten und mit ihnen die gesamte NATO am Ende des vergangenen Jahres militärisch zweifellos stärker und auch entschlossener den Herausforderungen überall in der Welt gegenüberstehen, ist Kennedys Verdienst und der beste Beweis dafür, daß er weit davon entfernt ist, etwa aus Berlin ein zweites München zu machen.
Vielleicht hatte Chruschtschow das gehofft, und in Washington hält man es für möglich, daß die allgemeine Verschlechterung der Beziehungen zu Moskau teilweise auf die Enttäuschung des sowjetischen Premierministers über den neuen amerikanischen Präsidenten zurückgeführt werden könne. Präsident Kennedy ist zweifellos keine aggressive Natur; an Zähigkeit und an Vorsicht bei der Anwendung extremer Macht wird er nicht so leicht von einem anderen regierenden Staatsmann dieser Jahre übertroffen werden können. Chruschtschow scheint den Mann an der Spitze der Gegenseite heute richtiger einzuschätzen als vor einem Jahr. Es ist bemerkenswert, daß die Grußbotschaften, die Kennedy und Chruschtschow austauschten, höflich und hoffnungsvoll gehalten sind. Es gibt hier auch Stimmen, die es für wahrscheinlich halten, daß Kennedy in diesem Jahre Chruschtschow in Moskau besuchen wird. Das Interview, das Kennedy dem Chefredakteur der sowjetischen Zeitung Iswestija gab, war ein großer Erfolg in der Sowjetunion. Es läge ganz in der Natur des Präsidenten, wenn er diesen Erfolg durch persönliche Wirkung in der Sowjetunion selber fortsetzen und vergrößern möchte. Er würde damit nachholen, was Chruschtschow dem Präsidenten Eisenhower im Zusammenhang mit der U-2-Affäre 1960 verweigerte.
Zum Schluß möchte ich einen Punkt aus den Jahresrückblick-Betrachtungen Kennedys herausgreifen, der uns in Deutschland und besonders die Berliner angeht. Der Präsident soll über die Mauer folgendes denken: Der Westen war am 13. August praktisch nicht in der Lage, die Abriegelung des Sowjetsektors gegen die Westsektoren zu verhindern. Es wäre wahrscheinlich möglich gewesen, durch Einsatz von Panzern den ersten Stacheldraht der Volkspolizei niederzuwalzen. Das Risiko einer ernsthaften militärischen Verwicklung mit sowjeti-schen Truppen lag auf der Hand. Selbst aber, wenn der Westen dieses Risiko auf sich genommen hätte, wäre die Abriegelung nicht zu vermeiden gewesen; denn die Kommunisten hätten dann ihren Wall nur hundert Meter weiter zurück, innerhalb des Sowjetsektors, zu errichten brauchen. Der Versuch indessen einer Aufrechterhaltung des Viermächtestatus in der Form des Eindringens westlicher Truppen in den Sowjetsektor hätte Krieg bedeutet. Kennedy glaubt, daß die Mauer vor aller Welt ein Eingeständnis kommunistischer Unfähigkeit ist. Sie ist zum sichtbarsten Ausdruck geworden der Absurdität totalitaristischer Herrschaftsform.
3.Januar 1962
Der Golf von Mexiko, die Karibische See liegen für die Vereinigten Staaten so nahe wie die Nordsee für Deutschland. Allein diese geographische Überlegung zeigt schon, wie wichtig politische Vorgänge an dieser Südflanke der USA für Washington sind. Präsident Kennedy gab heute bekannt, daß er demnächst Mexiko besuchen wird, nachdem er schon Venezuela und Kolumbien kurz vor Weihnachten persönlich aufsuchte. Fidel Castros gestrige Erklärungen und die Forderungen des mittelamerikanischen Staates Guatemala auf das britische Gebiet Honduras gehören in diesen Problemkreis.
Am 22. Januar werden die Außenminister der Organisation der Amerikanischen Staaten Zusammentreffen, um über die Bedrohung der ganzen amerikanischen Hemisphäre durch den Kommunismus, repräsentiert durch das Kuba Castros, zu beraten. Dr. Castro ist darüber empört und kündigte eine Massenversammlung an als Protest gegen den US-Imperialismus und dessen Lakaien, wie er sich ausdrückte. Castro war ursprünglich kein Kommunist, erklärte aber vor kurzem öffentlich, daß er sich nunmehr zum Marxismus-Leninismus bekenne, und die Sprache, die er spricht, bedient sich seither mehr und mehr sowjetischer Wendungen. Castro übt seit dem Sieg seiner Volkserhebung vor drei Jahren eine gewisse Anziehungskraft auf Volksbewegungen des mittel- und südamerikanischen Festlandes aus. Diese Anziehungskraft hat sich durch sein demonstratives Bekenntnis zur Moskauhörigkeit vermindert. Das ist der Hintergrund für seine neuen Propagandatiraden.
Castros Rede gestern in Havanna war begleitet von einer Militärparade. Sowjetische MIG-Düsenjäger, Stalinorgeln und viele andere Waffen aus dem Ostblock wurden gezeigt. Castro soll zur Zeit über eine Armee von 300 000 Mann verfügen. Das wäre nahezu die Stärke der deutschen Bundeswehr. Fidel Castro versicherte gestern auch, daß jeder Angreifer künftig bis zum letzten Mann ausgerottet werden würde. Er soll sich zunehmender Sabotageaktionen auf seiner Insel gegenübersehen. Infolgedessen will er Kuba, wie er sagte, bis an die Zähne bewaffnen.
Tatsächlich führte Castro die Kubaner in große wirtschaftliche Schwierigkeiten hinein. Der Abbruch der Beziehungen mit den Vereinigten Staaten war eine gefährliche Operation. Die Sowjetunion nimmt seither zwar das kubanische Nationalprodukt, den Zucker, ab und liefert dafür hauptsächlich Öl, aber die kubanische Wirtschaft braucht von der Außenwelt mehr als nur Öl. Die Industrie ist mit amerikanischer Ausrüstung aufgebaut worden. Ersatzteile, Verbesserungen und Erweiterungen auf dieser Basis könnten nur aus den benachbarten Vereinigten Staaten kommen. Selbst wenn der Ostblock bereit wäre, große Opfer für Kuba zu bringen, was nicht einmal der Fall ist, würde es viele Jahre dauern, bis die kubanische Wirtschaft so an die kommunistischen Hilfsquellen angeschlossen wäre, wie das heutzutage etwa für ein Land wie Rumänien zutrifft.
Zwischen der Hoffnung, daß Kuba für den Westen zurückgewonnen werden kann, und der Sorge, daß andere karibische Inseln und schließlich kleinere und größere Staaten des lateinamerikanischen Festlandes den Weg Kubas gehen könnten, bewegt sich die Politik Washingtons hinsichtlich der gesamtamerikanischen Probleme. Die Kennedy-Regierung nimmt Lateinamerika ernst. Sie hat mit der Kuba-Invasion einen schlimmen Fehler gerade auf diesem Gebiet begangen. Um so mehr ist der Präsident bestrebt, die problematische Vergangenheit der amerikanischen Nord-Süd-Spannungen hinter sich zu lassen. Kennedy wird im kommenden Jahr keine Anstrengung scheuen, diese Spannungen zu vermindern. Dabei dient ihm Castro als Ansporn.
4. Januar 1962
Die amerikanisch-sowjetischen Berlingespräche in Moskau finden in Washington eine sehr aufmerksame Interpretation. Charles Bohlen, der Spezialist des amerikanischen Außenamtes für sowjetische Angelegenheiten, unterrichtete gestern die Botschafter Großbritanniens, Frankreichs und den Vertreter des deutschen Botschafters in Washington über die geheimen Berichte, die der amerikanische Botschafter in Moskau, Llewellyn Thompson, über seinen ersten Kontakt mit Sowjetaußenminister Gromyko übermittelte. Aus derselben Quelle kommen vermutlich ausführliche Berichte und Spekulationen heute in den großen amerikanischen Zeitungen. Danach ergibt sich folgendes Bild.
An eine eigentliche Lösung des Berlinproblems sei im Augenblick nicht zu denken. Es gehe mehr darum, daß man einen Modus vivendi, einen Zustand des »Lebens und Lebenlassens« für Berlin aufrechterhalte. Diese Situation ließe es möglich und vielleicht zweckmäßig erscheinen, daß die beiden hauptsächlich in Berlin engagierten Großmächte, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, ein zweiseitiges Arrangement träfen. Es würde sich dabei nicht um einen Vertrag oder um die Formulierung eines neuen Status für Berlin handeln, sondern mehr um ein zweiseitiges Abgrenzen der vitalen Interessen. Die USA würden bei einem solchen Arrangement dem sowjetischen Interesse nach der Stabilisierung, der De-facto-Anerkennung ihres ostdeutschen Satelliten, der DDR, Rechnung tragen. Die Sowjetunion würde sich stillschweigend verpflichten, Westberlin und den Zugang nach Westberlin nicht anzutasten. Das wäre praktisch der Status quo – nur daß in den Stromkreis der Berlinspannungen eine Sicherung eingebaut wird, die den Kurzschluß verhindern würde, den beide Großmächte ernstlich zu fürchten haben: den Ausbruch militärischer Verwicklungen in Mitteleuropa, mit der zwangsläufigen Folge eines Atomkrieges auf Leben und Tod.
Es ist ganz und gar nicht ausgemacht, daß die Dinge diesen Lauf nehmen. Ich würde sagen, die Amerikaner hätten wahrscheinlich nicht viel dagegen einzuwenden. Sie haben so komplizierte Sorgen im Lande, in Südamerika, in Afrika und Asien, daß ein Einfrieren der gefährlichsten Unruhe, eben der Krise in Berlin, sie erleichtern müßte. Das darf niemand verwechseln mit einem Disengagement, mit einem Abrücken von übernommenen Verpflichtungen. Aber der derzeitige amerikanische Präsident hat es oft genug und deutlich genug ausgesprochen, daß er die Existenz der amerikanischen Nation zwar mit der Freiheit der Westberliner identifiziert, nicht aber mit dem Ringen um die Wiedervereinigung Deutschlands. Zweifellos wäre auch dem Präsidenten die Ideallösung »Berlin, Hauptstadt eines wiedervereinigten Deutschlands« am liebsten. Da sie zur Zeit unerreichbar ist, hätte er sicherlich einen Vertrag über einen neuen, klaren Status für Berlin vorgezogen gegenüber jener stillschweigenden Nichtangriffsvereinbarung, die im Augenblick das einzige zu sein scheint, was erreichbar wäre.
Erreichbar auch nur dann, wenn die Russen mitspielen. Wir müssen einfach abermals abwarten, ob die gegenwärtig praktizierte Geheimdiplomatie weiterführt. Daß die Botschaftergespräche eines Tages zur Außenministerkonferenz führen, ist auch durchaus nicht sicher. Und die immer wieder auftauchende Möglichkeit einer zweiten Begegnung Kennedy-Chruschtschow? Sie ist trotz der Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Großmächten im vergangenen Jahr nicht unwahrscheinlich. Beide Regierungschefs haben eine recht positive Vorstellung von der Kraft ihrer persönlichen Wirkung. In Washington hörte man zum Jahreswechsel viel über die inneren Schwierigkeiten, denen sich der Führer der Sowjetunion gegenübersehe. Die Fortschritte in der wirtschaftlichen und auch politischen Einigung Europas, die Stärkung der NATO-Streitkräfte seien ernste außenpolitische Sorgen Moskaus. Infolgedessen sei auch Chruschtschow an einem Arrangement mit Kennedy interessiert.
Für unser Berlin bedeutet das alles: Es ist keine grundlegende Verbesserung der Situation in Sicht. Gerade das vergangene Jahr aber und auch die neuesten Ost-West-Gespräche erweisen, daß es andererseits zu keiner grundstürzenden Verschlechterung kommen kann. Berlin bleibt also in der Schwebe, und gerade hier in Washington fragt man sich mit wachsender Besorgnis, ob die Stadt, für die man politisch und militärisch einsteht und die wirtschaftlich durch die
Bundesrepublik garantiert wird, unter all diesen Umständen psychologisch gehalten werden kann.
9. Januar 1962
»Er sieht aus wie der Wohlstand persönlich« – dieses Wort über den deutschen Bundeswirtschaftsminister wird heute in der amerikanischen Presse zitiert. Professor Ludwig Erhard findet bei seiner Anwesenheit dieser Tage in Washington eine betont freundliche Aufnahme. In einem Porträt der New York Times wird hervorgehoben, daß Erhard während der Hitlerjahre sich weigerte, in die NS-Arbeitsfront einzutreten, und seine Stellung verlor. Diese kleine Anmerkung zeigt, wie aufmerksam die Amerikaner stets die politische Vergangenheit deutscher Politiker im Auge behalten – auch wenn das offiziell nicht hervortritt.
Gestern abend hat Minister Erhard den amerikanischen Präsidenten ausführlicher gesprochen, als es vorgesehen war. Ursprünglich stand keine offizielle Begegnung auf dem Plan. Tatsächlich unterhielt sich Kennedy mit Professor Erhard etwa anderthalb Stunden. Das ist viel, gemessen an der sehr knappen und präzisen Zeiteinteilung des Weißen Hauses. Der Bundeswirtschaftsminister berichtete uns gestern abend, daß er während der siebzehn Jahre, die er jetzt in der Politik arbeite, selten einen Regierungschef getroffen habe, der so genau über wirtschaftspolitische Zusammenhänge informiert gewesen sei wie der derzeitige amerikanische Präsident. Kennedy habe ihm wohlüberlegte, präzise Fragen gestellt, und er, Erhard, hätte den Präsidenten nur ermuntern können, die geplante neue handelspolitische Aktivität zu entfalten.
Dabei handelt es sich natürlich vor allem um die von Kennedy beabsichtigte Senkung der amerikanischen Einfuhrzölle. Professor Erhard weiß, daß Kennedy seine neue Zollpolitik dem amerikanischen Parlament, dem Kongreß, vorlegen muß. Der deutsche Wirtschaftsminister als das Symbol des deutschen Erfolges mit einer freien Marktwirtschaft wurde nach Washington gebeten, weil die Kennedy-Regierung die Zustimmung und Unterstützung eines führenden europäischen Fachmannes gerade in den kommenden Auseinandersetzungen mit dem Parlament gut gebrauchen kann.
Professor Erhard sieht in einer Senkung des Außentarifs für die Länder des gemeinsamen europäischen Marktes eine der Möglichkeiten, von Europa her den liberalen wirtschaftspolitischen Kurs der amerikanischen Demokraten zu unterstützen. Erhard ist führender Politiker der deutschen Rechtspartei CDU, und die Demokraten sind die amerikanische Linkspartei. Die wirtschaftspolitische Übereinstimmung einer gemäßigten europäischen Rechten und einer liberalen amerikanischen Linken zeigt, wie wenig wir heutzutage noch mit alten politischen Begriffen anfangen können. Minister Erhard liebt es, die ökonomische Praxis in historisch-politische und philosophische Perspektiven zu rücken. So sagte er gestern in Washington, er sei gegen eine europäische Inzucht. So wie 1948 der Marshall-Plan Europa wirtschaftlich wiederbelebte, so sei heute der richtige Zeitpunkt für größere weltpolitische Entwicklungen. Erhard würde sicherlich einen transatlantisch gemeinsamen Markt für das Richtigste halten, obwohl er das hier nicht ausdrücklich sagte. Er weiß, daß selbst die fortschrittlichsten Kennedy-Berater noch nicht so weit gehen. Professor Heller zum Beispiel, der Spezialist des Weißen Hauses für wirtschaftspolitische Planung, oder George Ball, ein Wirtschaftspolitiker, der seit kurzem stellvertretender amerikanischer Außenminister ist, sind in diesen Tagen die wichtigsten Gesprächspartner des deutschen Bundesministers. Sie werden ihm sagen, daß das amerikanische Volk, daß der Kongreß für wirtschaftspolitische Perspektiven dieser Art nicht oder noch nicht zugänglich sind.
Walter Lippmann, dessen Gedanken einen großen Einfluß ausüben, schreibt heute, daß zweierlei für die Vereinigten Staaten außenpolitisch neu und im Grunde in diesem Lande noch unbegriffen sei: die Tatsache, daß man es bei der Sowjetunion zum erstenmal in der Geschichte Amerikas mit einem wahrscheinlich ebenbürtigen Gegner zu tun hat, der imstande ist, das amerikanische Festland selbst anzugreifen – und zweitens, daß ein vereinigtes Westeuropa in wenigen Jahren eine wirtschaftliche Macht sein wird, die auf allen Gebieten den Vergleich mit der bis dahin einsamen Spitzenposition der amerikanischen Wirtschaft aushalten werde. Lippmann glaubt, daß die Kennedy-Regierung diese grundsätzlich neue Lage erkannt habe, daß aber das Volk und der Kongreß psychologisch noch längst nicht darauf vorbereitet seien, eine Welt zu akzeptieren, in der der absolute amerikanische Führungsanspruch auf allen Gebieten nicht länger gerechtfertigt ist.
Minister Erhard ist hier auch danach gefragt worden, ob in den neuesten sowjetrussischen Hinweisen auf die Möglichkeiten eines stärkeren deutschen Osthandels für die Bundesrepublik eine Versuchung liegen könnte. Erhard sagte, daß vom gesamten Außenhandel der Bundesrepublik nur 4 Prozent auf den kommunistischen Ostblock entfallen, während 96 Prozent in die Länder des Westens oder in neutrale Länder gehen. Weniger präzis äußerte sich Erhard über Größenordnungen bei der Entwicklungshilfe. Er betonte, daß er persönlich in der Entwicklungshilfe eines der wichtigsten Ziele des westlichen, besonders aber des deutschen Wirtschaftspotentials sehe. Ludwig Erhard hatte dafür auch eine völkerpsychologische Erkenntnis bereit, indem er sagte, es müsse den Deutschen etwas gegeben werden, über das sie, abgesehen von ihrem eigenen Wohlergehen, nachdenken könnten, denn die Deutschen seien nicht glücklich und könnten gefährlich werden, wenn sie nicht irgendeine Art von Abenteuer im Auge haben dürften, das sie beschäftige. Anscheinend sieht Professor Erhard in der Entwicklungshilfe eine positive Spielart von Abenteuer. Auf die Zahl von einem Prozent des Sozialprodukts für Entwicklungshilfe wollte er sich aber nicht festlegen lassen. Natürlich kam auch Berlin zur Sprache. Aus dem Munde des Bundeswirtschaftsministers mögen die Amerikaner besonders gern gehört haben, daß es kein wirtschaftliches Problem sei, Westberlin zu halten. Die Vereinigten Staaten haben zur Zeit rund vier Millionen Arbeitslose. In Westberlin, sagte Erhard, sehen wir uns einem fühlbaren Arbeitskräftemangel gegenüber. Vor allem muß Berlin moralisch geholfen werden, betonte Erhard, aber es wurde nicht bekannt, ob er dafür entweder konkrete Vorschläge machen oder von amerikanischer Seite hören würde.
Um Berlin ging es ausschließlich in einigen anderen Gesprächen der letzten Tage hier in Washington. General Lucius D. Clay kam herübergeflogen und sprach hier am Sonntag den Präsidenten, nachdem er mit dem Außenminister und anderen Persönlichkeiten geredet hatte. Es sieht von hier aus betrachtet so aus, als ob die kurze Reise Clays in Deutschland überbewertet wurde. Clay ist, wie man seit den Zeiten der Luftbrücke weiß, ein selbständiger Kopf und ist gewiß nicht nach Berlin gegangen, um seinen direkten Draht zu Kennedy nicht zu benutzen. Es muß notwendigerweise einem militärisch denkenden Mann unheimlich Vorkommen, wenn er täglich praktisch sieht, wie verschlungen die Wege der Information und der Konsultation und selbst der Befehlsübermittlung im Felde zwischen Sektorengrenze in Berlin und Washington, London, Paris, Bonn sind. Es kann nur nützlich sein, wenn ein Mann wie Clay Gespräche darüber führt, wie die Entscheidungsgewalt etwa des amerikanischen Stadtkommandanten in Berlin, des amerikanischen Botschafters in Bonn, des politischen Leiters der amerikanischen Mission in Berlin gegeneinander vernünftig abgegrenzt und in eine funktionierende Beziehung zur Zentrale in Washington gestellt werden können. Bei der manchmal explosiven Situation in Berlin spielt unter Umständen sogar eine so banale Tatsache wie der Zeitunterschied von sechs Stunden zwischen Berlin und Washington eine Rolle. Denn wenn morgens um acht an der Mauer etwas passiert, ist es hier bei uns zwei Uhr nachts, und die Männer, die weittragende Entscheidungen fällen sollen, müssen erst geweckt werden. Washington ist zum Treffpunkt für Unterhandlungen geworden, von denen Schritt für Schritt die Zukunft der westlichen Welt abhängt. Das gilt auch für die beiden interessanten Besuche dieser Tage: die Besprechungen Bundesminister Erhards und General Clays in der amerikanischen Hauptstadt.
12. Januar
Winnetou, wenn er heute lebte, könnte reich werden. Mehr und mehr Indianer führen Prozesse, in denen sie den amerikanischen Staat verklagen auf Schadenersatz oder Abgeltung für Land, das ihnen genommen wurde. 596 solcher Prozesse sind gegenwärtig anhängig und in 28 Fällen, die bisher abgeschlossen wurden, bekamen die Kläger, also die Indianer, bereits die stattliche Summe von 37 127 116 Dollar zugesprochen.
Winnetou, lebte er heute, könnte seinen Prozeß anstrengen auf Grund der Tatsache, daß er American Citizen, amerikanischer Bürger wäre. Seit 1924 nämlich genießen auch die Indianer in den Vereinigten Staaten dieses stolze Vorrecht. Sie sind trotzdem weit von einer Integration ins bürgerliche Leben der Vereinigten Staaten entfernt. Trotz der Summe von 37 Millionen Dollar sind die meisten Indianer arm. Sie leben in den Reservationen des immer noch wilden amerikanischen Westens, sprechen zumeist ihre eigene Sprache, ohne Englisch zu können oder zu lernen.
Das soll nun alles anders werden. Die Kennedy-Regierung scheint entschlossen zu sein, mit den Bürgerrechten für Neger und auch für Indianer Ernst zu machen. Das geht natürlich nur Schritt für Schritt. Die erfolgreichen Prozesse der Indianer sind solche Schritte. Im Innenministerium hier in Washington gibt es eine Abteilung für indianische Angelegenheiten. Dort werden die Ansprüche der Indianer geprüft. Es ist einigermaßen verblüffend, daß die Regierung ihnen grundsätzlich ein Recht zugesteht auf das Land des amerikanischen Kontinents. Im Grunde könnten die rund 500 000 Indianer, die in den Vereinigten Staaten leben, also Entschädigungen verlangen für das ganze riesige Gebiet, auf dem heute mehr als 180 Mill. Menschen leben.
Ganz so ist es natürlich nicht. Der einzelne indianische Kläger muß nachweisen können, daß seine Vorfahren und deren Stamm ein bestimmtes Gebiet bewohnt haben. Meistens liegt das westlich des Mississippi. Die großen Indianerreservationen befinden sich in den Staaten Oklahoma, Arizona, Neu-Mexiko, in den großen Wüsten- und Berggebieten der Vereinigten Staaten. Bei dem oft recht schwierigen Rechtsnachweis braucht der Indianer juristische Hilfe. Sie wird ihm gern gegeben von Rechtsanwälten in Washington und anderen Städten, die dabei kein schlechtes Geschäft machen.
Die Indianerkriege waren bekanntlich grausam und schrecklich, und die Geschichten von Winnetou sind eine schöne Legende. Diese Legende hat ihre amerikanische Version und wird in unendlichen Variationen täglich im amerikanischen Fernsehen, in den Zeitungen und Büchern wiederholt. Es gibt aber auch eine seriöse Forschung über die Ursprünge und Entwicklungen der vielfältigen indianischen Kulturen. Sie bestätigten merkwürdigerweise oftmals die Vorstellung von den Indianern als großzügigen Naturkindern, die gastfreundlich und offen waren, gern schenkten, den Krieg mehr als Spiel betrachteten, lieber Gefangene machten als töteten und eine sehr lebhafte Religiosität pflegten.
Es ist eine Art von Wiedergutmachung, was wir jetzt bei den Indianer-Prozessen sehen. Das Bleichgesicht hat Winnetou getötet. Die wenigen Nachkommen Winnetous, die die Ausrottung einer ganzen Rasse überlebten, sollen nun entschädigt werden, so gut es geht. Ob sie dadurch glücklicher werden? Auf jeden Fall können sie sich mehr »Feuerwasser« kaufen. Aber wir sollten uns nicht lustig machen über den sehr ernsthaften Versuch der amerikanischen Regierung, auch den Indianern moralisch und innenpolitisch gerecht zu werden.
Ein amerikanischer Präsident muß dem Parlament zu Beginn eines jeden Jahres einen großen Rechenschaftsbericht vorlegen. Der zweite Bericht eines neugewählten Präsidenten ist im Grunde immer sein erster, und so erschien John F. Kennedy gestern vor dem Kongreß mit einem Rückblick auf Entwicklungen, die er selbst zu verantworten hat, und mit einem Ausblick auf Perspektiven, die er überblicken kann. Wir sahen einen Mann gestern mittag im Kapitol, der weniger philosophierte als vor einem Jahr, dafür aber genauer und zielbewußter von aktuellen Notwendigkeiten und Möglichkeiten sprach. Die Rede war, so kann man heute hier in Washington lesen und hören, ebensosehr Aufklärung über die persönliche Verfassung des Präsidenten Kennedy, wie sie eine Analyse der gegenwärtigen Verfassung war, in der sich die Vereinigten Staaten von Amerika befinden.
Eine Fülle von gesetzgeberischen Schwierigkeiten hat der Präsident sich mit seiner gestrigen Botschaft aufgebürdet. Selten machte ein Präsident einem Kongreß so viele Vorschläge für neue Gesetze. John Kennedy hat selbst vierzehn Jahre als Abgeordneter und als Senator in der mächtigen und komplizierten Gesetzgebungsmaschine der Vereinigten Staaten gearbeitet. Er zu allerletzt macht sich Illusionen über den Widerstand, den er besonders mit seinen Vorschlägen für eine verbesserte allgemeine Wohlfahrt im Repräsentantenhaus und im Senat finden wird – und keineswegs nur von seiten der Republikaner, der Gegenpartei. Aber Kennedy strahlte gestern ein sichtlich gewachsenes Selbstvertrauen aus. Er denkt an die ganzen vier Jahre seiner Amtsperiode und nicht nur an das unmittelbar vor ihm liegende zweite Jahr des 87. Kongresses. Im stillen denkt er zweifellos an weitere vier Jahre, denn ein amerikanischer Präsident kann einmal wiedergewählt werden.
Viele seiner Vorschläge sind also von vornherein nur zu Protokoll gegeben, damit man sie in kommenden Jahren um so dringlicher wiederholen kann. Das gilt zum Beispiel für einen Antrag auf Ermächtigung des Präsidenten zu kurzfristigen Steuerreformen für den Fall neuer wirtschaftlicher Krisen. Das gilt auch für die Mehrzahl der Punkte, mit denen die Kennedy-Regierung eine bessere staatliche Fürsorge für alte Leute erreichen will, und für die bundesstaatliche Aktivität im Erziehungswesen. Hier stehen die USA tatsächlich den meisten europäischen Staaten nach. Dringend jedoch sind vor allem Präsident Kennedys Forderungen nach einer schrittweisen Beseitigung der Zölle. Wie vorauszusehen war, sehen die Wirtschaftsplaner der Kennedy-Regierung in einem freieren Handel, namentlich mit dem Gemeinsamen Markt Europas, die ausschlaggebende Chance für eine neue Aktivität im teilweise stagnierenden Wirtschaftsgefüge der Vereinigten Staaten. Niemand jedoch wagt eine Voraussage darüber zu machen, ob der Kongreß in diesem Jahr die Liberalisierung des Außenhandels billigen wird.
Gegenüber den ökonomischen Problemen treten diesmal die militärischen und außenpolitischen zurück. Offensichtlich glaubt Kennedy, daß sein Land im letzten Jahr wesentlich stärkere und zur Zeit ausreichende Verteidigungskräfte mobilisiert hat. Kein Kongreß widersetzt sich ernsthaft notwendigen Verteidigungsausgaben. Es fehlt nicht mehr am Geld für die Rüstung, es geht nur noch darum, die riesigen Summen vernünftig auszugeben. Auch außenpolitisch war Präsident Kennedys Resümee wesentlich selbstbewußter und ausbalancierter als vor einem Jahr. Trotz aller Krisen und Spannungen haben die Kommunisten in der Tat während des ersten Kennedy-Jahres keine neuen Eroberungen gemacht; vielmehr ist die Stärke des Westens alles in allem gewachsen, und im Gefüge des Ostblocks zeigten sich deutliche Risse. So fürchtet Kennedy auch für Berlin nicht mehr das Äußerste, obwohl er nicht aufhört, sein Volks aufs Äußerste vorzubereiten. Der Präsident sucht unbeirrt nach einem Modus vivendi, einer Basis für friedliches Zusammenleben mit der Sowjetunion. Der Stillstand der Abrüstungsgespräche, das vorläufige Scheitern der Verhandlungen über die Einstellung aller Atomwaffenversuche und an der Spitze die Berlinkrise waren harte Rückschläge. Kennedy jedoch sieht sich heute offenbar besser als vor einem Jahr in der Lage, die Dynamik der Politik für den Westen zu nutzen.
15.Januar 1962
Eine Koralleninsel, die langsam durch die Beiträge aller wächst, hat Präsident Kennedy die Atlantische Gemeinschaft genannt. Nicht durch eine einzige, mächtige Explosion, wie ein Vulkan, kämen politische Zusammenschlüsse dieser Art zustande, sondern durch gute Handelsbeziehungen, gemeinsame Verteidigungsanstrengungen, Partnerschaft in diplomatischen und finanzpolitischen Positionen.
John F. Kennedy ist gerade ein Jahr im Amt. Sein »Bericht über die Lage der Nation« in der vergangenen Woche war Rechenschaft vor dem Parlament. Die Botschaft richtete sich an das Volk der Amerikaner und ihre demokratischen Vertreter vor allem, sie zielte auf notwendige Reformen im Innern. Aber die innenpolitischen Perspektiven Kennedys sind Teil einer Konzeption von der Rolle der USA in der Welt, und in dieser Konzeption haben die Probleme einer Atlantischen Gemeinschaft Priorität.
Das war in der ersten Rede des jungen Präsidenten vor einem Jahr noch nicht so deutlich. An Kennedys weltpolitischem Horizont erschienen noch ohne klare Rangfolge: ein ausgehandelter Waffenstillstand mit Moskau; ein diplomatisches Abtasten Pekings; eine neue Annäherung an alle neutralen Staaten, an der Spitze Indien; eine Anti-Castro-Allianz mit Lateinamerika. Zugrunde lag dieser Auflösung einer elliptischen Fixierung der Weltprobleme durch die Pole Washington und Moskau Professor Walt Rostows Theorie von der Entwicklung zu einer Welt mit mehreren neuen Zentren.
Rostow ist heute Leiter des politischen Planungsstabes im amerikanischen Außenministerium, und Kennedy überläßt ihm und seinem engsten Berater in allen Sicherheitsfragen McGeorge Bundy weiterhin die außenpolitische »Generalstabsarbeit«. Aber der Präsident hat das Laboratorium der allzu vielen Alternativen anscheinend hinter sich gelassen. Heute sieht er die Quellen der Stärke des Westens in einer bezeichnenden Reihenfolge: 1. die innere und äußere Kraft der Vereinigten Staaten selber; 2. die Kraft der Atlantischen Gemeinschaft; 3. die Möglichkeiten der ganzen amerikanischen Hemisphäre; 4. die Anstrengungen in den asiatischen und afrikanischen Entwicklungsländern; 5. die Vereinten Nationen.
John F. Kennedy ist ein Pragmatiker und doch auch ein Systematiker. Er wird also in all diesen Punkten immer zu Kompromissen geneigt sein, Niederlagen einkalkulieren und Vorteile ausnutzen. Am Ende aber wird Punkt 1 vor Punkt 5 den Vorrang haben und Punkt 2 vor Punkt 3 und 4. Das ist von großer praktischer Bedeutung. Das liberale Amerika, das mit dem Präsidenten Kennedy gegenwärtig den Kurs der USA bestimmt, sieht eine wichtige Aufgabe im Ausgleich der Spannungen zwischen den ehemaligen Kolonialmächten und deren ehemaligen Kolonien. Allenthalben kommt es dabei zu Interessenkonflikten, denn diese ehemaligen Kolonialmächte sind die NATO-Partner der Vereinigten Staaten, und die ehemaligen Kolonien erhalten oftmals amerikanische Wirtschaftshilfe oder diplomatische Unterstützung in den Vereinten Nationen. So entsteht eine scheinbar widerspruchsvolle Haltung Washingtons gegenüber Frankreich einerseits, Algerien andererseits; Belgien einerseits, dem Kongo andererseits; Portugal einerseits, Angola andererseits und Indien drittens. Aber geht es hart auf hart, rangiert das Atlantische Bündnis vor den Sympathien der ersten ehemaligen Kolonie, die sich befreite: Nordamerika – für die heute unabhängig werdenden Völker Afrikas und Asiens.
Und an dritter Stelle steht für Kennedy wohlgemerkt »die Hemisphäre«. Die USA sind durch Fidel Castro aus einem gern gehegten Schlummer oder Wahn geweckt worden: Lateinamerika ist durchaus nicht selbstverständlich der gute Nachbar der Vereinigten Staaten, nur weil diese anderen amerikanischen Länder die geographisch nächsten Nachbarn sind. Die bisher entschiedendste außenpolitische Bewegung des jungen amerikanischen Präsidenten weist in südliche Richtung. In allen anderen Punkten geht Kennedy vorsichtig und taktierend in der Richtung weiter, die andere vor ihm festlegten: große Verteidigungsausgaben helfen die Wirtschaft ankurbeln; das Bündnis mit Westeuropa ist das Rückgrat der westlichen Welt; Wirtschaftshilfe für die unterentwickelten Länder soll den Kommunismus eindämmen. Das alles taten ähnlich, wenn auch nicht immer so überlegt und artikuliert, Eisenhower und Truman ebenfalls. Kennedys »allianza para el progreso« hingegen, sein Fortschrittsbündnis mit Lateinamerika, ist die erste fundierte Anstrengung Washingtons zur Entwicklung und Demokratisierung der amerikanischen Nachbarländer.
Aber selbst diese, wie Kuba zeigt, brennende Aufgabe wird von Kennedy der Atlantischen Gemeinschaft nachgeordnet. Die USA stehen heute historisch neuen Faktoren gegenüber: a) Sie sind nicht mehr unangreifbar; in der Sowjetunion ist ihnen ein Gegner erwachsen, der das amerikanische Festland empfindlich, vielleicht tödlich, treffen kann; b) die USA werden schon bald nicht mehr einsam an der Spitze der ökonomischen Produktionen der Welt liegen; der Gemeinsame Markt Europas würde mit Einschluß Englands und anderer europäischer Länder ein ebenbürtiger Konkurrent sein.
Diese beiden Punkte nun bestimmen ausschlaggebend die amerikanische Innenpolitik der nächsten Jahre. Präsident Kennedy stand bei der Eröffnung der zweiten Sitzungsperiode des 87. Kongresses am vergangenen Donnerstag mit einem Haushaltsdefizit von rund 7 Milliarden Dollar vor dem Parlament. Das ist zurückzuführen auf eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 15 Prozent. Der nächste Budgetvoranschlag wird die gigantische Summe von 50 Milliarden Dollar für die Rüstung ausweisen. Die innenpolitische Diskussion im ersten Kennedy-Jahr war relativ undramatisch – bis auf zwei Streitfragen: Zivilverteidigung und Einberufung von Reservisten aus Anlaß der Berlinkrise. Die Amerikaner versuchen, zum Teil recht widerwillig, sich der Situation anzupassen, daß sie zum erstenmal seit Kolumbus direkt bedroht sind.
Und die Atlantische Gemeinschaft? Sie ist im Grunde nicht populär beim Durchschnittsamerikaner. Die Ostküste mit Washington und New York ist nicht Amerika. Dem aufstrebenden Kalifornien liegt geographisch Asien näher als Europa. Der Mittelwestler war und bleibt sich selbst immer noch am nächsten; hier ist der Isolationismus tief verwurzelt. Der Süden der Vereinigten Staaten hat seine tiefen sozialen und ökonomischen Sonderprobleme; auch für ihn ist eine mehr als militärische Gemeinschaft mit den Europäern ziemlich theoretisch.
Aber aus Alabama und Iowa, aus Oregon und Georgia kommen die Abgeordneten ins Kapitol zu Washington. Sie hören den Präsidenten des Bundesstaates, einen Mann aus Boston, Massachusetts. Sie sehen hinter und über ihm, auf dem Stuhl des Sprechers John Mc-Cormac, ebenfalls aus Massachusetts, den blassen Nachfolger des verstorbenen großen Parlamentariers »Sam« Rayburn. Sie vernehmen, daß »diese Eierköpfe von der Ostküste« die Einfuhrzölle senken wollen. Sie mögen den jungen Mann aus dem Weißen Haus, der ihnen das wohlformuliert begründet, ganz gern. Aber sie halten Importe aus Europa für einen Anschlag auf die Idee von der gottgewollten Überlegenheit amerikanischer Produkte; für viele Bundesstaaten würde ein liberaler Handel mit Europa tiefgreifende wirtschaftliche Strukturwandlungen auslösen. Das schafft Unruhe, Preis- und Lohnkämpfe, Unzufriedenheiten. Die Abgeordneten aus Oregon und Georgia wollen aber wiedergewählt werden zu Hause, und so wird es der Präsident schwer haben im Kapitol mit seinen handelspolitischen Reformen.
Europa und an der Spitze die Bundesrepublik Deutschland denkt heute in vielem moderner, zukünftiger, ja revolutionärer als Amerika. Die Vereinigten Staaten sind von den Kriegen des Jahrhunderts doch nur indirekt erschüttert worden. So erscheint für manchen Politiker in Bonn schon eine »transatlantische Union«, ein Bundesstaat der westlichen Welt mit einer einzigen gemeinsamen staatlichen Souveränität denkbar. Aber der bedrängte und überlastete Mann im Weißen Haus argumentiert derweilen mühsam um einen schrittweisen Abbau der Zollschranken zwischen den NATO-Ländern, und sein »Operationschef« Bundy erklärt ausdrücklich den Gedanken einer staatlichen Einheit der westlichen Welt für frühreif.
Mancher in Amerika hatte vom 20. Januar 1961 den Beginn eines Vulkanausbruchs nationaler Energien erwartet. John Kennedy bei der Amtseinführung vor einem Jahr – schien nicht ein junger Churchill und Roosevelt ans Ruder der westlichen Welt zu treten? Solche Erwartungen mußten enttäuscht werden. Der Präsident Kennedy ist ein Mann der Mitte; ein gemäßigt liberal und sozial denkender Politiker, der gern strategisch spricht, aber lieber taktisch handelt. Wenn er das Entstehen der Atlantischen Gemeinschaft mit dem langsamen organischen Wachstum einer Koralleninsel vergleicht, so ist das charakteristisch für ihn. Er hat den Überblick und die Gabe der Formulierung; aber er glaubt, daß die entscheidenden Entwicklungen klein bei klein vor sich gehen – nicht vulkanisch.
16.Januar 1962
Hätte die Aufrichtung der Mauer in Berlin verhindert werden können? Diese Frage kommt nicht zur Ruhe. Sie wurde gestern dem amerikanischen Präsidenten in seiner zwanzigsten Pressekonferenz, der ersten in diesem Jahr, gestellt. Kennedy antwortete sehr ernst. Niemand, der damals Verantwortung getragen habe, hätte empfohlen, unter Anwendung von Gewalt in den Sowjetsektor einzudringen, die Mauer einzureißen oder ihre Errichtung zu verhindern. Weder die amerikanischen Offiziere und Beamten in Berlin, noch Westdeutschland, Frankreich oder England hätten das gefordert. Kennedy fuhr fort: Seit Ende der 40er Jahre habe praktisch die Sowjetunion allein den Ostsektor Berlins kontrolliert. Sie habe aus dem russisch besetzten Teil Berlins die Hauptstadt Ostdeutschlands gemacht. Die Vereinigten Staaten verfügten über sehr begrenzte Streitkräfte in Berlin, die umgeben seien von einer großen Anzahl sowjetischer Divisionen. Der Präsident sagte, daß der Westen entschlossen sei zu halten, was er in Berlin habe, gab aber zu verstehen, daß er darüber nicht hinausgehen könne. Er fügte hinzu: »Nach meiner Meinung hätten wir Gewaltsamkeiten auslösen können, die uns einen schweren Weg aufgezwungen hätten.«
Der amerikanische Präsident bestätigte also gestern öffentlich, was um die Jahreswende aus seiner Umgebung verlautete. Damals hieß es noch zusätzlich, Kennedy habe darauf hingewiesen, daß mit der gewaltsamen Niederreißung der Mauer auch nichts gebessert worden wäre, denn dann hätten die Kommunisten eine andere Mauer hundert Meter weiter zurück errichten können. In dem großen Bericht über die Lage der Nation vor dem Kongreß erwähnte der Präsident Berlin verhältnismäßig kurz. In diesem Bericht stand ohnehin die Innenpolitik im Vordergrund. Seit Chruschtschow nicht mehr darüber spricht, wann der Separatfriedensvertrag zwischen Moskau und Ostberlin abgeschlossen werden soll, scheint sich der Streit um die alte deutsche Hauptstadt etwas beruhigt zu haben. Unter den möglichen Zukunftsentwicklungen für Berlin ist diejenige des Einfrierens der Krise nicht die unwahrscheinlichste. Aber zur Zeit gibt es ja weiterhin Berlingespräche auf beträchtlich hoher Ebene. John Kennedy drückte sich gestern hinsichtlich der Verhandlungen – er selbst gebrauchte dieses Wort –, der Verhandlungen des amerikanischen Botschafters Llewellyn Thompson mit dem Sowjet-Außenminister Gromyko vorsichtig und nicht hoffnungslos aus: »Ich hoffe, daß diese Gespräche fortgeführt werden.« Kennedy meint, daß das Problem Berlin sehr sorgfältig geprüft werden müsse und daß man erst nach einer vernünftigen Zeitspanne zu beurteilen vermöge, ob und wie es zu einem Arrangement über Berlin kommen könnte. Der fragende Reporter war hartnäckig und wollte wissen, welche Zeitspanne der Präsident in diesem Falle als vernünftig betrachte. Kennedy antwortete wiederum diplomatisch. Dies hänge davon ab, was sich während der Verhandlungen ereigne. Der Zeitmaßstab würde verschieden sein, je nachdem, ob ein Fortschritt sich abzeichne oder nicht. Im Augenblick gäbe es nur eines: die Kontakte fortzusetzen. Aus London vernimmt man heute in Washington, daß Premierminister Macmillan über die neusten Nachrichten aus Moskau besorgt sei. Das zweite Gromyko/Thompson-Treffen sei düsterer verlaufen als das erste. Die Engländer strebten eine Situation an, wie sie vor dem U-2-Zwischenfall und der gescheiterten Pariser Gipfelkonferenz bestanden habe. Der britische Premierminister erwäge, eigene Schritte zu unternehmen, wenn die amerikanische Verhandlungsführung durch Thompson in eine Sackgasse führe. Auch die Amerikaner sind sicherlich bestrebt, eine Sackgasse zu vermeiden. Die Frage ist, ob sie das tun können, wenn sie auf der Basis bleiben wollen, die zwischen Präsident Kennedy und Bundeskanzler Adenauer vereinbart wurde. Diese Basis war die Beschränkung auf Berlin als Verhandlungsgegenstand. Die Sicherheit der Bundesrepublik wurde von Kennedy und Adenauer mit Vorrang versehen. Im Hinblick auf die russischen Wünsche bedeutete das: die Ausrüstung der Bundeswehr mit modernsten Waffen, also auch mit Trägern für Atomsprengköpfe, sollte kein Verhandlungsgegenstand sein, kein Tauschobjekt für einen besser abgesicherten Status Westberlins.
Nehmen wir Kennedys Vorschlag für eine internationale Kontrolle der Zufahrtswege nach Berlin hinzu, dann haben wir die vorderste, gewissermaßen offensive Position des Westens in der Berlinfrage. Niemand weiß – natürlich außer Adenauer und Kennedy selbst –, ob zwischen Washington und Bonn Einigkeit besteht über Rückzugsmöglichkeiten von dieser Position. Es wäre allerdings unwahrscheinlich, wenn solche Möglichkeiten von zwei erfahrenen Politikern nicht ins Auge gefaßt würden. Die Russen haben ihrerseits ihre offensiven Berlinpositionen und dürften sich nach den Erfahrungen mit der Standfestigkeit des jungen amerikanischen Präsidenten im vergangenen Jahr nicht einbilden, daß sie diese Positionen halten können, wenn sie wirklich eine neue Übereinkunft wünschen. Gromyko scheint auch in der letzten Unterredung mit Thompson wiederum die Anwesenheit symbolischer sowjetischer Truppenkontingente in Westberlin gefordert und die internationale Kontrolle der Autobahn abgelehnt zu haben. Das diplomatische Berlinschachspiel scheint also im Augenblick vor allem zwei Möglichkeiten in den Vordergrund gebracht zu haben: Erste Möglichkeit – beide Seiten wollen einen neuen Vertrag und einen vom westlichen Standpunkt aus besseren Status für Berlin. In diesem Falle werden sich die Verhandlungen nicht auf Berlin beschränken, sondern die Deutschlandfrage abermals erörtern. Westliche Vorteile in Berlin müßten mit westlichen Zugeständnissen hinsichtlich der Bewaffnung der Bundesrepublik und hinsichtlich des Grades der Anerkennung der »DDR« bezahlt werden.
Zweite Möglichkeit – keine Seite ist bereit, den erforderlichen Preis für ein neues Berlinabkommen zu entrichten. In diesem Falle bleibt alles, wie es ist: die Mauer, die labile Freiheit Westberlins, der jederzeit mögliche Griff der Kommunisten nach den Zufahrtswegen, die Nichtanerkennung der »DDR«, die Aufrüstung der Bundeswehr im vorgesehenen NATO-Maßstab, der ein Mitbestimmungsrecht der europäischen Mächte, an der Spitze die am meisten gefährdete Bundesrepublik Deutschland, beim Einsatz der Atomwaffen immer wahrscheinlicher macht.