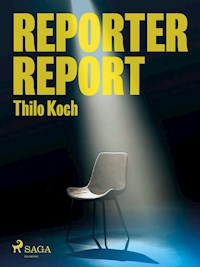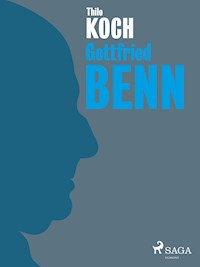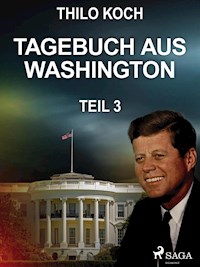
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Tagebuch aus Washington
- Sprache: Deutsch
Im letzten Teil dieser spannenden Reihe, folgt der Leser dem deutschen Journalisten Thilo Koch während dieser das Ende von J.F. Kennedys Amtszeit und dessen Ermordung als Korrespondent in Washington miterlebt. Hier werden die Ereignisse des Jahres 1963 ein weiteres Mal lebendig, während Thilo Koch seine Bilanz der "Ära Kennedy" in diesem Band beschließt. Wesen und Handlungen des ermordeten Präsidenten, ebenso wie dessen Erfolge und unerfüllten Pläne, werden hier ins rechte Licht gerückt.Die Ära Kennedy hatte Thilo Koch vollständig als Journalist begleitet, da er für den ARD Korrespondent in Washington war. In dieser Reihe erzählt Koch über diese Ära aus der Sicht eines deutschen Journalisten. Der Autor bleibt stets sachlich bei seiner Berichtserstattung, jedoch ist gleichzeitig seine eigene Einstellung zu den Geschehnissen in den USA deutlich, was der Buchreihe ihren ganz eigenen Charme verpasst. Der Journalist lädt den Leser ein, in die damalige Zeit einzutauchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thilo Koch
Tagebuch aus Washington 3
Saga
Tagebuch aus Washington 3Cover Bild: Shutterstock Copyright © 1964, 2019 Thilo Koch und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711836118
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
VORWORT
Ich sehe mich an der Pennsylvania Avenue stehen, dort, wo sie mit einer weiten Kurve zum Weißen Haus einbiegt. Im Zylinder der große alte Mann der Nation: Eisenhower; im Zylinder neben ihm der große junge Mann der Nation: Kennedy. Die jubelnde Fahrt zum Kapitol. Es war der 20. Januar 1961, ein ungewöhnlich kalter Wintertag.
Und ich sehe den Trauerzug kommen, sechs Grauschimmel ziehen eine Lafette. In dem Sarg unter dem Sternenbanner: der 35. Präsident der Vereinigten Staaten – ermordet. Vom Kapitol her, die Pennsylvania Avenue herunter, in umgekehrter Richtung diesmal, zum Weißen Haus, weiter zum Friedhof in Arlington. Es war der 25. November 1963, ein ungewöhnlich warmer Herbsttag.
Wieviel Zukunft wehte um den selbstbewußten Kopf mit dem unverkennbaren Haarschopf! Kennedy schien ein anderes, ein sich neu verstehendes Amerika zu sein – an der Spitze einer von alten Männern regierten westlichen Welt. Ich habe sie »Ken-ne-dy« rufen hören, die Berliner, rhythmisch, immer wieder, auf dem Rudolf-Wilde-Platz, der jetzt John-F.-Kennedy-Platz heißt. Mehr als ein Name war das – ein Programm, eine Vision. Die Hoffnung auf eine bessere Welt? Endlich einmal schien das keine bloße Phrase zu sein.
Die Schüsse von Dallas haben mehr getroffen als einen Mann in den besten Jahren. Ich hatte zum erstenmal hier in Amerika das Gefühl: weg, fort von hier. Wo dieser Mann auf diese Weise sterben mußte, da möchte man nicht mehr sein, nichts mehr beobachten, berichten, verstehen, lernen.
Die 1000 Tage des Präsidenten Kennedy sind die 1000 Tage dieser Notizen, Kommentare, Berichte für den Nord- und Westdeutschen Rundfunk, für DIE ZEIT. Unerwartet, weiß Gott, unvorhersehbar wurden die drei Tagebücher der drei Jahre 1961, 1962, 1963 eine Chronik der ganzen Ära Kennedy.
Es wird größere geben, schon bald – fundiertere. Diese ist frisch aus der Stimmung vieler einzelner der 1000 Tage heraus geschrieben – von einem der 100 Auslandskorrespondenten in Washington, deren ›job‹ es ist, das Weiße Haus zu ›covern‹, die Politik des Mannes dort im ›einsamsten Zimmer der Welt‹ Zug um Zug zu analysieren, zu kommentieren.
Das machte Spaß bei Kennedy. Selbst das gute alte White House erwachte zu ungeahntem Leben – dank Jacqueline Kennedy, der charmantesten First Lady, die jemals dieses Nationalmuseum mit der Adresse ›1600 Pennsylvania Avenue‹ bewohnte. Der Kennedy-Look, er war mindestens zur Hälfte ein Jackie-Kennedy-Look. Das neueste Bild von ihr: sie steht hinter der handbreit geöffneten weißen Tür ihrer neuen Wohnung im Washingtoner Stadtteil Georgetown, in Schwarz; die Andeutung eines Lächelns – allein.
Diese rasch wachsende, rasch sich wandelnde Nation wächst weiter. Der Kampf um die Bürgerrechte zwischen Schwarz und Weiß, das Rennen um den Arbeitsplatz, die 50-Milliarden-Rüstung, die weltweiten Verpflichtungen zwischen Berlin und Saigon – das alles ging nicht mit Kennedy zu Ende, fand keine ›Lösung‹ durch ihn. Aber neue Ziele und Wege zeigte er seinem Volk, und es begann zögernd zu folgen.
Das zu sehen, zu beschreiben war Teilnahme an einem Stück Geschichte aus nächster Nähe. Wie funkelnd und prickelnd, wie faszinierend und vielfältig es war, das merkt man erst jetzt, da plötzlich die Unruhe in dieser großen Uhr im Zentrum der Macht Washington zum Stillstand gekommen ist. Es lohnt sich nachzusinnen, ›wie es wirklich gewesen‹.
Washington, am 31. Dezember 1963
Thilo Koch
TAGEBUCH AUS WASHINGTON III
8. Januar 1963
Wenn man nach einem kurzen Winterurlaub nach Washington zurückkehrt, strahlt die Kuppel des berühmten Kapitols so weiß und erhaben wie eh und je über die Stadtsilhouette. Der Weg zum ›Hügel‹ hinauf, auf dem der Sitz des amerikanischen Parlaments errichtet wurde, ist glatt – Schnee und Eis sind über die Weihnachtszeit auch für die amerikanische Hauptstadt ein kleines Problem geworden, obwohl doch Washington auf demselben Breitengrad liegt wie die für unsere Begriffe sehr südliche italienische Insel Sizilien. Auch Präsident Kennedy, der heute aus Florida tiefgebräunt, bei bester Gesundheit und guter Laune an seinen Schreibtisch im Weißen Haus zurückkehrte, wird die breite Pennsylvania Avenue, die zum Kapitol führt, glatt und unwirtlich finden – in einer anderen Weise freilich noch als wir gewöhnlichen Sterblichen. Morgen nimmt der 88. Kongreß der Vereinigten Staaten seine Arbeit auf, und die Zeitungen sind seit Tagen voll von Diagnosen und Prognosen, von Analysen und Perspektiven für die künftige Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament, Exekutive und Legislative.
Übers vergangene Wochenende kamen die hundert Senatoren und vierhundertfünfunddreißig Abgeordneten des Repräsentantenhauses aus ihren 50 Staaten nach Washington gereist und viele den Dolch im Gewande. Wiederum werden es durchaus nicht nur die republikanischen Kongreßmänner sein, sondern auch viele Parteifreunde des Präsidenten, die die innenpolitischen Vorstellungen und Vorschläge John Kennedys zerstückeln oder ganz töten. Die Parlamentswahlen im November vorigen Jahres hatten zwar ein für die Kennedy-Partei überraschend positives Ergebnis in beiden Häusern des Kongresses; aber obwohl seine Partei, die demokratische, wiederum über solide Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus verfügt, sieht sich Kennedy dennoch der gleichen starken konservativen Opposition gegenüber. Anders als im deutschen Bundestag und manchem Parlament auf der Welt sonst gehen die Abstimmungsergebnisse im amerikanischen Kongreß zumeist quer durch die beiden Parteien. Die Senatoren und Abgeordneten aus Texas und Montana, aus Oregon und Maine, aus Arkansas und Connecticut, Virginia und Maryland werden eben in diesen ihren Heimatstaaten gewählt, fühlen sich von ihren Wählern als deren Vertreter in die Bundeshauptstadt entsandt und wollen vor allem wiedergewählt werden. Das heißt, ihre Arbeit in Washington muß zu Hause in Texas und Maryland gefallen. So stellen diese Abgeordneten sehr oft die lokalen Interessen über die nationalen. In der Frage der Bürgerrechte für die farbige Bevölkerung in den Süd-Staaten macht es infolgedessen kaum einen Unterschied, ob der betreffende Volksvertreter Republikaner oder Demokrat ist. Die farbige Bevölkerung in Mississippi, Alabama, Georgia usw. wird oft durch diskriminierende Wahlgesetze am Wählen gehindert, und so ist es noch immer weitgehend die auf Rassentrennung bedachte weiße Bevölkerung der Südstaaten, die einen Senator oder Repräsentanten nach Washington schickt.
Die Kennedy-Regierung sieht sich noch weit schwierigeren und fürs ganze Land bedeutsameren Problemen gegenüber als der Rassenfrage. An der Spitze steht die überfällige Steuerreform und die von Kennedy angekündigte drastische Steuersenkung. In dieser Frage prallen sowohl die Leidenschaften und Interessen als auch die ökonomischen Theorien aufeinander. Natürlich ist eine Steuersenkung populär. Wenn es dem Präsidenten darauf ankäme, das Volk mit seinem Steuerprogramm zu ködern und Stimmen zu fangen, so hätte er es entweder noch vor der letzten Parlamentswahl im Sommer/Herbst vorigen Jahres eingebracht oder er würde es sich aufsparen für die Zeit, da seine eigene Wiederwahl zur Debatte steht: Herbst 1964. In der Tat hat Kennedy solche Mittel nicht nötig, zumindest zur Zeit nicht. Ohnehin verläuft seine Popularitätskurve höher und glanzvoller als selbst diejenige Eisenhowers, des geliebten Vaters der Nation. Der außenpolitische Kuba-Erfolg glich ein gewisses Nachlassen der Kennedy-Begeisterung wieder aus. Dieser junge Präsident steht heute mit seinen 45 Jahren absolut sicher, ich möchte sogar sagen souverän an der Spitze des amerikanischen Volkes, und er hat es gelernt, das schwierigste Amt der Welt so gut zu handhaben, wie das überhaupt menschenmöglich ist.
Merkwürdigerweise nun hat Kennedys Popularität, sein gerade durch die Fernsehfähigkeiten dieses Präsidenten ungemein enger Kontakt mit dem Volk, kaum Einfluß auf sein Verhältnis zum Parlament. Die wichtigsten Senatoren und Repräsentanten zeigen sich sogar betont wenig beeindruckt von Kennedys innen- und außenpolitischen Erfolgen. Es handelt sich bei diesen Männern um überwiegend ältere Herren, die diesem jungen Mann irgendwie nicht trauen, sei es, weil er nicht ihrer Generation angehört, sei es, weil er ein Millionärssohn ist und infolgedessen zumeist nicht ihrer Gesellschaftsschicht entstammt, sei es, weil sie ihn als Intellektuellen ablehnen, sei es, daß sie seine Berater nicht mögen. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, daß sehr ähnliche Einwände gegen Kennedy und seine Regierung aus dem Ausland bekannt sind, zum Beispiel aus der Bundesrepublik Deutschland, und der Schluß liegt nahe, daß ähnliche Motive und Hintergründe, ähnliche psychologische und soziologische und politische Antriebe die Ursachen sind. Ironischerweise verdienen Kennedy und seine Mitarbeiter diese Art Mißtrauen gar nicht, denn ihre Politik ist weit konservativer als ihre Ideen und selbst diese Ideen sind alles andere als revolutionär. Wer von Kennedy erwartet hatte, daß er innenpolitisch ein junger Roosevelt werden würde, ein Reformator —, der sieht sich nach zwei Jahren Amtsführung eines anderen belehrt. Alle sozialpolitischen Vorschläge der Kennedy-Regierung waren, gemessen an den Forderungen etwa der britischen Labour-Party, der skandinavischen oder auch deutschen Sozialdemokraten, der französischen und italienischen Sozialisten, höchst bescheiden. Sie blieben alle im Rahmen der bestehenden amerikanischen Gesellschaftsordnung, im Rahmen des aufgeklärten Kapitalismus, der in den Vereinigten Staaten das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben bestimmt.
Weitere wichtige Themen des morgen zusammentretenden 88. Kongresses sind: Kennedys Gesetzesvorschlag zur Verbesserung der Altersfürsorge, der schon einmal abgewiesen wurde; ein Gesetzesentwurf für Bundesmittel zur Verbesserung des Erziehungswesens, der auf erbitterten Widerstand der religiösen Privatschulen stößt; das in der vergangenen Legislaturperiode ganz und gar verwässerte neue Landwirtschaftsgesetz; das seit Trumans Zeiten unglücklich umstrittene Auslandshilfeprogramm. Dies sind nur einige der Streitobjekte. Hinzu kommen schwere Differenzen über die vernünftigste Anwendung der Verteidigungs-Milliarden. Der anglo-amerikanische Streit um die Skybolt-Rakete wird in diesem Zusammenhang wahrscheinlich noch ein parlamentarisches Nachspiel haben. Dabei geht es ja tatsächlich auch letzten Endes um die gesamte Zukunft der Luftwaffe, um die Frage, ob Raketen ganz und gar an die Stelle von Bombenflugzeugen treten werden. Weniger Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Parlament sind auf außenpolitischem Gebiet in Sicht. Aber auch in Amerika ist die Außenpolitik immer nur so stark und gut, wie die innenpolitische Situation, die wirtschafts- und sozialpolitische Basis das gestattet.
9. Januar 1963
Soll man eine so alte Lady über den Atlantik reisen lassen? Es ist wahr, die Mona Lisa ist 459 Jahre alt. Aber André Malraux, der französische Kultusminister, hatte Jackie Kennedy diese Visite versprochen, und so soll er seinen entrüsteten Kritikern in Paris geantwortet haben: »Was ist schlimmer, Mrs. Kennedy verletzen oder La Gioconda?«
Die Dame auf dem berühmten Bild Leonardo da Vincis war die Gattin von Francesco di Bartolommeo di Zanobi del Giocondo. Die Italiener und die Franzosen nennen sie daher La Gioconda, im übrigen aber ist sie unter ihrem Vornamen »Mona Lisa« bekannt. Ich vermute, es gibt ganze Bibliotheken über das Rätsel ihres geheimnisvollen Lächelns und über ihre wunderbar zarten Hände. Das Bild gilt seit Jahrhunderten als eines der schönsten Meisterwerke der Malerei. Die Amerikaner machen daraus in diesen Tagen »das größte Bild aller Zeiten«.
Gestern abend, es war schon beinahe Nacht, defilierte ich auf Tuchfühlung zwischen allem, was in der amerikanischen Hauptstadt gut und teuer ist, unter den dunklen, seltsam abgewandten Augen der Signora Mona Lisa Gioconda vorbei. Der gesamte Kongreß der Vereinigten Staaten war in die Nationalgalerie eingeladen worden – am Vorabend der Wiederaufnahme der Parlamentsarbeit. Man konnte lächeln und plaudern mit Millionärsgattinnen und dem berühmtesten Rechtsanwalt der USA, Mr. Donovan, der gerade die kubanischen Gefangenen befreite.
Neben der Mona Lisa selbst war es natürlich Jackie Kennedy in einem taillenfreien, weich fließenden griechischen Gewande, die als Stern des Festes ihre neueste Frisur präsentierte und wie immer zum Präsidentengatten bewundernd aufblickte. John Kennedy selber wirkte wie ein junger römischer Feldherr im Smoking, ließ den blauen Adlerblick wohlwollend schweifen und lachte mit seinem prächtigen weißen Gebiß.
Ich stand neben Verteidigungsminister McNamara, als eine Dame das Absperrseil überwinden wollte, und konnte mein Vertrauen in die blitzschnelle Intelligenz des heute wichtigsten Mannes neben Kennedy vertiefen. Während nämlich einige Herren vergeblich versuchten, der Dame über das Seil zu helfen, hob er es kurz entschlossen in die Höhe, weil er erkannt hatte, daß die Lady ein futteralenges Kleid anhatte und leichter zu Kniebeugen als zu Ausschreitungen in der Lage war.
Bobby Kennedy verlor mit halbgeöffnetem Mund kein Wort seines Bruders, wurde aber überragt von mehreren seiner Schwestern, die in köstlichen Abstufungen von Rot ihre schönsten Kleider spazieren trugen – es war schwer, sie zu zählen.
Inmitten all des amerikanischen Glanzes wirkte der bedeutende Schriftsteller André Malraux, der für de Gaulle als Kultusminister dient, eher bescheiden und nüchtern. Seine Worte indessen waren von gallischem Feuer, und er hätte sicherlich ironisch gelächelt, wenn er hätte hören können, was mir ein Kollege zuflüsterte: »Immer wenn die politischen Beziehungen schlecht sind, intensiviert man die kulturellen.«
Es war schon sehr merkwürdig, zwischen Militärkapelle in roten Röcken, Kennedy-Rede, Obersten Richtern, Senatoren-Gattinnen, Kunst-Kritikern und Fotografen, still und fern, unberührbar, aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt, dieses kleine, nicht einmal quadratmetergroße Bild goldgerahmt und vor einem Altar aus rotem Samt hängen zu sehen.
Sicher ist eines: Wenn man in abermals 459 Jahren fragen wird: Kennedy, de Gaulle – wer war das?, dann wird noch immer ein anderer Name lebendig sein: Leonardo da Vinci.
11. Januar 1963
Der derzeitige amerikanische Präsident ist entschlossen, es auf Reibereien und Spannungen mit den europäischen Verbündeten der Vereinigten Staaten ankommen zu lassen. »Ich erwarte nicht, daß die Vereinigten Staaten sich beliebter machen werden, aber ich hoffe, daß wir mehr erreichen können.« Dies ist ein wörtliches Zitat aus einem vertraulichen Gespräch Kennedys mit Journalisten, das er während seines Weihnachtsurlaubs in Palm Beach, Florida, führte. Britische Korrespondenten, die daran teilgenommen hatten, zitierten daraus und hierüber entstand jetzt einiger Ärger. Kennedys Pressechef Salinger kündigte an, daß der Präsident daraufhin womöglich keine Hintergrund-Informationen dieser Art mehr geben werde. Das Weiße Haus veröffentlichte Auszüge aus einer wörtlichen Niederschrift der Ausführungen Kennedys; sie erscheinen heute in den amerikanischen Zeitungen.
Kennedys Worte und alles, was die Journalisten, zu denen er sprach, ausführten, zeigen, daß der Präsident die in Nassau im Dezember eingeschlagene Richtung konsequent und mit offenbar wachsendem Eifer verfolgt. Man darf diesem Mann glauben, daß er seinen Führungsanspruch nicht aus persönlicher Lust an der Macht verwirklichen will. Ohne Zweifel gefällt diesem jungen, erfolgreichen Präsidenten sein Amt. Unverkennbar fühlt er sich zur Handhabung der Macht geboren und berufen. Aber Selbstkontrolle und Nüchternheit, und vor allem die Fesseln der amerikanischen Verfassung würden ihm nie gestatten, aus purem Übermut, wie ihm das einige englische Stimmen unterstellen, das westliche Bündnissystem in Frage zu stellen. Es sind harte politische Realitäten, die den amerikanischen Präsidenten veranlassen, die europäischen Verbündeten – zunächst England und Frankreich – vor einige folgenreiche Alternativen zu stellen. Kennedy ist nicht mehr bereit, den amerikanischen Schutz für Europa ohne entsprechende Entscheidungsgewalt über die Art und die Anwendung dieses Schutzes zu gewähren.
Rein militärisch gesehen ist eine Entwicklung oder auch nur Beibehaltung nationaler Atomwaffen in Europa blanker Unsinn. Die amerikanischen Atomstreitkräfte stehen für 97 Prozent der atomaren Abschreckung. Die restlichen drei Prozent, die sich aus britischen Sprengköpfen ergeben, sind unerheblich, weil bereits 50 Prozent der vorhandenen atomaren Zerstörungskraft der Amerikaner ausreichen würden, um einen Gegner wie die Sowjetunion vollständig zu vernichten. Diese Grundtatsache wird oft vergessen. Es handelt sich also bei der gesamten Diskussion um eine sogenannte multilaterale oder multinationale Atommacht, um die NATO als vierte Atommacht, immer nur um politische Prestige-Probleme. Die letzte Waffe ist heute das entscheidende Merkmal absoluter Souveränität. Nur die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion sind in diesem Sinne in unserer heutigen Welt vollkommen souverän.
Die Kennedy-Regierung findet es verständlich, daß Großbritannien, Frankreich und später andere NATO-Mächte – Italien, die Bundesrepublik usw. – ebenfalls nach jener letzten Souveränität streben. Die Amerikaner finden es weiterhin verständlich, daß ihre europäischen Partner sich nicht für alle Zeiten und ganz rückhaltlos auf den amerikanischen Schutz verlassen wollen. Deshalb bauen sie ihren Bundesgenossen eine goldene Brücke. Englische Polaris-U-Boote, später vielleicht französische, italienische, deutsche – alle gemeinsam zu einer NATO-Vergeltungsstreitmacht zusammengeschlossen – das, so denkt Kennedy, sollte geeignet sein, beides zu befriedigen: das Prestigebedürfnis und das nationale Sicherheitsverlangen.
Natürlich ist diese goldene Brücke ein Zauberkunststück und wenn man so will ein Trick, denn die Polaris-Raketen und zumeist auch die Polaris-U-Boote sind »Made in USA«. Was nützt den Engländern und Franzosen die Produktion eigener Atomsprengköpfe, wenn ihnen die Träger, die Raketen, fehlen, um diese Köpfe ins Ziel zu bringen? Und was den Kontroll-Mechanismus, die Entscheidungsbefugnis, das Mitspracherecht, beim Einsatz von Kernwaffen angeht, so wird auch hier, was immer man für eine Maschinerie ausarbeitet, das amerikanische Wort das entscheidende und das letzte sein. Dies sind längst keine Hintergrundtatsachen mehr, die vertraulichen Gesprächen vorbehalten bleiben müßten, sondern es liegt offen zu Tage. Je eher es auch in London und Paris eingesehen wird, desto besser für den Westen.
New York, 12. Januar 1963
Was soll aus dem Kongo werden? In New York berichtet heute einer der höchsten Beamten der Vereinten Nationen dem Generalsekretär U Thant über seine Reise ins Kongo-Gebiet, von der er gerade zurückkehrte. Ralph Bunche, ein Amerikaner dunkler Hautfarbe, bemühte sich an Ort und Stelle, die Kongo-Politik der Vereinten Nationen und der Vereinigten Staaten, die zur Zeit nahezu identisch sind, zu überprüfen und vorwärtszubringen. Es gibt zwei Gründe, die die UNO zwingen, Entscheidungen am Kongo sehr schnell herbeizuführen.
Der erste Grund ist, daß die ernsten finanziellen Sorgen der Organisation spätestens im Sommer dieses Jahres die UNO buchstäblich arbeitsunfähig machen würden, wenn nicht bis dahin das teuerste Unternehmen der Vereinten Nationen, die Polizeiaktion im Kongo-Gebiet abgeschlossen ist. Diese Aktion kostet monatlich 10 Millionen Mark und wird praktisch durch eine amerikanische Anleihe finanziert. Präsident Kennedy versicherte indessen bei seiner Bitte um diese Mittel vor dem Kongreß, daß er nicht noch einmal auf die gleiche Weise und für denselben Zweck Geld fordern würde. Im Generalsekretariat der Vereinten Nationen bezeichnet man den Juni als äußerste Zeitgrenze für das finanzielle Problem »Kongoaktion«.
Die zweite Ursache dafür, daß U Thant alle notwendigen militärischen Operationen der UNO-Truppen sehr bald abgeschlossen haben muß, ist das Drängen der Inder. Sie stellen das wichtigste UNO-Truppen-Kontingent am Kongo. Die indischen Truppen aber sollen bis spätestens Ende März abgezogen werden, um zur Zeit der Schneeschmelze an der indisch-chinesischen Grenze im Himalaya eingesetzt werden zu können.
Es sieht so aus, als ob U Thant von den beiden entscheidenden Großmächten, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, vor seiner Wahl verlangt hat, daß sie ihm den Weg zu einer Lösung der Kongo-Frage im Sinne der UNO-Politik, deren Ziele noch Dag Hammarskjöld absteckte, nicht verbauen würden. Die Tatsache, daß Thant einstimmig gewählt wurde, läßt den Schluß zu, daß ihm Zusagen gemacht wurden. In der Tat geht es ja am Kongo heute um die Existenz der Organisation der Vereinten Nationen selbst. Kuba aber hat beiden Großmächten gezeigt, wie nützlich die Organisation als Ausweichgleis, als neutrale Gesprächsplattform sein kann.
Natürlich ist der Kongo im Grunde keine Frage militärischer Auseinandersetzungen zwischen UNO-Truppen und Katanga-Söldnern. Jahrzehnte wird es brauchen, bis hier die soziologischen Voraussetzungen für eine funktionierende Selbstverwaltung geschaffen werden können. Die Belgier trifft eine schwere historische Schuld. Anders als die Engländer und die Franzosen haben sie es versäumt, rechtzeitig in ihrem Kolonialbereich die Voraussetzung für politische Unabhängigkeit zu schaffen. In New York kann man erfahren, daß von 15 Millionen Kongolesen im Zeitpunkt der Unabhängigkeitserklärung ganze vierzehn Personen eine akademische Bildung hatten.
Seit Henri Spaak in der belgischen Regierung sich tatkräftig um das Kongo-Problem kümmert, scheinen sich Wege zu eröffnen für eine Rückkehr belgischer Fachkräfte zum Aufbau des Kongo. Es sind vor allem belgische und britische Interessen in der reichen Provinz Katanga, die bisher einer Wiedervereinigung des ganzen Kongo entgegenstanden. Die Entschlossenheit der Vereinten Nationen, hinter denen ein wachsender Druck der Amerikaner steht, hat es nun bewirkt, daß diese belgisch-britischen Interessen sich nicht mehr so hartnäckig auf ihren Exponenten Tschombe, den Repräsentanten der Abspaltung der Provinz Katanga, stützen.
Es mag wohl eine Zusicherung der Zentralregierung Adoulas an die Belgier und Briten geben, die Katanga-Minen nicht zu nationalisieren, wenn die Minengesellschaft »Union Minière« zuverlässig und ausreichend Steuern zahlt. Das würde den Weg zu einem Rückzug der UNO-Armee öffnen. Weiter notwendig bleibt dreierlei: eine ausreichend starke UNO-Polizei, amerikanische Wirtschaftshilfe und technische Hilfe aus Europa, vor allem aus Belgien.
14. Januar 1963
Die Lage war nie so gut. So lapidar und bestimmt sprach Präsident Kennedy es aus. Dieser Satz war das Fundament seiner Botschaft »state of the union«, die Lage der Nation. Die beiden Häuser des Kongresses, das Kabinett, die obersten Richter hörten und sahen für eine knappe Stunde einen fünfundvierzigjährigen Mann, der in den zwei Jahren, seit er ins Weiße Haus einzog, zu einem guten Präsidenten der Vereinigten Staaten wurde. Die Senatoren und Abgeordneten, die ihm in den zwei Jahren oft das innenpolitische Leben schwer gemacht hatten, huldigten ihm stehend mehrere Minuten durch Ovationen. Es war der Sieger von Kuba, der Führer der stärksten Nation der Welt, der würdig und ohne Pathos ungemein nüchtern und unter bewußtem Verzicht auf ein Zur-Schau-Tragen seiner Führerrolle nur noch durch Argumente zu überzeugen versucht. Seine Botschaft war weniger als vor einem Jahr mit Zitaten gespickt. Jefferson und Lincoln, an die sich John Kennedy am liebsten anlehnt, standen weniger in den Anführungszeichen als in der eigentlichen Substanz des Rechenschaftsberichtes.
Die Lage war also nie so gut wie in diesem einhundertfünfundsiebzigsten Jahr der Republik USA. Kennedy nannte Berlin als erstes Beispiel für die außenpolitischen Erfolge; nach wie vor sei West-Berlin frei und sicher. In Laos sei immerhin eine Art Ausgleich erreicht. Die Aggressionen gegen Vietnam konnten aufgehalten werden. Am Kongo sei vielleicht das Ende der Auflösung in Sicht. Die sowjetische Troika-Doktrin zur Lähmung der Vereinten Nationen sei tot. Und schließlich Kuba. Hinsichtlich der chinesisch-russischen Gegensätze stellte Kennedy neben die Hoffnung die Vorsicht. Der Westen dürfe nicht aufhören »seine Waffen nahebei bereitzuhalten«. Kommunistische Befreiungskriege würden weiterhin auch von Moskau unterstützt, ja gefordert, und die Herausforderungen des Kalten Krieges dauerten an.
Präsident Kennedy widmete trotzdem dem Herausforderer selbst, dem Kommunismus, bemerkenswert wenige Worte. In keiner seiner Reden bisher wurde es deutlicher, daß John Kennedy vor allem in dem Stärkerwerden der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten den Schlüssel sieht zu einem allmählichen Sieg über den Kommunismus, zu einer Welt, in der zu leben es sich lohnt – für alle Erdenbürger. Man mag es Realismus nennen, daß dieser Präsident heute weniger Wert als früher auf sein sozialpolitisches Programm legt, daß er im Hundert-Milliarden-Dollar-Haushalt der Vereinigten Staaten dem Verteidigungsposten eindeutig den Vorzug gibt. Kennedy wird für diesen Realismus von Links kritisiert, und die Rechte findet ihn nicht konservativ genug. Für das Schulwesen und die Altersfürsorge geht Kennedy nicht gerade auf die Barrikaden. Er tut es indessen für Steuersenkung in Verbindung mit Steuerreform, obwohl der mächtige Wilbur Mills, Vorsitzender des zuständigen Parlamentsausschusses dagegen ist. Viele Stimmen im Kongreß und im Lande halten einen ausbalancierten Haushalt für wichtiger. Sie bezweifeln, daß die Vorschläge der Regierung die Wirtschaft so stark beleben können, wie Kennedy das in Aussicht stellt.
Der Präsident bezeichnete seine Vorschläge für eine neue Steuergesetzgebung als das Kernstück seiner Innenpolitik im Jahre 1963. Damit warf er sein gesamtes Prestige in die Waagschale. Er will die persönliche Einkommenssteuer und die Körperschaftssteuer um nicht weniger als 13 Milliarden Dollar kürzen. Der dafür in Aussicht genommene Zeitraum wird mit drei Jahren angegeben. Von den Steuererleichterungen erhoffen sich Kennedys Steuer-Theoretiker eine höhere wirtschaftliche Wachstumsrate und mehr Arbeitsplätze. Die Erwartungen gehen dahin, daß jeder, der von seinem Einkommen weniger abgeben muß, dafür mehr einkaufen kann, infolgedessen die Produktion steigert und damit höhere Umsätze und Profite in der Wirtschaft ermöglicht. Der allgemeine Aufschwung werde das Sozialprodukt und das Einkommen pro Kopf der Bevölkerung und damit schließlich letzten Endes das Steueraufkommen erhöhen. Die Steuerreform soll Ungleichheiten, Schlupflöcher und ungerechtfertigt hohe Abschreibungsmöglichkeiten bereinigen. Zur Zeit liegt die Einkommenssteuer zwischen zwanzig und einundzwanzig Prozent, je nach Höhe des Einkommens. Kennedy wünscht eine neue Skala zwischen vierzehn Prozent und fünfundsechzig Prozent. Er ist bereit, abermals mit Schulden aus dem nächsten Haushaltsjahr hervorzugehen, da er sicher ist, daß das Aufblühen der Wirtschaft auf lange Sicht auch der Staatskasse zugute kommt. Die Staatsschulden der USA sind seit dem Zweiten Weltkrieg, dem Koreakrieg und den zumeist defizitären Budgets aller Nachkriegspräsidenten ohnehin gigantisch – mehr als 300 Milliarden Dollar.
Die größte Sorge der Kennedy-Regierung ist offensichtlich die Arbeitslosigkeit. Es ist ihm in den ersten beiden Jahren nicht gelungen, sie wesentlich zu mindern und die Versprechungen aus dem Wahlkampf und aus den ersten Regierungserklärungen zu erfüllen. Wohl konnte Kennedy jetzt melden, daß eine Million Arbeitsplätze mehr geschaffen wurden; aber die Bevölkerung der Vereinigten Staaten vermehrt sich in jedem Jahr um vier Millionen Seelen und in jedem Jahr werden zwei Millionen neue Arbeitsplätze benötigt. Der Präsident nannte zwei erschreckende Zahlen: in jedem Jahr kämen eine Million junger Amerikaner auf den Arbeitsmarkt, ohne daß es eine ausreichende Nachfrage für sie gäbe. Die zweite Zahl: es leben nicht weniger als 32 Millionen Amerikaner, Bürger der Vereinigten Staaten, des reichsten Landes der Welt »an der Grenze zur Armut«. Der Präsident richtete eine kräftige Warnung an die Adresse der Gewerkschaften: die Fünfunddreißig-Stunden-Woche verteuere die Arbeitsstunde um vierzehn Prozent. Das müsse zur Lohnpreisspirale, zur Entwertung des Dollar, zur Inflation führen.
Breiten Raum in der relativ kurzen Botschaft nahmen die Verteidigungsprobleme ein. Kennedy bekräftigte den in Nassau eingeschlagenen Kurs hinsichtlich der amerikanischen Verteidigungskonzeption für Europa. Ernste und direkte Auseinandersetzungen mit Präsident de Gaulle erscheinen hiernach unausweichlich. Fünfzehn Milliarden Dollar werden die USA im kommenden Haushaltsjahr allein für die Atomrüstung mitsamt den Weltraumexperimenten ausgeben. Etwa genausoviel bringen alle europäischen NATO-Partner insgesamt für ihre Verteidigung überhaupt auf. Kennedy bezeichnet die Verteidigung des Westens als absolut unteilbar. Dies bedeutet: die Vereinigten Staaten verteidigen Europa wie sich selbst; dafür muß Europa angemessen an der Riesenlast der Rüstung mittragen. Kennedy fordert für sich das Recht, die Gewichte nach rationalen, technologischen Gesichtspunkten zu verteilen. Französischen und britischen Prestigebedürfnissen trägt er Rechnung durch die Konzeption der »multilateralen Atomstreitmacht«. Interdependence löst Independence ab – so lautet die Formel: gegenseitige Abhängigkeit tritt an die Stelle der Unabhängigkeit.
Der achtundachtzigste Kongreß scheint der Kennedy-Regierung etwas aufgeschlossener gegenüberzustehen als der siebenundachtzigste. Die erste wichtige parlamentarische Entscheidung jedenfalls, eine Abstimmung über den Verfahrensausschuß, der den Fluß der Gesetzgebungsarbeit dirigiert, fiel zugunsten der Regierung aus. Es scheint sich hier ein alter amerikanischer Sinnspruch zu bewahrheiten: nichts ist so erfolgreich wie Erfolg.
16. Januar 1963
Filibuster ist ein lustiges Wort. Die würdigste Versammlung amerikanischer Politiker, die es gibt, der Senat des Kongresses, filibustert zur Zeit über das Filibustern. Das ist weniger lustig, als recht bedeutsam für die politische Bewegungsfreiheit der Kennedy-Regierung. Und nebenbei ist es ein bißchen komisch.
Das Filibuster ist ein unbegrenztes Reden-halten-dürfen. Der Ausdruck wird speziell angewandt auf die Debattenordnung des Senats. Der Senat ist formal vergleichbar dem britischen Oberhaus und dem deutschen Bundesrat. Das amerikanische Parlament, Kongreß genannt, hat zwei Häuser, eben den Senat und das Repräsentantenhaus.
Der Senat besteht aus hundert gewählten Vertretern der fünfzig Einzelstaaten der USA. Jeder Staat – ob klein wie Hawai oder riesig wie Texas – entsendet zwei Senatoren. Ein »Rat der Alten« wie sein großes römisches Vorbild ist er insofern nicht unbedingt, als zum Beispiel der jüngste Bruder des Präsidenten, genannt Teddy, im Alter von 30 Jahren gerade eben Senator wurde.
Während nun das Repräsentantenhaus mit seinen 435 Abgeordneten einen Geschäftsordnungsausschuß hat, der eine Lähmung der Parlamentsarbeit durch sinnlos ausgedehnte Debatten verhindern kann, lehnte es der Senat immer wieder ab, sich selbst solche Beschränkungen aufzuerlegen. Darin steckt eine gewisse Weisheit. Die Meinung der Minderheit soll niemals vollkommen unterdrückt werden können. Notfalls soll jeder einzelne Senator die Möglichkeit haben, Beschlüsse zu verhindern, die er nicht wünscht. Sein letztes Mittel ist das endlose Reden und dadurch Verschleppen eines Beschlusses.
In der letzten Zeit wurde an der Parlamentsarbeit in den Vereinigten Staaten vielfach Kritik geübt. Tatsächlich arbeitete der Kongreß im vorigen Jahr nicht sehr effektiv. Die Gesetzgebung schleppte sich dahin, die verabschiedeten Gesetze wurden oft verwässert oder mit komplizierten Zusätzen geschmückt. Ein Wunsch nach Reformen in der Parlamentsarbeit liegt vor.
Der Senat hat sich nach der Wiederaufnahme seiner Tätigkeit heute vor einer Woche sogleich in drei Gruppen gespalten vor der Frage, ob man nicht die hemmende Redseligkeit einiger Senatoren begrenzen könnte. Der Streit ums Filibustern ist nicht neu; schon vor dem Ersten Weltkrieg kam es zu dem Beschluß, daß die Redezeit begrenzt werden dürfe, wenn zwei Drittel der anwesenden Senatoren sich dafür aussprächen.
Die liberale Anti-Filibuster-Gruppe im Senat möchte diese Zweidrittelmehrheit reduzieren auf 51 von 100 Senatoren. Die konservative Gruppe, vertreten vor allem durch die Südstaatler, wendet sich beredt dagegen, und eine vermittelnde Gruppe hat entdeckt, daß im Dezimalsystem der Bruch drei Fünftel auch recht nett aussieht. Das Komische an der Sache ist nun, daß es womöglich zu einer der gefürchteten langen Filibuster-Debatten kommt – mit dem Ziel, das Filibustern ein für allemal zu beenden.
Das witzige Wort selber übrigens kommt aus dem Holländischen und bedeutete ursprünglich Freibeuter. Filibuster nannte man später Abenteurer, die sich nach dem mexikanisch-amerikanischen Krieg zusammenschlossen, um Revolutionen in lateinamerikanischen Staaten zu entfesseln. Die Aktivität der Exil-Kubaner heutzutage hat also eine Art von Filibuster-Tradition.
Der Senat mag kaum an solche Hintergründe denken. Die gegenwärtige Filibuster-Diskussion zeigt zweierlei von politischem Gewicht: in den Vereinigten Staaten wird der Widerstreit zwischen Mehrheit und Minderheit, wie er sich in parlamentarischen Abstimmungen spiegelt, außerordentlich ernst genommen, und die Volksvertreter bemühen sich, die parlamentarischen Verfahrensregeln zu modernisieren.
18. Januar 1963
Washington ist am Beginn dieses Jahres nicht sehr glücklich über die Entwicklung seines Verhältnisses zu den europäischen Alliierten. Die Nachrichten aus Paris und Brüssel werden mit Besorgnis, ja sogar mit Mißvergnügen studiert. Ob der stellvertretende Außenminister George Ball in Bonn den Bundeskanzler Adenauer vollständig von der militärpolitischen Konzeption der Kennedy-Regierung überzeugen konnte, ist noch offen; man wartet ab, welches Ergebnis die Begegnung Adenauers mit de Gaulle haben wird. Relativ erfreulich hat sich im Schatten europäischer Wolken in den letzten Tagen das Verhältnis zu Rom entwickelt. Der italienische Ministerpräsident Amintore Fanfani hatte mit Präsident Kennedy Gespräche, die anscheinend von gegenseitiger Sympathie getragen waren und in ihrer politischen Substanz eine große Aufgeschlossenheit der italienischen Regierung für die Europa-Politik und die militärische Strategie der amerikanischen Regierung bewiesen.
London, der englische Vetter, erweist sich wieder einmal als der stabilste Partner jenseits des Atlantik, obwohl es gerade 150 Jahre her war, daß die Engländer das Weiße Haus verbrannten. Tatsächlich führten ja die damals noch sehr jungen Vereinigten Staaten von Amerika 1812 einen erbitterten Handelskrieg mit ihrer ehemaligen Kolonialmacht. Aber das ist eben doch wirklich schon sehr lange her, und die Gemeinsamkeiten der angloamerikanischen Mächte sind offenbar stark genug, Belastungsproben wie die Skybolt-Affäre und die Konferenz von Nassau zu überstehen. Gefühlsmäßig sind auch die amerikanisch-französischen Beziehungen positiv und in der Geschichte verwurzelt. Der Name La Fayette wird hier wie der eines Retters der Nation verehrt, denn es waren ja die Franzosen, die den Amerikanern halfen, die Unabhängigkeit von Großbritannien zu erstreiten. Französische Künste, Manieren und Wissenschaften haben die Vereinigten Staaten stets geprägt.
Präsident Kennedy erinnerte noch bei der Eröffnung der »Mona-Lisa-Ausstellung« daran, daß amerikanische Soldaten in diesem Jahrhundert Frankreich zweimal gerettet haben: durch den Eintritt der USA in den 1. und in den 2. Weltkrieg an der Seite Frankreichs und gegen das Deutsche Reich. Im übrigen gibt es Paris, und jeder Amerikaner, der Wert auf etwas internationale Bildung legt, trägt goldgerahmt ein Bildchen von Paris in seinem Herzen. Um so mehr natürlich muß es verwunden, wenn der Führer des heutigen Frankreich so unverhohlen anti-amerikanische Empfindungen äußert. Man bemüht sich, Verstimmungen hintan zu stellen und möglichst nüchtern zu analysieren, was Präsident de Gaulle in jener verhängnisvollen Pressekonferenz äußerte.
Aber gerade die Nüchternheit zwingt zu höchst bitteren Erkenntnissen. Zeichnet sich nicht ein tiefer Zwiespalt für Europa ab, ein Europa, das die Vereinigten Staaten verteidigen wollen wie sich selbst? Man empfindet es als wohltuend, daß Ministerpräsident Fanfani für ein größeres Europa mit Einschluß Englands eintritt. Hinsichtlich Adenauers ist man sich nicht so sicher. Man glaubt jedoch, daß die Männer, die nach Adenauer die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland lenken werden, keinesfalls Geschmack finden können an jener Konzeption eines selbstgenügsamen Europa, der de Gaulle nachhängt. Mit großer Aufmerksamkeit beachtet man Anzeichen wie einen heute hier wiedergegebenen Aufsatz des Chefredakteurs von »L’express«, Servant-Schreiber, der die Perspektive, die sich zwangsläufig aus de Gaulles Abkehr von der Atlantischen Gemeinschaft ergebe, in Richtung Moskau erweitert. Die Washingtoner Kreml-Sachverständigen haben natürlich auch schon einmal über Zukunftsaspekte nachgedacht, die Rußland in einem Verteidigungskampf der weißen Rasse wieder an die Seite des Westens führen könnten. Aber niemand glaubt, daß in absehbarer Zukunft, schon gar nicht zu Lebzeiten de Gaulles, solche Aspekte Realitäten sein könnten. Viel hängt für Washington in dieser merkwürdigen Verschränkung der europäischen Allianz-Linien von Bonn ab. Aber wer oder was ist im gegenwärtigen Zeitpunkt Bonn? Eine Adenauer-Regierung von nur noch wenigen Monaten Frist – das ist für Washington auch nicht der Angelpunkt für seine Versuche, der Sorgen mit Kontinental-Europa Herr zu werden.
20. Januar 1963
Zwei Jahre steht John Fitzgerald Kennedy heute an der Spitze der machtvollsten und reichsten Nation unserer Zeit. Zwei Jahre hat er in dem berühmten ovalen Arbeitsraum des Weißen Hauses in Washington gesessen und gearbeitet, und oft fiel noch spät in der Nacht das Licht seiner Schreibtischlampe durch die großen Fenstertüren in den Rosengarten am Westflügel. Man hat ausgerechnet, daß Präsident Kennedy in einer durchschnittlichen Arbeitswoche mehr als 50 prominente Besucher empfängt, etwa 200 Briefe persönlich unterschreibt und manchmal im Text erheblich ändert; daß er mehr als 30 Telefongespräche pro Tag führt, da er den direkten Kontakt mit vielen seiner Mitarbeiter schätzt; daß er etwa 60 Stunden in der Woche arbeitet, darüber hinaus aber auch in den Wohnräumen des Weißen Hauses selten ohne Lektüre oder politische Besucher anzutreffen ist.
Selbst für einen gesunden Mann seines Alters wäre das ein hartes Pensum. Ein amerikanischer Präsident wird natürlich medizinisch sehr umsichtig betreut. Es heißt, daß Kennedy täglich mindestens 30 Minuten schwimmt – zumeist in einem Schwimmbecken im Kellergeschoß des Weißen Hauses, und zwar kurz vor dem Mittagessen. Dieses konsequente Training mag bewirkt haben, daß seine schwere Rückenverletzung sich nicht verschlimmert hat. Dennoch – als John Kennedy sich vor einigen Wochen bei einem seiner deutschen Besucher, der selbst schwer verwundet wurde, teilnehmend nach dessen Schmerzen erkundigte, fügte er hinzu: »Ich weiß, wovon Sie sprechen; ich selbst fühle mich selten frei von Beschwerden.« Als John und Jacqueline Kennedy jung verheiratet waren, mußte sich der damalige Kongreß-Abgeordnete Kennedy einer komplizierten Wirbelsäulenoperation unterziehen. Er war nahezu total gelähmt, und es ging um Tod oder Leben. Auf Krücken führte er damals seinen Wahlkampf um den Senatorensitz des Staates Massachusetts. Seine Leiden sind zurückzuführen auf einen Unfall bei dem sehr rauhen amerikanischen Football und auf Verletzungen im Kriege. Der heutige Präsident der Vereinigten Staaten diente als Schnellboot-Kommandant im Pazifik, und die Geschichte des Unterganges seines Schiffes und der Rettung eines Teiles der Besatzung durch ihren jungen Kapitän kennt heute jedes amerikanische Schulkind.
Kennedy zeigt im persönlichen Auftreten keine ungewöhnliche oder übertriebene Eitelkeit. Sicherlich es er dennoch nicht frei von dieser Eigenschaft, die so manchen in die vorderste Reihe der Politik führt. Die Kritiker und die Bewunderer dieses Präsidenten stimmen darin überein, daß er ungewöhnlich sorgfältig auf das bedacht ist, was die Amerikaner ›image‹ nennen. Seine persönliche Ausstrahlung ist beträchtlich und wird besonders vom Fernsehschirm günstig reflektiert und potenziert. Dieser Tatsache verdankt Kennedy den letzten Anstoß für seinen Sieg über Nixon. Er kennt seine Wirkung, und er setzt sie bewußt und planmäßig ein. Er hat Berater, die das ganze Wissen der Psychologie und der Werbetechnik der Herausbildung des Kennedy-Look dienstbar machen. Hierin kommt ein Raffinement zum Ausdruck, das ebenso für die Persönlichkeit des Politikers Kennedy charakteristisch ist wie für die Politik des Menschen John Kennedy.
In Amerika wird es nicht übelgenommen, wenn jemand sein Gehirn nutzt und andere Gehirne für sich arbeiten läßt, um Erfolg zu haben. Aber wenn die Sprache darauf kommt, woran es trotz all der vielen Qualitäten bei John Kennedy fehlt, dann wird gern gesagt: an Wärme und Spontaneität. Er erreicht mehr den Kopf seiner Zuhörer, nicht so sehr ihr Herz – heißt es. Mit hoher Intelligenz versteht er es, Zustände zu analysieren. Er und seine Berater gebären Woche für Woche schöne neue Formeln, und die großen Reden Präsident Kennedys gehören zu den geschliffensten, gedankenvollsten rhetorischen Leistungen, die in unserem Jahrhundert aus dem Weißen Haus hervorgegangen sind. Aber seltsamerweise folgt der überzeugenden These nicht immer eine adäquate politische Dynamik.
Kennedy hat das Ohr des Volkes, und er liebt es, zum Volke zu sprechen. Er unterrichtet das Volk – mehr als Eisenhower und Truman das taten. Er ist ein Meister in der Handhabung der modernen publizistischen Massenmedien. Seine zahlreichen Pressekonferenzen wurden zu einer Art großem ›Elternabend der Nation‹. Aber ist er ein wirklich guter Lehrer? Gelingt es ihm, Amerika zu erziehen? Lieben ihn die Amerikaner? Respektiert ihn die Welt? Erwies er sich als ›Vollblut-Politiker‹? Kommt er ›über die Rampe‹? Erzielt er Durchbrüche – zu Hause, beim Kongreß – draußen, gegen Castro und Chruschtschow, bei de Gaulle?
Diese skeptischen Fragen kamen in den letzten zwei Jahren auf und werden in den kommenden zwei nicht verstummen. Sie werden in Amerika fast immer gestellt auf der Basis allgemeiner Wertschätzung und Anerkennung. Kaum ein Präsident – noch dazu einer, der mit so knapper Mehrheit ins Weiße Haus gelangte – hatte jemals eine so gute Presse. John Kennedy war selbst ein Journalist und ein Schriftsteller, bevor er ein Berufspolitiker wurde. Am Abend nach dem Tage seiner Inauguration besuchte er einen Journalisten zu Hause, um mit ihm ganz wie früher über die Zeitläufte und ihre Perspektiven zu plaudern. Obwohl diese weitgehende Intimität und Zwanglosigkeit mit Geistesfreunden außerhalb der rein politischen Sphäre fühlbar nachließ, lädt Präsident Kennedy noch immer unverhältnismäßig oft Verleger und Redakteure zum Essen ein, und gern spricht er unter vier Augen mit den großen Leitartiklern und Kommentatoren, die die öffentliche Meinung in den USA machen.
Kennedy ist populär. In den Vereinigten Staaten ist das außerordentlich wichtig. Schon fürs amerikanische Kind, für den amerikanischen Schüler gibt es nichts Wichtigeres als ›to be popular‹, und ›to be unpopular‹ ist so etwa das Schlimmste, was es im sozialen Zusammenleben der amerikanischen Nation gibt. Insofern ist John Kennedy ein sehr typischer Amerikaner. Walter Lippmann bezeichnete es einmal als den ernsthaftesten psychischen Fehler des hochbegabten Politikers Kennedy, daß er es nicht ertragen könne, auch einmal unpopulär zu sein. Infolgedessen weiche er unpopulären Entscheidungen aus, auch dann, wenn sie offensichtlich notwendig sind. Es falle ihm außerordentlich schwer, sich von ungeeigneten Mitarbeitern zu trennen, weil er den schlechten Eindruck fürchte, den es in Amerika macht, wenn es an Teamarbeit zu mangeln scheint.
Tatsächlich erwies sich John Kennedy einige Male als überraschend empfindlich gegenüber öffentlicher Kritik. Er liest mehr, als all seine 34 Vorgänger im Amt zusammen jemals gelesen haben mögen. Lincoln nicht ausgenommen – so wurde einmal ironisch angemerkt. Das Presseamt des Weißen Hauses infiltriert mit Stolz die Zahl 1200 – soviele Worte nämlich könne der Präsident in einer Minute lesen. Schon zum Frühstück durchfliege er vier, fünf oder sechs der großen amerikanischen Zeitungen; zum Lunch-Break sehe man ihn niemals ohne einige der umfangreichen Zeitschriften des Landes entschwinden. Sogar Bücher – das wird geradezu ehrfürchtig hervorgehoben – gehören zur Routine-Lektüre Präsident Kennedys. Eine Zeitung indessen weigert er sich noch heute in die Hand zu nehmen, anzusehen und aufzuschlagen: die New York Herald Tribune. Ein kritischer Artikel der ›Trib‹ hatte ihn einmal so geärgert, daß er Pressechef Salinger anwies, alle Abonnements des New Yorker Blattes unverzüglich zu annullieren.
Irische Zähigkeit und eine Konsequenz im Denken, die gern Alternativen zur Kenntnis nimmt, um sich bestätigen zu lassen, sind dem Präsidenten offenbar auch in den kleinen menschlich-allzumenschlichen Zügen seines Charakters eigen. Es ist diesem Millionärssohn, diesem strahlenden Glückshelden in der mächtigsten Position, die unsere heutige Welt zu vergeben hat, keineswegs alles in den Schoß gefallen. Da waren die harten Kriegsjahre, und da war ein planmäßiges Ringen um jede Sprosse auf der politischen Leiter nach oben. Abgesehen von kleinen Streichen, die ihm sein beträchtliches Temperament gelegentlich spielt, sind kühle Zielstrebigkeit und eiserne Selbstkontrolle beherrschende Eigenschaften John Kennedys. Natur und Herkommen gewährleisten eine unverkennbare Großzügigkeit und Fairneß. Als Präsident der Vereinigten Staaten hat John Kennedy ein Jahresgehalt von 100 000 Dollar. Er behält keinen Cent davon, sondern läßt den gesamten Betrag der amerikanischen Wohlfahrt zugute kommen. Allerdings soll er über ein persönliches Vermögen von etwa 10 Millionen Dollar verfügen, und sein Vater wird auf 200 bis 400 Millionen Dollar geschätzt.
Wie beliebt ist Präsident Kennedy in seinem eigenen Lande? Die Amerikaner haben für solche Fragen gern die scheinbar so unanfechtbare Prozentzahl der letzten Meinungsumfrage zur Hand. Dr. Gallup sagt, daß die Popularitätskurve Kennedys wesentlich positiver verläuft als die entsprechende Kurve Präsident Trumans, aber auch – und das ist überraschend – positiver als diejenige Dwight D. Eisenhowers. Allerdings sagen zur Zeit nur 64 Prozent der ›repräsentativ‹ Befragten, daß sie meinen, Kennedy »is doing a good job«, während es in der besten Zeit einmal 83 Prozent waren. Aber es kommt bei diesen Umfragen sehr darauf an, welche politischen und psychologischen Bereiche die Fragestellung wirklich deckte. Die große Mehrheit der Amerikaner erkennt an, daß Kennedy wesentlich fleißiger ist als der golfspielende Eisenhower, mehr weiß als Harry Truman und ›seinen job‹ alles in allem gut macht, ›da oben in Washington, im Weißen Haus‹. Aber Eisenhower, die große Vater-Figur, stand doch dem Herzen der Nation näher und wäre ein drittes Mal gewählt worden, wenn er hätte kandidieren dürfen. Es ist vielleicht bezeichnend, daß sich bis heute kein griffiger Spitzname für John F. Kennedy einstellte, während Eisenhower überall ›Ike‹ hieß.
Ist John Kennedy nur der Name eines amerikanischen Präsidenten oder personifiziert er eine politische Idee? Wer seine Reden und Entscheidungen zur Kenntnis genommen hat, braucht nicht im unklaren darüber zu sein, was dieser Mann will und was er nicht will. Er will Amerika vorwärtsbringen; er will die Arbeitslosigkeit reduzieren und die Rassenschranken beseitigen. Er will das Atlantische Bündnis festigen und stärken; er will den Kolonialismus auflösen und Lateinamerika entwickeln. Er will dem Kommunismus widerstehen; er will die blockfreien, jungen Nationen dem Westen verpflichten und die atomare Gefahr unter Kontrolle halten. Das sind Ziele und Notwendigkeiten, die sich für einen amerikanischen Präsidenten mehr oder weniger von selbst verstehen. Kennedy hat im wesentlichen die Außenpolitik Eisenhowers und Trumans fortgesetzt, die Verteidigungsanstrengungen auf der Linie seiner Vorgänger intensiviert, und im großen und ganzen war er darin erfolgreich. Die Vereinigten Staaten sind heute stärker als jemals in ihrer Geschichte, und nirgendwo auf der Welt erzielten die Kommunisten während der zweieinhalb Kennedy-Jahre buchenswerte Einbrüche. Im Gegenteil: in Afrika verloren sie an Einfluß; der russisch-chinesische Konflikt hemmte ihre Vorstöße in Asien; in Lateinamerika konnte der sowjetkommunistische Expansionsdrang auf der Insel Kuba isoliert werden; an der europäischen Front behauptete sich der Status quo – der Vorposten Berlin wurde durch Präsident Kennedys Entschlossenheit gehalten, der sowjetische Druck ließ fühlbar nach.
Weniger konservativ, aber auch weniger erfolgreich, war Kennedys Wirtschafts- und Sozialpolitik. Seine Kritiker von rechts sagen: weil sie zu liberal und sozialistisch ist, die Kritiker von links behaupten das Gegenteil. Wahr ist, daß Kennedys umfangreiches Gesetzgebungswerk in einer unverkennbar liberalen Handschrift abgefaßt ist, der Substanz nach aber durchaus maßvoll und aufgeklärt konservativ genannt werden darf. Auch wo Reformen die einzige heilsame Kur wären, begnügen sich die Gesetzesvorschläge der Kennedy-Regierung mit graduellen Verbesserungsanträgen. Das gilt für die Altersfürsorge ebenso wie für das Arbeitsbeschaffungsprogramm. Der Präsident hat einmal unerwartet hart und entschlossen reagiert – als die Stahlindustrie eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften und der Regierung beiseite schob und die Preise zu erhöhen versuchte. Kennedy setzte sich durch, aber auch hier wollten die Früchte nicht recht heranreifen.
Das gilt auf andere Weise für das aktuellste innenpolitische Problem Kennedys ebenfalls. Seine Haltung im Rassenkonflikt ist unmißverständlich. Er stellt entschlossen die ganze Bundesgewalt in den Dienst der Gesetze. Er spricht und handelt im Sinne der Gleichberechtigung und der völligen Freiheit der farbigen Bürger der Vereinigten Staaten. Niemanden kann es überraschen, daß er dafür von den Gegnern der Integration angegriffen wird – und zwar aus dem Lager der Republikaner sowohl wie aus den Parteiverbänden der Demokraten in den Südstaaten. Aber auch die Neger – die dazu beitrugen, daß er 1960 gewählt wurde – werden immer unzufriedener mit ihm. Sie wünschen, daß er schneller, persönlicher und durchgreifender für die praktische Realisierung ihrer Rechte eintrete.