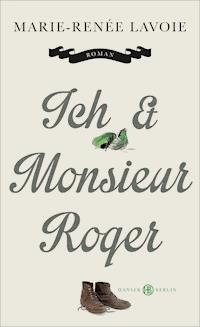9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 48-jährige Diane wird von ihrem Mann verlassen. Sie sei ihm zu langweilig geworden. Und er habe übrigens eine neue, natürlich ein paar Jahre jüngere, Freundin ...
Diane macht sich auf die Suche nach ihrem Selbstvertrauen und erlebt Zusammenbrüche in Umkleidekabinen, kleine Rachen an der Geliebten sowie der ewig vorwurfsvollen (Ex-)Schwiegermutter, Weißweinpartys am frühen Nachmittag und Zerstörungsorgien im ehemals trauten Heim.
Ein schreiend komischer und aufs Beste unterhaltender Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungKapitel 1, in dem ich erkläre, was ich von der Ehe halte.Kapitel 2, in dem ich langsam untergehe, hinabgezogen durch mein eigenes Gewicht.Kapitel 3, in dem Claudine erfolglos versucht, mir zu helfen.Kapitel 4, in dem ich den Wert von Wörtern ermesse.Kapitel 5, in dem ich meinen sechsten Zeh preisgebe.Kapitel 6, in dem Jean-Paul mein Rebound wird.Kapitel 7, in dem ich von banalen Dingen rede.Kapitel 8, in dem ich mich an die Freuden meiner Kindheit erinnere.Kapitel 9, in dem ich wie Rocky schreie: »Charlèèène!«Kapitel 10, in dem ich versuche zu joggen.Kapitel 11, in dem ich die Tierhandlung suche.Kapitel 12, in dem ich etwas erlebe, was zu Twilight Zone passt.Kapitel 13, in dem ich meiner früheren Schwiegermutter allen möglichen Unsinn erzähle.Kapitel 14, in dem ich noch einmal Ja sage.Kapitel 15, in dem ich beginne, Laubgebläse zu hassen.Kapitel 16, in dem ich Kaffee verschütte.Kapitel 17, in dem ich mir den Umschlag ansehe und Apfelkuchen esse.Kapitel 18, in dem ich erkenne, dass manche Dinge perfekt sind, wenn sie nur aus drei Vierteln bestehen.Kapitel 19, in dem ich herausfinde, dass manche Abgründe endlos sind.Kapitel 20, in dem ich mich im Spiegel sehe.Kapitel 21, in dem ich stricke, laufe, tanze.Über dieses Buch
Die 48-jährige Diane wird von ihrem Mann verlassen. Sie sei ihm zu langweilig geworden. Und er habe übrigens eine neue, natürlich ein paar Jahre jüngere, Freundin …
Diane macht sich auf die Suche nach ihrem Selbstvertrauen und erlebt Zusammenbrüche in Umkleidekabinen, kleine Rachen an der Geliebten sowie der ewig vorwurfsvollen (Ex-)Schwiegermutter, Weißweinpartys am frühen Nachmittag und Zerstörungsorgien im ehemals trauten Heim.
Ein schreiend komischer und aufs Beste unterhaltender Roman.
Über die Autorin
Marie-Renée Lavoie, 1974 in Limoilou/Quebéc geboren, unterrichtet Literatur am Collège de Maisonneuve in Montréal. »Tagebuch einer langweiligen Ehefrau« war sowohl in Québec als auch im englischsprachigen Kanada ein großer Erfolg. Die Fortsetzung ist Anfang 2020 erschienen.
M A R I E - R E N É E L A V O I E
Aus dem kanadischen Französischvon Christiane Landgrebe
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Titel der kanadischen Originalausgabe:
»Autopsie d’une femme plate«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2017 by Éditions XYZ inc.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Aylin LaMorey-Salzmann, Berlin
Umschlaggestaltung: U1berlin/Patrizia Di Stefano
Unter Verwendung von Motiven von
© Getty Images: George Peters und R. Tsubin
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-9860-1
www.eichborn.de
www.luebbe.de
Für alle, denen wegen eines »Auf immer und ewig«, das doch vorzeitig endete, das Herz gebrochen wurde.
Wir sollten darüber lachen.
KAPITEL 1
in dem ich erkläre, was ich von der Ehe halte.
Ich fand es schon immer ziemlich anmaßend, alle seine Lieben zu versammeln und ihnen zu sagen: Seht her, wir beide sind im Moment eng miteinander verbunden in der Illusion von Ewigkeit, und bei uns gilt das FÜRIMMER, allen deprimierenden Statistiken zum Trotz. Wir haben euch gebeten, Zeit und Geld aufzuwenden und hierherzukommen, denn wir sind gegen alles gefeit, was bei anderen die Liebe tötet. Wir sind dreiundzwanzig, wir sind uns unserer Sache ganz sicher und möchten das mit euch teilen. Dass die meisten vor uns an so einem Versprechen gescheitert sind, hat uns weder überzeugt noch erschreckt. Unsere Liebe wird halten, sie ist nämlich etwas ganz Besonderes. Unsere Ehe wird überleben.
Doch auf fast allen Hochzeitsfeiern, auf denen es viel zu trinken gibt, stürmen die Leute auf die Tanzfläche und wollen Gloria Gaynor und ihren Song I will survive übertönen und sagen, sie hätten das Ende ihrer Illusionen überlebt. Ich habe genug Frauen gesehen, die mit imaginären Mikrofonen in der Hand sangen: I will survive, hey, hey! Ja, sie haben überlebt, trotz ihrer Scheidung.
Eigentlich gibt es nur ein echtes Problem bei einer Hochzeit: das gegenseitige Treuegelöbnis. Es ist einfach unseriös, sich Liebe für ein ganzes Leben zu versprechen, in guten wie in schlechten Zeiten. Damit künftige Generationen ehrlich sein können, schlage ich vor, das Gelöbnis abzuändern, damit es besser ins 21. Jahrhundert passt und sich nicht anhört wie im Märchen: »Ich verspreche dir feierlich, dich zu lieben und so weiter und so weiter, bis ich es nicht mehr tue. Oder bis ich mich in jemand anders verliebe.« Es ist doch nicht zu übersehen, dass die Dampfwalze des Alltagslebens selbst die größten und stabilsten Leidenschaften plattmacht.
Gewiss, jeder kennt Paare, die seit sechzig Jahren zusammen sind, allen Stürmen standgehalten haben, eine schöne Metapher, die seit Jahrhunderten dazu dient, die Enttäuschung von Eheleuten, die oft Gefangene ihres Versprechens sind, in ein besseres Licht zu rücken. Es gibt auf Erden mehr Kinder mit sechs Fingern oder Zehen als Paare, die wirklich ihr ganzes Leben lang miteinander glücklich sind. Für Wissenschaftler sind solche Auswüchse große Ausnahmen, die Ehe aber ist in unserer Gesellschaft noch immer eine der wichtigsten Institutionen. Eigentlich müsste man eher den sechsten Finger oder Zeh feiern.
Ich wollte einfach nur mit dem Mann leben, den ich liebte, und Kinder mit ihm haben. Ich wünschte mir, dass wir uns gegenseitig beistehen würden, so gut es ging, und zwar so lange wie möglich. Ich hätte meine Kinder nicht weniger geliebt, wenn sie unehelich gewesen wären, und auch nicht meinen Mann, wenn er nur mein Freund gewesen wäre. Vielleicht sogar mehr, denn diese Ehe hat uns eingeengt und ich erkannte nicht, dass unsere Liebe langsam zerbröckelte.
Ich habe geheiratet, weil die Familie meines Mannes Liebe allein zu simpel fand. Ich hatte bis dahin noch nie gehört, dass Einfachheit etwas Schlechtes sein könnte. Aber sie wollten es gern schwierig – bitte schön, jetzt konnten sie es erleben: Scheidungen sind schließlich alles andere als simpel.
Ich habe Jahre gebraucht, um wieder klarzukommen, nachdem er mir gesagt hatte: »Ich gehe, ich liebe eine andere.«
Er hat mit diesen Worten nicht mich getötet, aber die Person, die ich mir vorgestellt hatte, in seinen Augen zu sein. Er hat die Person getötet, die durch die Erfüllung, die ich gefunden hatte und die mein Leben ausmachte, existieren konnte. In unserem Zusammenleben hatte ich mich völlig aufgegeben, es war ja schließlich durch feierliche Versprechen und geweihte Ringe besiegelt.
Als er mir sagte, er könne sich nicht mehr an das Versprechen halten, glitt mir der Boden unter den Füßen weg. Nur wenige Worte, und ich verlor jeden Halt. Ich stürzte in die Hölle hinab und konnte mich nirgendwo festhalten.
Nun mag es den Anschein erwecken, ich sei ihm böse gewesen, dass er mich nicht mehr lieben konnte. Aber Gefühle lassen sich nicht befehlen, das weiß doch jeder. Und das ist auch gut so. In unserer Wut vergessen wir es manchmal, aber irgendwann versteht man es wieder. Ich wusste es immer, auch in der Zeit, als ich völlig am Ende war. Wie hätte ich ihn auch zwingen sollen, mich weiter zu lieben? Sicher wäre es auch für ihn einfacher gewesen, noch in mich verliebt zu sein. Er hätte sich nicht dauernd vor aller Welt rechtfertigen müssen, bevor er wieder seinen Frieden fand. Ich habe ihn in dieser Zeit ehrlich gesagt keinen Moment beneidet.
Böse war ich ihm nur wegen der Spuren, die die Zeit unweigerlich überall an meinem Körper hinterlassen hat. Er kann nichts dafür, aber ich finde es einfach ungerecht, dass die Zeit für Männer, also auch für ihn, nur Vorteile bringt, jedenfalls nach heutigem Geschmack. Schauspieler um die fünfzig sehen blendend aus; doch wenn Monica Bellucci sich aufführt wie ein Bond-Girl, lachen sich alle schlapp. Wegen dieser Ungerechtigkeit habe ich ihn verabscheut, ihn und seine Tussi, dafür, dass er in der Lage war, ganz bei null anzufangen in einem Alter, in dem mein Fortpflanzungssystem sein Ende ankündigte. Ich war so verbittert, dass ich mich selbst zu hassen begann, mit Leib und Seele. Hätte Jacques keine Argumente für die Trennung gehabt, ich hätte sie ihm haufenweise liefern können.
Aber ich habe am Ende doch überlebt wie jene Frauen auf der Tanzfläche, die sangen I will survive.
KAPITEL 2
in dem ich langsam untergehe, hinabgezogen durch mein eigenes Gewicht.
»Ich habe mich in eine andere Frau verliebt.«
Mir stieg alles Blut in den Kopf. Ich fühlte, wie meine Augen in den Augenhöhlen vibrierten, nur wenige Milliliter mehr, und sie würden herausspringen. Ich fand diese Worte so unsinnig, dass ich mich Richtung Fernseher wendete in der Hoffnung, dass die Worte in Wirklichkeit von dort kamen. Aber die beiden Prominenten, die gerade versuchten, ein Hähnchen mit Schinken zu füllen, lachten aus vollem Hals. Über verlorene Liebe sprachen sie nicht.
»Diane … ich wollte es nicht … es liegt nicht an dir, aber …«
Dann überschüttete er mich mit einer unerträglichen Flut von Klischees. Er war nervös, aufgeregt, als wolle er es schnell hinter sich bringen. Ich verstand nicht viel, nur ein paar Worte, die wehtaten, »Langeweile«, »Öde«, »Lust«, und dass er sich schon seit Langem über uns beide Gedanken gemacht habe.
Charlotte war gerade ausgezogen, und ich hatte noch keine Zeit gehabt, mich wieder an ein Leben ohne Kinder zu gewöhnen, mich selbst ohne Kinder zu definieren. Ich hätte mich darum bemühen müssen, ich weiß, aber als ich darauf kam, war es schon zu spät.
»Diane, ich gehe.«
Jacques ist noch am selben Abend gegangen, er wollte mir Zeit lassen, mich zu beruhigen und über alles nachzudenken. Fünfundzwanzig Jahre Ehe mit wenigen Worten wie weggeblasen. Er dachte, es würde mich am Nachdenken hindern, wenn er bliebe. Er wollte mir Raum geben, um mit dieser Nachricht umzugehen, die, das gab er gerne zu, alles andere als angenehm war. Seine faden, farblosen Worte zerbröselten sofort, mir war speiübel.
Seufzend stand er auf, vom Reden erschöpft. Er wollte mir nicht sagen, wohin er ging. Aber es war ja nicht schwer zu erraten. Die andere wartete sicher irgendwo auf ihn, um mit ihm den Beginn eines neuen Lebens zu feiern, die ersten Nägel meiner Kreuzigung einzuschlagen.
»Wie alt?«
»Was?«
»Wie alt ist sie?«
»Diane, es geht hier nicht um Alter.«
»ICHWILLWISSEN, WIEALTSIEIST, VERDAMMTNOCHMAL!«
Er sah mich an wie ein geprügelter Hund, als wollte er sagen: Ja, Diane, ihr Alter, eigentlich ein bisschen peinlich, aber die Sache ist so schrecklich banal.
»Es ist nicht, was du denkst …«
Als der Mann meiner Freundin Claudine sie wegen einer seiner Studentinnen verließ, da war es auch anders, als sie gedacht hatte.
»Sie ist einfach brillant und hat alle Werke von Heidegger gelesen.«
Der arme Philippe konnte also nichts dafür, Heidegger hatte seine ganze philosophische Weisheit in das Gehirn einer seiner Studentinnen ejakuliert, und das hatte sie unwiderstehlich gemacht. Wen interessierte schon Heidegger? Claudine war der Typ so egal, dass sie eine ganze Sammlung seiner Bücher aus dem Regal nahm, um den Kamin damit anzuzünden oder Katzenstreu daraus zu machen. Sie stellte sich das von Heideggers Existenzialismus überflutete Hirn vor – scheußlich. Man tut, was man kann, um sich besser zu fühlen.
Ich blieb allein im dunklen Wohnzimmer sitzen und starrte auf den Fernseher, den Jacques in der Zwischenzeit ausgestellt hatte. Ich sah mein Spiegelbild, reglos und wie zu Eis erstarrt. Ich war so voller Scham und Schmerz, dass ich mich nicht rühren konnte. Wenn ich noch länger dort sitzen bliebe, würde ich mich in nichts auflösen, ich wollte niemandes Glück im Weg stehen. Ich war doch nur eine langweilige Ehefrau.
Die Sonne ging an derselben Stelle auf wie immer. Unglaublich. Offenbar ließen sich die Sterne vom Weltuntergang nicht beeindrucken. Alles schien weiterzugehen wie bisher, obwohl ich am liebsten auf der Stelle gestorben wäre. Vorsichtig stand ich auf, begann meine leblosen Beine wieder zu bewegen. Sie sollten mich ja noch eine Weile tragen. Als Erstes würde ich das Sofa wegwerfen, das ich in meiner Erstarrung vollgepinkelt hatte.
Ich stellte mich komplett angezogen unter die Dusche. Am liebsten hätte ich alles, was mich bedrückte, abgelegt wie Kleider. In das Duschbecken rannen die Farbe meines neuen Kostüms, meine Mascara, meine Spucke und meine Tränen. Der eigentliche Schmutz aber verschwand nicht.
Draußen warf ich alle Kissen auf den frisch gemähten Rasen. Dann ging ich in den Keller und holte einen Vorschlaghammer. Mit der letzten mir verbliebenen Energie zertrümmerte ich das Sofa und schlug dabei versehentlich ein großes Loch in die Wand. Es fühlte sich gut an. Wäre ich nicht so müde gewesen, hätte ich das ganze Haus zu Staub verwandelt.
Zwei Tage später rief mich Jacques an, um zu fragen, ob es mir besser ginge, und mich zu bitten, ob wir nicht aus Respekt vor unseren Lieben noch eine Weile so tun sollten, als sei alles in Ordnung. Wir sollten die Kinder, die Kollegen, die Familien besser langsam auf alles vorbereiten. Wir hätten ja bald silberne Hochzeit und sollten die Feiern nicht einfach absagen – »Ich weiß. Ich hätte eher daran denken sollen« – und diesen Abend gemeinsam verbringen, in angenehmer Atmosphäre, denn das »erwarten alle, und sie haben es verdient«.
Ich kam mir vor wie die Frauen in Indien, die am Abend ihrer Hochzeit vom Feiern ausgeschlossen sind und sich zurückziehen, um den Segen für ein Glück zu erhalten, von dem sie bereits ferngehalten werden. Ich habe nie verstanden, warum ich anderen Menschen etwas schuldig sein sollte.
»Denkst du mal darüber nach und sagst mir dann Bescheid?«
»Hm, hm.«
Ich habe sein »Denk mal darüber nach« nie besonders gemocht.
Doch ich folgte seiner Anweisung und dachte nach.
Ich entschied mich für eine einfache, zeitgemäße Lösung: Ich legte ein Facebook-Profil an (dabei hat mir mein Sohn Antoine am Telefon geholfen). Dann schickte ich stundenlang jede Menge Freundschaftsanfragen los, und zwar überallhin. Ich fing bei meinen Schwiegereltern an. Dann kam meine Schwägerin an die Reihe, entfernte Cousins, unsere Kollegen, Freunde, Nachbarn, Bekannte, Feinde und so weiter. Sobald jemand meine Freundschaft annahm, habe ich mir dessen Freundesliste angeschaut, um sicher zu sein, dass ich auch niemanden vergessen hatte. Von allen Seiten gab es Kommentare über mein spätes, aber längst fälliges, wenn auch plötzliches Auftauchen in den sozialen Netzwerken. Ich antwortete immer mit »Likes«, egal, was die Leute schrieben, zeigten oder kommentierten. Selbst bei denen, die Wert darauf legten zu erzählen, dass sie Tetris gespielt hatten oder welchen Tee sie gerade tranken. Ich beantwortete alles mit einer Begeisterung, die so echt war, wie eine Kunstpflanze lebendig ist.
Am selben Abend schon hatte ich hundertneunundzwanzig neue Freunde und wartete noch auf hundert Antworten. Dann verfasste ich meinen ersten Facebook-Status. Beim ersten Mal muss es unvergesslich sein und voll reinhauen.
DIANEDELAUNAIS. 20:00 Uhr
Facebook, du weißt ja immer alles; kannst du mir sagen, ob ich die Feier zu meiner silbernen Hochzeit absagen soll, weil Jacques (mein Ehemann) mir angekündigt hat, dass er mich wegen einer anderen verlässt? Ziel: 300 Likes bis morgen. Bitte weiterleiten. Und guckt jetzt andere #epicfails von Leuten, die so kläglich scheitern wie ich.
Danach schaltete ich meinen Rechner aus, auch mein Smartphone, das Licht, den Fernseher. Ich verriegelte sämtliche Türen (mit Ketten und Sicherheitsschloss). Dann nahm ich ein paar Schlaftabletten und legte mich in Embryohaltung ins Gästebett. Es ging mir viel zu schlecht, als dass ich mich über irgendetwas hätte freuen können. Ich wollte, dass die nächsten Tage ohne mich vergingen. Ich wollte, dass die Leute sich gegenseitig anriefen, sich Vorwürfe machten, sich trösteten, ihn verurteilten, mich bedauerten, uns verdammten, aufschrien, erschraken, die ganze Sache analysierten und kommentierten, aber ich wollte nichts davon mitbekommen. Ich wollte ihr Unbehagen nicht erleben, mir nicht Dinge wie »Gott, wir hatten ja keine Ahnung« anhören, wollte ihre ausweichenden Blicke nicht sehen, ihre erschrockenen Gesichter oder wie sie vor Überraschung oder Entsetzen (oder in voller Zufriedenheit, man weiß es ja nie) die Hände über dem Kopf zusammenschlugen. Niemand sollte mir anmerken, wie sehr ich mich bemühte zu verbergen, dass ich am liebsten sterben würde. Ich hatte so oft gesehen, wie Leute im Büro oder anderswo wie Zombies umherwankten, die Arme voller Akten, und so taten, als sei alles in Ordnung. Ich nahm mir unbezahlten Urlaub, der mich so viel kostete wie ein Empfang zu einer silbernen Hochzeit, und würde erst wieder arbeiten, wenn ich dazu in der Lage war. So etwas kann man sich mit achtundvierzig Jahren leisten, wenn man genug Überstunden und einiges auf dem Konto hat. Ich hatte meine Nachricht verbreitet, wie man hungrigen Hunden ein saftiges Knochengerüst mit viel Fleisch vorwirft. Ich wollte erst wieder auftauchen, wenn nichts mehr übrig war als ein paar weiße Knochen, die ich auflesen konnte, ohne dass mir dabei übel wurde.
Ich hätte mir gewünscht, dass die Mühe, die ich mir gemacht hatte, um eine solche Bombe zu zünden, meinen Schmerz lindern würde. Aber er wurde dadurch letztlich nur schlimmer. Ich wurde nun mit allem konfrontiert, das mit unserer Beziehung zusammenhing. Ich hatte immer gedacht, dass körperliche Schmerzen die schlimmsten waren; aber ich hätte gern mehrere Geburten ohne Rückenmarksanästhesie gegen dieses Debakel eingetauscht. Und ich weiß, wovon ich spreche.
In den folgenden Wochen wollte ich niemanden außer meine Kinder sehen. Auch sie litten natürlich. Alle anderen hämmerten gegen meine Haustür und schickten Mails und Sprachnachrichten auf allen Kanälen. Ich löschte sie alle, ohne sie zu lesen oder anzuhören. Ich löschte auch mein Facebook-Profil wieder, ohne die vierhundertzweiundsiebzig Kommentare zu lesen, die sich dort angesammelt hatten. Tagelang, nächtelang starrte ich an die Decke und tat nur eins, ich dachte darüber nach, wie es so weit hatte kommen können. Irgendwann schlief ich erschöpft ein, doch dann wachte ich in einem noch schlimmeren Zustand wieder auf. Mir wurde klar, dass ich amputiert worden war. Der Schmerz ließ nicht nach, die Wunden heilten nicht. Die Luft erreichte meine Lunge nicht mehr. Meine Existenz war in tausend Stücke zersprungen, ich steckte tief in der Krise und war völlig wehrlos.
In höchster Not fand ich dann doch die Kraft, mich langsam wieder aufzurappeln. The show must go on, wie es in dem Lied so schön heißt. In der Pubertät hatte ich es oft lauthals gesungen, jetzt erlebte ich es.
Nach und nach schaffte ich es wieder, Leute zu treffen, die mir wichtig waren. Ich musste mir allerdings eine endlose Reihe abgedroschener, mit größter Vorsicht vorgetragener Weisheiten anhören, wie Gebete, die seit Jahrhunderten heruntergeleiert werden. Ich ließ die gut gemeinten Ratschläge über mich ergehen, wie man nach einer Magenverstimmung eine salzige Brühe trinkt. Sie konnten mich nicht heilen, aber ein kleines bisschen vor mir selbst schützen.
Die silberne Hochzeit wurde nicht mit allem Drum und Dran auf einem Schloss gefeiert. Keine schönen Reden über beständige Liebe und Treue, keine neuen guten Wünsche, keine alte Tante mit einer Turmfrisur, keine betrunkenen Onkels, die gern die Hände nach einem ausstreckten. Und auch keine Frauen auf der Tanzfläche, die überlebt hatten.
Mit dem Geld, das ich für Verlobungsring und Ehering bekam, kaufte ich mir ohne die geringste Scham ein Paar superschöne, sündhaft teure italienische Stiefel, damit meine Füße eine Weile alles andere in den Schatten stellten. Die Jugendeinrichtung, der ich den Rest des Geldes gespendet habe, hat sich davon einen Tischfußball und eine Tischtennisplatte gekauft. Der Gedanke, dass Jugendliche mit Bällen auf den Resten meiner Ehe kicken würden, tat mir gut.
KAPITEL 3
in dem Claudine erfolglos versucht, mir zu helfen.
Meine Freundin Claudine hat mir, wie man es bei solchen Gelegenheiten immer tut, geraten, mich an die guten Seiten der Trennung zu halten. Nach dem Motto Kein Unglück so groß, es hat ein Glück im Schoß. Sie war klug genug, ein paar Monate zu warten, bevor sie mir die Rettungsleine zuwarf, sie hatte es nämlich selbst erlebt und wusste: Die Wut in der ersten Zeit ist so groß, dass sie alles wegspült, auch das Denkvermögen.
»Überleg mal, du brauchst seine dreckige Wäsche nicht mehr aufzuheben und seine müffelnden Socken nicht mehr zu waschen.«
»Jacques hat das alles selber gemacht.«
»Jetzt hast du das Bett für dich allein.«
»Das hasse ich. Lieber schlafe ich im Gästebett.«
»Und das Haus! Du kannst das Riesenhaus verkaufen und dir eine schöne Wohnung in der Stadt kaufen, in der Nähe der schönen kleinen Cafés, du musst dich um nichts mehr kümmern.«
»In dem Haus sind meine Kinder aufgewachsen, ihre ganze Kindheit steckt darin, sie haben dort noch ihre Zimmer.«
»Aber sie sind doch keine Kinder mehr.«
»Charlotte wollte im Sommer kommen.«
»Na und? Kauf dir eine Wohnung mit einem Gästezimmer, das reicht doch völlig.«
»Und was ist, wenn mich meine Enkelkinder besuchen kommen?«
»Du hast doch gar keine!«
»Bisher noch nicht, aber Antoine und seine blonde Freundin reden schon davon.«
»Antoine? Der kann sich ja nicht mal um sich selber kümmern.«
»Er ist nur ein bisschen unordentlich.«
»Nimm eine Wohnung mit Schwimmbad, dann besuchen sie dich ganz oft und abends hauen sie wieder ab.«
»Ich bin noch nicht so weit.«
»Dann ist da noch seine Familie. Deine Schwägerin, die verwöhnte Prinzessin mit ihren Gören, die hast du doch immer gehasst?«
»Ach, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe sie zum Teufel geschickt.«
»Tatsächlich?«
»Ja, ein paar Wochen nachdem Jacques weg war.«
Eines Abends, als alle durcheinanderredeten, hatte sich Jacques’ Schwester beschwert, sie hätte kein richtiges Leben mehr, nie könne sie sich ausruhen, habe keine Minute Zeit für sich wie all die anderen. Da hatte Jacques zu ihr gesagt, wir könnten ihr ja helfen und so könnte sie sich ab und zu eine Pause gönnen, wenn wir auf ihre Kinder aufpassten. Ich weiß noch, dass es mir einen Stich versetzte, als ich diesen Vorschlag hörte.
Jacinthe, so heißt sie, war mit Anfang vierzig Mutter geworden – sie fand, es sei Verschwendung, sich vorher seine Jugend zu verderben, indem man sich um Kinder kümmert –, und jetzt hatte sie zwei junge Monster, die alles durften, vor nichts Respekt hatten, nicht vor Dingen, nicht vor Personen. Immer hatten sie alles sofort bekommen und sahen nicht ein, warum sie zu anderen nett und höflich sein sollten. Sie waren wie kleine Götter, für die es keinerlei Vorschriften gab und die machen konnten, was sie wollten, ohne dass es Folgen hatte. Jacinthe war sofort einverstanden. Am folgenden Mittwoch kam sie mit einer großen Tasche, da war alles drin, was die Kleinen an diesem Abend brauchten. Sie ging zum Yoga und dann mit ihren Freundinnen in ein Restaurant, das gerade angesagt war.
Niemand erneuerte das Angebot, trotzdem kam sie jeden Mittwochabend, egal, ob sie zum Yoga ging, zum Crossfit oder was auch immer. Der liebe Jacques hielt es nicht für nötig, ihr zu sagen, es sei nicht gerade höflich, sein Angebot, ihr hin und wieder zu helfen, auszunutzen und zu einer festen Einrichtung zu machen, jeden Mittwochabend. Zwei- oder dreimal waren wir dem entgangen, weil ich Jacques zwang, mich um halb fünf im Restaurant zu treffen. Dass ich niemals, als unsere Kinder klein waren, verlangt habe, irgendwelchen Ausgleichssport zu machen, hatte er wohl völlig vergessen, als er mir voller Überzeugung sagte:
»Sie braucht mal eine Pause, das ist nicht einfach mit zwei kleinen Kindern, außerdem ist Georges fast nie zu Hause.« Wenn der großartige Georges da war, hatte er leider nie Zeit, sich um seine Kinder zu kümmern. Fast zwei Jahre lang habe ich mich an Jacques’ Verpflichtung gehalten. Zum einen, weil ich nicht wusste, wie ich mich dem entziehen könnte, außerdem weil ich diese beiden Kinder ein bisschen erziehen wollte. Da Jacinthe eine der Ersten gewesen war, die meine Facebook-Bombe gelesen hatten, war sie klug genug, nicht gleich am ersten Mittwoch darauf bei mir aufzutauchen. Auch hatte ihre Mutter sie sicher davor gewarnt, im Namen des Halbgottes, der mich geheiratet hatte, ihre Kinder einer Hysterikerin zu überlassen, die Familientreffen boykottierte. Die Großeltern passten nie auf die Kinder auf, sie hatten nicht mehr die Kraft, hinter ihnen herzulaufen und sie daran zu hindern, an den Gardinen hochzuklettern. In den nächsten Wochen erschien Jacinthe bei mir jedoch zur gewohnten Stunde. Wie es mir ging, schien ihr herzlich egal, sie kam kurz vor dem Abendessen, wie immer mit der großen Tasche. Mehrmals läutete sie Sturm und war überglücklich, als ich die Tür öffnete.
»Oh Gott, ich hatte schon Angst, du bist nicht da! Gott sei Dank! Kinder, hört auf, überall herumzulaufen, kommt her, Tante Diane ist da!«
»Ja, aber Tante Diane ist nicht in der Stimmung, auf Kinder aufzupassen. So wie ich gerade drauf bin, massakrier ich sie am Ende noch.«
»Aber es geht dir doch sicher schon besser?«
»Nein, das kann man nicht sagen.«
»Du siehst aber gut aus.«
»Das täuscht.«
»Okay, ich verstehe. Pass auf: Ich gehe in meinen Kurs, dann esse ich mit den Freundinnen, nur eine Vorspeise, dann komme ich gleich. Ich bleibe nicht den ganzen Abend weg.«
»Nein, heute nicht, Jacinthe, tut mir leid. Ich kann es einfach nicht. Du hättest vorher anrufen sollen.«
»Ich hab es x-mal versucht, du bist nicht drangegangen!«
»Ich möchte mit niemandem reden und auch keinen Besuch empfangen.«
»Also das, das ist ja wirklich blöde, ich hatte mich schon so gefreut, mal einen Abend für mich zu haben. Manchmal frage ich mich, warum ich nicht völlig durchdrehe. Ich renne herum von früh bis spät, und Georges ist nie zu Hause …«
»Ja, das verstehe ich, ich habe das ja auch erlebt, ich habe schließlich drei Kinder. Aber ich hatte keine Tante, die jede Woche auf sie aufgepasst hat. Mir hat nie jemand seine Hilfe angeboten …«
»Ich finde es wirklich bescheuert, dass meine Kinder jetzt für eure Trennung bezahlen sollen. Und meine Freundinnen auch, das ist nämlich auch ihr Highlight der Woche.«
»Geh zu deinem Bruder. Er ist noch am Leben.«
Sie schnitt eine Grimasse und sah plötzlich aus wie ihre Mutter.
»Dann verpasse ich den Kurs schon wieder! Hätte ich das nur gewusst, dann hätte ich mich nicht so beeilt und sie nicht so früh abgeholt. Super! Was mache ich denn jetzt zum Abendessen? Los, Kinder, wir gehen, Tante Diane geht’s nicht gut!«
»Ich wünsche dir, dass du jemanden findest, der zuverlässig ist und auf sie aufpassen kann.«
»Jemand, der zuverlässig ist …«
»Ja, genau, ich glaube, ich habe dir oft genug geholfen.«
»Meinst du das ernst? Wirfst du uns jetzt auch noch raus? Ich bin es verdammt leid! Ihr beiden trennt euch, das Leben hört auf, alles ist zu Ende, sollen die anderen doch sehen, wie sie klarkommen!«
»Ich bin es auch leid, wenn ich sehe, wie du hier einfach ankommst, jede Woche, DEINE Kinder ablieferst, auf die DEIN Bruder aufpassen wollte, NICHTICH, und zwei Jahre lang habe ICH praktisch jede Woche auf sie aufgepasst. ZWEIJAHRE!«
»Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das macht dir Spaß, auf sie aufzupassen.«
»Ja, ich fand es schön, aber es wäre noch schöner gewesen, wenn ich sie nur ABUNDZU bei mir gehabt hätte, so wie wir es dir angeboten hatten.«
»Was ist schon ein Abend in der Woche?«
»Ein Abend in der Woche ist mir genauso viel wert wie dir.«
»Deine Kinder sind ja aus dem Haus.«
»So ist es auch bei deinem Bruder, seine Kinder sind auch aus dem Haus. Nur dass ich ganz allein bin und er jetzt Unterstützung hat.«
»Na schön, vergiss es, ich fahre nach Hause, dann gehe ich eben nicht in den Kurs, dabei bin ich völlig am Ende, ist ja nicht weiter schlimm, Madame will ihre Abende für sich haben …«
»So, jetzt reicht’s mir aber! Nicht dir geht es schlecht, sondern mir! Ich gehe niemandem auf die Nerven, ich werde hier mies behandelt, von deinem Bruder, von dir, von so einigen Leuten, verdammt noch mal! Mach es wie andere, besorg dir einen Babysitter. Hast du je auf meine Kinder aufgepasst, als du alle Abende frei hattest? Nein, niemals, kein einziges Mal. Was hast du an deinen Abenden gemacht, du egoistische Schlampe?«
»Ich hätte vor den Kindern nicht so fluchen dürfen.«
»Gott, wie gern wäre ich dabei gewesen …«
»Warte. Während sie die Tür zuschlug, hörte ich sie murmeln: ›Mein armer Bruder, ich kann ihn wirklich verstehen …‹, irgendwas in der Art. Da kam es mir fast hoch.«
»Wirklich eine verfluchte Hexe!«
»Dann habe ich die Tür aufgemacht und gerufen: ›He, und du bist zu dick und zu alt, um Leggins zu tragen! Die sind viel zu eng für dich!‹«
»Trug sie wirklich Leggins?«
»Ja, mit Mustern drauf.«
»Hast du dich danach besser gefühlt?«
»Leider nicht. Ich habe mich hinter der Tür zu Boden geworfen und den ganzen Abend laut geheult.«
»Das sind die Nerven.«
»Die beiden Kids werden mir fehlen.«
»Okay, das ist wirklich nicht gut, wir müssen etwas anderes für dich finden.«
Claudines Bemühungen führten zu nichts. Dass Jacques nicht mehr da war, merkte ich auf Schritt und Tritt. Er hatte sich um die Mülleimer gekümmert, um Recycling und Kompost, er kochte oft – sogar besser als ich –, er bezahlte die Rechnungen, vergaß nie wichtige Verabredungen, kam nie zu spät, pinkelte im Sitzen, mochte gern Wein, gutes Essen, meine Freundinnen und kaufte samstagmorgens immer Muffins mit Körnern und Nüssen. Von wenigen Härchen hier und da abgesehen, hatte ich keinen Grund, mich im Haushalt über seine Abwesenheit zu freuen.
Vermutlich war die andere jetzt gerade dabei, zu entdecken, dass ihr Liebhaber ein auf vielen Gebieten sehr brauchbarer Lebensgefährte war. Sie würde ihn wohl so schnell nicht mehr gehen lassen. Das ist das Problem: Wenn man sich seinen Ehemann zu sorgfältig aussucht, fällt es einem später schwer, ihn zu teilen.
»Du hattest doch bestimmt genug von den immer gleichen alten Geschichten, die er erzählte, und das zwanzig Jahre lang.«
»Nein, er konnte wunderschön erzählen.«
»Aber er war nie gut angezogen.«
»Das stimmt nicht.«
»Schnarchte er?«
»Nein.«
»Roch er manchmal streng?«
»Nein.«
»Auch nicht nach dem Sport?«
»Nicht mal dann.«
»War er unordentlich?«
»Weniger als ich.«
»Hörte er dir nie zu und tat nur so, als interessierte ihn, was du redest?«
»Nein.«
»Samstags wusch er sicherlich sein Auto vor der Garage.«
»Er hat es nie selbst gewaschen.«
»Er trug in Sandalen Strümpfe.«
»Niemals.«
»Und war er immer geduldig?«
»Als hätte er alle Zeit der Welt.«