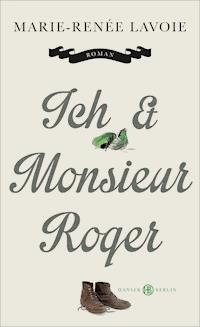13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Jahre ist es her, dass Diane von Jacques für eine Jüngere verlassen wurde. Inzwischen ist sie fast 50, geschieden und lebt in einem rein weiblichen Dreigenerationenhaus, zusammen mit ihrer besten Freundin Claudine, deren Tochter Adèle und Mutter Rosanne.
Zum Glück ist Claudine ebenfalls frisch geschieden, sodass sich die beiden Freundinnen gegenseitig ihr Leid klagen, aber auch die neuen Freiheiten, die so eine Scheidung in der zweiten Lebenshälfte mit sich bringt, gemeinsam genießen können. Braucht frau da überhaupt noch einen Mann?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Über dieses Buch
Zwei Jahre ist es her, dass Diane von Jacques für eine Jüngere verlassen wurde. Inzwischen ist sie fast 50, geschieden und lebt in einem rein weiblichen Dreigenerationenhaus, zusammen mit ihrer besten Freundin Claudine, deren Tochter Adèle und Mutter Rosanne.
Zum Glück ist Claudine ebenfalls frisch geschieden, sodass sich die beiden Freundinnen gegenseitig ihr Leid klagen, aber auch die neuen Freiheiten, die so eine Scheidung in der zweiten Lebenshälfte mit sich bringt, gemeinsam genießen können. Braucht frau da überhaupt noch einen Mann?
Über die Autorin
Marie-Renée Lavoie, 1974 in Limoilou/Québec geboren, unterrichtet Literatur am Collège de Maisonneuve in Montréal. Tagebuch einer langweiligen Ehefrau war sowohl in Québec als auch im englischsprachigen Kanada ein großer Erfolg. Die Fortsetzung erschien Anfang 2020.
Aus dem kanadischen Französischvon Anja Mehrmann
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Titel der französischen Originalausgabe:
»Diane demande un recomptage«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2020, Éditions XYZ inc.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Umschlaggestaltung: U1berlin/Patrizia Di Stefano
Einband-/Umschlagmotiv: © GeorgePeters/getty-images
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0951-4
eichborn.de
luebbe.de
lesejury.de
Kapitel 1
in dem ich ein bisschen Mathe mache
Das Leben ist viel zu kompliziert, als dass man das Alter einer Person tatsächlich aus der Anzahl der Jahre ableiten könnte, die sie bereits gelebt hat. Es kommt mir wie eine grobe Vereinfachung vor, stumpf die vergehenden Tage zusammenzuzählen. Ein zehnjähriges Kind, das in einem Kriegsgebiet festsitzt, ist ein Greis; ein älterer Mensch, der sein Leben lang nichts anderes getan hat, als Nabelschau zu betreiben, ist dagegen nur ein Jugendlicher in einem verbrauchten Körper. Viele Erwachsene, die seit Jahrzehnten auf dieser Welt sind, verweilen bei den süßen Freuden der Jugend, ohne dass jemand auf die Stoppuhr drückt. Das menschliche Wesen entwickelt sich in Dimensionen, die sich den Gesetzen der echten Zeit entziehen, da kann die Mathematik nichts ausrichten. Sogar Einstein würde den Überblick verlieren.
Ich persönlich kenne Leute in den Fünfzigern, deren Reifegrad den von Zwanzigjährigen nicht übersteigt (hier bitte den gewünschten Namen eintragen). Es kommt vor, dass Menschen, die die Weisheit förmlich mit Löffeln gefressen haben und gegen die Erschütterungen der Jugend immun sein müssten, auf unerwartete Weise riesige Rückschritte machen. Diese Art von Regression ist so alltäglich wie ein Schnupfen. Trotzdem haben Psychiater und Psychologen alle möglichen Theorien mit komplizierten Namen aufgestellt, um dieses Phänomen zu erklären, was ihm meiner Meinung nach eine übertriebene Bedeutung verleiht. Das sind nur Hirnfürze, giftige Ausdünstungen, die jeden einhüllen, der sich in ihrer Nähe befindet.
Dennoch zählt die Zeit genauso wie für alle anderen auch für diese Leute unbeirrbar ihren Rosenkranz ab. Das ist verständlich. Um das reibungslose Funktionieren der Gesellschaft sicherzustellen, werden Menschen wie Autos ihrem Alter entsprechend eingeordnet. Man muss sie einstufen, Statistiken über sie erstellen und die zu zahlende Versicherungsprämie festlegen. Aber ich habe alles genau durchgerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das Gespenst der fünfzig, das seit meinem letzten Geburtstag über mir schwebt, grausamerweise alle gleich behandelt.
Kapitel 2
in dem ich meine Füße pflege und Cassoulet esse
Mein Hausarzt ist tot. Diese Leute sterben wie alle anderen auch, und Schuster tragen immer die hässlichsten Schuhe. Der Sensenmann lässt sich nicht überlisten wie das Finanzamt, es ist unmöglich, ihn auszutricksen, jeder muss irgendwann dran glauben und seine Schulden vollständig bezahlen. Schade. Er war eine gute Seele und hätte einen Aufschub verdient. Das sage ich aus völlig egoistischen Gründen.
Während ich darauf warte, dass ich endlich einen Termin bei einem neuen Arzt bekomme, vertraue ich mich dem Wohlwollen einer Klinik ohne Terminvergabe an, die POHs – Personen ohne Hausarzt – und ähnliche Kandidaten aufnimmt, die die Gewinnspannen eines Systems schmälern, das völlig aus der Bahn geworfen ist, weil wir inzwischen alle immer älter werden. Aber ich konnte nicht länger tatenlos zusehen, wie meine Füße austrockneten. Meine Fersen bekamen Risse und fingen an zu bluten. Die Salben und Cremes, die ich mir auf Anraten aller Leute um mich herum kaufte, erwiesen sich als wirkungslos. Die Trockenheit wurde immer schlimmer und breitete sich aus, bis sie auch den Rest meines Körpers zu erobern drohte, der seit Jacques Weggang vollkommen brachlag.
In dem Wartezimmer voller Menschen, die kränker aussahen als ich, kamen mir Zweifel an der Notwendigkeit ärztlichen Rats. Dasselbe Zögern hatte ich früher empfunden, wenn meine Kinder sich verletzt hatten. Zwischen dem Moment, in dem ich voller Panik im Krankenhaus ankam, und der Sekunde, in der unser Name aus der Sprechanlage erklang, hatte sich meine Überzeugung, eine besorgte Mutter zu sein, die mit unterdrückten Schreien sofortige Behandlung verlangte, in die Gewissheit verwandelt, dass ich unnötigerweise das System belastete und einem echten Kranken seinen Platz stahl. Den Kindern geht es besser, sobald man im Wartezimmer ankommt, das ist ein Naturgesetz. Als mir an jenem Tag klar wurde, dass meine Nummer – A 74 – mehrere Stunden Wartezeit bedeutete, war ich zunächst empört – immerhin wandert die Hälfte meiner Steuern ins Gesundheitssystem! –, aber gerade noch rechtzeitig, ehe ich mich in ein fieses Luder verwandelte, fiel mir ein, dass ich seit meiner Entlassung mehrere Monate zuvor gar keine Steuern mehr gezahlt hatte. Also habe ich mich einfach brav hingesetzt. War ja nicht so, dass ich irgendwo erwartet wurde.
Ein junger Mann mir gegenüber schlief wie ein Stein, mit verschränkten Armen und hängender Unterlippe. Der Speichelfluss würde nicht lange auf sich warten lassen. Dass Männer in aller Öffentlichkeit schlafen können, hat mich immer schon fasziniert. Sie bringen es fertig, sich mitten in einer Menschenmenge, in einer Besprechung, bei einer Taufe, während eines Theaterstücks oder einer Senatsversammlung einfach gehenzulassen. Beim letzten Galaempfang der Handelskammer, an dem ich teilgenommen habe, schlief ein stellvertretender Minister auf der Bühne. Kein Mensch nimmt daran Anstoß, die Kerle werden eher mitleidig beäugt (»Lassen Sie ihn doch, er ist so müde«). Frauen schlafen nicht in der Öffentlichkeit oder nur sehr selten, weil sie vollauf damit beschäftigt sind, den Schein zu wahren, dieses verdammte Gezücht, das ihnen schon als Kindern an den Fersen klebt und ihnen ermöglicht, sich für den Rest ihres Lebens selbst zu vergiften. Wenn sie aus Versehen doch einmal einschlafen, werden sie rasch wieder geweckt (»Wir können nicht zulassen, dass sie dermaßen bescheuert aussieht!«), und sie versäumen es nie, sich eilig zu rechtfertigen (»Ich habe nur für einen Moment die Augen zugemacht«). Es ist eine uralte Geschichte: Frauen, die trinken, rauchen und pennen, sind vulgär und schwach; Männer, die sich demselben Hochgenuss hingeben, sind Männer, echte Männer. Ich glaube, von Gleichheit zwischen den Geschlechtern kann erst dann die Rede sein, wenn alle eine Frau total süß finden, die bei einer Familienfeier eine kleine Siesta hält. Meine Tochter Charlotte glaubt, dass wir keinen Schritt vorankommen, solange Frauen »Meine Wohnung ist nicht geputzt« sagen statt: »Die Wohnung ist nicht geputzt.«
Als ich an die Reihe kam, war mein Handyakku seit anderthalb Stunden leer, und ich war gerade fertig damit, die zerfledderten Klatschblätter unter die Lupe zu nehmen, die überall herumlagen. Im Grunde hatte ich nichts Neues erfahren, außer dass Promis öfter heiraten und sich öfter scheiden lassen als namenlose Menschen und dass die Kardashians viele Babys bekommen. Ach ja, und dass Demi Moore faltige Knie hat. Ich schätze, ihr Chirurg hat diesen kleinen Schönheitsfehler, der sie in die Kategorie der Hässlichen verfrachtet hätte, inzwischen behoben.
Eine junge Krankenschwester betrat das kleine Untersuchungszimmer, in das man mich geführt hatte, um Blutdruck und Puls zu messen und mich zu wiegen.
»Muss das mit der Waage unbedingt sein?«
»Haben Sie sich in letzter Zeit mal gewogen?«
»Äh … nein.«
Wie alle Frauen, die am liebsten komplett auf ihr Gewicht pfeifen würden, wusste auch ich bis auf hundert Gramm genau, wie viel ich wog, aber ich hatte absolut keine Lust, es laut auszusprechen, die Worte zwischen den beigen Wänden dieses Besenschranks widerhallen zu lassen, den ich nur betreten hatte – vielleicht hätte ich das gleich zu Beginn klarstellen sollen –, um mir eine Wundercreme für die Füße abzuholen. Aber ich bin eine gute Verliererin, darum habe ich mich so weit wie möglich ausgezogen und bin mit geschlossenen Augen auf diese abscheuliche Waage gestiegen. Verweigerung ist ein Bollwerk wie jedes andere auch. Ich war vermutlich höchstens zwölf Kilo von der Glückseligkeit entfernt, warum mir also den Tag versauen?
»Haben Sie Fieber?«
»Nein.«
»Warum sind Sie hier?«
»Wegen meiner Fersen.«
»Wegen Ihrer Fersen?«
»Ja.«
»Und was ist das Problem?«
»Sie sind so trocken, dass die Haut reißt, und dann fängt es ständig an zu bluten. Es geht weniger darum, dass es wehtut, mich stört eher, dass ich beim Spazierengehen wie eine Leprakranke aussehe. Ich habe schon alle möglichen Salben ausprobiert.«
Sie machte sich Notizen mit Codes und Abkürzungen, als gäbe es für das Teilgebiet der blutenden Fersen einen eigenen medizinischen Fachjargon. Ich hätte mir sagen müssen, dass ich in guten Händen war, stattdessen kam ich mir ziemlich unspektakulär vor. Ein Flechtwerk aus zarten Blumen umgab das Handgelenk der Frau und verschwand unter dem Ärmel ihres Schwesternkittels. Womöglich befand sich auf ihrem Rücken eine Fülle von vorwitzigen Stängeln, deren Blütenköpfe bis in die feuchten Falten ihres Körpers reichten.
»Noch andere Probleme?«
»Oh ja, jede Menge, aber nichts Medizinisches.«
Sie lächelte höflich wie eine Kellnerin, die gefragt wird, was sie gegessen hat. »Damit ich auch mal so gut aussehe wie Sie.« Witzig, die Olle, echt witzig.
Ein paar Minuten später kam der Arzt herein, mit gelangweilter Miene, als wüsste er bereits, dass ich wegen einer lächerlichen Bagatelle gekommen war. Seine Schläfen begannen zu ergrauen, er hatte die Krähenfüße des reiferen Alters und eine von tiefen Falten zerfurchte Stirn, wie Menschen sie haben, die ein bisschen zu schlank sind. Drei Viertel der Jahre zwischen fünfzig und sechzig hat er schon hinter sich gebracht. Ich habe ihn mir in einem Ohrensessel mit geschnitzten Füßen auf einem Bärenfell vorgestellt, ein Glas Bourbon in der Hand.
»Madame … Delaunais.«
»Ja.«
»Sie sind also wegen Ihrer … äh … Fersen hier?«
»Ja, wegen denen an meinen Füßen.«
»Das trifft sich gut, andere kenne ich nämlich nicht.«
»Äh …«
»Nehmen Sie bitte dort drüben Platz, junge Frau.«
»Es ist bestimmt nichts Schlimmes, ich möchte eigentlich nur ein Rezept für eine Salbe, meine Fersen sind zu trocken, ich habe ständig Risse, dauernd blutet es, und die Cremes aus der Apotheke bringen überhaupt nichts …«
Ich stieg auf den kleinen Tritthocker und setzte meinen jungmädchenhaften Hintern auf das weiße Papier, das hoffentlich sauber war. Bei der Vorstellung, mich in die Sekrete anderer Kranker zu setzen, drehte sich mir der Magen um – ich verdrängte den Gedanken sofort wieder. Da ich die Skinny Jeans trug, die ich mir im Jahr zuvor mit Charlotte gekauft hatte, bereitete es mir Mühe, die Beine übereinanderzuschlagen und die Hinterseite meines rechten Fußes vorzuzeigen, den es am schlimmsten erwischt hatte.
»Zeigen Sie mal her.«
»Ausgerechnet jetzt blutet es nicht, aber ich habe heute auch kaum etwas getan …«
»In Ordnung, Sie können sich wieder anziehen.«
»Oh! Schon? Haben Sie denn …?«
»Mhm.«
Er schrieb bereits etwas in meine Akte. Irgendein Kauderwelsch in unleserlicher Schreibschrift. Hätte ich gewusst, dass die Sache im Nu geklärt werden konnte, hätte ich einfach ein Foto geschickt.
»Sie sehen aus, als wäre das nichts Neues für Sie … Gibt es einen Namen dafür?«
»Die Hausfrauen-Krankheit.«
Das sagte er, wie man ein Haar ausspuckt, das einem auf der Zunge klebt, wobei er leicht mit den Schultern zuckte, als wolle er sagen: »Nennen wir das Kind doch beim Namen.«
»Frauen, die nicht arbeiten, tragen meistens keine Strümpfe, sie laufen in Flipflops oder Sandalen herum, die Haut bekommt nicht genug Feuchtigkeit, wird rissig …«
Das verächtliche Schnauben, das den Hintergrund seiner Worte bildete, ließ in meinem Geist abscheuliche, falsche Synonyme für »Hausfrau« aufsteigen – Durchschnittsfrau, unbezahltes Kindermädchen, Bürgerin zweiter Klasse, schlecht gekleidete junge Frau –, aber sie wurden glücklicherweise vom rettenden Bild des Vorschlaghammers überdeckt, den ich im Einbauschrank im Flur für Notfälle dieser Art aufbewahrte. Ihn in Reichweite zu wissen, übte eine beruhigende Wirkung auf mich aus, es gandhifizierte mich geradezu.
»Ich verschreibe Ihnen eine Salbe. Die verwenden Sie morgens und abends, und zwei, drei Mal pro Woche tragen Sie Strümpfe. Dann sollte bald alles wieder in Ordnung sein.«
Ich erlaubte mir nur eine kleine Rache von kindischer Unschuld, die mir aber wahnsinnig guttat. Um zu begreifen, dass man unverzeihlich engstirnig sein musste, um eine »Hausfrau« mit einer »Frau, die nicht arbeitet« gleichzusetzen, hätte er zwar einen Grundkurs Ethik verdient, aber ich begnügte mich damit, ihm ein Kompliment zu machen, als ich bereits an der Tür stand.
»Es ist nobel von Ihnen, dass Sie noch arbeiten, obwohl Sie schon im Rentenalter sind. Wirklich gute Ärzte sind einfach Mangelware.«
Als Antwort schenkte er mir ein Lächeln, das seltsamerweise dem ähnelte, mit dem Claudine ihre Tochter Adèle bedenkt, wenn die ihr dermaßen auf die Nerven geht, dass es ihr vor Wut die Sprache verschlägt. Im Teenagerjargon mit lauter Ausdrücken für körperliche Vorgänge, die typisch für das Kleinkindalter sind, aus dem sich manche nur mit Mühe lösen, nennt man das »ein Lächeln, von dem ich kotzen könnte«. Ich verabschiedete mich von ihm, indem ich das Rezept schwenkte wie eine weiße Fahne. Immer schön friedlich sein. So habe ich es auch meinen Kindern beigebracht.
Im Wartesaal schlief der junge Mann noch immer, die Nummer D 49 klemmte zwischen Daumen und Zeigefinger. Auf dem Bildschirm blinkte die D 53. So ein schlafender Mann ist wirklich rührend.
*
Ich traf mich mit Claudine im Restaurant À la Casserole!, einem netten, kleinen französischen Bistro und nur einen Katzensprung von dem Haus entfernt, das wir ein paar Monate nach meiner Trennung gemeinsam gekauft haben. Sie wohnt im Erdgeschoss mit Adèle, ihrer Jüngsten – Laurie ist mit ihrem Freund zusammengezogen –, und ich belege den ersten Stock mit dem Kistenkater alias Steve, dem dreibeinigen Tier, das sich vor der Treppe nicht fürchtet. Das Cassoulet, das sie in diesem Lokal servieren, besitzt heilende Kräfte gegen die meisten Schäden, die das Unglück in unserem Leben anrichtet. Wir haben in den vergangenen Monaten oft davon Gebrauch gemacht, um unsere malträtierten Herzen und Seelen zu kitten, obwohl sich unser Taillenumfang dadurch ordentlich vergrößert hat – irgendwann werden wir das beim Spinning oder in einem Bootcamp wieder verbrennen.
»Also ehrlich, es gibt bestimmt einen Namen für diese Krankheit! Du hättest den Kerl zum Teufel jagen sollen.«
»Mir ist was Besseres eingefallen …«
»Übrigens, bevor ich es vergesse: von fünf bis sieben am Donnerstagabend im Igloo.«
»Ach, mal sehen …«
»Na los, Ji-Pi kommt auch.«
»Und was soll ich mit ihm anfangen? Er ist verheiratet!«
»Es macht einfach Spaß, ihn anzusehen.«
»Das finde ich anstrengender, als etwas mit ihm anzufangen.«
»Jetzt komm schon! Der Neue taucht bestimmt auch dort auf.«
»Fabio?«
Wir hatten ihn umbenannt, um ihm einen Touch Sexyness zu verleihen; Claudine wollte sich nicht damit begnügen, mit einem Fabien zu knutschen. Der Kellner kam mit einem dicken Holzbrett an, auf dem unsere heißen Suppenschalen aus Steinzeug standen.
»Achtung, Ladys!«
Das schutzlos den Blicken ausgesetzte gepökelte Schweinefleisch, der Räucherspeck, die Würstchen und das Entenconfit waren im Holzofen schön dunkel geworden, wie es sich gehört. Ein zarter, durchsichtiger Fettfilm überzog den Bohneneintopf, in den ich soeben meine Gabel bohren wollte, zwischen zwei Karottenstückchen und frevelhaftem Lauch – ein französischer Tourist hatte sich bei dem Anblick bereits bekreuzigt –, um die fleischigen Spiralen des Aromas zu inhalieren, als könnte ich durch die Nase essen. Claudines Töchter, strenge Vegetarierinnen, weigerten sich rundheraus, dieses Lokal zu betreten, so überzeugt waren sie davon, dass der schlichte Akt des Atmens sie zum Verrat an ihren Überzeugungen verleiten würde. Meine Speicheldrüsen arbeiteten auf Hochtouren, um diese unanständige, aber ach so liebliche Menge an Kalorien in verdauliche Moleküle zu zersetzen. Einziger Wermutstropfen: Das Paris-Brest zum Dessert würde ich nicht mehr schaffen.
»Soll ich Ihnen ein Gläschen Cahors bringen?«
»Bleibt uns denn was anderes übrig?«
Paradoxerweise erschien uns die Sache bei einem Verdauungsschlückchen – wie unser Gastgeber den Wein nannte, um dessen Nutzen zu betonen – nicht mehr so dekadent, wir kamen uns beinahe vernünftig vor. Im Grunde begleitete der Wein das Gericht weniger, als uns davon zu kurieren. Und wir waren gute Patientinnen.
»Was ist los mit dir?«
»Scheißtag.«
»Oh.«
»Ich komme gerade von Adèles Schule.«
»Auweia …«
»Die Frucht meiner Lenden ist für drei Tage vom Unterricht suspendiert worden.«
»Jetzt schon? Das Schuljahr hat doch gerade erst angefangen?«
»Madame trägt verbotene zerrissene Jeans, bauchfreie Shirts, verbotene Räderschuhe, und sie redet mit den Lehrern, wie sie mit mir redet, nur damit du Bescheid weißt …«
»Räderschuhe?«
»Von ihrem Vater, er hat sie ihr aus den Staaten mitgebracht. Wenn du aufs Steißbein knallen oder dir den Schädel aufschlagen willst, sind die Dinger perfekt. Darum haben sie nach neun Verwarnungen, zweimaligem Nachsitzen und ein paar schlecht artikulierten, aber klar verständlichen ›Fuck offs‹ beschlossen, sie zu suspendieren.«
»Die sind aber geduldig.«
»Sehr.«
»Was willst du jetzt machen?«
»Ich überlege noch.«
»Was ist mit ihrem Handy?«
»Wurde schon am Samstag von ihrem Vater konfisziert.«
»Warum?«
»Um sich ihre gesammelten Werke anzusehen, hat er gesagt.«
»Verdammt, was ist nur los mit ihr?«
»Ich habe schon überlegt, ob ich sie aufs Rad flechten soll, aber ich habe keins, das groß genug dafür wäre … Ich könnte sie natürlich auch vierteilen, was natürlich sehr schmerzhaft wäre, aber dafür bräuchten wir Pferde, und ich habe keine Lust, nur deswegen aufs Land zu fahren.«
»Auf den Scheiterhaufen?«
»Und wo?«
»Bei uns in der Straße.«
»Die Feuerwache ist gleich nebenan, die Feuerwehrleute würden eingreifen, ehe das Feuer richtig lodert, diese Hyperaktiven mit der Stoppuhr in der Hand, diese Bande munterer Kerlchen.«
»Die chinesische Wasserfolter?«
»Keine Ahnung, wie so was geht.«
»Ich auch nicht.«
»Ich dachte an Eisbäder wie damals in den Irrenhäusern.«
»Das muss richtig ätzend sein …«
»Aber sie ist zu schwer, ich schaffe es nicht, sie da reinzuhieven. Sie würde sich wehren, ich müsste Fußtritte einstecken, das kann nicht gut enden.«
»Dann musst du richtig schwere Geschütze auffahren.«
»Wie meinst du das?«
»Deine Mutter hat ihre geliebten Enkeltöchter schon ziemlich lange nicht mehr besucht.«
»Oh mein Gott …«
Kapitel 3
in dem ich versuche, mich wieder in die Nahrungskette einzufügen
»Die lassen euch da bestimmt Rollenspiele machen. Du musst üben.«
»Ich glaube, das ist nicht nötig, mit Kindern habe ich Erfahrung, beinahe hätte ich sogar ein Diplom gemacht …«
Es war an der Zeit, mich in das Chaos um mich herum zu stürzen und mir wieder einen Job zu suchen – der bissige Kommentar des Arztes hatte seine Wirkung getan –, aber auf keinen Fall würde ich mich erneut von neun bis fünf in einem klimatisierten Büro voller Josy-Josées aufhalten (Gattungsname für lästernde Bürofrettchen, die ständig Chaos anrichten, sodass im Grunde jeder davon träumt, seinen Kaffee über ihnen auszugießen), und ich würde mich auch nicht abrackern, um irgendwem irgendetwas zu verkaufen. Ich wollte nicht mehr an einen Computer gekettet sein, noch sollte meine Zeit oder meine Energie dazu dienen, das Finanzgebäude einer Handvoll Aktionäre zu errichten, die ohnehin schon so überfüttert waren wie fette Gänse. Ich wollte eine nützliche Arbeit leisten, mich mit Leib und Seele bedürftigen Menschen widmen, verletzlichen Wesen, für die ich, verzeiht mir das Klischee, tatsächlich einen Unterschied machen würde. Vor dem geistigen Auge meiner Tochter Charlotte, der ich meine neuen Lebenspläne verraten hatte und die meinen mageren Lebenslauf auswendig kannte, tauchte, groß wie eine Kathedrale, ein einziges Wort auf: Schule.
Denn wer »Schule« sagt, beschreibt ein breit gefächertes Engagement, völlige Selbstaufopferung (erhebliche Einsparungen für den Staat) und eine Quelle großer persönlicher Befriedigung (ein angenehmes Gefühl, das die staatlichen Einsparungen adelt).
Eine Schule ist ein bodenloser Brunnen von Bedürfnissen, die erfüllt werden müssen, von kleinen und großen Schmerzen, gegen die etwas getan werden, von Begierden, die eingedämmt, und von Entzücken, das hervorgerufen werden muss. Der Einsatz ist direkt, menschlich und kompromisslos. Wer an einer Schule arbeitet, nötigt anderen Bewunderung ab, die Leute sparen nicht mit guten Worten – zusammengesetzt aus Anerkennung und einer Art sich windendem Mitleid –, wenn sie auf jemanden treffen, der dort tätig ist.
»Aber Mama, du kannst mit den Kindern in der Schule nicht so umgehen wie mit deinen eigenen, das ist nicht mehr wie anno tuck, heute sind ’ne Menge Sachen verboten.«
»Zum Beispiel?«
»Jemandem auf die Finger schlagen.«
»Manchmal bleibt einem halt nichts anderes übrig.«
»Eben nicht, es ist genau, wie ich es sage: Das darf man nicht! Du bringst dich in Schwierigkeiten, wenn du so was machst, und dann sitzen dir die Schulleitung, die Eltern und die sozialen Netzwerke im Nacken.«
»Na schön. Dann fang an, Schatz.«
»Madame Delaunais …«
»Ja, die bin ich.«
»Übertreib es nicht, deute einfach ein Nicken an und mach ›hmhm‹.«
»Warum?«
»Weil ›Ja, die bin ich‹ altmodisch klingt. Im echten Leben würdest du so was nicht sagen. Also, sei natürlich. Okay: Warum haben Sie sich entschieden, in der Kinderbetreuung unserer Schule zu arbeiten?«
»Wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze, stumpfe ich allmählich ab und werde eine dicke geschiedene Spießerin …«
»Mama …«
»Weil ich gleich nebenan wohne.«
»…«
»Weil ich Kinder liebe und der Gemeinschaft etwas zurückgeben will, indem ich mich für sie aufopfere. Außerdem ist es praktisch, ich wohne gleich nebenan.«
»Nun, vielleicht erst mal ein kleines Rollenspiel, Madame Delaunais …«
»Hmhm.«
»Zwei Kinder streiten sich auf dem Schulhof, und es kommt zu Handgreiflichkeiten. Wie gehen Sie damit um?«
»Blutet eins der Kinder?«
»Das spielt keine Rolle.«
»Beim Hockey ist das wichtig, da geht es um zwei oder vier Minuten.«
»Mama …«
»Ich albere doch nur ein bisschen rum, Schätzchen.«
»Sehr witzig.«
»Ich schicke sie in zwei verschiedene Ecken und sag ihnen, dass sie nachdenken sollen.«
»Worüber denn?«
»Na ja, worüber sie wollen, Hauptsache, sie tun hinterher so, als täte es ihnen leid.«
»Mama!«
»Worüber sollen sie deiner Meinung nach nachdenken? Die beiden werden einfach nur wütend, weil sie eine Show abziehen und sich vor aller Augen entschuldigen sollen. Ein Kind denkt nicht nach, wenn es in der Ecke steht, es träumt nur von Rache. Das wissen alle Eltern dieser Welt.«
»Aber das kannst du doch nicht sagen!«
»Du wolltest, dass ich echt bin.«
»Geschenkt … Eine andere Situation, Madame Delaunais: Ein Kind macht sich in die Hose.«
»Ich tue so, als hätte ich es nicht gesehen.«
»Es kommt laut weinend zu Ihnen gelaufen.«
»Ich schicke es zum Duschen in die Umkleidekabine, und anschließend soll es sich umziehen.«
»Es gibt hier keine Dusche, wir sind eine Grundschule.«
»Schade. Dann trocknen wir den Jungen oder das Mädchen, so gut es geht, mit dem braunen Papier ab, und ich sorge dafür, dass er oder sie die Kleider wechselt.«
»Das ist schwierig, das Kind hat keine Sachen zum Wechseln dabei.«
»Dann begnügen wir uns mit der Fundkiste.«
»Okay, das war leicht. Trotzdem, ein Punkt für Sie.«
»Aber man wird das Pipi riechen, die anderen werden sich vor ihm ekeln, am Ende gibt es Streit, also kommt es wieder zu der Situation von vorher, die auf dieselbe Art geregelt wird: in getrennten Ecken so tun, als dächten sie nach, der kleine Vollgepinkelte auf der einen Seite, die bösen Kinder auf der anderen.«
»Mama …«
»Streit fängt fast immer auf dieselbe Art an, glaub mir, ich habe es oft genug erlebt.«
»Ein kleines Mädchen kommt mitten im Winter halb angezogen in die Schule.«
»Auch das regeln wir mit der Fundkiste. Dann rufen wir die Eltern an und brüllen sie an.«
»Ein Kind kommt ohne Mittagessen zur Schule.«
»Ich nehme dem kleinen Mistkerl, der das andere Kind blutig gehauen hat, das Essen ab und gebe es ihm.«
»…«
»Na gut, jeder gibt ein bisschen was ab, damit das Kind auch etwas zum Mittag hat. Dann rufen wir die Eltern an und brüllen sie an.«
»Sie bemerken, dass eines der Kinder, für die Sie verantwortlich sind, ernsthaft von einer Bande kleiner Schulhofbullys tyrannisiert wird.«
»Ich finde den Bandenboss und schalte ihn aus.«
»…«
»Wir rufen die Eltern des Opfers an und schlagen ihnen vor, ein paar Auftragsmörder zu engagieren, um den Kopf der Bande diskret aus dem Verkehr zu ziehen, idealerweise außerhalb des Schulgeländes.«
Ich mag eine langweilige Frau sein (so beleidigend Jacques’ Worte kurz nach der Trennung waren, so sehr amüsiere ich mich heute über sie), aber manchmal finde ich mich sehr lustig.
»Okay, ich hab noch was anderes zu tun, als mir deine komische kleine Nummer hier anzuhören.«
»Okay, okay! Warte, jetzt mal im Ernst: Wir sagen allen Bescheid, den anderen Erziehern, den Lehrern, den Eltern, der Schulleitung, den Psychologen, wir bilden ein Interventionsteam, dann treffen wir uns mit den Tyrannen und dem Tyrannisierten, zusammen oder auch getrennt, und versuchen, das ungesunde Beziehungsmuster zu durchbrechen, das entstanden ist. Wir legen strenge Sanktionen für die Tyrannen fest, die in einer Suspendierung oder sogar einem Schulwechsel bestehen können; wir sensibilisieren die anderen Schüler, räumen mit Vorurteilen auf, wir reden, halten pädagogische Workshops ab, Projekte, 3-D-Handys, wir engagieren große Stars, die uns sagen, wie wir’s machen sollen …«
»Mama! Du hast so gut angefangen, versau es jetzt nicht.«
»Und wenn ein kleines Mädchen weint, weil es seine Mutter vermisst und sich ganz verloren fühlt, schließe ich sie so fest wie möglich in die Arme und tröste sie, indem ich ihr liebe Worte ins Ohr flüstere.«
Meine große Charlotte neigte das hübsche Gesicht um zwanzig Grad nach Nordnordost, und ich wusste: Wenn es nach ihr ginge, würden sie mich sofort einstellen, trotz meiner flachen Witze. Im vergoldeten Teil ihres Gedächtnisses überdauerte das Bild der freundlichen Clarissa, die in den ersten Kindergartentagen großzügig ihre Arme und die weiche Brust herausgestreckt hatte, bis Charlotte sich über die Tatsache meiner Abwesenheit beruhigen konnte. Ich besaß weder Clarissas üppige Formen noch ihre Geduld, dafür aber die Gabe, die Zuneigung von Kindern zu erlangen. Schlimmstenfalls würde ich ihnen heimlich ein paar Bonbons zustecken.
*
Die Sekretärin, die mich in Empfang nahm, sprach kein Wort mit mir. Sie begnügte sich damit, ein weißes Blatt hochzuhalten, auf dem in Großbuchstaben geschrieben stand: PAUSE.
»Oh, kein Problem, ich setze mich da hin und warte. Ich komme wegen der Anzeige für die Kinderbetreuung.«
»Mir bleibt nichts anderes übrig, Madame. Es tut mir leid, aber sonst komme ich nie dazu, mal Pause zu machen. Ständig Eltern, Telefon, Lieferungen, verletzte Kinder, die Kleinen aus dem Kindergarten, die noch nicht trocken sind … whatever … es hört einfach nie auf. Die Klassen sind voll, die Schule platzt aus allen Nähten, die Direktorin ist gerade in einer Klasse, weil ein Lehrer fehlt, und die Aushilfe ist gestern schreiend davongelaufen. Schon die zweite seit Beginn des Schuljahrs. Am Ende hat der Hausmeister die Kinder aus dem Unterricht entlassen.«
Ich warf diskret einen Blick auf den Kalender an der Tür: 17. September.
»Der Haushalt kann auch mal warten. Bei uns tut er das häufig – wie bei vielen anderen vermutlich auch. Nicht jeder hat das Geld, um sich eine Putzfrau zu leisten, schätze ich, aber ich selbst könnte durchaus eine bezahlen, es ist eine Frage der Prioritäten. Ich kaufe mir lieber Klamotten, das gefällt mir, dafür putze ich dann eben selbst. Na ja, wenn die Toilette drei Tage lang nicht sauber gemacht wurde, muss man sowieso selber ran, schließlich lässt keiner seine Putzfrau alle drei Tage kommen. Also muss der Haushalt warten, daran stirbt man nicht, das passiert jedem mal, darum ist es auch nicht schlimm, wenn der Hausmeister hin und wieder aushilfsweise eine Klasse beaufsichtigt. Die Raumpflege kann warten wie bei allen anderen auch.«
Ich war beeindruckt, denn ihr Wortschwall führte nicht dazu, dass sie den Faden verlor. Ihre im kalten Neonlicht wie gelackt wirkenden bonbonrosa Strähnchen – die seltsame Idee einer Friseurin, die sie ihr auf den Kopf gepinselt hatte – wirbelten wie ein Staubwedel durch die Luft. Vielleicht … Nein. Bei genauerem Hinsehen waren sie mit Sicherheit das Ergebnis einer heimischen Do-it-yourself-Aktion. Unmöglich, ihr Alter zu erraten, das irgendwo zwischen fünfunddreißig und fünfundfünfzig liegen musste. Im Tonfall einer Großmutter hielt sie einen Vortrag, der besser zu einer alten Schabracke gepasst hätte, während sich unter ihrer Kleidung dezent ihr rundlicher Körper abzeichnete. Nachdem sie nun aufgehört hatte, mit einem transparenten Plastiklöffel energisch ihren Joghurt umzurühren – der laut Etikett ohnehin gerührt war –, redete sie weiter mit mir, wobei sie die Worte in milchige Röllchen verwandelte.
»Heißen Kaffee bekomme ich hier nie zu trinken. Wirklich, niemals! Sobald ich morgens den Fuß ins Büro setze, ist es vorbei, keine ruhige Sekunde mehr, finito bis zum Abend. Ich kann nicht mal pinkeln gehen! Gestern ist mir eine Lehrerin auf die Toilette gefolgt, um mir zu sagen, dass sie ein Kind in mein Büro geschickt hatte, dem schlecht geworden war. Wir schwatzten durch die Tür hindurch, um zu entscheiden, was wir mit dem Kind machen sollten, nur damit Sie’s wissen. Ich hatte mir kaum den Slip wieder hochgezogen, da kotzte mir der Kleine schon vor den Schreibtisch. Glücklicherweise war der Hausmeister in diesem Moment nicht in einer Klasse – manche Tätigkeiten im Haushalt können warten, andere nicht …«
Ein Schüler kam herein. Er hielt sich mit beiden Händen den Kopf und jammerte wie einer, der im Sterben liegt. Die Sekretärin richtete ihre Kuhaugen an die Zimmerdecke, ehe sie sich wieder dem armen Kleinen zuwandte, der sich instinktiv zu mir drehte. Lag wahrscheinlich an meinem Hausfrauengesicht.
»Ich hab mir den Kopf aufgeschlagen …«
»Die Sekretärin macht gerade ein Päuschen, es dauert nicht lange. Zeig doch mal. Oh, da hast du ja ganz schön was abgekriegt! Was ist passiert?«
»Ich hab mich gebückt und Cédric auch.«
»Ihr habt euch gleichzeitig gebückt?«
»Mein Spin war runtergefallen.«
»Dein was?«
»Mein Fidget Spinner.«
»Dann wollte er dir sicher nur helfen.«
»Nein, er wollte ihn mir klauen!«
»Na hör mal, du kannst ihn nicht einfach beschuldigen …«
»Der klaut mir dauernd meine Sachen!«
»Okay. Pass auf, wir halten das Aua unter kaltes Wasser. Du zeigst mir, wo die Toiletten sind.«
»Mein Spinner ist weg …«