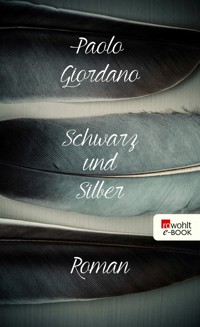12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Tasmanien ist ein Roman über unsere Gegenwart. Über unsere Sehnsüchte und Verwundbarkeiten. Er erinnert uns daran, dass wir alle auf der Suche sind: nach einem Ort, der Rettung verspricht, einem Ort, an dem eine Zukunft möglich scheint und wir weniger allein sind.
Es gibt Momente, in denen sich plötzlich alles ändert und unser Leben eine Wendung nimmt. Paolo ist Anfang vierzig, Journalist und Autor von Romanen. Er lebt mit seiner Frau und seinem Stiefsohn in Rom, alles scheint in Ordnung zu sein. Bis er erkennen muss, dass er nie selbst Vater werden wird. Von diesem Moment an entgleist ihm sein Leben: sein Buchprojekt stagniert, sein bester Freund wendet sich von ihm ab, seine Frau scheint ihm fremd. Um seinen eigenen Dämonen zu entfliehen, beschäftigt sich Paolo immer eingehender mit der Welt, die ihn umgibt: dem Klimawandel, dem Terrorismus. Doch während er glaubt, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren, findet er schließlich Trost, wo er ihn nicht vermutet hätte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Ähnliche
Cover
Titel
Paolo Giordano
Tasmanien
Roman
Aus dem Italienischen von Barbara Kleiner
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Tasmania bei Giulio Einaudi editore, Turin.Die Übersetzung dieses Buches ist dank einer Förderung des italienischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Kooperation entstanden.Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiano.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5439.
suhrkamp taschenbuch 5439© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023© 2022 Giulio Einaudi editoreThis edition published in agreement with the Proprietor through MalaTesta Literary Agency, Milan.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung des Originalumschlags von Giulio Einaudi editore. Umschlagillustration: Lorenzo Ceccotti
eISBN 978-3-518-77744-2
www.suhrkamp.de
Widmung
Would you agree times have changed?
Bright Eyes, Claireaudients(Kill or Be Killed)
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Erster Teil Im Fall der Apokalypse
Zweiter Teil Die Wolken
Dritter Teil Die Strahlungen
Danksagung
Informationen zum Buch
Erster Teil
Im Fall der Apokalypse
Im November 2015 fand ich mich in Paris wieder, um an einer Konferenz der Vereinten Nationen über den Klimawandel teilzunehmen. Ich sage, ich fand mich wieder, nicht weil ich mir diese Situation nicht ausgesucht hätte: Im Gegenteil, die Umweltfrage beschäftigte mich seit Längerem im Kopf und in meinen Lektüren. Aber hätte da nicht eine Konferenz übers Klima in Aussicht gestanden, hätte ich vermutlich einen anderen Vorwand gefunden, um aufzubrechen, einen bewaffneten Konflikt, eine humanitäre Katastrophe, eine andere und größere Sorge als meine eigenen, von der ich mich vereinnahmen lassen konnte. Vielleicht beschäftigen sich daher einige von uns obsessiv mit drohenden Katastrophen, haben einen Hang zu Tragödien, den wir für edelmütig halten und der, glaube ich, in dieser Geschichte im Mittelpunkt stehen wird: das Bedürfnis, bei jedem schwierigen Schritt in unserem Leben etwas noch Schwierigeres zu finden, etwas noch Dringlicheres und Bedrohlicheres, worin wir unser persönliches Leiden aufgehen lassen können. Vermutlich hat das mit Edelmut wirklich überhaupt nichts zu tun.
Es war eine merkwürdige Zeit. Meine Frau und ich hatten etwa drei Jahre lang immer wieder versucht, ein Kind zu bekommen, und uns dabei immer demütigenderen ärztlichen Prozeduren unterworfen. Auch wenn ich der Genauigkeit halber sagen müsste, dass vor allem sie sich diesen Prozeduren unterwarf, denn in meinem Fall war es ab einem bestimmten Punkt hauptsächlich darum gegangen, die Rolle des betroffenen Zuschauers einzunehmen. Trotz unserer blinden Entschlossenheit und einer nicht unbeträchtlichen Summe investierten Geldes ließ der Plan sich nicht verwirklichen. Nicht die Injektion von Gonadotropinen, nicht die künstliche Befruchtung und auch nicht die verzweifelten Reisen ins Ausland, von denen wir niemandem gegenüber ein Wort erwähnten. Die göttliche Botschaft in diesen wiederholten Fehlschlägen war klar: All das soll nicht euer Schicksal sein. Da ich mich weigerte, das anzuerkennen, hatte Lorenza auch für mich entschieden. Eines Nachts hatte sie mir mit schon getrockneten Tränen oder ganz ohne zu weinen (das werde ich nie wissen) mitgeteilt, dass sie nicht mehr die Absicht hätte. Sie hatte diese offene Formulierung gewählt, ich habe nicht mehr die Absicht, ich hatte mich auf die Seite gedreht und ihr meinerseits den Rücken zugekehrt, Wut stieg in mir auf über eine Entscheidung, die mir ungerecht und einseitig erschien.
In diesen Tagen lag mir meine kleine persönliche Katastrophe mehr am Herzen als die planetarische, von der Zunahme an Treibhausgasen, dem Schmelzen der Gletscher bis zum Anstieg des Meeresspiegels. Einzig aus dem Grund, um rauszukommen, bat ich den Corriere della Sera um eine Akkreditierung für die Konferenz in Paris, auch wenn die Bewerbungsfrist abgelaufen war. In der Tat musste ich sie beschwören, als ginge es für mich um ein unverzichtbares Ereignis. Sie würden mir nur den Flug und meine Beiträge bezahlen müssen. Unterkommen würde ich bei einem Freund.
Giulio wohnte zur Miete in einer düsteren Zweizimmerwohnung in der Rue de la Gaîté im 14. Arrondissement. Straße der Heiterkeit?, fragte ich beim Eintreten. Das passt ja nicht so zu dir.
Du hast recht. An deiner Stelle würde ich keine hohen Erwartungen haben.
Vor Jahren hatten wir uns in Turin eine Wohnung geteilt, Giulio als Student von außerhalb, ich als Privilegierter, der zum ersten Mal nicht zuhause wohnt, auch wenn die Eltern nur eine halbe Stunde Busfahrt entfernt waren. Im Gegensatz zu mir war Giulio nach dem Studienabschluss bei der Physik geblieben. Er hatte unzählige Male die Stelle gewechselt, immer in Europa, weil er eine unüberwindliche politische Aversion gegen die Vereinigten Staaten hegte. In der Zwischenzeit hatte er geheiratet und war geschieden worden, er hatte einen Sohn und war schließlich in Frankreich gelandet mit einem Forschungsauftrag an der École Polytechnique, wo er sich mit der Anwendung von Modellen der Chaostheorie auf den Finanzmarkt beschäftigte.
Abends aßen wir zwei Portionen Nudeln wie Zwanzigjährige, ohne den Tisch zu decken, und ich erzählte ihm vom Grund meines Besuchs in Paris, dem offiziellen Grund. Giulio holte ein Buch aus dem Regal. Hast du das gelesen?
Ich verneinte und ließ die Seiten unter dem Daumen durchlaufen. Kollaps, murmelte ich, das scheint mir passend.
Es gibt darin einen interessanten Punkt zur Vernichtung. Behalte es.
Das Wort Vernichtung ging mir eine Weile lang im Kopf herum, wie das Etikett zu einem persönlichen Schicksal. Ich räumte die Teller ab, während Giulio mir rasch das Neuste über Adriano erzählte, der schon vier Jahre alt war. Durch die Kohlehydrate war ich ein wenig schläfrig geworden, aber der Wein war alle, also gingen wir aus dem Haus, um weiter zu trinken.
Paris war militarisiert, düster. Wenige Tage zuvor waren während eines Auftritts der Eagles of Death Metal Attentäter in den Konzertsaal eingedrungen und hatten minutenlang in die Menge geschossen. Andere Terroristen hatten Bistrots angegriffen und zwei hatten sich vor dem Stade de France in die Luft gesprengt. An diesem Abend war ein befreundetes Paar zum Abendessen bei uns, und es war Lorenzas Mutter, die uns benachrichtigte. Beim ersten Anruf war sie nicht hingegangen, auch beim zweiten nicht, aber diese Beharrlichkeit war verdächtig, und am Ende hatte sie nachgegeben. Ihre Mutter hatte nichts weiter gesagt als Macht den Fernseher an, während sich auf unseren Handys die Nachrichten überschlugen. Wir hatten die Live-Berichterstattung über eine Stunde lang verfolgt, schweigend, dann waren die Freunde gegangen, getrieben von der völlig irrationalen Notwendigkeit, den Sohn zuhause zu überwachen. Lorenza und ich hatten den Fernseher noch lang angelassen, der rote Kriechtitel mit den neuesten Nachrichten am unteren Bildrand, die Meldungen begannen sich zyklisch zu wiederholen. Die Teller standen noch auf dem Tisch, kalt, als etwas anderes zu unserer Bestürzung hinzutrat: ein privater Schrecken. Ein Gefühl von Trauer ohne Verlust, das über der Wohnung hing, genau seit der Nacht, als sie Ich habe nicht mehr die Absicht gesagt hatte und ich mich auf die andere Seite gedreht hatte.
Giulio und ich gingen eine Weile dahin, vorbei an Massagesalons mit verdunkelten Fenstern, Geschäften mit Sex-Spielzeug und asiatischen Garküchen. Dann setzten wir uns irgendwohin, die Stühle zur Straße gekehrt, und bestellten zwei Bier. Er erzählte von den Büchern, die er gelesen hatte: Texte über die digitale Überwachung, über den arabischen Frühling und neue Populismen. Giulio las eine Unmenge Bücher. Er hatte eine wesentlich komplexere Weltsicht als ich, war viel engagierter, und das war er, seitdem ich ihn kannte. An der Universität hatte er zwei Jahre lang das Kollektiv der Aula B1 koordiniert, im Souterrain, wo No Nukes Poster hingen und ein Foto von Oriana Fallaci, den Namen zu URINA entstellt, während ich nur in der Mittagspause in die B1 hinunterging und auch nur, um mit ihm zusammen zu sein, als ob diese Nähe genügte, um ein wenig bewusster, ein wenig ethischer zu werden.
In der Rue de la Gaîté hörte ich ihm Bier trinkend zu. Ich ließ meinen Geist von seiner unfehlbaren Kompetenz läutern, vom Autolärm, von der Brown’schen Bewegung der Menschen. In den kurzen Gesprächspausen richteten wir beide unsere Blicke anderswohin, und in diesen Momenten schien es mir, als sähen wir dieselbe Szene vor uns: ein schwarzes Gespenst, das aus der Menge auftauchte und die Arme zum Himmel erhob, bevor es das Lokal mit Maschinengewehrsalven belegte. So wie ich mich tief im Inneren fühlte – steril, der Zukunft beraubt –, wünschte sich ein Teil von mir, dass das wirklich geschähe. Das war eine idiotische und schädliche Fantasie, voller Selbstmitleid, aber ich gestattete sie mir, auch wenn ich Giulio nichts davon sagte. Ich hatte nie mit ihm über die Kinderfrage gesprochen. Wir hatten stets eine Freundschaft gehabt, in der man über die äußere Welt sprach und so wenig wie möglich über sich selbst, und wahrscheinlich hat sie deshalb so lange gehalten.
Am nächsten Morgen nahm ich den RER B und dann einen Bus, um nach Le Bourget zu gelangen, wo die UN-Klimakonferenz COP21 stattfand. Die Kontrollen am Eingang waren lästig, aber einmal drinnen, konnte man sich frei bewegen. Pavillons, kleine und mittelgroße Säle, Plenarsitzungen und parallele Meetings, nach Farben unterschieden. Eine Hostess zeigte mir den mit allem Nötigen ausgestatteten Arbeitsplatz samt Kabelanschlüssen im Pressesaal. Ich demonstrierte eine Vertrautheit mit diesen Dingen, die ich nicht hatte.
Nach einigen Tagen der Teilnahme an Panels jeder Art, die ich zufällig aus dem Programm auswählte, musste ich mir eingestehen, dass es nicht viel zu erzählen gab. In den Versammlungen wurden spezielle Absätze oder Paragrafen diskutiert, sogar einzelne Begriffe, die schließlich in dem Abkommen auftauchen würden, die Vorträge waren hölzern oder übertrieben allgemein. Umwelt war ein langweiliges Thema. Langsam, ohne Handlung oder Spannungsbogen, abgesehen von den eventuell auftretenden Zwischenfällen. Dafür überfrachtet mit guten Absichten. Das war das verborgene Problem der Klimakatastrophe: die grausame Langeweile. Der Aushandlung eines internationalen Abkommens beizuwohnen, war geradezu einschläfernd. Hätte ich über jedes millimeterweise Vorankommen berichten sollen, indem ich es als Revolution darstellte, aber wen sollte das interessieren? Wen, wenn ich der Erste war, der in den in Dämmerlicht getauchten Sälen einschlief, beschwert von den Sandwiches, die ich ständig aß, eingelullt von den eintönigen Beiträgen der senegalesischen oder kubanischen Delegierten oder jener in tibetischen Trachten?
Nach fünf Tagen hatte ich noch nicht einen Artikel zustande gebracht. Die Zeitungsredaktion begann mich zu fragen, was ich vorhätte. Ich denke darüber nach, versicherte ich, ich bin bald so weit.
Beim Abendessen sprach ich mit Giulio darüber. Das Interessanteste, das ich gefunden habe, ist diese Installation, ein Mini-Eiffelturm aus übereinandergestapelten Stühlen. Aber das scheint mir nicht ausreichend für einen Artikel.
Wie sehr mini?
So hoch.
Nein, das ist nicht ausreichend.
Ich hatte uns Steaks gebraten, die ich eingeschweißt in einem Bio-Supermarkt gekauft hatte. Als Zeichen der Erkenntlichkeit. Ich hatte beim Braten viel Qualm produziert, Giulio hatte aber beim Heimkommen nichts gesagt.
Ja, das Klima kann einem echt auf den Sack gehen, räumte er ein.
Ich dachte, die Unterhaltung wäre damit beendet. Aber nach einem Moment des Überlegens sagte er: Du könntest Novelli treffen. Vielleicht erzählt er dir was anderes.
Wer ist das?
Ein Physiker, wie wir.
Alter?
Unter fünfzig. In Rom hat er Übungen zur Methodik gehalten. Extrem sympathisch im Unterricht, aber ein Aas in den mündlichen Prüfungen. Damals war er ein fanatischer Kapitalismusgegner.
Wie du?
Giulio lächelte: Schlimmer. Ich habe ihn hier in Paris wieder getroffen. Jetzt beschäftigt er sich mit Klimamodellen, irgendwas mit Wolken. Wenn du willst, bringe ich euch in Kontakt.
Ich musste mit den Schultern gezuckt und so getan haben, als würde ich darüber nachdenken, aber ich klammerte mich schon an diese Aussicht. Alles, um einen weiteren Tag des Herumirrens zwischen den summenden Pavillons in Le Bourget zu vermeiden, mit vorgefertigten Sätzen zum besorgniserregenden Zustand des Planeten im Kopf.
Was ich nicht erwartet hätte, war, dass Novelli mich noch am selben Abend in eine Brasserie in der Rue Monge einladen würde. Ich ging zu Fuß hin, obwohl es fast drei Kilometer waren. Den ganzen Weg über hielt ich den Blick auf das Handy gerichtet, um möglichst viele Informationen über Dr. Jacopo Novelli zu sammeln. Im Netz gab es nicht viel, er war damals noch nicht bekannt (oder berüchtigt) genug für einen Wikipedia-Eintrag, aber er hatte seine eigene, etwas dilettantische WordPress-Seite. Er listete die jüngsten Papers auf und verwies auf seinen Kurs über komplexe Systeme. Es gab eine Fotogalerie mit bewölkten Himmeln, versehen mit kurzen Bildunterschriften, die den Typus von Wolkenbildung klassifizierten: Altostratus-, Cirrus-, Cumulonimbus-Wolken, eine Nomenklatur, die ich mich für die Prüfung in Meteorologie geweigert hatte zu lernen, weil das nur drei Punkte brachte.
Ich habe mit dem Bestellen nicht auf Sie gewartet, sagte Novelli, ohne sich im Geringsten schuldig zu fühlen. Ich hatte kalkuliert, dass Sie weniger Zeit brauchen würden.
Ich bin zu Fuß gekommen.
Vom Vierzehnten aus?
Er schien verwundert, sagte aber nichts weiter. Aber er folgte meinem Blick auf seinen Teller, auf den Berg Dinge, die darauf waren.
Beachtlich, hm? Ich komme absichtlich hierher. Auch wenn man Hamburger dieser Größe nicht essen sollte. Wegen des CO2-Ausstoßes natürlich. Aber vor allem wegen der Arterien. Nur dass die hier wirklich unwiderstehlich sind. Sehen Sie?
Er hob den Hamburger hoch, um ihn mir in Seitenansicht zu zeigen. Die einzelnen Schichten schön getrennt, Salat, Käse, Fleisch, Zwiebeln. Nicht der Matsch, den man sonst so vorgesetzt bekommt. Bestellen Sie sich einen.
Ich habe schon gegessen, danke.
Pech für Sie.
Er biss in den Hamburger, während ich mir die Zeit nahm, ihn zu studieren. Er hatte das etwas angespannte Aussehen gewisser Wissenschaftler auf dem Gipfel ihrer Karriere. Wenn er als junger Mann nachlässig in der Kleidung gewesen war, wie viele Physikstudenten (mich eingeschlossen), musste ihm dieses Thema jetzt ziemlich am Herzen liegen.
Kennen Sie das Kessler-Syndrom?, fragte er mich. Ich schüttelte den Kopf.
Giulio hat mir gesagt, Sie wollten vom Ende der Welt reden. Wie übrigens alle in diesen Tagen. Auch wenn man sich darüber im Klaren sein sollte, dass wir nicht vom Ende der Welt reden, höchstens vom Ende der menschlichen Zivilisation, was einen Unterschied macht. Während ich hier auf Sie wartete, ist mir jedenfalls das Kessler-Syndrom in den Sinn gekommen.
Er schleckte sich die Mayonnaise vom Zeigefinger, bevor er das Handy nahm und ein Bild suchte. Was sehen Sie hier?
Ufos, tippte ich, mehr zum Scherz.
Ufos, genau, das sagt ihr alle. Nur schade, dass es Ufos nicht gibt und das hier ein echtes Foto ist. Das sind Satelliten, die reihenweise von einem dieser neuen chinesischen Internetunternehmen hochgeschossen werden. Sie haben ja keine Vorstellung, welche Menge Metall da über unseren Köpfen herumfliegt, praktisch haben wir die niedrigen Umlaufbahnen schon damit angefüllt.
Er drehte den Hamburger um und nahm ihn vom anderen Rand her in Angriff. Vielleicht wollte er sich den mittleren Teil, den saftigeren, für zuletzt aufheben.
Stellen Sie sich vor, ein Bolzen löst sich von einem dieser Satelliten. Das kommt ständig vor, nicht wahr? Bolzen lösen sich. Gut, dieser Bolzen fliegt mit ungefähr dreißigtausend Stundenkilometern, er ist ein Projektil. Bei dieser Geschwindigkeit kann er ohne weiteres Stahl von einer gewissen Dicke durchschlagen. Jetzt stellen Sie sich vor, der Bolzen trifft einen anderen Satelliten, der zerschellt und schießt eine Menge anderer metallischer Projektile durch die Gegend, die wiederum andere Satelliten treffen.
Eine Kettenreaktion.
Genau, eine Kettenreaktion. Was geschieht am Ende mit all diesem herumfliegenden Metall? Das weiß niemand. Aber ein Teil davon könnte auch auf die Erde herabfallen, wie eine Art Asteroidenregen. Das heißt Kessler-Syndrom, und wissen Sie was? Das ist eine reale Bedrohung. Die Leute denken nicht daran, weil sie es nicht wissen. Das wissen nur diejenigen, die die Satelliten ins All schießen, und in der Tat bauen sie sich mit dem Geld, das sie verdienen, Atombunker. Aber die Leute hier an diesen Tischen nicht. Jetzt haben alle den Islamischen Staat und die Erderwärmung im Kopf, aber die Wahrheit ist, dass es eine Unmenge anderer, originellerer Bedrohungen gibt. Dürre, Wasserverseuchung, Pandemien– genau das sagte er –, Aufstand der Künstlichen Intelligenzen. Außer denen natürlich, die uns aus der Mode gekommen zu sein scheinen. Wie der gute alte nukleare Winter.
Während ich ihm zuhörte, musste ich einen Moment lang an meinen Vater denken. Daran, wie er an Sonntagen meiner Mutter in der Wohnung nachlief, sie verfolgte wie eine Drohne: in der Waschküche, auf dem Balkon, in der Küche, und dabei unaufhörlich von der Ölkrise erzählte, von der Luftverschmutzung und von der Lichtverschmutzung. Eine Katastrophe pro Monat. Ich fragte mich, ob auch Novelli ein solcher Ehemann war. Ob am Ende auch ich ein solcher Ehemann war.
Und die Wolken?, fragte ich.
Novelli verzog das Gesicht. Wolken sind kompliziert. Die hohen binden die Feuchtigkeit und tragen daher zur Überhitzung des Planeten bei. Die niedrigen reflektieren das Sonnenlicht, daher kühlen sie ihn ab. Sie sind zugleich gut und schlecht, das reinste Durcheinander also. Manche glauben, der Klimawandel würde uns eine Welt ohne Wolken bescheren, Tag und Nacht strahlend blauer Himmel, dreihundertfünfundsechzig Tage im Jahr. Ich nehme an, einigen würde das gefallen. Mir nicht.
Ich habe gesehen, dass Sie auf Ihrer Website Fotos sammeln.
Das ist ein Wettbewerb für die Studenten. Die interessanteste Wolke fotografieren. Aber er ist auch für andere offen. Sie können mitmachen, wenn Sie wollen.
Ich fotografiere nicht.
Wie Sie wollen.
Ich kann nicht rekonstruieren, worüber wir an diesem Abend geredet haben, auch weil wir lange zusammen waren, erst auf der Terrasse der Brasserie unter den übertrieben heißen Heizpilzen, dann auf der Straße entlang dem Jardin des Plantes. Sicher haben wir über die Konferenz der Vereinten Nationen gesprochen, in die Novelli laue Hoffnung setzte, und wir haben über die Nostalgie gesprochen, die wir beide für eine von der Welt abgelöste Physik empfanden. Und sicher hat er mich nach einer Weile gefragt, ob ich ihn gerade interviewte.
Ich glaube nicht, nicht wirklich.
Sie können mich interviewen, wenn Sie möchten, sagte er, und ich bemerkte dieses Moment naiver Eitelkeit in all dem Reden über das Ende der Welt.
An einem gewissen Punkt unseres Spaziergangs fragte er mich, ob ich Kinder hätte. Ich gab die Frage sofort zurück: Er? Zwei. Der Zweite war etwas später gekommen als die Erste, die schon sieben Jahre alt war. Ich fragte ihn, ob das nicht ein Widerspruch war, wenn man eine solche Zukunft vor sich sah wie er. Unwillkürlich war ich etwas steif geworden. Novelli sagte: Wie sollen wir daran glauben, alles zu überleben, wenn nicht, indem wir auf die Kinder vertrauen?
Als wir bei seinem Haustor ankamen, war die Unterhaltung verebbt, die letzten zehn Minuten waren wir einfach nur nebeneinander hergegangen. Auf den Straßen war niemand mehr. In der Stille hatte sich bei mir der Gedanke an die Attentate wieder eingestellt, und ich überlegte mir, die Metro auf dem Rückweg zu meiden, auch wenn das nicht viel Sinn hatte. Die Selbstmordattentate setzen eine Menschenmenge voraus, einen gewissen Showeffekt.
Womit beschäftigen Sie sich also?, fragte mich Novelli, als ob ihm diese Frage den ganzen Abend durch den Kopf gegangen wäre.
Ich bin Schriftsteller.
Giulio hat mir gesagt, Sie arbeiten für eine Zeitung.
Ich arbeite für eine Zeitung, bin aber Schriftsteller.
Aus irgendeinem Grund war ich enttäuscht. Als ob ich den Sinn und Zweck dieses Abends missverstanden hätte und Novelli mich mit einem Standardprogramm abgespeist hätte, angefangen beim Kessler-Syndrom, mit spektakulären Begriffen, die er einem Studierenden gegenüber genauso einsetzen würde.
Er begann mit dem Schlüssel zu hantieren, öffnete die Tür. Na dann. Gutes Gelingen für Ihren Artikel. Meine Nummer haben Sie, wenn Sie noch etwas brauchen.
Auf die Idee, Urlaub auf der Insel zu machen, war Lorenza gekommen, während ich in Paris war, sie sah es als eine sehr zeitgemäße Form der Paartherapie an. Es gab keinen Schmerz, so die westliche Weisheit, den eine Woche in den Tropen nicht beheben konnte. Nach einem Gipfeltreffen über den Klimawandel war ein Flug mitten im Winter in die Karibik vielleicht nicht ganz der kohärenteste Schritt: Rechnete man tausend Kilogramm Kohlenstoffdioxid pro Kopf und Strecke, würden wir insgesamt ungefähr vier Tonnen CO2 in die Atmosphäre emittieren, um die Traurigkeit zu überwinden, die sich in unserer Ehe eingenistet hatte. Es war den Versuch wert. Mein Umweltbewusstsein müsste für diesen Moment eben kurz aussetzen.
Man sagt, Guadeloupe habe die Form eines Schmetterlings. Wenn das stimmt, dann befand sich unser Resort auf dem rechten Flügel im Zentrum einer kleinen Schleife. Bei der Ankunft gab man uns zwei zusammengerollte Mikrohandtücher, getränkt mit parfümiertem Wasser, um das Gesicht zu erfrischen. Die großen, in den Boden eingelassenen Becken in der Lobby waren bevölkert von Langusten, die träge ihre Antennen bewegten. Bequem auf den weißen Sofas sitzend und noch benommen von der Reise, ließen wir uns von den zahllosen Relax-Gelegenheiten und den dazugehörigen Modalitäten der Bezahlung berichten. Da wir das Upgrade gewählt hatten, logierten wir im Ocean Room, das würde uns bestimmt gefallen, und so war es auch.
Nachdem wir die Koffer ausgepackt hatten, gingen wir, um das letzte Licht auszunutzen, an den Strand hinunter. Lorenza hatte ein neues Strandkleid mit geometrischem Muster, sie ließ es auf einem Baumstamm liegen, der in seine Umgebung viel zu gut zu passen schien, als dass er dort hätte angespült werden können. Wir gingen ins Wasser, und in zwei Metern Entfernung von unseren Beinen schwamm ein Rochen vorbei, wie ein gutes Omen. Die Wellen waren flach, kaum angedeutet. Lorenza umschlang mit den Beinen meine Taille, und ich bewegte mich mit kleinen Sprüngen im seichten Wasser vorwärts und zog sie mit. Es sei nicht schlecht, einfach wieder ein Paar zu sein, nichts weiter, sagte sie mir ins Ohr. Zuhause wurden wir permanent unterbrochen: von der Arbeit, von Eugenio, von Telefonaten. Sie presste mich mit aller Kraft, die sie in den Oberschenkeln hatte, ich fühlte sie jünger, und zum ersten Mal seit Wochen geriet mein Unmut ins Wanken, das leise Ressentiment, das ich ihr gegenüber hegte. Lorenza strich mir mit der feuchten Hand durchs Gesicht, wie um meinen inneren Monolog zu beenden, wovon auch immer er handelte. Wir küssten uns und lösten uns voneinander, aber auch so wiederholten wir uns ein ums andere Mal, was für ein großartiger Ort die Insel in Form eines Schmetterlings war und dass wir am liebsten nie wieder fortgehen würden.
Diese Harmonie hielt nur bis zum Abendessen vor, als ich Lorenza durch den Buffetraum folgte und auf die Absurdität von drei verschiedenen Menüs schimpfte, einschließlich eines mit japanischem Fleisch, und waren frische Erdbeeren in den Tropen wirklich notwendig? Das San Pellegrino in Plastikflaschen? Möglich, dass es Mineralwasser, ich sage ja nicht in der unmittelbaren Umgebung, aber wenigstens in sechstausend Kilometern Entfernung gab? Plötzlich drehte Lorenza sich mit dem Teller in der Hand um, und wie unschlüssig, ob sie ihn fallen lassen oder mir ins Gesicht schleudern sollte, sagte sie: Du bist gegen Verschwendung, das verstehe und respektiere ich. Aber ich bin gegen das Unglücklichsein. Also.
Also Relax: die Devise des Hotels. Relax, Relax, Relax, Relax.
Die Behandlung auf der Grundlage von Bädern in lauwarmem Wasser und Piña Colada um vier Uhr nachmittags hatte Effekt. Der Sex zwischen uns lebte wieder auf, der wahre Grund, weshalb wir hierhergekommen waren. Danach las Lorenza auf dem Bauch auf dem Bett liegend, noch ohne Slip, und schien ruhig. Ich konnte mich entweder ihr wieder nähern oder neben ihr sitzen und die überzeugendsten Absätze in dem Buch, das Giulio mir gehliehen hatte, unterstreichen, das Begehren hinauszögern. So sollte das Eheleben immer sein, dachte ich: erfüllt von dieser Sinnlichkeit. Vielleicht hatte Lorenza recht, meine Erwartungen im Hinblick auf das Vaterwerden waren übertrieben, ich war Opfer einer Idealisierung geworden. Es gab zahllos viele Paare, die ohne Kinder lebten, und nichts ließ vermuten, dass sie sich weniger verwirklicht fühlten als andere, oder weniger glücklich. Doch auch im Ocean Room blieb ein Gefühl von Erschöpfung zwischen uns, vor allem in den Gesprächen, als ob sich im Kern des Genusses ein Riss aufgetan hätte. Unser privates Ozonloch.
In Kollaps schildert Jared Diamond eine Art Paradox. Er legt dar, wie die Zivilisationen, von denen wir als sicher annehmen, dass sie zu wachsendem Wohlstand fortschreiten, sich manchmal in entgegengesetztem Sinn entwickeln, indem sie unbewusst die Voraussetzungen für ihr Ende schaffen. Das eklatanteste Beispiel sind die Osterinseln: Lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass die dort ansässigen Indigenen durch von den Europäern eingeschleppte Seuchen, vor allem Syphilis und Pocken, dezimiert worden seien, doch eine jüngere Theorie legt nahe, dass dieser Bevölkerungsrückgang mit den Riesenskulpturen zusammenhänge, die sie als Vermächtnis hinterließen, diese rätselhaften quaderförmigen Figuren, die dem Meer den Rücken zukehren. Um die Steinquader zu transportieren, mussten die Einwohner sie über Baumstämme rollen lassen, und um die Baumstämme zu gewinnen, mussten sie die Insel roden. Ohne Bäume geriet das Ökosystem aus den Fugen, es kam zu Erdrutschen, Hungersnöten und Bürgerkriegen. In der letzten Phase gingen die Inselbewohner zum Kannibalismus über. Zum Kannibalismus, verstehst du, sagte ich zu Lorenza.
Sie streichelte mir mit dem Zeigefinger über den Schenkel, ohne den Blick von ihrem Buch zu heben. Sie bewegte die angewinkelten Beine scherenförmig in der Luft, auf eine verblüffende Weise den Langusten in der Lobby ähnlich. Hast du nichts anderes zum Lesen mitgebracht?
Gegen Mitte der Woche buchten wir einen Ausflug ins Landesinnere. Wir hatten nicht wirklich Lust, aber es war eine Gelegenheit, das Schuldgefühl zu beschwichtigen, das uns beschlich, weil wir uns nie vom Hotelstrand wegbewegt hatten.
Wir brachen um neun Uhr morgens auf, in einem Van, zusammen mit einem niederländischen Paar. Wir folgten einem Pfad mit sanftem Auf und Ab inmitten des tropischen Regenwalds, umgeben von Vogelrufen. In diesen Breiten war alles üppiger, feuchter, erregender. Nach den Tagen in der Sonne spendete mir der Schatten eine unverhoffte Erleichterung.
Mich begeisterte die Erklärung des Führers über einen Baum, der ursprünglich aus Westafrika stammte und in raschem Tempo die autochthone Vegetation verdrängte. Dichrostachys cinerea war sein wissenschaftlicher Name, aber in Afrika wurde er »Weihnachtsbaum« genannt. Im April bekam er hübsche gelbe und violette Blüten, die einen Moment lang vergessen ließen, wie schädlich er war. Ich muss es mit dem Fragen übertrieben haben, denn die Niederländer gaben Zeichen von Ungeduld und Lorenza seufzte wie manchmal, wenn ich mich wie der Klassenstreber aufführte.
Wir kehrten zurück an die Küste. Das Mittagessen war im Schatten von Mangroven angerichtet. Es kamen dort auch andere Gruppen zusammen, aus anderen Hotels oder von anderen Tourenanbietern, und das Gedränge verdarb die Atmosphäre von Exklusivität, die uns im Übrigen bei der Buchung zugesichert worden war. Zusammen mit den Niederländern besetzten wir einen der Holztische und machten uns breiter als nötig, damit niemand auf die Idee kam, sich zu uns zu gesellen.
Ich begann mit Otto ein Gespräch über die Qualität des Resorts und darüber, wie das Reisen nach den Attentaten von Paris noch nervenaufreibender geworden war. Er war Ingenieur und arbeitete in der Automobilindustrie, beschäftigte sich aber vorwiegend mit Marketing. Das Thema Nachhaltigkeit lag ihm am Herzen.
Wir tranken jeder einen Ti Punch, dann einen zweiten und einen dritten. Natürlich sprachen wir auch über das kreolische Essen und wie repetitiv es mit der Zeit wurde.
Auf dem Rückweg bin ich im Van eingeschlafen, so tief, dass ich die letzte Etappe nicht einmal mitbekam. Als die anderen wieder einstiegen, schienen sie aufgekratzt, so auch Lorenza. Sie schworen, es sei schade, dass ich die Villa im Kolonialstil verpasst hatte, sie war wirklich sehenswert.
Am vorletzten Tag nahmen wir einen Leihwagen, um an einen Strand zu fahren, den uns die Niederländer empfohlen hatten: Das Leben in Resorts besteht aus Empfehlungen von Stränden. Als wir nach der Fahrt durch die Macchia dort ankamen, bemerkten wir, dass es ein FKK-Strand war. Was tun? Lorenza zuckte mit den Schultern. Jetzt sind wir schon hier.
Wir zogen uns aus, steckten die Badesachen in die Taschen und breiteten die Handtücher am Boden aus, aber einfach da zu liegen, war etwas komisch, also gingen wir ins Wasser. Es war ziemlich lustig. Während wir etwa dreißig Meter vom Strand auf dem Wasser trieben, näherte sich das niederländische Paar. Sie hatten uns nicht Bescheid gesagt, dass sie hierherkommen würden, sonst hätten wir wahrscheinlich das Ziel geändert. Es ist wunderbar, nicht wahr?, sagte Otto.
Lorenza unterhielt sich mit der Frau, die einen Sonnenbrand hatte, mit roten Flecken und zwei weißen Bikinistellen. Durch die Brechung des Lichts wirkten ihre Beine im Wasser dicker.
In dem Versuch, die Verlegenheit zu überwinden, ließ ich Otto gegenüber eine Bemerkung fallen, wie gut er die kurze Strecke zu uns herüber geschwommen sei. Er erzählte mir von einem Diplom, das in den Niederlanden alle Kinder erwerben müssen und das in drei Stufen gegliedert ist: Bei der Prüfung musste man in Kleidern und mit Schuhen schwimmen und mit angehaltener Luft einen Tunnel durchqueren.
Das ist wegen der Gefahr, dass die Niederlande durch den steigenden Meeresspiegel überschwemmt werden, stelle ich mir vor.
Otto sah mich verwundert an. Steigende Meeresspiegel? Ach wo. Wir wollen nur nicht, dass in Amsterdam die Leute in den Kanälen ertrinken.
Bei dieser Unterhaltung waren wir alle vier nackt, und ich wurde das Bewusstsein davon nicht wirklich los. Hast du die dahinten gesehen?, fragte mich Otto schließlich und deutete auf den Strand. Im Halbschatten sah ich die dunklen Umrisse von Jungen, die im Gebüsch hockten. Sie rieben sich rhythmisch zwischen den Beinen, wie eine Meditationsübung, aber auf die Ferne konnte man nicht sehen, ob sie Badehosen trugen oder nicht. Was machen sie?, fragte ich naiv, und Otto lächelte mir zu, als ob meine Bemerkung eher eine Anspielung als eine Frage wäre.
Später nahmen wir ihre Einladung zum Abendessen an. Unsinnigerweise zogen wir uns besser an als üblich, ich sogar geschlossene Schuhe, auch wenn es bloß darum ging, wie immer ins Erdgeschoss auf die Terrasse hinauszugehen, nacheinander ans Buffet zu treten, das wir mittlerweile auswendig kannten, und denselben chilenischen Rotwein mit Schraubverschluss zu bestellen, der am Ende zu den Extras gerechnet werden würde.
Nur dass wir das am Tisch von Otto und Maaike taten, unsere vorübergehenden Freunde, die in Den Haag, nein, nicht in Amsterdam, in Den Haag wohnten, genauer, etwa zwanzig Kilometer außerhalb der Stadt, in einem dieser typischen Häuser, wie du sie dir vorstellst, wenn du an die Niederlande denkst, genau so eins … und ob wir da gewesen sind, mehr als einmal, auch im Mauritshuis, ah, das spricht man nicht so aus, ja natürlich, auch wir waren verzaubert von der Ansicht von Delft, mit diesem Licht, das nicht auf das Bild zu fallen, sondern aus ihm hervorzukommen scheint.
Sie hießen nicht Otto und Maaike. Ich habe keine Ahnung, wie sie hießen, es gab keinen Grund, mir ihre Namen einzuprägen. Ich nahm Lorenzas Hand unter dem Tisch, und sie streichelte mit dem Daumen meine Handinnenfläche, zart, ihre Einwilligung signalisierend.
Als ich ein paar Stunden später erwachte, hatten die Niederländer das Zimmer verlassen. Lorenza schlief, diagonal auf dem Bett liegend, was von der Absonderlichkeit der Nacht zeugte. Ich bedeckte ihre Beine mit einem Zipfel des Lakens und stand auf. Die Fenstertür war weit offen, und ich ging hinaus auf die Terrasse. Ein sehr dünner rosa Streifen verlief parallel zum Horizont. Der Himmel darüber changierte von himmelblau bis tiefblau. Eines Tages, dachte ich, würde diese Insel nicht mehr existieren, würde diese Terrasse nicht mehr existieren und würden auch wir nicht mehr existieren. Lorenza und ich würden keine Spur hinterlassen, wie versunkene Atolle.
Über dem Meer lag eine ringförmige Wolke, kompakt, reglos und außerordentlich glatt. Ein schwebender, gasförmiger Diskus, der nach unten kaum merklich zulief, wie einer Spirale folgend. Ich ging zurück ins Zimmer und holte das Handy. Ich fotografierte die Wolke und schickte das Bild an Novelli mit einer minimalistischen Unterschrift. Guadeloupe.
Er antwortete sofort: Lenticularis-Wolke. Die Luft trifft in ihrem Fluss auf ein Hindernis und wird modelliert. Nicht so selten, aber in jenen Breiten schwer zu sehen. Kann ich sie auf meine Seite stellen?
Einen Moment später kam eine zweite Nachricht: Wenn Sie die Ränder genau ansehen, erkennen Sie die Farben des Regenbogens. Das sind die Tröpfchen, die das Licht brechen. Wenn Sie in Paris vorbeikommen, sollten wir uns sehen.
Im Juli erschien in Nature ein Artikel über den Zusammenhang zwischen Wolken und Klimawandel. Anhand von Satellitenbildern stellten die Autoren fest, dass die Wolken sich durch die Erderwärmung gradweise in Richtung der Pole verlagerten. Die Wolkendecke zog von dort, wo sie zur Filterung der Sonnenstrahlung diente – am Äquator, in den Tropen –, in Richtung der arktischen Zonen, wo sie wesentlich weniger nützlich war. Das würde mit der Zeit zum sogenannten »positiven Feedback« führen, das allerdings überhaupt nichts Positives hatte, es war positiv nur im streng mathematischen Sinn, das heißt, es fungierte als +–Zeichen: Je wärmer es war, desto wärmer würde es werden.
Meinen Kurs in Triest begann ich mit der Lektüre des Artikels von Norris et al. Ich hielt eine Reihe von Lektionen über Wissenschaftsjournalismus im Rahmen eines Masterstudiengangs in Kommunikationswissenschaften und beschloss, den ganzen Zyklus dem Klimawandel zu widmen. Die Wanderung der Wolken schien ein guter Ausgangspunkt, so erschreckend wie poetisch. Der Kurs dauerte insgesamt vier Wochen. Ich buchte ein Airbnb in Cavana. Wäre es nach mir gegangen, hätte ich ein weniger belebtes Viertel gewählt, ich hätte mich mit einem der Hotels begnügt, mit denen die Uni Abkommen hatte und die günstig zum 38er Bus lagen, aber Lorenza hatte mich davon überzeugt, dass ich mir etwas gönnen sollte. Wenn du schon ins Exil gehst, such dir wenigstens einen schönen Ort aus: Bis zum Beweis des Gegenteils hast du keine Schuld abzubüßen. Aber stimmte das? Im Frühjahr und dann anschließend im Sommer, den wir vorwiegend getrennt verbrachten, hatten sich die Dinge zwischen uns erheblich verschlechtert. Wir telefonierten selten. Fremden Zutritt zu unserem Bett gewährt zu haben, hatte sich als riskant erwiesen.
In Triest gewöhnte ich mir eine neue Routine an. Wenn ich keinen Unterricht hatte, stand ich spät auf, stellte aber den Wecker auf sieben, um das Handy anzuschalten und der Welt mittels der ersten WhatsApp-Nachricht zu beweisen, dass ich nicht faul war. Danach hatte ich, abgesehen von der Korrektur der Kursaufgaben, nicht viel zu tun, also ging ich spazieren. Der Weg nach Miramare nahm einen Großteil meines Tages in Anspruch, aber da waren auch der Rilke-Weg und der Karst mit seiner düsteren Kargheit. Ich sagte mir, alle diese Kilometer seien notwendig, um Ideen zu dem Buch zu sammeln, das ich schreiben würde, das sagte ich auch Lorenza, und sie glaubte es oder tat zumindest so, die meiste Zeit aber ging ich nur vor mich hin, mit leerem Kopf. Ich hatte immer Kopfhörer auf, wie ein Jugendlicher. Nach der memory der Spotify-Playlist zu schließen war das meistgehörte Stück in diesem Jahr ein Song von Majical Cloudz, ein Titel mit einem Fragezeichen am Ende: Are You Alone?
Die Studierenden im Kurs waren größtenteils Post-Docs aus den Mint-Fächern: Physiker, Mathematikerinnen, Biotechnologen. Nur selten tauchte ein Linguist oder eine Historikerin auf, und sie fühlten sich fremd. Alle waren sie dort, weil sie sich an einem bestimmten Punkt der akademischen Laufbahn enttäuscht oder ganz einfach müde gefühlt hatten. Sie hatten zu viel oder zu lange äußerst schwierige Fächer studiert, jetzt hofften sie, sich auf dem elastischeren Terrain der Kommunikationswissenschaften auszuruhen. Meine anfängliche Bestrebung ging dahin, dieses Vorurteil auszuräumen: Wenn sie glaubten, das Maximum an Komplexität erforscht zu haben, indem sie sich den Naturwissenschaften widmeten, würde ihnen in meinem Kurs eine andere Form der Komplexität begegnen, die sie ganz beanspruchen würde. Sie zu beeindrucken, war leicht, seit mindestens zehn Jahren hatten sie keine Übung mehr im Schreiben, waren gehemmt, nachdem sie es nur mit Papers oder hochspezialisierten Fachbüchern, Formeln und kartesianischen Grafiken zu tun gehabt hatten. Das weiße Blatt bereitete ihnen Unbehagen.
Unter den Studierenden dieses Jahrgangs war ein Astrophysiker, Christian. Er saß in einer der mittleren Reihen, gegen die linke Wand gelehnt, wie auf, aber auch abseits der Bühne. Er hatte einen undefinierbaren Akzent, und vielleicht war es das, was mich neugierig machte. Oder vielleicht war es die Art und Weise, wie er mich fixierte, während ich vom Verschwinden der Wolken sprach, die Augen unnatürlich weit aufgerissen.
Als er bei der Vorstellungsrunde dran war, sagte er, er hätte sich lange mit Gravitationswellen und Schwarzen Löchern beschäftigt. Aber diese Art von Studium, sagte er, indem er ein Büschel Haare um den Finger wickelte, tue ihm nicht gut. Mitten in einem Projekt und mit einem Artikel kurz vor der Publikation hatte er beschlossen, die Astrophysik aufzugeben und auf die Erde zurückzukehren. Er verwendete genau diesen Ausdruck, »auf die Erde zurückkehren«. Ich fragte ihn, in welchem Sinn ihm die Beschäftigung mit Schwarzen Löchern nicht guttue, und als er antwortete, achtete er peinlich darauf, meinen Blick nicht zu kreuzen: Ist es Ihrer Ansicht nach möglich, Prof, dass ein Wissensgebiet die Oberhand über dich gewinnt?
In der Mensa ging ich zu Marina, der Koordinatorin des Kurses. Ich fragte sie, was sie von Christian halte, und sie begriff sofort. Er ist sehr empfindlich, sagte sie, besser behutsam sein.
Ich hatte den Eindruck, sie behielte eine relevante Information für sich. Die Personalakten der Studierenden und die sensiblen Daten der Zulassungsgespräche wurden nicht an uns Lehrbeauftragte weitergegeben.
Mir scheint, er hat Talent, sagte ich.
Ach ja? Und woran hast du das gemerkt? Du hast sie zwei Stunden lang gesehen.
Instinkt.
Instinkt, wiederholte sie. Dann sah sie vom Tablett auf und wandte mir ein gezwungenes Lächeln zu.
In den Evaluierungen des vergangenen Jahres hatten sich einige Studierende über meine »Parteilichkeit« beklagt. Sie behaupteten, einige Arbeiten seien mit besonderer Aufmerksamkeit korrigiert worden, während anderen nur wenig Zeit gewidmet worden sei. Außerdem würden im Unterricht stets dieselben reden, meist Männer. Marina hatte mir die Ergebnisse des Fragebogens mit einer vollkommen neutralen Mail geschickt: Im Anhang Kopie von. Ich hatte Lorenza das Endergebnis gezeigt (nicht die einzelnen Kommentare), und sie hatte etwas gezögert, bevor sie sagte, siebeneinhalb erscheine ihr nicht so schlecht. Aber ich wollte nicht siebeneinhalb, ich wollte neun oder zehn, ich wollte lobende Erwähnungen und Komplimente der Prüfungskommission. Ich hatte bei Giulio Trost gesucht: Findest du es normal, dass jetzt die Studenten den Lehrern Noten geben? Studierende-Kunden, hatte er mich korrigiert, da kannst du nichts machen, das ist der neue Trend im Unterricht. Nur mühsam konnte ich mir die Frage verkneifen, wie seine letzte Evaluierung gewesen war.
Was Christian anging, hatte ich mich jedenfalls nicht getäuscht. Im Unterricht lieferte er glänzende Beiträge, er war immer bei der Sache, sogar leidenschaftlich. Eines Morgens las ich einen Passus aus Kollaps vor, und am nächsten Morgen hatte er ein Exemplar davon vor sich auf dem Tisch.
Als er mit der Präsentation seines Reportageprojekts an der Reihe war, stand er auf und stellte sich vor die Klasse. Sein Vortrag war konfus, er zwirbelte weiter seine Haarlocke, und was er vorstellte, konnte man nicht wirklich eine Idee nennen, allenfalls einen Fluss von Gedanken, denen eine Besorgnis zugrunde lag. Er sprach von einem point of no return, ein Begriff, der ihm nach Jahren des Studiums der Schwarzen Löcher vertraut war. Wenn ein Körper den Ereignishorizont überschreitet, verschwindet dieser Körper, man weiß nichts mehr von ihm, und alles, was danach mit ihm geschieht, ist undurchdringliches Geheimnis. Dieser Körper könnte sich jenseits des Horizonts befinden, deformiert und zerstückelt, oder in etwas anderes verwandelt sein, womöglich in pures Licht. Christian fragte sich, ob ein solcher Punkt auch für unseren Planeten existierte, eine Grenze, jenseits derer wir einfach nur fallen. Wenn es ihn gab, wie weit war er von diesem Morgen entfernt, von diesem präzisen Moment, in dem er sprach? Vielleicht, sagte er, haben wir ihn schon überschritten, ohne es zu bemerken. Und vielleicht … also … Doch da brach er plötzlich ab. Darüber will ich schreiben.
Er wirkte erschöpft, als ob jede seiner Zellen zitterte. Verlegenheit machte sich im Raum breit. Ich forderte seine Kommilitonen auf, den Vorschlag zu kommentieren, sie murmelten Anerkennendes, aber sie waren perplex. Also ergriff ich wieder das Wort. Ich sagte zu Christian, dass das Thema sicher faszinierend sei, dass es mir aber auch sehr vage erschiene. Er laufe Gefahr, sich zu verlieren. Du solltest dich auf etwas Greifbareres konzentrieren, an dem man diese Verwandlung schon sehen kann.
Ich weiß nicht, auf was, erwiderte er streng, immer noch, ohne mich anzusehen.
Zum Beispiel die Veränderung der Ökosysteme.
Ich erzählte ihm von der Dichrostachys cinerea, der afrikanischen Pflanze, die das Ökosystem Guadeloupes bedrohte. Aber du solltest eine Situation im näheren Umfeld finden, die du direkt beobachten kannst. Denn das machen wir hier, wir betrachten die Realität und schreiben Reportagen.
Unwillkürlich war ich näher zu ihm hingegangen, so dass ich ihn in der Stille atmen hörte. Ich war ein guter Lehrer, kein mit siebeneinhalb zu bewertender. Ich konnte motivieren, anleiten, ich hatte Fantasie, ich war großzügig.
Christian sagte weder ja noch nein, nicht einmal, dass er darüber nachdenken wolle. Er starrte auf einen Punkt jenseits des Fensters, als könne er den Blick nicht von etwas wenden, einem Ereignishorizont, dem wir alle entgegenschritten, den aber nur er sehen konnte. Er bat um Erlaubnis, an seinen Platz zurückzukehren.
Unter den Reportagen dieses Jahres, an die ich mich erinnere: eine vom Aussterben bedrohte besondere Art von Teichfrosch, die Auswirkungen der Produktion von Büchsenfleisch auf die Erderwärmung, die Erforschung einer Höhle in Slowenien, die eigentlich vor dem Klimawandel hätte geschützt sein müssen, sich aber auf dramatische und irreversible Weise veränderte.
Christian hat meinen Rat schließlich befolgt und als Thema den Götterbaum gewählt, einen Baum asiatischer Herkunft, der sich mit bestürzender Geschwindigkeit in unserer Vegetation ausbreitet. Sein Anfang, den er laut vorlas, erzählte von einer Zugreise nachhause, während der er bemerkte, dass der Götterbaum sich die ganze Eisenbahnlinie entlang mimetisch unter die heimischen Pflanzen gemischt hatte. Der Text war voller Bilder. So wogten beispielsweise die Wipfel in dem Versuch, mit ihm zu kommunizieren, und an einem bestimmten Punkt wurde der Götterbaum wie ein einziger riesiger pflanzlicher Organismus beschrieben, ein Rhizom, das sich dicht unter der Oberfläche über den ganzen Globus erstreckte.
Als er zu lesen aufhörte, außer Atem, klatschten seine Kommilitonen Beifall. Ich fragte mich, ob sie das »voreingenommen« finden würden, aber am Ende schloss auch ich mich dem Applaus an. Um diesen Exzess auszugleichen, unterzog ich diesen Anfang einer strengeren Prüfung. Wann würde er zu den relevanten Informationen kommen? Wo waren die Daten, jenseits der subjektiven Sinneseindrücke? Der Gebrauch der zweiten Person Singular schließlich verwunderte mich, und die Zeichensetzung schien auch etwas willkürlich, wenigstens nach dem zu urteilen, wie er gelesen hatte.
Christian veränderte seinen Gesichtsausdruck, während ich sprach. Nervosität machte sich in der Klasse breit, und eine Frau, Greta, brachte die Anspannung auf den Punkt: Mir hat es so gefallen. Haben nicht Sie selbst uns geraten, persönlich zu sein, Prof?
In der folgenden Woche war Christian nicht im Kurs. Ich fragte seine Kommilitonen, ob sie den Grund wüssten. Einige wandten sich um und sahen Greta an, oder vielleicht nicht, vielleicht schreibe ich ihnen das im Nachhinein nur zu. Kann sein, dass sich niemand zu ihr umdrehte und sie ansah und dass sie einfach nein sagten (und logen). Doch nach der Stunde passte mich ein Student auf dem Flur ab: Da ist etwas, Prof. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist oder ob ich es Ihnen sagen soll.
Was denn?
Nachts ist Christian immer in einem Lokal, das Mirò heißt.
Ich weiß, wo das Mirò ist.
Okay, das wusste ich nicht.
Und was macht er da?
Er zuckte mit den Schultern. Vielleicht geht er nicht immer hin, sagte er, aber zwei von uns haben ihn zu verschiedenen Zeitpunkten dort gesehen.
Und habt ihr nicht mit ihm gesprochen?
Schuldbewusst ließ er den Kopf hängen. Mit Christian zu reden ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, aber er ist ein bisschen seltsam.
Ich versicherte ihm, dass ich nichts dergleichen festgestellt hatte, womit ich ihm zu verstehen gab, dass die Seltsamkeit ganz in ihrem Misstrauen lag.
An diesem Abend ging ich ins Mirò. Die Stimmung war die einer Studentenparty. Ich hoffte, niemandem aus dem Masterstudiengang zu begegnen, weil sie mich düster finden würden, wenn ich allein an einem Tisch saß und trank. Auch deshalb suchte ich mir einen Platz etwas abseits neben dem DJ-Pult. Um ein Uhr nachts war ich ein wenig betrunken und im Begriff zu gehen, ich weiß nicht, ob enttäuscht oder erleichtert, als ich ihn hereinkommen sah, Christian, in Pyjama und Flip-Flops.
Er hatte den Laptop unter dem Arm. Er setzte sich an die Theke, und die Barkeeperin beugte sich vor, um ihn auf die Wangen zu küssen. Ich bemerkte eine Vertrautheit zwischen ihnen, als ob diese Szene sich jede Nacht immer gleich abspielen würde. Die Barkeeperin servierte ihm ein Bier, während Christian den Bildschirm aufklappte und zu tippen begann. Das Lokal war nicht sehr groß, Luftlinie trennten mich fünf Meter von Christian, der mir den Rücken zukehrte, weshalb ich seine nackten Fersen und einen Streifen Haut am unteren Rücken sah, wo das Oberteil des Pyjamas nach oben rutschte, weil er nach vorne gebeugt dasaß. Der Bildschirm war von mir aus gut zu sehen, und auch ohne die Worte zu unterscheiden, war klar, dass er ein Word-Dokument bearbeitete.
Als der DJ