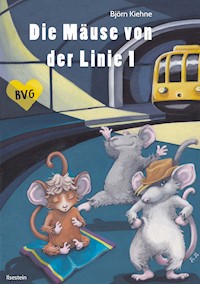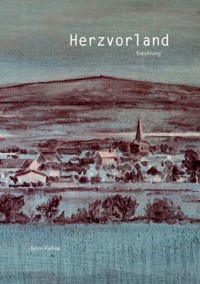Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Ilsestein
- Sprache: Deutsch
Reisen Sie mit Taube und Tiger in ein mythisches Indien, eine Welt zwischen Märchen und Wirklichkeit. Banyanbäume, die den Himmel tragen, Berge, wie Heilige gehüllt in Umhänge aus Eis, und zwei Männer, die ungleicher nicht sein könnten, auf geheimer Mission im Himalaya. Ein wildes Bergvolk soll zur Besinnung und zurück unter die Herrschaft des Rajas gebracht werden. Tückische Hinterhalte, ein verrückter Elefantenpriester und der unberechenbare Fluss erwarten sie. Jeder Schritt birgt neue Gefahren. Können sie ihre Mission erfüllen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Christine und Günther
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel I: Im Wald
Kapitel II: Auf dem Fluss
Kapitel III: In den Bergen
Dank
Zum Autor
Zum Text
Vorwort
Ich bin in einem kleinen Dorf im Harzvorland aufgewachsen. Im Osten beendete der Eiserne Vorhang meine Welt und im Süden drängten sich die Berge des Harzes aneinander. Von den Hängen des Brockens sprangen Bäche die Täler hinab und trugen Glimmerschiefer und Geschichten mit sich. Auch wenn dieses indische Märchen dem Lauf des Ganges folgt, sind es doch immer die Bäche und Flüsse der Kindheit, an denen man sein Leben lang entlangstreicht.
Die Erzählungen in der Edition Ilsestein laden zum Innehalten und Aufbrechen gleichermaßen ein.
Björn Kiehne
Goslar, im Winter ’21
I Im Wald
Es war fast vollkommen still, nur vereinzelt waren die Geräusche des Morgens zu hören. Das Rascheln einer Schlange, die sich durch das trockene Gras wandte, das Fallen der großen Teakbaumblätter, die vorsichtig aus dem Dach des Waldes auf den staubigen Boden herabsegelten. Und das Rauschen des kleinen Baches, der die Kieselsteine Millimeter für Millimeter vor sich hertrieb, hinab aus den Hügeln in die weite Gangesebene. Er kannte jedes dieser Geräusche. Mit seiner Aufmerksamkeit folgte er ihnen nach, wenn sie in sein Ohr drangen, das Trommelfell bewegten, die Nervenenden reizten und als feine Schwingung durch den ganzen Körper wanderten. Er versuchte, alle Empfindungen gleich zu behandeln, zu verstehen, dass sie sich veränderten. Jedes Geräusch, den Windhauch, der die warme Luft bewegte, genauso wie den Sturm, der den alten Baumriesen, unter dem er saß, durchschüttelte und womöglich einen Ast auf ihn warf. Er behandelte den Sonnenstrahl, der seinen Weg durch das dichte Blätterwerk gefunden hatte und seine Nase kitzelte, genauso wie den Regentropfen, der kalt in seinen Nacken schlug. In diesen Augenblicken war er frei. Sein Atem war fein und hörte fast vollends auf. Seine Aufmerksamkeit stieg hinab, in die inneren Räume, in denen sein Name nicht von Belang war.
Anand. Alle Menschen in den umliegenden Dörfern kannten ihn. Jeden Morgen ging er zu den wenigen Hütten, die sich um einen Platz mit Brunnen und Feigenbaum drängten. Er stand still mit seiner Almosenschale vor den Türen aus Flechtwerk, wartete, bis ihm die Frau des Hauses auftat. Dann trat er mit gesenktem Kopf vor und man gab ihm den vorgekochten Reis mit einem hölzernen Löffel direkt in die Bettelschale. Er schwieg, blickte zu Boden, seine Aufmerksamkeit fest auf das gerichtet, was in seinem Inneren geschah. Das Aufblitzen eines Gedankens. Das Aneinanderreiben der Atome. Der ganze Tanz des Werdens und Vergehens. Dann sprach er einige Zeilen aus der Mangala Sutta, die Verse, die ihm in den Sinn kamen und die so oft genau zu dem passten, was die Familie der Spender beschäftigte. Einige Zeilen über die Pflege der Alten, über das Geben, über die richtigen und die falschen Freunde oder das Glück, einen guten Beruf zu lernen, der einem ein Einkommen sicherte. Alles kleine Bausteine des Glücks, die so schnell im Alltag der Menschen verschütt gingen. Sie hörten still zu. Sie verstanden die Sprache, in der der Mönch leise sang, nicht mehr vollständig. Seit der Buddha über die Ebene Nordindiens gewandert war, waren viele Jahre vergangen. Noch waren überall Bauwerke zu finden, die von dem Respekt zeugten, die die Menschen ihm entgegenbrachten. Kleine Cetiyas, Stupas und große Klöster, in dem die Texte und die Techniken der Meditation immer neu mit Leben gefüllt wurden. Noch mehr aber war etwas in der Atmosphäre geblieben. Trotz der Konflikte, trotz der Armut, die vielerorts von den Städten und Dörfern Besitz ergriffen hatte, lag über der Landschaft: Frieden wie Goldstaub. Erinnerung an die Zeit, in der Indien der Lehrer der Welt war.
Anand ging von Haus zu Haus, sammelte sein Essen, sang leise und ging dann mit gutgefüllter Schale zurück zu seiner Hütte im Wald, seinem Zufluchtsort, für den er sich entschieden hatte, als ihm das Leben im Kloster zu laut geworden war. Die Diskussionen über die Interpretation der Lehre, die Unstimmigkeiten über einzelne Begriffe und die richtige Auslegung der Anweisung für die Aufmerksamkeitstechnik hatten ihn aufgerieben. Er suchte den direkten Zugang, wollte selbst erfahren, was es hieß, sich mit jedem Atemzug in Richtung Freiheit zu bewegen.
Er sprach also mit dem Abt, holte seine Erlaubnis ein und machte sich auf, einen Ort zu suchen, der ihm den Frieden bot, den er für seine Praxis brauchte. Frisches Wasser, den Schatten alter Bäume, ein ebener Boden, Material für eine Hütte und ein Dorf mit Menschen in der Nähe, die ihn mit Essen versorgen würden. All das fand er dort, wo die Ebene begann, sich aufzuwellen, wo der Lauf des Flusses laut wurde, weil sein Bett enger wurde und mit Steinen aus dem Himalaya ausgefüllt war. Hier war der Wald dichter, von den Schneefeldern schwang sich von Zeit zu Zeit ein kalter Wind hinab und alles war erfüllt von einer Klarheit und Stille, die ihn einlud, sich zu setzen, zur Ruhe zu kommen, zu beobachten.
Ein Bauer hatte ihm die Kuti gebaut. Ein Podest, ein wenig erhoben, um die Schlangen und Skorpione davon abzuhalten, auf die Schlafmatte aus Schilfgeflecht zu kriechen, einige dünne Wände aus geflochtenen Weidenästen, das Dach mit Palmwedeln belegt, gerade dicht genug, um leichtem Regen zu trotzen. Vor der Hütte ringelte sich ein kleiner Bach wie ein schüchternes Reptil. Er brachte frisches Wasser und erfüllte die Luft mit seinem Flüstern.
Es gab eine Taube, die sich immer in einer gewissen Nähe zu Anand aufhielt. Sie gehörte zur Familie der Felsentauben. Eigentlich lebten die immer zu zweit. Sie führten ein stilles Leben, das umeinanderkreiste. Doch diese hatte keinen Partner. Ob er verstorben war oder sie keinen gefunden hatte, das wusste Anand nicht. Sie saß auf dem Zweig eines Bodhibaumes, wenn er meditierte. Sie schritt neben ihm, wenn er seine Gehmeditationen machte. Sie pickte im Gras, wenn er das Essen aus seiner großen Bettelschale zu sich nahm. Sie kam nie bis zu ihm heran. Sie ließ sich nicht füttern. Sie setzte sich weder auf seine Schulter noch auf seinen Kopf. Aber sie war immer bei ihm.
Andere Tiere kamen ihm dabei viel näher und das gab allerhand Gesprächsstoff und Verwunderung unter den Menschen im Dorf. Affenhorden besuchten den Mönch. Obwohl sie sonst immer brüllten, sich stritten und einander die Felle durchlausten, wurden sie in seiner Nähe ganz still. Ja, sie setzten sich sogar hin, so als wollten sie meditieren. Es gab Papageienschwärme, die sich auf das Dach seiner Kuti setzten und diesem eine Farbe von Blau und Grün schimmerndem Lapislazuli gaben. Dann waren da die größeren Tiere, die Büffel, die mit einem einzigen Tritt seine kleine Hütte zerstören konnten. Doch sie legten sich nur in den Schatten der Palmen und dösten zufrieden vor sich hin, während Anand sein Tagwerk verrichtete. Ein seltener, aber sehr beeindruckender Besucher war ein Elefant aus dem Dschungel, der regelmäßig, aber in großen Abständen vorbeischaute. Er brachte immer, und das war, was alle, außer den Mönch selbst, zutiefst erstaunte, etwas mit. Mal war es eine Staude wilder Bananen, dann ein Büschel von Kushi-Gras. Eigentlich hatte Anand ein wenig Angst vor diesem großen Tier. Er war froh, dass der Elefant immer einen gewissen Abstand zu ihm hielt. Vielleicht aus Respekt, vielleicht spürte er aber auch, dass der Mönch ein wenig angespannt war, wenn der große graue Koloss auf ihn zukam. Er legte das jeweilige Bündel behutsam vor die Hütte des Mönches, machte keinen Laut und verschwand wieder im Dunkel des Waldes.
Für die Dorfbewohner, die den Besuch der Tiere aus der sicheren Entfernung eines Gebüschs beobachteten, war es ein Wunder. Sie scheuchten Tiere von den Feldern, bauten Zäune, schlossen alles Essbare vor den Affen weg, und hier, im Wald, wo der Bach floss, brachten die Tiere dem Mönch Dinge mit, als wollten sie an seinen Verdiensten Teil haben.
Das Tagwerk des Mönches war einfach. Es folgte der immer gleichen Abfolge von Aufstehen um vier, Körperpflege, Meditation, erster Almosengang, Essen etwa um elf, dann Ruhezeit, Meditation, Saubermachen, Meditation, Ausruhen. Sobald das Licht schwand, verschwand auch Anand in seine kleine Hütte, um zu schlafen. Die Geräusche der Nacht umhüllten ihn wie eine warme Decke. Am Morgen waren es die Vögel, die ihn weckten. Wenn er aus der Hütte trat, pickte schon die Taube im Staub vor ihm nach Körnern. Er schätzte diese Eintönigkeit, dieses Immer-Wiederkehren des Gleichen. Es war der friedliche Rahmen, der es ihm ermöglichte, mit seiner Aufmerksamkeit tiefer in sich hinabzusteigen. Die Bewegungen des Körpers, der Atem, die Dinge, die in den Geist traten. Das Zusammenspiel von Geist und Körper: eine einzige Aneinandereihung von Veränderungen ohne Innehalten, ein Nebel von Empfindungen, am Ende nichts, was blieb.
Doch an diesem Morgen war viel Unruhe in seinem Geist. Ein Gedanke jagte den anderen. Er konnte Verspannungen im Körper spüren. Die sonst so feinen Empfindungen schlugen aneinander wie Wellenkämme einer vom Sturmwind aufgewühlten See. Er kannte diese Empfindungen. Er wusste: Etwas würde heute passieren. Und so kam es auch.
Sie standen in einer geraden Reihe vor ihm. Die Gesichter hochgestreckt. Muskulöse Körper, die Körper von Kriegern. Menschliche Maschinen für den Kampf. Anand saß unter dem alten Baum und erwartete sie. Er hatte sie lange gespürt, bevor er sie sah, deren Würde, die Arroganz der Kraft, die Angst vor dem Wald, dem Versagen, die Sorge um die, die daheim in der Stadt in den Dörfern auf die jungen Männer warteten. Anand öffnete langsam die Augen. Die Reihe der Soldaten formierte sich neu, ein Gang wurde gebildet und ein Herr in Zivil trat durch ihn hindurch. Er baute sich würdevoll vor Anand auf, ehe er sich auf die Knie setzte und sich dreimal tief verbeugte. Buddha, Dhamma, Sangha, für jedes der drei Seiten des Juwels eine Verbeugung. Ob er wirklich wusste, was er tat, fragte sich der Mönch. Der Gesandte füllte sich sichtlich wohler, als er wieder voll ausgestreckt vor ihm stand. Sein Bauch schaukelte leicht hin und her. Von seiner Stirn perlte Schweiß. An den goldbestickten Schuhen saß der Staub wie ein Makel, doch seine Nase reckte sich stolz empor und begann die Worte mit rhythmischen Bewegungen zu untermalen, die er aus der Hauptstadt mitbrachte:
„Ehrwürdiger Anand, Bhanteji, ich bringe dir hochachtungsvolle Grüße von unserem Raja. Er hofft, dass es dir gutgeht. Bitte nimm seine Spende an. Sie soll dir, selbst hier in diesem Wald“, er sah sich die Nase rümpfend um, das Sonnenlicht ließ seine schweren Goldketten aufblitzen, „einen, äh, komfortableren Aufenthalt ermöglichen“. Er verbeugte sich tief und machte den Weg für zwei Krieger frei, die einen Teppich auf ihren Schultern trugen. Vorsichtig legten sie ihn vor dem Mönch ab und entrollten ihn im dämmrigen Licht. Was erschien, war eine gewebte Abbildung eben dieses Waldes, in dem sie sich befanden. Die alten Bäume mit ihren Stämmen, an denen sich tiefgrüne Kletterpflanzen heraufwanden, hochaufschießendes Gras dort, wo Licht hinkam, selbst die Schatten auf der Erde waren eingewebt. Anand sah sich den Teppich an und dann den schwitzenden Boten: „Warum bringst du mir ein Abbild dessen, was mich umgibt? Meinst du, dieser Wald reicht mir nicht, so dass ich einen Zweiten aus Fäden brauche?“ Der Bote verneigte sich etwas verlegen: „Aber siehe doch, er ist ganz weich. Du kannst wunderbar auf ihm meditieren oder auch ausruhen.“ Der Mönch nickte und schwieg. Ein unausgesprochenes „Was wollt Ihr hier?“ lag in der Luft. Und als hätte der Bote die unsichtbaren Worte aufgenommen, begann er zu sprechen: „Der Raja bittet Euch in die Hauptstadt. Er bittet Euch inständig, ehrwürdiger Anand, er braucht Eure Weisheit und Euren Beistand.“ Warme, angenehme Empfindungen breiteten sich im Körper des Mönches aus. Das hatte einen Grund: Ihm gefielen diese Worte, und dieses Gefallen zeigte sich in seinem Körper als Wellen feiner und rundum angenehmer Empfindungen.
Er kannte den König als jungen Prinzen. Als dieser für einige Monate Novize wurde, um Zucht und Anstand zu lernen, war Anand selbst gerade ins Kloster gekommen. Anand hieß damals noch Balu. Sie mussten beide etwa acht Jahre gewesen sein. Während er selbst mit jeder Faser seines Körpers Mönch werden wollte, fragte sich der Prinz mit jeder Minute, mit jeder Stunde, jedem Tag, jeder Woche mehr, was er eigentlich an diesem todlangweiligen und unbequemen Ort sollte. Balu versuchte es ihm zu erklären, aber es war zwecklos. Er musste heute noch darüber lachen, wie er als Achtjähriger dem Prinzgefährten alle möglichen Geschichten vom Buddha vortrug. Er erfand sogar neue, um dem jungen Prinzen die Zeit im Kloster sinnvoll erscheinen zu lassen, doch den ödete alles an. Er versteckte Essen unter seiner Robe und störte die Meditation der anderen Samaneras durch lautes Schnarchen, das nicht das eines Jungen zu sein schien, sondern viel eher das eines Ehrfurcht gebietenden Mannes. Genau der Mann, der er heute war: der Raja, Gebieter über ein Königreich, das sich von den ersten Vorbergen des Himalayas bis weit hinunter in die Gangesebene erstreckte. Er regierte über Millionen. Mit einem Wort konnte er ganze Städte vernichten. Und dieser Raja bat ihn um Rat, wollte seinen Beistand. Anand lächelte.
Die Dorfbewohner staunten über die Prozession von Soldaten. Sie verneigten sich ehrfürchtig. Angeführt wurde die Karawane von einem Kriegselefanten, auf dessen Trage der stolze Bote saß, als durchpflügte er mit seiner langen Nase die Felder der Bauern selbst. Der Ehrwürdige Anand, der in sich gekehrt lächelte, schritt zu Fuß zwischen Elefant und Soldaten. Er war sich der Wirkung dieses Bildes bewusst: Der hohe Beamte hoch zu Elefant, die Soldaten im angestrengten Gleichschritt, doch er, der mit jedem Schritt in Richtung Freiheit ging, zu Fuß. Er hatte der Welt entsagt. Hatte allen Reichtum aufgegeben, den sicheren Hort der Familie abgelehnt, hatte sich als einzige Sicherheit die Zuflucht zum dreifachen Juwel zugestanden. Keine Macht, kein Einfluss, nichts, nur diesen leisen Wind der Freiheit, der ihn umspielte und mit dem er die Landschaft um ihn herum segnete. So schritten die Eitelkeit des Einen und die Bescheidenheit des Anderen im Gleichschritt durch den Staub. Die Taube stapfte im selben Takt nebenher, flatterte manchmal auf einen Ast, betrachtete die Karawane aus der Höhe und schloss sich ihr dann wieder an, indem sie, erhobenen Hauptes, den gleichen Schrittrhythmus annahm wie die Prozession.
Anand konnte die Stadt schon riechen, noch bevor sie hinter den grünen Hügeln erschien. Ein Gemisch aus menschlichem Schweiß, den Ausdünstungen der Tiere, dampfenden Müllhalden und frischgekochtem Essen, Holzfeuer, Jasminblüten. In das Zwitschern der Vögel und den gleichmäßigen Takt der Schritte mischten sich Marktschreie, gebrüllte Befehle der Soldaten, Musik, Fanfarenklänge, der Schrei eines Esels. Anand machte die Stadt schon aus der Ferne nervös. Sie war das genaue Gegenteil seines Heimes im Wald. Es war genau das Gegenteil von dem, was er suchte. Er wollte Frieden, hier herrschte Krieg, die kleinen Schlachten des Alltags: Geld verdienen, sich streiten, sich freuen, weinen, lieben, hassen. All das, was er hinter sich zu lassen versuchte. Und auf all das bewegte er sich nun zu. So als übten die geöffneten Tore in der Stadtmauer eine unsichtbare Anziehungskraft aus, wurde der Elefant mit dem Boten schneller, wurden die Soldaten schneller und Anand blieb nichts anderes übrig, als sich dem neuen Tempo anzupassen. Vor dem Tor stellten sich zwei Wachen in den Weg, erhoben ihre Speere und forderten die Papiere der Reisenden. Es war mehr eine Formalie, denn schon nach einem kleinen Augenblick traten sie zur Seite und ließen die Karawane eintreten. Mit dem Schritt durch das Tor hindurch trat der Mönch in eine andere Welt. Ihm war, als verließe er einen kühlen Raum, um sich in eine warme gallertartige Masse zu begeben. Das Geschrei, der Geruch, all das vermengte sich zu einem unappetitlichen Brei. Er versuchte, nicht darauf zu reagieren. Alles, was an seinen Sinnestoren ankam, ließ er zwar ein, er bot ihnen aber keinen Platz an, sich hinzusetzen. Er beobachtete mit seiner geschulten Aufmerksamkeit die Wellen von Empfindungen, die diese Reize in ihm hinterließen. Sie rannten durch seinen Körper, überschlugen sich, brachen sich aneinander und verebbten, während sogleich ein neuer Reiz anklopfte.
Eine Gasse hatte sich vor der Karawane gebildet und Anand sah, dass sich einige Menschen an ihrem Rand auf die Knie warfen, die Hände zusammenlegten und sich dreimal vor ihm verbeugten. Sie murmelten etwas, den kleinen Fetzen einer Sutta, die sie von den Besuchen der Mönche in ihren Häusern erinnerten.
Der Raja liebte den Pomp. Für ihn war es die einzig richtige Antwort auf die Vergänglichkeit. Schnörkel, Diamanten, Sklaven aus fernen Ländern, Frauen, Essen, so köstlich und zart, dass es in der warmen Luft verdunstete. Er hatte drei Paläste. Einen für die heiße Jahreszeit. Hier war die Decke mit fein durchlöcherten Silberplatten abgehängt, über die klares Wasser von einem Gletschersee im Himalaya geleitet wurde. Der Dunst, der so entstand, kühlte den ganzen Saal und legte sich angenehm auf die Haut. Manchmal ließ er das Wasser mit ätherischen Ölen mischen. Jasmin zum Morgen, Lavendel zum Abend, Amber, wenn er sich mit einer seiner Frauen traf. Der zweite Palast war für den Winter bestimmt. Unter den Marmorfliesen floss warmes Wasser. Es kam aus heißen Quellen, die im Garten sprudelten und durch die Tonskulptur eines Drachen geleitet wurden. Aus seinem weit aufgerissenen Maul stieg Dampf. In jedem Raum gab es ein offenes Feuer, in dem nur wohlriechende Hölzer brannten: Wacholder, Sandelholz, das harzige Holz von jungen Kiefern. Die Feuer loderten in verschiedenen Behältern. Im Thronsaal tanzten sie in einer goldenen Krone, in den Schlafzimmern stiegen sie aus runden Behältern, die aussahen wie Brüste. Der dritte Palast war für den Frühling bestimmt. Er war der Luftigste. Innen und außen verschmolz. Der Garten kroch mit seinen Blüten durch lange Säulengänge in den Palast, dieser wiederum kroch mit seinen Marmormosaiken in den Garten. Wasser wurde durch kleine Rinnen durch die Gartenzimmer und Palasträume geleitet. Auf ihnen trieben stets frische Blüten und kleine aus Papier gefaltete Boote, auf denen Gedichte standen, die der König liebte.
Jetzt saß der in dem Thronsaal des Sommerpalastes, in dem es trotz des Wasserdunstes, der von der Decke fiel, sehr heiß war. Musik waberte durch den Raum wie ein Schwarm müder Vögel, es roch nach Pfefferminze, denn ein leichter Husten plagte den Herrn. Er war auf hunderte Kissen gebettet, die seinen massigen Körper stützten. Sie hatten die Farben des Sommers: Gelb wie die Felder, trotzig wie das Grün der Sala-Bäume. Man konnte nicht genau sagen, wo der Raja anfing und wo er aufhörte. Durch seine beachtliche Körperfülle verschmolz er mit den Kissen zu einer einzigen Skulptur. Hustete er, so schienen alle Kissen mit zu husten, und die Leibärzte, Diener und Frauen sahen ihn besorgt an.
Anand durchschritt das Tor zum Palast, und es kam ihm erneut vor, als verließe er diese Welt für eine andere. Draußen gab es Alter, Krankheit, Tod, Lärm, Schmutz, Streit, doch hinter den Palastmauern, da blühte ein ewiger Garten. Schon im ersten Hof sprangen muntere Fontänen links und rechts des Weges in die heiße Luft. Man hatte große und bunte Schmetterlinge gezüchtet, die elegant durch den Blütenduft flatterten. Stolze Rosen reckten ihre Blütenköpfe, Bambus rauschte in den Ecken. In goldenen Käfigen saßen Singvögel, die mit ihrem Gesang die Schwere der Steinmauern auflösten. Auf der Rasenfläche im Zentrum des Gartens graste ein Hirsch. Als Anand den Weg betrat, blickte er vom Äsen auf und betrachtete den Mönch mit schwarzen Augen. Er kam einige Schritte heran und schnupperte an Anands ausgestreckter Hand. Der konnte den warmen Atem des Tieres auf seiner Haut spüren. Er nahm seine Neugier und auch den letzten Rest Angst wahr. Dann legte er seine Handfläche leicht auf den Kopf des Tieres und es ging vor ihm in die Knie. Ein Raunen erhob sich aus den Reihen der Soldaten und Diener des Hofes. Er war da, der Heilige aus dem Wald, der, der mit den Tieren sprach wie mit Brüdern und Schwestern.
Schon als Kind hatte Anand ein Gespür für Tiere gehabt. Er ging mit den Wasserbüffeln in die Felder, er molk die Kuh, er lockte die Hühner zurück in den Stall, wenn sie beim Scharren ihren Weg nach Haus nicht mehr finden wollten. Schon immer interessierte er sich für sie und ihr Leben: das der Tiere auf dem Hof, später für die Vögel in den Bäumen, die Affen, die zu Besuch kamen und, zumindest aus der Ferne, auch die Raubtiere, die in den dunklen Büschen um das Dorf herum auf Beute lauerten. Er erinnerte sich an den Augenblick, in dem er sich im Wald unter einen Baum setzte, müde. Den ganzen Tag hatte er die Büffel vor sich her von Grün zu Grün getrieben. Er wollte sich ausruhen und fand zwischen den Wurzeln eine Mulde, in der altes Laub wie ein weiches Kissen lag. Er strich es für sich zusammen und setzte sich im Schneidersitz, den Rücken an den mächtigen Stamm gelehnt. Die Geräusche des Waldes, das Rauschen des Blätterdaches, das Zittern des Lichts, das den Weg durch die Millionen Blätter fand. Er schloss die Augen und wie von selbst begann sein Geist, sich unterhalb der Nase und oberhalb der Oberlippe auszuruhen. Er spürte wie der Atem ein- und ausging. Manchmal war er lang, manchmal war er kurz. Beim Einsaugen der Luft war der Atem kühler, beim Ausatmen wärmer. Und dann war der Atem verschwunden. Da war nur noch Stille und von weit her rollte eine Welle von Freude heran, die er so in seinem Leben bisher nie erlebt hatte. Sie näherte sich seinem Bewusstsein, die Welle brach sich am Rest der übriggebliebenen Gedanken wie an Felsen am Meeresufer. Bis sie vollends verschwanden. Erschrocken und verzückt öffnete er die Augen. Vor ihm, auf dem graslosen Platz unter dem Baum stand ein Hirsch und sah ihn aus seinen großen schwarzen Augen an. In diesem Augenblick wusste er, dass er Mönch werden wollte.
Als er seine Unterkunft betrat, musste er leise auflachen. Das sah dem Raja ähnlich. Er konnte das Scherzen nicht lassen. Mönche und Nonnen sollten nicht auf hohen und luxuriösen Betten schlafen, doch die Einfachheit und Askese, die er in dieser Kammer vorfand, war wirklich ein wenig übertrieben. Er wusste, dass sein alter Freund ihn hier mit einem Augenzwinkern begrüßte. Auf dem festgetretenen Lehmboden waren in einer Ecke ein paar trockene Blätter aufeinandergeschichtet und mit einem leichten Leinentuch abgedeckt. Daneben stand eine alte Kiste mit einem Steinkrug mit Sprung an der Seite, aus dem das Wasser tropfte. Alle Bemalungen der Wände waren mit Kalkfarbe übertüncht. Das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen, dachte Anand schmunzelnd bei sich. Er hatte seine Aufmerksamkeit darauf trainiert, nicht auf attraktive Motive zu reagieren, und zwar auch nicht auf richtig attraktive Motive, wie eine junge, schöne Frau, die ihm beim Almosengang den Reis in seine Schüssel tat. Was waren dagegen ein paar Wandmalereien. Er zuckte mit den Achseln und lächelte in sich hinein. Der Raja, der alte Gauner, immer zu einem Späßchen aufgelegt. Er machte sich frisch und setzte sich dann auf den für ihn vorbereiteten Meditationshocker. Er konnte die Reise, die Eindrücke des Ganges durch die Stadt in sich spüren. Wie Lichtflecken, die zurückbleiben, wenn man zu lange in die Sonne schaut. Was der Raja wohl von ihm wollte? Er war ein unberechenbarer Mann, dem immer wieder einmal merkwürdige Ideen kamen. Wie der Schrein, den er zu Ehren des Buddhas bauen ließ, umgeben von einem weitläufigen Park mit Pavillons. Als Anand zur Einsegnung gerufen wurde, wurde ihm schnell klar, wofür die anderen Gebäude im Park gedacht waren – nicht etwa zur Meditation, sondern für Tête-à-Têtes mit der Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünftfrau des Rajas, und das alles schön an der Eifersucht seiner Hauptfrau vorbei, als Orte der Einkehr und Besinnung getarnt.
Alles im Thronsaal, jede Säule, jedes Ornament, jedes Podest, jedes Fenster, ja, der ganze Raum war allein gebaut worden, um die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf den Raja zu richten. Anand versuchte, sich diesem Sog zu entziehen, doch er konnte nicht umhin, zum Thron zu schauen. Und da saß er, der König mit all seiner Macht und all seinen Kissen. Ein Berg von Mensch und ein Berg von Ignoranz, wie der Mönch sich selbst zuflüsterte. Im Säulengang auf der einen Seite standen die Vertreter der Macht, Mitglieder der hohen Familien, Minister, Kriegsräte. Auf der anderen Seite saßen die Vertreter des Sangha, die Äbte der großen Klöster in orangenen Roben. Es war aber kein Orange der Erde. Es war nicht dadurch entstanden, dass man Flicken in der lehmigen Erde der Gangesebene wälzte. Nein, das war Safran, die teuerste vorstellbare Farbe, gewonnen aus Krokussen, die unter elendigen Qualen von den Hängen der hohen Berge herbeigeschafft wurden, nur um den einflussreichen Mönchen das Strahlen der aufgehenden Sonne in die Roben zu weben. Licht war es ja, was sie ihren Anhängern versprachen. Das eine Licht, das niemals erlischt. Das Licht der Erkenntnis. Anand wagte aber zu vermuten, dass diese Mönche eher das Licht des Sonnenuntergangs vertraten. Seit dem Paranibbana des Buddha war viel Wasser den Ganges hinabgeflossen. Aus den einfachen Klöster waren luxuriöse Paläste geworden und die Äbte waren eitel darauf bedacht, so viel Einfluss am Hofe zu erlangen wie möglich. Sie hatten mehr Macht auf die Entscheidungen des Rajas, als auf den Fluss ihrer Gedanken. Der floss, wohin es ihm gefiel und genoss, was immer Genießbares ihm in den Weg kam. Aber Anand hasste sie nicht. Das hätte er sich selbst nicht erlaubt. Aber er verachtete sie insgeheim, denn in Statur und Lebensstil eiferten sie eher dem dicken Raja nach, als einem Asketen wie dem Buddha oder ihm selbst mit seinem einfachen Leben im Wald. Er senkte seinen Blick beschämt tiefer und hoffte, dass niemand im Saal seine Gedanken lesen konnte.
Der König legte seine wurstigen Finger aneinander und senkte das Haupt, so dass die Smaragde im Gold seiner Krone aufschimmerten. „Ehrwürdiger Anand, Balu, mein alter Freund. Ich freue mich, dass Ihr gekommen seid!“ Er nannte ihn bei seinem alten Namen, den er seit Geburt bis zu seiner Ordination getragen hatte. Eine kleine Stichflamme des Ärgers schoss in die Brust des Mönches, doch er löschte sie schnell mit dem kalten Wasser seiner Aufmerksamkeit. Still, dachte er bei sich, er nimmt mich noch immer nicht ganz ernst. Er denkt wirklich, dass ihm diese alberne Krone und der ganze Tand, die dicken Kissen alle Würde und Macht der Welt geben. Aber unter Samt und Seide gärt dieser Koloss wie ein Komposthaufen. Anand konnte es förmlich riechen und sah vor seinem geistigen Auge, kurz, sehr kurz, einen gewaltigen, golden dampfenden Komposthaufen vor sich. Er schwieg. Das war seine Art, Zustimmung auszudrücken. Als Thera musste er sich nicht vor einem König verbeugen. Der herrschte zwar über das Reich und schützte den Sangha, doch letztendlich war der Schutz, den das Dhamma bot, höher angesehen. Dieses Dhamma repräsentierten die Mönche und Nonnen. „Es ist so lang her, dass wir als Jungs durch die Klosterhöfe marschiert sind. Ihr wart ein hervorragender Mönch, schon damals. Ich dagegen war“, der Raja lachte laut auf und der ganze Körper-und-Kissen-Berg begann, bedrohlich zu wackeln, „schon damals ganz der vortreffliche König, der ich heute bin“. Ein Raunen der Zustimmung ging durch den Saal. Speichellecker, dachte Anand bei sich. In diesem Audienzsaal wurde wahrscheinlich höchst selten die Wahrheit ausgesprochen. „Ich habe gehört, dass Ihr heute als Heiliger verehrt werdet. Man erzählt sich im ganzen Land von Eurer Fähigkeit, Frieden zu schaffen. Und jetzt sehe ich es selbst. Ihr strahlt von innen heraus.“ Der Mönch reagierte nicht gleich. Er wusste, dass hinter dem Lob eine Bitte stand. Er kannte den König zu gut, um zu glauben, dass er diese Worte aus reiner Freundlichkeit wählte. Deshalb sprach er: „Ich freue mich auch, Euch zu sehen. Ihr habt Euch auch sehr entwickelt, seid in beeindruckender Weise gewachsen.“ Die Versammelten im Saal hielten den Atem an. Doch nach einer kleinen peinlichen Pause, begann der Berg von König zu lachen und sich vor Vergnügen zu schütteln. Alle Minister, Äbte und Edlen lachten lauthals mit. „Wie schön, wieder einmal einen unabhängigen Mann vor sich zu haben. Darum ging es ja, unabhängig zu werden von allem, dieser ganzen Welt, mit all ihrem Leiden. Ihr seid weit gekommen, alter Freund. Sehr gut, denn ich habe eine Aufgabe für Euch.“ Aha, dachte Anand. Hier war er, der Grund seines Rufs an den Hof. Ein kleiner Page zeigte ihm ein Kissen auf einem Podest neben dem König. Anand setzt sich und sah aufmerksam zu Boden. Er wollte seinen Blick nicht im Saal verlieren. Zu viel war hier versammelt, was ihn aus seinem Fokus herausziehen könnte. Der Prunk, die einflussreichen Menschen. Die Kunst überall. Es war nicht so, dass er vollkommen unempfänglich dafür war … und das bereitete ihm Sorgen. Der König hatte Recht, er war schon als Junge dem achtfachen edlen Pfad verschrieben gewesen, doch wie schmal war dieser Weg, wie leicht war es, von ihm abzukommen.
Anand kannte ehemalige Mönche, die nach Jahrzehnten der Meditation wie wild hinter Ruhm und Einfluss hergelaufen waren. Sie folgten dem oberflächlichen Glanz der Welt, den sie vorher in ihren Reden abgelehnt hatten.
„Mein Reich ist groß und wird immer größer. Dank meiner klugen Herrschaft und dem Rat meiner weisen Minister und Berater“, begann der König. Ein zustimmendes Nicken ging durch den Saal. „Es liegt aber in der Natur der Dinge …“ Klar, dachte Anand, jetzt kommt irgendein Problem, an dessen Ursache er selbst natürlich aus seiner eigenen Sicht keinen Anteil hatte. „Ich herrsche über Städte, Dörfer, Felder und Wälder. Mein Reich folgt dem Lauf der Flüsse und dem Zug des Windes.“ Seine Poesie war auch nicht besser geworden, dachte Anand, und: Hör auf, so höhnische Gedanken zu haben, du bist ein Mönch und du solltest Mitgefühl für diesen törichten Fleischklops haben. „Leider ist es so, dass selbst wenn die Macht groß ist und die Führung weise, das Land unendlich ist. Je größer das Gefäß, desto mehr löst sich der Tropfen meiner Herrschaft in ihm auf. Sajeed,