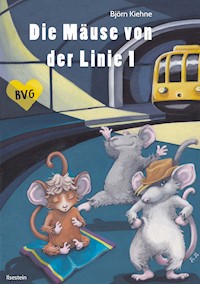Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Ilsestein
- Sprache: Deutsch
In einem kleinen Tal in Frankreich ist eine alte Dame gerade Witwe geworden. Ihre Tochter hat Angst um sie und noch mehr um das Erbe, das ihr zusteht. Sie sendet einen Pflegeroboter aus Paris, um ihre Mutter vor Dummheiten zu bewahren. Doch es kommt anders, als sie denkt ... "Madame, Antoiin und die Liebe zu den Sternen" ist eine herzerwärmende Erzählung über die Kraft der Verbindung, die sich in den ungewöhnlichsten Beziehungen entfaltet. Es ist eine Geschichte darüber, wie die Suche nach Sinn und die Sehnsucht nach Freundschaft uns zu den erstaunlichsten Abenteuern führen können - selbst bis zu den Sternen! Tauchen Sie ein in eine Geschichte, die die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, Jung und Alt, Liebe und Freundschaft auf wunderbare Weise verschwimmen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erschienen sind bisher
Zwei Taschen voll Glück Luc – In den Wellen Taube und Tiger Die Mäuse von der Linie 1
Inhalt
Das Tal
Die Testamentseröffnung
Suzanne stockt der Atem
Antoiin
Madame geht shoppen
Kindheit auf dem Land
Der Tanz
Monster
Daten, Daten, Daten
Ans Meer
Die Republik
Alles ist Energie
Ist da jemand?
Suzanne fährt vor
Spazierengehen
Abdul spricht
Eine Geschichte für Antoiin
Sterne, überall Sterne
Das Tal
Sie spürte das Tal auf ihrer Haut. Die Äcker, die in der Frühlingssonne dampften. Das Wasser, das unsichtbar durch das Gras in den Bach lief. Es sprang über die Steine, als könne es nicht erwarten, diesen Ort zu verlassen – anders als sie. Sie würde hierbleiben bis zuletzt. Der Himmel über ihrem Tal, das war der einzige Ort, an den sie ziehen wollte.
Als Kind hatte sie sich gewünscht, von hier wegzukommen, dorthin, wo das Meer rauscht und alle Namen, die Menschen in den Sand schrieben, verwischt. Sie war ein Leben lang vom Meer umgeben, das blau glühende Mittelmeer im Süden, der hungrige Atlantik, wütend grün schäumend, im Westen. Doch der Mann, der sie heiratete und damit aus der dunklen Enge des elterlichen Bauernhofs befreite, hatte Angst. Winde beunruhigten ihn, Wellen ängstigten ihn, jede Form von Unordnung war ihm zuwider. Frieden fand er nur in den ellenlangen Tabellen der Einkünfte und Ausgaben von kleinen Unternehmen, deren Buchhalter er war.
Drei Kinder hatte sie für ihn großgezogen, und alle passten fein säuberlich in die für sie vorgesehenen Spalten. Sträubten sie sich dagegen, wurde er, der die Ordnung liebte, unordentlich, ein ärgerliches Meer, ein schmutziger Sturm. Es dauerte manchmal Stunden, ehe sie das Chaos im Haus gebändigt und die blauen Flecken der Kinder mit Pusten und Liedern versorgt hatte.
Ein kalter Windhauch strich über ihre Haut. Sie vermisste ihn nicht. Doch die Kinder vermisste sie, als fürsorgliche Mutter. Die aber lebten ihr Leben in Paris – einem weiteren Ort, den sie nie gesehen hatte.
Die Nachrichten jedoch reichten ihr, um sich vorzustellen, wie es da aussah. Laut war es und belanglos.
Ihre Kinder hatten sich in dieser urbanen Melange vollkommen aufgelöst. Von dem Bubu und Pubspubs war nichts mehr geblieben. Sie waren nicht mehr ihre Kinder, die Stadt hatte sie übernommen und ernährte sie mit Beschäftigungen, für die ihre Fantasie nicht ausreichte, um sie sich vorzustellen. War sie ein schlechter Mensch, so zu denken? Sie lächelte, ein bisschen, ja, endlich ein bisschen.
Auf der anderen Seite des Tals lebte Monsieur Chabrol. Er war ihr einziger Nachbar, ein pensionierter General. Er hatte trotz seiner 77 Jahre noch eine blonde Tolle, die über seiner sonnengegerbten Stirnhaut wippte. Die Jahre als Soldat hatten seinen Körper gestählt. Sein breiter Brustkorb schien ständig die Luft anzuhalten. Seinen Gesprächspartnern gab er damit den verunsichernden Eindruck, dass er Luft sammelte, um ihnen im nächsten Augenblick Befehle zuzuschreien. Doch das hatte Monsieur Chabrol lange hinter sich gelassen. Das einzige harte Regiment, das er noch führte, war das über Hecken und Rabatten seines Gartens. Alles aufrecht, alles in Reih und Glied. Aber, da war sich Madame sicher, er hatte ein weiches Herz. Jeden Abend wartete er in der Dunkelheit seiner Küche darauf, dass sie die Kerze entzündete. Das verabredete Zeichen: Sie lebte. Dann zog er die Streichhölzer aus dem kleinen Fach unter der bleich geschruppten Tischplatte und machte wiederum seine Kerze auf dem Fenstersims an. Sie lebten beide. Sie lebten, und das war doch etwas.
Und sie waren nicht allein. Jeden Tag kam der Postbote, selbst wenn er nichts lieferte. Die Kinder hatten ihn beauftragt, nach den Alten zu sehen. Er bekam dafür eine symbolische Anerkennung. Abdul gefiel es. An vielen Tagen in seinem früheren Leben hätte er sich den Frieden in diesem Tal nicht einmal vorstellen können, dass es auf der Welt einen Ort gab, an dem die Vögel die lautesten Geräusche machten. Er hörte in seinen Träumen noch immer Gewehrsalven, hörte Gebrüll, Schlagstöcke, Funken, die früher oder später den ganzen Himmel sprengen würden.
Madame Claude kannte seine Ängste. Er hatte schon oft an ihrem Küchentisch gesessen und sie hatten zusammen Tee getrunken. Er legte den Besuch im Tal extra an das Ende seiner Arbeitstage, um Zeit zu haben. Sie erhitzte dann umständlich Wasser in einem verbeulten Messingkessel, der beim Pfeifen stotterte. Wenn der Wasserdampf durch die Küche wirbelte, erzählte sie vom Universum: „Weißt du, Abdul, wir sind nicht mehr als Wasserdampf und Staub.“ „Den Allah zusammengebracht hat“, antwortete er dann entschieden. Madame Claude nickte. Wer wusste schon, was oder wer das große Ganze aus seinen Einzelteilen erschaffen hatte. Es war nicht wichtig. Sie war davon überzeugt: Was zusammengesetzt war, zerfiel wieder in seine Bestandteile. Das hatte sie schon tausendfach beobachtet und das reichte ihr als Lebensphilosophie. Draußen und drinnen.
Sie erzählte Abdul von den Sternen. Schon als Mädchen hatten sie sie fasziniert. Sie war aus dem Fenster im ersten Stock, aus dem Zimmer, das sie sich mit drei Schwestern teilte, in den Walnussbaum geklettert hinunter in den Garten, um auf einem der Hügel den Himmel zu betrachten. Und sie sprach mit ihm. Jeden der Sterne kannte sie mit Namen und wenn nicht, gab sie ihm einen. „Wie geht es euch? Was ist los in der Milchstraße?“
Morgens müde in der Schule wartete sie sehnsüchtig auf den Physikunterricht. Einstein und Madame Curie waren ihre Helden. Sie kannte ihre Biografien auswendig und sah sich später selbst als Frau mit weißem Bart und wirren Haaren, die an einer grünen Tafel die Geheimnisse der Welt erläuterte. Doch daraus wurde nichts. Weder wuchs ihr ein Bart, noch konnte sie ihr Wissen über Physik und Chemie vertiefen. Die Lehrer gingen zu schnell zu verwertbaren Themen über. Denn das waren ihre Bestimmungen: Zwei Hände ohne Kopf sein, Frauen von Männern, Mütter von Kindern, in Kinderzimmern, in Ställen, auf dem Feld.
Aber sie hasste Erde auf ihrer Haut, sie ertrug das Gefühl nicht. Das Jucken trieb sie in den Wahnsinn. Eine Zukunft auf den Äckern? Nie! Als sie sechzehn war, kam Monsieur Claude, und mit ihm kam die Rettung.
Seine Erscheinung hatte nichts von Staub und Erde. Er schien dagegen direkt aus einer Waschmittelreklame zu entstammen, die zu dieser Zeit, als optischer Kontrast zur Ärmlichkeit der Dörfer, an den Straßenrändern stand. Sein Hemd war gestärkt. Sein Scheitel makellos, sein Lächeln gekonnt. Er sah Madame Claude, die damals Madeleine hieß, und verliebte sich in sie. Verlieben hieß für ihn, er integrierte sie in eine seiner endlosen Zahlentabellen, und zwar in die Rubrik: Haushalt und Kinder. Eine Spalte, die schon lange leer stand (er war 35). Ein Schauer des Behagens durchfuhr ihn, als er merkte, dass sie eine Leerstelle in seinem Leben füllen könnte, und er kontaktierte ihren Vater. Der war froh, so früh schon eines der Mädchen zu verheiraten, was für ihn hieß, sie aus einer seiner Kostentabellen herauszustreichen, und er gab sie ihm bereitwillig mit. Madame schwebte auf Wolken, dort, wo sie der Staub der Felder nicht erreichte.
Die Hochzeit war schlicht. Der Priester sprach so positiv vom Bund der Ehe, der, wie der Bund, den Gott mit den Menschen durch Jesus Christus geschlossen hatte, heilig war. Madame glaubte ihm aufs Wort, auch als ihr frisch vermählter Ehemann schmerzhaft in sie eindrang, um sich nach dem Erguss keuchend von ihr abzuwenden und „Mach das sauber“ sagte. Worte, die sie in den danach folgenden 57 Jahren noch oft hören würde.
Jetzt war er tot. Sie ließ sein sauberes Grab (er hatte sich Marmorplatten, die das ganze Grab bedeckten, gewünscht) verwildern, indem sie Löwenzahn ermutigte, in den Rissen des Steins zu wuchern, die sie selbst mit einem kleinen Hammer geschlagen hatte. Sie goss und düngte ihn. Nein, sie war kein ganz guter Mensch mehr. Aber sie war frei.
Freiheit lässt sich nur durch Einsamkeit erkaufen, das hatte sie einmal gelesen. Sie hielt es aber für Unsinn – Einsamkeit war Freiheit. Sie dachte weder über die Vergangenheit nach, noch sorgte sie sich um die Zukunft. Sie fand in jedem Augenblick eine Beschäftigung und hier und da ein kleines Wunder.
Zum Beispiel die Rehe morgens auf der Wiese am Bach. Der Nebel, der für Augenblicke zu tanzen schien, ehe die Morgensonne ihn auflöste. Der Vogelschwarm, der vor den Wolken für eine Sekunde zu einem Körper verschmolz. Sie war nicht glücklich, aber zufrieden.
Jede Woche rief eines ihrer Kinder aus Paris an. So hörte sie also in drei Wochen von allen dreien, es sei denn, dass sie die Anrufpflicht untereinander tauschten. Madame Claude stellte sich vor, in welcher Tauschwährung: Okay, ein Cappuccino, die Kinokarte, ja, ja, ich wasche dein Auto dafür, wenn du Maman anrufst. Wieviel war sie ihnen wert? Es war ihr egal.
Die Testamentseröffnung
Es roch nach altem Holz. Wie in einem Sarg, sagte sie zu sich selbst. Aber nicht meiner. Noch nicht. Die Testamentseröffnung hatten alle mit Spannung erwartet. Die Kinder waren aus Paris angereist. Ein seltener Besuch. Sie saßen da, als würden sie sich einen letzten Tadel ihres Vaters abholen. Dieses Mal einen schriftlichen, weihevoll von einem vertrockneten Beamten vorgelesen.
Geld interessierte sie nicht. Das Leben der Familie war immer karg gewesen und keiner im Raum hätte vermutet, was der Notar verkündete. Er saß für einige Augenblicke starr auf dem alten Bürostuhl. Seine Haut schimmerte wie das polierte Holz der Paneele im Hintergrund. Das Gesicht schien sich aus dem Gemälde irgendeines depressiven Malers des neunzehnten Jahrhunderts an der Wand gelöst zu haben. Es zeigte Napoleon, den Siegreichen, der in einer Hinterstube seines Geistes wusste, was in Waterloo geschehen würde. „Ich freue mich, dass Sie alle vollzählig erschienen sind“, begann er dann mit tragender Stimme, doch ein Rumpeln vor der Tür unterbrach ihn. Die fünf Enkelkinder nahmen das Vorzimmer auseinander. Suzanne sprang aus dem Stuhl hoch, stapfte zur Tür, riss sie auf und schrie zu laut für das alte ehrwürdige Gebäude: „Ruhe!!“ Dann schloss sie die Tür und kehrte zu ihrem Platz zurück, setzte sich und lächelte. Madame dachte, sie ist ihrem Vater immer am ähnlichsten gewesen. Suzanne liebte Ordnung und verteidigte sie lautstark.
Der Notar hüstelte. Kein anderer im Raum verzog das Gesicht. Sie kannten Suzanne. Sie war ein Vulkan, dessen Krater der Alltag mit einer dünnen Schicht Asphalt geschlossen hatte. „Ihr Vater, Ihr Vater war ein überaus“, er räusperte sich wieder, als wolle er jeden im Raum einladen, diesen Halbsatz für sich zu vollenden (übler Stinkstiefel, Pedant, Verrückter), „wohlhabender Mann.“ Alle außer Madame Claude sahen ihn erstaunt an. Sie wusste, dass Monsieur jeden Pfennig zweimal umgedreht und in einem riesenhaften, lutherbibelschweren Buch alle Ein- und Ausgaben notiert hatte. Ihr hatte er das Haushaltsgeld nur unter Vorlage eines Finanzplans ausgehändigt, in dem sie darlegte, was sie zu kaufen gedachte, während das Übrige über die Jahre angewachsen war.
Monsieur selbst hatte gern dicke Zigarren geraucht, ziemlich teure dazu, aber heimlich, in dem Raum, den er hochtrabend „die Bibliothek“ nannte. Es war der dunkelste Ort im Haus. Nicht einmal ein genügsamer Farn hatte hier überlebt. Den Kindern fielen die Augen förmlich aus dem Gesicht, als der Notar die Summe nannte, die an Geld auf einem Konto lag. Und dann schnappten diese wieder zurück in ihre Höhlen, als er verkündete, dass alle Vollmacht über das Geld bis zu ihrem Ableben bei Madame lag. Sie gingen leer aus. Was jeder für sich, auf seine persönliche Art und Weise, ungerecht fand.
Madame Claude war erstaunt über ihren Mann. Sie hätte eher erwartet, dass er das Geld irgendeiner abstrusen Gesellschaft für Tabellen oder Geometrie vermacht hatte und sie mit dem Pflichtteil abspeiste. Doch das hatte er nicht, und sie lächelte ihm in Gedanken zu. Wobei sie nicht wusste, ob sie dabei nach oben oder nach unten schauen sollte. Das Haus und alles Geld gehörten ihr. Inklusive der Freiheit, die er ihr hinterließ.
Das Verhältnis ihrer Kinder zu ihr veränderte sich dadurch sofort radikal. Waren sie bisher eher gleichgültig bis genervt von ihr gewesen, zeigten sie eine neue Form der Fürsorge. Jan erzählte ihr von seinem Traum, eine eigene Praxis aufzumachen. Bis dahin hatte Madame nicht einmal gewusst, dass er in seinem wirren Kopf so etwas Sortiertes wie Träume hatte. Suzanne sprach von den Privatschulen, auf die sie ihre Eleven schicken musste, damit sie nicht hinter den Kindern der Kollegen ihres Mannes zurückzufielen, und Jacques fantasierte von einer größeren Wohnung im 16. Arrondissement.
Madame hörte sich alles aufmerksam an und ließ ihre Kinder dann mit leeren Händen und ohne ein Versprechen zurück in die Hauptstadt fahren. Sie selbst nahm ein Taxi ins Tal, in dem sie mit Monsieur Chabrol zum Tee verabredet war.
Warum er bei der Fremdenlegion gewesen war, die er heute nur „die Legion“ nannte, als wäre sie die einzige Armee der Welt, blieb Madame Claude verborgen. Sie nahm aber an, dass er sich selbst hatte loswerden wollen. Damit beschrieb sie das Bedürfnis eines Menschen, nicht mehr da sein zu wollen. Kurzum, sie vermutete in ihm eine zarte Seele. Eine, die eher an den Rosen roch als an Gewehren. Nach seiner Pensionierung fand diese Seele ein Betätigungsfeld: Sein Garten war ein kleines Versailles. Es blühte, brummte und duftete, aber alles im exakt abgesteckten und peinlich genau gepflegten Rahmen der Buchsbaumhecken. Diese waren das zweite Ich des Monsieurs. Sie durften genauso wenig sie selbst sein – wie er es sich selbst gestattete, denn endete einmal die peinliche Pflege, dann umrankte eine wilde Kraft alles und würde letztlich auch ihn verschlingen.
Madame Claude wusste um diese Kraft und respektierte die Entscheidung des Monsieurs, ihr nicht freien Lauf zu lassen. Sie genoss seine militärisch genaue Aufmerksamkeit. Er deckte den Kaffeetisch mit einer Akkuratesse, die in Frankreich und darüber hinaus ihresgleichen suchte. Doch neben dieser Ordnung, neben der glänzenden Perfektion des Porzellans lag immer eine geblümte Serviette. Sie würden den Tee in Monsieur Chabrols Wintergarten einnehmen. Madame Claude sah von hier aus ihr Haus: die sandfarbenen Steine, das silberne Schieferdach, Tauben, die nebeneinander auf dem Dachfirst gurrten.
„Wie war es?“, fragte er sie, nachdem sie sich mit einem Seufzer auf dem Stuhl niedergelassen hatte. Sie lächelte ihn geheimnisvoll an. „Ich weiß es nicht.“ Monsieur Chabrol schwieg und schenkte ihr behutsam etwas Tee ein. Der dampfte in der Tasse wie ein Orakel und Madame nahm einen kleinen vorsichtigen Schluck.
Monsieur Chabrol hörte ihr aufmerksam zu. Er war ein sehr guter Zuhörer und Beobachter. Er bemerkte immer auch die allerkleinsten Bewegungen. Auch das Stolpern einer Ameise auf einem Blatt entging ihm nicht.
Madame erzählte vom Erbe, von der Reaktion der Kinder und davon, dass sie zwar nicht wusste, was mit dem ganzen Geld anzustellen war, dass es aber ihre Kinder dafür umso besser wüssten. Monsieur Chabrol lachte. „Und was haben sie jetzt vor?“
„Mein lieber Monsieur, genau das weiß ich eben nicht. Aber seien Sie sicher, ich finde es heraus!“
Die letzten Worte hatte sie mit Nachdruck gesprochen. Monsieur Chabrol zweifelte nicht daran, dass Madame etwas einfallen würde. Er kannte sie lange genug. Die schweigsame Frau neben einem raumfordernden Mann. Die fürsorgliche Mutter. Doch da war etwas anderes an ihr. Er hatte sie bei Nacht auf dem Dach ihres Hauses stehen sehen. Sie stand da und betrachtete die Sterne, während das Tal unter ihr schlief.
*
Abdul schleppte schwer. Es waren mehrere unhandliche Pakete, die er abzuliefern hatte. Er schwitzte, als er sein Lastenfahrrad die letzten Meter in Richtung des Hauses von Madame schob. Dabei bewegten sich seine fein geschwungenen Augenbrauen wie die Taktstöcke eines Dirigenten. Madame stand verzückt am Küchenfenster und schlug vor Aufregung die Hände zusammen. „Abdul, Abdul, hierher!“ Der Postbote mühte sich sichtlich ab, legte aber dann ein Paket nach dem anderen mit einem Schnaufen, aber behutsam auf den Tisch neben der Eingangstür. „Um Himmels Willen, Madame, was ist da drin? Was haben Sie sich aus den unendlichen Weiten des Internets bestellt?“
Abdul liebte Science-Fiction-Bücher, das merkte man an seiner Wortwahl. Alles, was er tat, war ein Schritt im All. Sein Fahrrad war ein Raumschiff, Frankreich ein anderer Planet, auf dem er nie vollkommen landen würde können.
Madame antwortete nicht. Sie reckte sich und winkte hinüber zum anderen Haus im Tal, in dem Monsieur Claude die Fensterbänke reinigte. Als der sie sah, winkte er zurück, legte seine grüne Haushaltsschürze ab und spazierte herüber.
„Bitte, Monsieur, bauen Sie es mir zusammen?“
„Was ist es denn?“
„Ein Raumschiff!“, flüsterte Abdul andächtig.