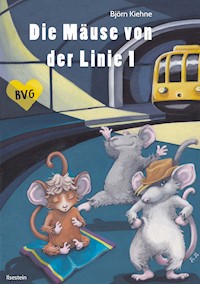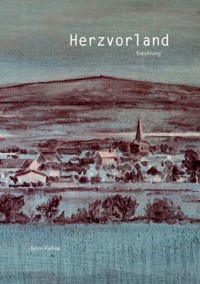
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem Weg in seine Heimat am Harz erfindet der Erzähler sein Dorf neu - voller Schrulligkeiten, Magie und Geheimnisse. Hier treffen Eigenarten der Leute auf Sagengestalten und Schatten der Vergangenheit. Frau Bauerochse verteidigt die Dunkelheit, der Himmel wimmelt vor Hexen, ein Taufengel träumt von Freiheit, 13 Mal droht die Welt unterzugehen, eine Fabrik malt Wolken, am Fluss heult ein verfluchter Wolf. Bis zum Halleluja des Krippenspiels wird geliebt, gebangt und gehofft. In poetischen Bildern und mit Humor entsteht ein Ort, offen und gütig - ein Herzvorland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erschienen sind bisher
Zwei Taschen voll Glück
Luc – In den Wellen
Taube und Tiger
Die Mäuse von der Linie 1
Madame, Antoiin und die Liebe zu den Sternen
Für Steffi
Inhalt
Herr Burmester
Erna
Die Wolkenfabrik
Darius und seine Frau
Die 13 Weltuntergänge der Frau Bauerochse
Zwerge
Ein Engel für Pastor Heinke
Tauben
Gespenster
Ernas Schulter
Kemals Herz
Hexenhimmel
Wolfsgeheul
Schlüpferstürmer
Rentnerbank
Frau Bauerochse verteidigt die Dunkelheit
Ein Mantel für St. Martin
Das Feuermännchen
Kräuteraugust
Und es begab sich …
Die Spinnerin im Feld
1, 2, 3, bei 4
Felder
Maria
Kulissen
Frau Bauerochse spricht mit dem Tod
Herodes
O Tannenbaum
Masern
Frau Bauerochse regt sich
Halleluja
Die Autobahn führt von Osten nach Westen. Polnische Lastwagen mit verdreckten Windschutzscheiben jagen die teuren neuen Autos der Deutschen. Es ist gefährlich, hier unaufmerksam zu sein. Schnell wird man von der kilometerlangen Blechlawine mitgetragen und verschüttet. Kein schöner Ort zum Sterben.
Ich erinnere mich an einen Sommertag. Die Gerste färbte sich golden und die Hügel rollten übermütig über den Horizont, und ich durchstreifte die Felder auf der Suche nach geronnenem Licht. Aus den Ähren ragte ein mächtiger Erdhügel auf, der mir erschien wie ein großer Berg. Ich kletterte den nackten Hang hinauf, rutschte aus, fiel, stand wieder auf und ragte bald stolz und schwitzend auf diesem menschengemachten Berg. Ich sah ein braunes Band, das sich neben meinem Dorf durch die Landschaft Richtung Harz zog. Die kleine Ansammlung von Häusern, die der Kirchturm im Auge behielt, schien das nicht zu kümmern. Mein Dorf lebte in seiner eigenen Welt. Es träumte in Jahrhunderten, nicht in Sekunden. Die Baumaschinen, die ich in einiger Entfernung sah, fraßen sich wie hungrige Insekten am Grün der Hecken heran zu den Rändern des Dorfes. Sie bauten eine Trasse für die chronologische Zeit, die den Takt unseres Lebens vorgibt und die Welt immer näher an den Rand eines Herzinfarkts treibt. Bald würde sie auch mich abholen und mitreißen. Weg aus dieser kleinen Welt. Doch noch war ich Kind, versuchte die Zeichen zu lesen und sah keinen Ernst, nur das Abenteuer.
Die Erinnerung ist eine launische Erzählerin. Sie schreibt unsere Geschichte immer wieder um. Ich zum Beispiel möchte aus einer heilen Welt kommen und jederzeit in sie zurückkehren können. An einen sicheren Ort, dem keine Baumaschine etwas anhaben kann. Dieser Ort entsteht nur im Erzählen, im Lesen, im Hören – und verschwindet wieder mit dem Umblättern einer Seite. Er existiert in der Herzzeit. Das ist ein flüchtiger Ort, so flüchtig wie Gedanken, Gefühle und Geschichten. Er ist mein Herzvorland, in dem meine Geschichte beginnt und endet.
Ich fahre unruhig auf dieser Straße, denn sie führt nach Hause. Die Benachrichtigung kam überraschend. Ich dachte, dass man mich längst vergessen hätte. Gleich nachdem ich mein Abitur in der Tasche hatte, war ich abgehauen – auf der Autobahn, auf der ich nun in die entgegengesetzte Richtung fuhr.
Die Male, die ich aus der großen Stadt kommend in Richtung meines alten Dorfes gefahren war, hatte es sich immer angefühlt, als würde ich in den Sonnenuntergang fahren, egal zu welcher Tageszeit. Ich hatte es oft versucht. Einige Male war ich bis in Sichtweite der Ortschaft gekommen, doch bin immer wieder umgedreht. Im letzten Augenblick habe ich den Fuß vom Gas genommen und den Wagen halsbrecherisch gewendet. Nun ein weiterer Versuch. Ich biege ab, fahre in Richtung Harz. Die Wälder werden dichter, am Horizont steht der Brocken ungerührt.
Ich mag Straßen. Sie geben mir die Hoffnung, dass das Leben irgendwo hinführt. Heute führt es mich zurück, und ich merke, wie ich meinen Fuß langsam vom Gas nehme, wie sich die Geschwindigkeit des Wagens verringert und die Landschaft vor meinen Augen verschwimmt. Man könnte meinen, dass von hier bis zum Brocken ein einziges Meer von Buchen und Eichen steht und der runde Berggipfel eine Insel darin ist. Die Hügel wehren sich nicht gegen den dunkler werdenden Himmel, der von den letzten Strahlen der Sonne glüht. An der dünnen Linie zwischen Luft und Erde taucht der alte Kirchturm auf. Mein Fuß hebt sich wieder vollends vom Gaspedal. Ich rolle ohne Motorkraft in die Vergangenheit … Wie war es gewesen, in Lupenrode?
*
Lupenrode war ein Dorf, wie es Hunderte in Norddeutschland gab. Es hatte 700 Einwohner, etwa 1000 Hühner, 26 Hofhunde, 60 Pferde, 123 Obstbäume, eine Kneipe, einen Bäcker, einen Schlachter und einen Kirchturm. Und viele andere Dinge, die andere Dörfer nicht hatten. Der goldene Hahn auf der Spitze des Kirchturms thronte über einer sanft geschwungenen Landschaft. Wie die Rücken schlummernder Drachen lagen die Hügel zwischen den dunklen Fichtenstreifen des Harzes, als hätten sie sich nur für einige Minuten zum Schlafen niedergelegt und könnten jederzeit ihre weiten grünen Flügel ausbreiten und in den Himmel fliegen. Die Buchenwälder rauschten bei Wind, der neugierig von der fernen See ins Hinterland wehte. Im Herbst färbten die Buchenblätter das Harzvorland golden, als wäre ein warmer, glühender Sonnenuntergang vom Himmel gefallen.
Aus dem Gebirge floss ein munterer Fluss hinab ins Tiefland, die Oker. Sie hatte über die vielen Jahre ein Tal gegraben, in dem sie sich wohlig wie eine schillernde Schlange in der Sonne räkelte. Ab Herbst stiegen am Abend aus ihrem Tal Nebelschwaden auf. Manchmal besuchten die Nebelschwaden auch die Vorgärten und Häuser der Lupenroder. Dann steckten sie ihre weißen, feuchten Nasen in die offenen Fenster und besichtigten das Leben der Familien.
Deren Leben war gewöhnlich und merkwürdig zugleich. In der nahen Stadt und den umliegenden Dörfern genossen sie einen zweifelhaften Ruf. „Die Lupenroder?“, hörte man dort, „die haben doch einen Sockenschuss!“. Ein Bürgermeister eines Nachbarortes sagte immer, wenn ihm jemand mit merkwürdigen Ideen kam: „Wir wollen hier doch keine Lupenroder Verhältnisse!“ Und nein, Lupenroder Verhältnisse, die wollte keiner, keiner außer den Lupenrodern.
Herr Burmester
Es war ein wunderschöner Herbsttag. Die Äpfel streckten ihre prallen roten Wangen in die milde Sonne. Die Zuckerrüben standen prächtig in langen grünen Reihen und warteten auf die Ernte und damit darauf, dass sie als brauner Kandis in die tiefen Teetassen der Friesen fallen konnten. Herr Burmester ging beschwingt durch die Straßen seines Dorfes. Seit vielen Jahren war er der hochgeachtete Bürgermeister von Lupenrode. Er war stolz auf sich und sein Dorf. Auf sich, weil er den umfangreichsten Bauch der Gemeinde, und die Gemeinde, weil sie die umfangreichsten Einnahmen des Kreises hatte. Seine Wangen waren ebenso rot wie die der Äpfel, und er polierte sie jeden Abend bei einem Schnaps in der Kneipe „Zur krüppligen Tanne“ auf. Heute war Samstag, der Tag, an dem er jede Woche mit einem kleinen Notizblock und einem abgekauten Bleistift durch das Dorf ging, um zu schauen, was es zu tun gab. Jetzt stand er vor dem alten Toilettenhäuschen der Schule, in die er als Junge noch selbst gegangen war. Heute mussten die Kinder in die Stadt fahren. Eine Schande, wie er fand.
Er erinnerte sich sehr gern an seine Schulzeit. Sie waren dreißig Schüler gewesen und hatten einen Lehrer, der sie in allen Fächern unterrichtete. Er war genauso gut in Mathe wie in Deutsch und Erdkunde. Herr Burmester war sich sicher, dass niemand in der Stadt die Kinder so gut für das Leben vorbereiten konnte, wie sein alter Lehrer das gemacht hatte. Er war ein kluger Mann gewesen, der Herr Krause. Aus russischer Gefangenschaft war er mit einem nachsichtigen Lächeln zurückgekehrt und mit einem unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen. Er begründete es immer mit dem Stück Brot, das ihm eine russische Bäuerin auf seinem langen Weg aus Sibirien zugesteckt hatte. „Sie war einfach aus ihrem Vorgarten gekommen, hatte mich angeschaut, mir aufmunternd zugelächelt und mir das Stück Brot gegeben. In meinem ganzen Leben hat mir noch kein Stück Brot so gut geschmeckt. Ich habe seinen Geschmack noch immer auf der Zunge.“ Dann hatte er gelächelt und mit der Zunge geschnalzt und alle Schüler hatten für einen Augenblick auch den süßen Geschmack eines lange gekauten Brotes im Mund. Herr Krause war mit ihnen in den Wald gegangen und hatte ihnen die verschiedenen Bäume erklärt, die großen wie die kleinen. Von den Wanderungen brachten sie Bucheckern, Kastanien und Vogelbeeren mit, aus denen sie dann im Klassenzimmer lustige Figuren bastelten. Das Kamel, das er gemacht hatte, stand noch immer in seinem Stubenschrank.
Herr Burmester sah verträumt auf das alte Toilettenhaus, das nun verlassen im Schulhof stand. Er hatte den großen, rostigen Schlüssel in der Tasche. Er zog ihn heraus und steckte ihn in das Schloss. Die Tür kreischte, als er sie öffnete. Ein muffiger Geruch von Urin, Staub und Reinigungsmittel schlug ihm entgegen. Etwas wehmütig machte er den Schritt in die breiige Dämmerung. Er suchte den Lichtschalter, glitt mit seiner Hand durch Spinnweben und legte dann den Kippschalter um. Ein Blitz schlug durch den Raum, es gab einen lauten Knall und dann war es genau so dunkel wie zuvor. Herr Burmester zuckte zusammen und trat einen Schritt zurück. Hier war seit zwanzig Jahren keiner mehr drin, dachte er bei sich, kein Wunder, dass die Leitungen marode sind. Er wartete noch einen Augenblick, atmete noch einmal frische Herbstluft ein, fasste Mut und trat ein. Die Dämmerung umfing ihn wie ein schwerer Wintermantel. Ein Gefühl der Beklommenheit überkam ihn. Sein Atem wurde schneller.
Komisch, dass ich immer noch Angst habe, hier eingesperrt zu sein. Es ist doch so lange her, dachte er bei sich. Mit Widerwillen erinnerte er sich an den Tag, seinen ersten Schultag, an dem er stolz mit seinem schweren Tornister über die Hauptstraße vom Hof zur Schule gegangen war. Über viele Jahre hatte er die größeren Jungs beneidet. Fast erwachsen konnten sie schon auf dem Trecker ihrer Väter fahren und kerzengerade Ackerfurchen ziehen. Sie konnten in der Jugendmannschaft Fußball spielen und nicht bei den Knirpsen wie er. Er erinnerte sich genau, wie er unter der alten Kastanie auf das Schulhaus zusteuerte, voller Erwartung auf den neuen Lebensabschnitt, der nun für ihn beginnen sollte. Am Fuße der Treppe stand eine Gruppe von Jungen. Er kannte sie, sein Vater hatte ihn schon früh vor ihnen gewarnt. Sie waren im Winter berühmt für die Eisbälle, die sie den Kleinen auf die Hintern schmetterten, und im Sommer für die Wasserbomben, die einen unerwartet überall treffen konnten. Herr Burmester war immer in relativer Sicherheit vor ihnen gewesen, denn sein Vater war der größte Bauer des Dorfes, der Rübenkönig, wie man ihn respektvoll und auch ein bisschen spöttisch nannte. Als Sohn dieses Königs, als Rübenprinz, hatte man im Dorf einen besonderen Stand, denn jeder wusste, dass er einmal der größte Bauer im Dorf und damit auch der Bürgermeister werden würde. Das Haus, in dem er noch heute wohnte, hatte der Zucker in die Höhe wachsen lassen. Hohe Fenster, lasierte Ziegel, Türmchen und Erker, die an einen Palast erinnerten, ein Rübenschloss.
Die großen Jungs auf der Treppe steckten ihre Köpfe zusammen. Kein gutes Zeichen, aber der kleine Rübenprinz war guter Dinge. Es war sein erster Schultag, der erste Tag des „echten Lebens“. Er ging schnurstracks auf die Treppe zum Klassenraum zu. Da zerriss ein Pfiff die Luft, sie packten ihn und er flog durch die Luft und landete auf dem Hosenboden. Er sah sie fassungslos an, wollte etwas sagen, doch die Angst und der Schrecken schnürten ihm die Kehle zu. Sie brachten ihn zum Toilettenhaus, rissen die Tür auf und trugen ihn zu einem der WCs. Der älteste der Jungs, Torsten, der die größte Zahnlücke im Harzvorland hatte und den meisten Schwachsinn zwischen den Ohren, sah ihn an und sagte in drohenden, mit Speichel versetzten Worten: „So, Rübenprinz, jetzt kannst du dir das Dorf mal von unten angucken.“ Er gab ein Zeichen und zwei der stärksten Jungs nahmen ihn an den Füßen, drehten ihn um und steckten seinen hochroten Kopf in die Klomuschel. Ihm blieb der Atem weg. Das brackige, stinkende Wasser kam bedrohlich nah. Die Jungs hatten vorher den Abfluss verstopft. Es stand hoch und brühte bedrohlich vor seinen Augen, die sich mit tanzenden Sternen füllten. „Eins, zwei, drei …!“, rief Torsten, und wie ein Stück Zuckerkuchen tunkten sie ihn in den Kaffee. Es ging ihm bis zum Stirnansatz. Er begann zu husten. Er hatte Angst zu ersticken. Dann zogen sie ihn wieder hoch, drehten ihn um und setzten ihn an den Fuß des WCs. Höhnisch lachend steckten sie ihm seine Schieferplatte unter den Arm. Auf der stand: RÜBENPRINZ KLOPRINZ.
Herr Burmester schrumpfte bei dieser Erinnerung. Der Gestank des Klowassers stieg ihm wieder in die Nase. Bewegungslos stand er in der Dämmerung. Und doch hatte er das merkwürdige Gefühl, nicht allein zu sein. Schluchzte da nicht jemand? Das Geräusch kam aus der hinteren Ecke, dort, wo die Kabinen waren. Herrn Burmester wurde ganz mulmig zumute. Fast hätte er sich umgedreht und das Toilettenhäuschen von seiner Liste gestrichen – er konnte sich ja nicht um alles kümmern (besonders wenn schlechte Erinnerungen daran klebten). Aber er riss sich zusammen und ging auf die Tür zu, woher das Geräusch kam. Da war das Schluchzen wieder. Er hörte es genau, ganz genau, erschreckend genau. Er streckte seine Hand aus und drückte die Klinke herunter. Sie öffnete sich mit einem gequälten Knacken. Herr Burmester zuckte zusammen. Was er sah, konnte nicht wahr sein. Es konnte einfach nicht wahr sein! Er schüttelte fassungslos den Kopf und sagte immer wieder: „Nein, nein, nein …!“ Da, gelehnt an den Fuß der Toilette, saß er als Siebenjähriger. Sein Kopf lag schwer auf der Brust, und unter seinem Arm war die Schiefertafel geklemmt, auf der stand: RÜBENPRINZ KLOPRINZ.
Herrn Burmester entfuhr ein Schluchzen. Tränen drängten sich in seine Augen, durch die er den kleinen Jungen mit den nassen Haaren anstarrte. Er ging zu ihm, bückte sich hinunter und legte die Hand auf die schmale Schulter. Der Junge blickte auf und sah ihn an. Sein Blick war verstört und ängstlich. Tränen hatten sich in das Klowasser, das ihm das Gesicht hinunterlief, gemischt, und Schnodder hing ihm aus der Nase. Herr Burmester nahm dem Jungen die Schiefertafel aus der Hand und wischte das KLOPRINZ weg. Er lächelte ihn aufmunternd an und half ihm, aufzustehen, zog sein Taschentuch aus der Tasche und säuberte das kleine Gesicht. Dann strich er ihm die Haare zurecht. Ein vorsichtiges Lächeln zeigte sich. Der Junge blickte zu dem Fenster oben an der Wand. Herr Burmester verstand und reckte sich, um es zu öffnen. Der Junge lächelte, wurde dann immer durchsichtiger und verschwand durch das kleine Fenster, und mit ihm die schlechte Erinnerung. Herr Burmester sah ihm hinterher. Er entspannte sich. Ach, es ist so lange her. Die Jungs haben ihre Strafe bekommen, dachte er bei sich. Er lächelte, wenn auch schief, und ging über den Flur hinaus in die Herbstsonne. Da wurde ihm leicht ums Herz, und er wusste nun, was er mit dem alten Toilettenhäuschen anstellen würde. Mit den Männern von der Freiwilligen Feuerwehr würde er außen das Fachwerk freiklopfen und zu einem Spielhaus machen, mit Gummimatten auf dem Boden und Wänden, durch die man klettern konnte. Die Klos würde er höchstpersönlich zur Deponie bringen, und wenn die Feuerwehrleute mitmachten, dann wäre Torsten, der alte Racker, ja auch dabei. Dieser Gedanke machte ihm Freude. Er blickte hinauf zum Himmel und seufzte: Ja, das konnte einem nur in Lupenrode passieren. Das ist Lupenrode und so, wie es ist, ist es gut.
Erna
Erna war ein Schreikind. Dabei tat sie, als sie aus dem warmen Bauch ihrer Mutter gepresst wurde und, blau und verschmiert, nach Atemluft schnappen sollte, erstmal nichts. Sie blieb still. Ihre Mutter, eine stämmige Tochter pommerscher Kartoffelbauern, rief aufgebracht: „Sie ist tot, sie ist tot, sie ist tot!“ Die Hebamme aber nahm Erna bei den Füßen, hielt sie wie eine prall gefüllte Einkaufstüte in die Luft und gab ihr einen beherzten Klaps auf den schrumpeligen Hintern. Da begann Erna zu schreien. Die einfachen Glasscheiben des kleinen Hauses zitterten. Die Hühner im Stall verschluckten sich an ihren Weizenkörnern. Der Hund erschrak und heulte den wolkenverhangenen Himmel an. Im Kännchen auf dem Kaffeetisch wurde die Milch sauer.
Erna schrie und schrie, aber hörte nicht auf damit. Die Nachbarn sammelten sich vor dem Gartentor und starrten auf das kleine Sprossenfenster, das von der Anstrengung beschlagen war. Erna hörte auch nicht auf zu schreien, als die Hebamme sie auf den verschwitzten Bauch ihrer Mutter legte. Aus den Schleiern des Glücks und der Erleichterung heraus betrachtete ihre Mutter sie zunehmend ratlos und besorgt. Ernas Gesicht war das einer alten Frau, faltig, schartig, vom Schweiß verschmiert. Sie erinnerte sie an ihre Nachbarin in Pommern, die still ihre Sachen gepackt hatte, als sie hörte, dass die Russen kamen. Die ihre Kleider zusammenlegte, das Kruzifix in den Koffer legte, still aus der Haustür trat und sich der Schlange der Flüchtlinge anschloss, die sich über die Feldwege gen Ostsee wand. Sie war so unheimlich ruhig gewesen, keine Träne, keine Sorgenfalten. Sie sprach mit niemandem, hielt den Blick gesenkt. Doch auf dem Hügel vor dem Dorf sah sie sich noch einmal um und begann zu schreien. Einen Schrei, der die Wolken auseinanderriss, der die Enten vom Dorfteich auffliegen ließ und den Wind vor Schreck stumm machte. Einige der anderen Flüchtenden versuchten, sie zu beruhigen, doch sie schüttelte ihre sorgenden Hände ab und schrie, schrie, Kilometer für Kilometer. An einem von der Winterkälte starren Haselnussstrauch brach sie zusammen, fiel auf den Rücken, jammerte, bis der letzte feuchte Atemnebel aus ihrem Mund gestiegen war und sie still wurde.
Ernas Mutter strich mit einer resoluten Handbewegung die Erinnerungen fort. Sie streckte ihre kräftige Hand aus und steckte ihren vom Walnuss-Schälen braunen Daumen in Ernas Mund. Das Kind wurde augenblicklich still. Erna saugte, ihre Gesichtszüge entspannten sich.
Die ersten Lebensmonate verbrachte Erna so am Daumen ihrer Mutter, denn ansonsten schrie sie das Dorf zusammen. Aus Solidarität teilten sich die Lupenroderinnen den Haushalt von Ernas Mutter. Denn da Ernas Vater seine Zeit als Schlosser in einem rostigen Harzer Hüttenwerk verbrachte und den Rest des Tages in der Kneipe saß, um zahlreiche Kartoffelschnäpse zu genießen, blieb die Hausarbeit liegen. Doch die Nachbarsfrauen kamen am Morgen, machten die Betten, kochten, wuschen das Geschirr und das Gemüse, so dass Erna am Daumen ihrer Mutter nuckeln konnte und still war. Das Haus der kleinen Familie wurde zum Mittelpunkt des Dorfes. Keine Neuigkeit, die nicht unter seinen niedrigen Decken ausgetauscht wurde, kein Fest, das nicht hier besprochen wurde. Doch Ernas Mutter wurde wieder schwanger. Die Situation wurde unhaltbar, trotz der Hilfe der Dorffrauen. Sie berieten, was zu tun war. Elfriede Lamme, die Frau des Tischlers, hatte eine Idee. Sie wies ihren Mann an, einen Daumen aus Kirschbaumholz zu schnitzen. Aufgeregt kam sie an einem Nachmittag in Ernas Haus. In einer alten Zigarrenschachtel, die sie mit Ohrenwatte ausgepolstert hatte, brachte sie das hölzerne Wunder. Die ganze weibliche Nachbarschaft war in der Stube um das rot-samtene Kanapee versammelt und betrachtete gespannt das Geschehen. Ernas Mutter war sich unsicher. Sie wusste, was es hieß, der Kleinen ihren Daumen aus dem Mündchen zu ziehen: Sie würde das Dorf mit allen Häusern, Scheunen und mitsamt der Kirche zu Grund und Boden schreien. Aber die Frauen nickten ihr aufmunternd zu. Also bewegte sie ihren Daumen vorsichtig. Erna schaute sie mit ihren dunklen, wachen, jetzt zunehmend skeptischen Augen an. Ihre Mutter hielt inne, wollte schon aufgeben, als die Frau des Schlachters ihren Ellenbogen fasste und ihn nach hinten zog. Es machte Plopp. Erna tat einen tiefen Atemzug. Alle anderen im Raum standen still vor Erwartung. Dann nahm Frau Lamme den hölzernen Daumen und steckte ihn dem Kind in den Mund. Erna blickte erstaunt, verwirrt, verzog die Augenbrauen, entspannte sie wieder und begann dann, zur Erleichterung aller Umstehenden, am Holzdaumen zu nuckeln. Ihre Mutter wiegte sie sanft in den Armen. Alle lächelten, alle waren froh. Erna wurde in ein warmes Deckennest auf dem Kanapee gelegt und blieb ruhig. Der hölzerne Daumen blieb in ihrem Mund, bis sie vier war, dann verschwand er in einer der Taschen ihrer Jacke und wurde nur noch zu besonderen Anlässen, zum Beispiel dem Tod ihrer Katze oder einem Gewitter, herausgeholt. Noch als erwachsene Frau trug sie ihn in ihrer Jackentasche, versteckt vor neugierigen Blicken, und holte ihn immer dann heimlich heraus, wenn sie ängstlich wurde.
Erna kannte Torsten schon lange, so wie jeder jeden in Lupenrode schon lange kannte, aber sie sprach das erste Mal mit ihm, als der Sommer so heiß war, dass der Teer auf den Straßen schmolz und die Fallschirme des Löwenzahns beim Flug durch die Luft verbrannten.
Sie war zu einer jungen Frau geworden, mit schwarzen Haaren und energischem Blick, der noch etwas von der Kraft ihrer kindlichen Schreie ahnen ließ. Die Leute im Dorf sagten, dass sie „nicht hässlich“ sei, was in Lupenrode so etwas wie schön bedeutete – nur „etwas dünn“ sei sie, also schlank, was unter Bauersleuten grundsätzlich Skepsis hervorrief. Wahrscheinlich habe sie sich als Säugling zu lange die Seele aus dem Leib geschrien und sei bis heute erschöpft und nervös, so die übliche Erklärung. Sie sprach nicht viel, doch wenn, dann in abgehackten Sätzen, die sie in die Luft schleuderte, als spucke sie Kirschkerne aus. Sie arbeitete als Näherin bei Steppdecken-Schulze im Nachbardorf. Sie war eine der schnellsten Arbeiterinnen, die sich so manchen Bonus durch ihre flinken Hände verdiente. Mit ihren 25 Jahren lebte sie noch immer bei ihrer Mutter. Der Bruder, der kurz nachdem sie den Holzdaumen bekommen hatte, geboren worden war, war gestorben und lag in einem der engen Kindergräber am Lindener Weg. Sie besuchte ihn manchmal, traurig und mit einem lungernden Schmerzschrei, der in ihrer Brust wartete, entfesselt zu werden, den sie aber mit dem Streicheln ihres Holzdaumens in ihrer Jackentasche im Zaum hielt.
Dieser Sommer kam überraschend über das Harzvorland. Nach einem grauen, regnerischen Frühling hatte niemand eine solche Hitze erwartet. Die Sonne schlug auf die Dächer, Straßen und Felder wie ein Hammer auf Metall. Das Knallen, beinahe hörbar, schien zu wandern und alle und alles einmal zu treffen. Alles glühte. Bei Steppdecken-Schulze hatten sie heute früher Schluss machen können. Es war einfach zu heiß in dem dunklen Fabrikraum, und die Nähte torkelten ab Mittag über den Baumwollstoff wie betrunkene Bauarbeiter.
Torsten war ein solcher Bauarbeiter. Er hatte mit Mühe und Not die Hauptschule geschafft und, zur Erleichterung seiner Eltern, bei einem kleinen Bauunternehmen in der nahen Stadt eine Lehre als Maurer gemacht. Da lernte er das Polieren und Verputzen und noch intensiver das Saufen. Es gab einen Witz unter den Maurern: Kommt eine gute Fee auf ein Gerüst und sagt dem Maurer: Du hast zwei Wünsche frei! Sagt der Maurer: Ich will ’ne Flasche Feldschlösschen, die niemals leer wird. Plopp, die Flasche steht vor ihm und er beginnt begeistert zu trinken. Die Fee erinnert den Maurer an den noch freien Wunsch: Und was wünschst du dir als Zweites? Der Maurer überlegt lange und sagt dann: Noch so ’ne Flasche.
Torsten hätte in dieser Situation nicht anders gehandelt. Er war selten nüchtern, was seine Arbeit nicht beeinträchtigte. Vielmehr galt er als der beste Verputzer im ganzen Landkreis. Mit seinen starken Armen zog er die Kelle sicher über das Mauerwerk. Jede noch so unregelmäßige Oberfläche konnte er in die glatteste Fläche verwandeln. Das brachte ihm sehr viel Achtung ein. Die kleinsten Erhebungen strich er nach der Betrachtung seines Werkes mit einer tiefen Innerlichkeit, aus der manchmal ein kleiner Hickser aufstieg, mit dem Daumen glatt. Diese Daumen waren etwas Besonderes an Torsten. Während sein ganzer Körper stark, muskulös und ein wenig grobschlächtig war, waren seine Daumen zart, klein und feingliedrig. Scherzhaft sagten die Lupenroder, er habe keinen grünen, dafür aber einen grauen Daumen, der ihm vom Himmel für das Verstreichen des Zementputzes gegeben worden sei. Erna hatten diese Daumen immer fasziniert. Schon als kleines Kind hatte sie Torsten beobachtet, wie er ein Holzstück mit dem Messer in ruckartigen, fast brutalen Hieben bearbeitete und dann den Holzstaub sanft mit seinen zarten Daumen von der Oberfläche strich. Erna kannte seine Daumen genau. Den Rest des Mannes, der er geworden war, ließ sie außer Acht.
An diesem heißen Sommertag hatte Torsten die Aufgabe bekommen, eine neue Güllegrube zu verputzen. Der Vorabend war in einem wilden Schnapsgelage in der Kneipe geendet. Er wusste nicht mehr, wie er nach Hause gekommen war, er wusste nur, dass er jetzt einen gewaltigen Kopf hatte. Einen Kopf, der seiner Wahrnehmung nach so groß wie ein gestrandeter Wal am Strand der Nordsee sein musste. Torsten stand in der Grube, ein Trog mit Zementputz stand neben ihm. Die Klappleiter hatte er an die Wand der Güllegrube gestellt. Der Rest des Werkzeugs lag in einer alten Schubkarre. Ihm war schwindlig und in seinem Magen waberte eine wilde Mischung aus Hochprozentigem und Magensäure. Es roch nach Schweinestall. Er konnte die Viecher in ihren Ställen quieken hören. Torsten war sehr heiß. Er schwitzte so viel, dass er gar nicht so viel trinken konnte, wie er an Wasser verlor. Er beugte sich zu dem Trog hinunter und nahm einen großen Batzen der grauen Masse auf seine Kelle. Mit einem Stöhnen streckte er sich und begann, die Klappleiter hinaufzusteigen. Sterne wirbelten hinter seinen Augen herum. Er versuchte, die Kelle gegen die Wand zu schlagen. Doch wo er hinschlug, war keine Wand. Da war nichts, nur Leere, und in diese Leere stürzte er. Sein schwerer Körper fiel ins Schwarze. Er hatte den Halt verloren und stürzte kopfüber in den Trog mit Zementputz.
Erna war auf dem Weg nach Hause. Sie war müde von der Arbeit. Ihr Rücken tat weh. Diesen Monat würde es keinen Bonus geben. Zuviel Zeit hatte die Hitze des Sommers gekostet und ein Teil der Ware war zurückgekommen, obwohl sie sich sicher war, jeden Stich vollkommen genau gesetzt zu haben. In Gedanken versunken lief sie an dem großen Schweinestall vorbei. Der Gestank war unerträglich. Sie hielt sich die Nase mit einem Taschentuch zu und hätte so fast die Gestalt übersehen, die genau am Wegesrand in einer halbbetonierten Grube mit dem Kopf in einem Trog steckte. Sie riss sich das Taschentuch vom Gesicht und sprang, ohne einen Augenblick des Nachdenkens, in die unfertige Güllegrube. Noch ein Schritt und sie stand am Trog, griff Torsten am Kragen und riss ihn aus der Betonsuppe. Sobald er auf dem Rücken lag, schlug sie ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Er gab keinen Laut von sich. Sie schlug noch einmal zu, da hustete er. Beherzt kniff sie ihm in die Wangen und zwang ihn, den Mund zu öffnen. Sie steckte ihren Finger in die Mundhöhle und räumte die grauen Brocken Beton heraus. Dabei berührte sie das Zäpfchen und löste ein Glucksen aus. Ein Zittern ging durch seinen Körper. Er bäumte sich auf, verkrampfte sich, warf seinen schweren Oberkörper vor und erbrach sich auf den grauen, staubigen Boden. Erna hielt ihm die Stirn und betrachtete seine Daumen, die sich in den Boden drückten und ganz weiß, ganz durchsichtig wirkten. Nach dem dritten Schwall von grüner Galle und Schnaps half sie ihm, sich aufzurichten. Mit einigermaßen vereinten Kräften (ihre hätte sie sich selbst nicht zugetraut) hievte sich Torsten und hievte sie Torsten über die Ziegelmauer, wo er plump auf den Boden fiel. Erna leerte die Schubkarre und zerrte den schweren Körper des jungen Mannes hinein, indem sie die Karre auf die Seite legte und erst ein Bein, dann einen Arm und dann erst die Hüfte auf das Metall brachte. Sie stemmte ihren Fuß gegen seinen Beckenknochen und brachte die Schubkarre mit einem kräftigen Stoß zum Stehen.
Die Lupenroder standen in ihren Vorgärten und betrachteten mit weit aufgerissenen Augen das Schauspiel. Erna schob die Karre mit dem schweren Körper des Maurers durch die Straßen, als käme sie mit einem gefallenen Krieger direkt vom Schlachtfeld. Der gefallene Krieger gab keinen Laut von sich, doch er atmete. Das war ein gutes Zeichen. Sie kippte ihn, nicht besonders sanft, auf ihrem Hof ab, drehte den Gartenschlauch auf und ließ das kalte Wasser in einem rücksichtslosen Strahl in sein Gesicht prasseln. Er setzte sich erschrocken auf, riss die Augen weit auf und betrachtete sie mit einem verdatterten Blick, aus dem mit jedem Liter kalten Wassers die Schnapsschwaden mehr und mehr verschwanden. Auf seinen groben Gesichtszügen erschien ein Lächeln. Er griff das Ende des Gartenschlauchs und begann, Erna zu sich heranzuziehen. Erna ließ es geschehen und sah fasziniert auf seine Daumen. Er griff ihre Arme und zog sie zu sich herab. Sie ließ auch das geschehen, mehr noch, sie nahm seine Hand, führte sie zu ihrem Mund und steckte seinen Daumen hinein. Er sah sie erstaunt, aber lächelnd an, und ließ es zu. Nie hatten die Lupenroder eine solch zärtliche Szene gesehen. Einige klatschten vor Begeisterung in die Hände. Noch in diesem Sommer wurde die Hochzeit gefeiert. Torsten war schon bei der Trauung betrunken, und Erna spuckte das „Ich will“ wie zwei kleine Kirschkerne auf den Altar, doch sie waren glücklich und mit ihnen das ganze Dorf.
Die Wolkenfabrik
Wenn der Sommer langsam müde wurde und sich erste Nebel über das Okertal legten, dann war es für die Lupenroder Bauern Zeit, die Rüben zu ernten. Die Zuckerrüben standen wie eine runzlige Zwergenarmee auf den Feldern, blickten mit grimmigen Gesichtern um sich und trugen ihre schrumpeligen Blätter wie grüne Kronen auf den sonst haarlosen Köpfen. Ihr Anblick ließ nichts von der Süße erahnen, die sie aus Sonne, Luft und Wasser in ihren Bäuchen gesammelt hatten. Der Zucker bildete den Reichtum des Dorfes, der die Rübenschlösser in den Himmel hatte wachsen lassen und die Landbesitzer stolz machte. Mit großen Erntemaschinen wurden die Rüben aus dem Boden gerissen. Nichts anderes war zu hören als lärmende Motoren und surrende Förderbänder. Tausende grüne Kronen wurden gekappt und auf große Haufen gekippt: Winterfutter für die hungrigen Mägen der Kühe und Schweine. Die süßen Körper der Zuckerzwerge kamen auf große Wagen und wurden ins Nachbardorf gefahren. Hier stand die Wolkenfabrik. Hinter einem unscheinbaren Bauernhaus erhob sich ein Gewirr aus schimmernden Rohren, Ventilen und Trichtern. Dazu zwei riesige weiße Kessel, die aussahen wie riesige Klopapierrollen. Daneben ein schlanker Schornstein aus rotem Ziegel, aus dessen Öffnung immerwährend Wolken stiegen – dichte, weiße Wolken in wundersamen Formen, die der Fabrik ihren Namen gaben. Manchmal verschmolzen sie mit dem grauen, vom Regen schweren Himmel, doch meist schwebten sie in ein tiefes Blau.
Am ersten Tag der Erntesaison, der Kampagne, warteten die Lupenroder auf einem der Hügel, von dem man das Nachbardorf gut beobachten konnte, und starrten den roten Schornstein an. Sobald die ersten Dunstfahnen emportraten, ging ein Raunen durch die kleine Menge, und sobald das erste weiße Wolkenschiff seine Segel in den Himmel hisste, klatschten sie erfreut in die Hände, denn nun war die Zeit des goldenen Herbstes gekommen: die Zeit der Kürbissuppen, Kartoffelfeuer, der süßen Äpfel und Birnen, des Danks an den Gütigen Herrn.
In dieser wundertätigen Fabrik arbeitete Frank. Frank war ein Träumer. Als Kind eines Kaufmanns, der noch bis vor einigen Jahren mit seinem Ford Taunus über die Dörfer gefahren war, mit einem Kofferraum voller sinnvoller und unsinniger Dinge, und jetzt einen Supermarkt leitete, war er von klein auf zu Effizienz und Nüchternheit erzogen worden. Jeder Augenblick musste genutzt werden. Jeder Augenblick sollte einen Gewinn abwerfen. Jeder Augenblick sollte mit Arbeit ausgefüllt sein. In seinem Haushalt hatte es keine Verschwendung gegeben. Aber damit auch wenig Genuss.
Seine Mutter war eine zärtliche Person, die, wie ihr Mann es ausdrückte, in ihrer Kindheit in ein Fass mit Zuckerrübensaft gefallen sein musste. Ihr großzügiges Wesen machte es ihr unmöglich, das Haushaltsgeld streng einzuteilen, was ihren Mann dazu veranlasste, das Haushaltsgeld erst wochen- und später tageweise zuzuteilen. Doch auch das tat der impulsiven Kauffreude seiner Frau keinen Abbruch. Also richtete er in einem Raum im Untergeschoss eine Art privaten Kaufladen ein, in dem seine Frau zwischen den wichtigen Waren des täglichen Bedarfs auswählen konnte, die er vorher in der nahen Stadt im Sonderangebot besorgt hatte oder die als B-Ware im Supermarkt verkauft wurden. So wurden beide Bedürfnisse befriedigt: seins nach Effizienz, ihres nach Verschwendungssucht, fand er.
Jeden Mittwoch war Shopping-Tag im Keller. Franks Mutter stieg mit ihrem Portemonnaie die dunklen Stufen hinunter; der Sohn mit ein paar Pfennigen in der Tasche, für die er eine Stange Lakritz oder eine Packung Kaugummi erwerben konnte, hinter ihr. Beide freudig erregt, wenn auch nur kurz.
Frank entzog sich diesem häuslichen Regiment, indem er träumte – eine lange Leine an bunten, schillernden, warmen Träumen, in denen er mal der Chef des Supermarkts war, wo er die Preise immer weiter senkte, bis nichts mehr etwas kostete, mal den Ford Taunus seines Vaters mit einem eigenen Auto von der Straße drängte.
Die Träume hatten dem kleinen Frank eine weitere Welt eröffnet und dem erwachsenen eine berufliche Karriere verbaut. Mathematik, Musik, Grammatik und Physik wollten einfach nicht bis zu ihm durchdringen. So endete seine Schullaufbahn in der Hauptschule und nicht in der Fakultät der Betriebswirtschaft der Universität Göttingen, wie der Vater es ihm vorgezeichnet hatte. Frank fand Arbeit als Helfer auf einem großen Hof, versorgte die Tiere, holte das Heu ein, ritt auf dem Trecker und manchmal auf dem breiten Schoß der Bäuerin. Jeweils zum Beginn der Kampagne wurde er von seinem Chef für die Arbeit in der Wolkenfabrik freigestellt, der dafür eine Kaution erhielt. Dann saß Frank an den Hebeln und Ventilen und war der Meister des Wasserdampfs, der Herr der Wolken. Ein erhebendes Gefühl!
Dieses Jahr war ein ganz besonderes für Frank, denn er war verliebt. Die Liebe war ein Gefühl, das die Lupenroder stoisch in ihren Kartoffelkellern aufbewahrten und nur ganz selten durch die Dorfstraßen schickten. Doch hatte sie einmal die feuchten Keller verlassen, dann tanzte sie leichtfüßig über den Dorfplatz. Frank hatte Norma beim Schützenfest ein paar Wochen zuvor das erste Mal gesehen, ein schmales, schüchternes Mädchen mit dunklen Augenringen und etwas strähnigem Haar. Sie wurde die Königin seiner Träume. Norma arbeitete in einem Bekleidungsgeschäft in der Kreisstadt und verkaufte Übergrößen. Kein aufregendes Leben, doch sie war nichts Aufregendes gewohnt. Ihre Eltern hatten sie erst spät bekommen. Sie war, so sagte ihre Mutter, vom Himmel direkt in ihren Bauch gerutscht, so überraschend, dass sie dachte, sie sei ein verklemmter Pups. Ihr Vater war so alt, dass er seine Tochter kaum wahrnahm. Seine Familie bestand aus ARD und ZDF und der Schaubude. Echte Menschen fand er anstrengend.
Frank besuchte Norma nun des Öfteren im Bekleidungsgeschäft. Sein Mofa knatterte durch die Fußgängerzone, er hupte und betrat dann den Laden. Er behauptete jedes Mal, dass keine Hose und kein Pullover ihm passen würden, obwohl er durchschnittlich gebaut war. Schmunzelnd hatte sie ihm Hosen und Pullover so groß wie das Spinnaker eines Segelboots auf der Okertalsperre gezeigt. Er sah darin aus wie die einzige Stange eines Tipis. Doch er behauptete steif und fest, dass er nie Kleidung besessen habe, die ihm besser gepasst hätte. Sie lächelte und verkaufte sie ihm. So kam er in den Besitz von mächtigen Pullovern, Jacken und Hemden, die einem ganzen Kindergarten ein Dach über dem Kopf geboten hätten.
Norma mochte Frank. Sie mochte seine blauen Augen, die immer in irgendeine Ferne zu schauen schienen. Sie mochte sein Mofa, mit dem er verheißungsvollere, knatternde Zeiten ankündigte. Als sie in einen drei Meter langen Schal ihre Telefonnummer einwickelte, war für Frank klar: Sie war seine Frau. Sie gingen Eis essen, sie tranken Kaffee. Er brachte sie zum Lachen, sie berührte ihn tief mit ihrer schüchternen Art. Frank hatte lange darüber nachgedacht, wie er ihr seine Liebe beweisen konnte, so dass es für alle, alle Lupenroder, alle Harzer, die ganze Welt sichtbar sein würde. Einige Wochen der Kampagne hatte er an den Ventilen gesessen und nachgedacht. Dann war ihm eine Idee gekommen, eine wunderbare Idee!
Er bat Norma, an einem Sonntag zu einer bestimmten Zeit auf dem Hügel am Rande von Lupenrode zu sein, von dem aus man die Fabrik sehen konnte. Sie hatte sich schick gemacht, ihr schwarzes Haar zu einem Zopf gebunden und die Samtjacke mit Fellbesatz angezogen. So stand sie da, über ihr der endlose blaue Herbsthimmel. Norma schaute gespannt und zunehmend nervöser über die Felder. Die Herbstkälte begann, sich durch die Sohlen ihrer viel zu leichten Schuhe zu winden. Frank war schon fünf Minuten über die Zeit. Das war nicht seine Art. Er liebte sie doch, das wusste sie ganz genau, und er war nicht der Typ, der sich über sie lustig machen würde. Schon überlegte sie, ob sie gehen solle. Das flaue Gefühl in der Magengegend fragte sie, ob ihm vielleicht etwas zugestoßen war. Doch dann sah sie es und ließ alles los. Aus dem Schornstein wand sich ein schneeweißes Herz. Ja, es war ganz deutlich zu sehen, ein wunderbares, bauchiges, weißes Herz. Norma schlug die Hände vor ihrem Gesicht zusammen, Tränen des Glücks traten in ihre Augen, sie sprang auf und ab und lief dann los in Richtung Wolkenfabrik. Nach einer halben Stunde und etlichen Diskussionen mit Vorarbeitern, Pförtnern und dickbäuchigen Angestellten war sie beim Arbeitsplatz von Frank angekommen. Dort saß er, still lächelnd auf seinem Stuhl vor den Ventilen. Sie trat zu ihm und sagte: „Ja, ich will.“ Langsam stand er auf, nahm sie in seine Arme und küsste sie zum ersten Mal.