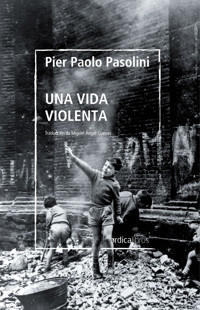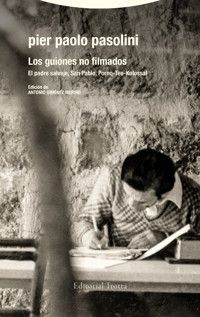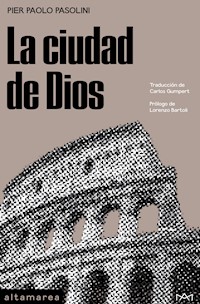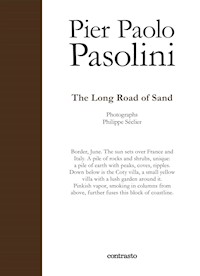Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Messias ist zu Gast bei der Bourgeoisie – und er hat Liebe für alle mitgebracht: In diesem so analytischen wie verspielt-ironischen Roman, das literarische Gegenstück zum gleichnamigen Film von 1968, trifft der Dichter Pasolini auf den Polemiker der »Freibeuterschriften«. »Komme morgen an.« Mehr steht nicht in dem Telegramm, mit dem der namenlose Gast seinen Besuch bei einer Mailänder Industriellenfamilie ankündigt. Es dauert nicht lange, und der überirdisch gut aussehende junge Mann hat der Reihe nach alle – geschlechter- und klassenübergreifend – verführt: Mutter, Vater, Tochter, Sohn und Dienstmädchen. Der intime Kontakt mit dem göttlichen Sex und dem heiligen Geist lässt keine und keinen unberührt zurück. Die wohlgeordneten bürgerlichen Verhältnisse kollabieren, die Konsequenzen sind absurd oder politisch wünschenswert: Sie reichen von sexueller Befreiung über die Kollektivierung der Fabrik bis hin zur Heiligenexistenz. Im Zusammenspiel von lustvoll-provokantem Ton und scharfer politischer Reflexion erkundet Pier Paolo Pasolini in dieser Parabel die Krise einer seelenlosen bürgerlichen Ordnung, die dem Chaos menschlicher Bedürfnisse im Zweifel kaum etwas entgegenzusetzen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus dem Italienischen von Heinz Riedt
Die italienische Originalausgabe erschien 1968 unter dem Titel Teorema bei Garzanti Editore in Mailand, die deutsche Übersetzung erstmals 1969 beim Piper Verlag in München.
E-Book-Ausgabe 2022
© 1968, 1991, 1994, Garzanti Editore s.p.a,
© 1999, 2008, 2009, Garzanti S.r.l., Milano
Gruppo editoriale Mauri Spagnol
© 2022 für diese Ausgabe:
Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung nach einem Konzept von Julie August. Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph. Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978-3-8031-4344-0
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2847 8
www.wagenbach.de
»Gott führte also das Volk um, auf die Straße durch die Wüste.«
Exodus 13, 18
VORBEMERKUNG
… Da die Prosa ein wenig »Kunst«-Prosa ist, ergibt sich, daß es hier um eine Parabel geht und nicht um eine eigentliche Untersuchung der »Verhaltenskrise« (eine Formulierung, über die ich das Buch definieren möchte).
Gleichsam auf Goldgrund entstanden, habe ich Teorema mit der Rechten gemalt, während ich mit der Linken damit beschäftigt war, ein Fresko (den gleichnamigen Film) auf eine große Wand zu werfen. Bei einer solchen Doppelnatur weiß ich nicht, was mehr Gewicht hat: die Literatur oder der Film. In Wahrheit ist Teorema vor etwa drei Jahren schon als Pièce in Versen entstanden; dann verwandelte es sich in einen Film und zugleich in die Erzählung, die dem Film zugrunde liegt und die durch den Film korrigiert wurde. So ist für diesen kleinen weltlichen Leitfaden mit ungewissem Kanon, in dem der religiöse Einbruch in ein geregeltes Mailänder Familienleben behandelt wird, die beste Lesart wohl diejenige, die »Fakten«, das »laufende Geschehen«, zu verfolgen und sich sowenig wie möglich bei den einzelnen Seiten aufzuhalten. Das ist zumindest meine Haltung. Und was den Rest betrifft, so hat die bürgerliche »indirekt freie Rede«, die ich wohl oder übel unter das Gewebe dichterischer Prosa legen mußte, auch mich mit einem leichten Sinn für Humor, Distanz und Maß angesteckt (und mich zu meinem großen Verdruß nicht so anstößig werden lassen, wie das Thema es erfordert hätte): Aber ich meine, es ist im wesentlichen alles noch immer aus einem extremen Bildwinkel heraus geschildert, vielleicht etwas zu sanft (worüber ich mir klar bin), doch immerhin alternativlos.
Pier Paolo Pasolini
ERSTER TEIL
1 EINIGE DATEN
Die ersten Daten unserer Geschichte beziehen sich schlicht auf das Leben einer Familie. Es handelt sich um eine kleinbürgerliche Familie: Kleinbürger im ideologischen, nicht ökonomischen Wortsinn. Denn es sind sehr reiche Leute, und sie wohnen in Mailand. Gewiß kann sich der Leser unschwer vorstellen, wie diese Leute leben; wie sie sich zu ihrem Milieu (dem reichen industriellen Bürgertum) verhalten; wie sie sich im Familienkreis benehmen, und so fort. Und wir meinen, daß es ebenso leicht ist, sich diese Leute nacheinander vorzustellen, was uns die Aufzählung gewisser und sicher nicht neuer Lebensgepflogenheiten erspart: Es sind in keiner Weise besondere, sondern mehr oder minder durchschnittliche Leute.
Die Glocken läuten den Mittag ein. Die Glocken aus dem nahen Lainate oder dem noch näheren Arese. In den Glockenklang mischt sich das gedämpfte und fast sanfte Heulen der Sirenen.
Eine Fabrik beansprucht den ganzen (wegen des Nebelschleiers, den nicht einmal das Mittagslicht zerstreuen kann, sehr unbestimmten) Horizont, dessen Begrenzung von einem Grün ist, so zart wie das bleiche Azur des Himmels. Die Jahreszeit ist nicht näher bezeichnet (vielleicht Frühjahr oder Herbstanfang oder alles beides, weil unsere Geschichte keine chronologische Folge hat); und die Pappeln, die in langen, regelmäßigen Reihen das riesige Gelände umstehen, auf dem (erst vor ein paar Monaten oder Jahren) die Fabrik entstanden ist, sind kahl oder knospen gerade (oder haben welke Blätter).
Beim Verkünden des Mittags strömen die Arbeiter aus der Fabrik, und die Reihen parkender Autos, Hunderte und Aberhunderte, geraten in Bewegung …
In dieser Umgebung, vor diesem Hintergrund, erscheint die erste Person unserer Erzählung.
Aus dem Haupttor der Fabrik – die Wächter grüßen militärisch – rollt langsam ein Mercedes. Darinnen, mit dem sanftbekümmerten und etwas erloschenen Gesicht eines Mannes, der sich sein Lebtag nur mit Geschäften und vielleicht sporadisch auch mit Sport abgegeben hat, der Besitzer – oder doch mindestens der Hauptaktionär – dieser Fabrik. Alter: vierzig bis fünfzig Jahre. Aber er sieht sehr jugendlich aus (das Gesicht braungebrannt, das Haar leicht meliert, der Körper noch elastisch und muskulös, eben wie bei jemandem, der von Jugend an Sport treibt). Sein Blick verliert sich im Leeren, ist ebenso besorgt wie gelangweilt oder einfach ausdruckslos: daher unergründlich. Die Zeremonie seiner Ankunft und Abfahrt – als Fabrikherr – ist für ihn etwas Gewohntes. Kurzum, er sieht aus wie ein Mann, der mitten im Leben steht: Daß er ein bedeutender Mann ist, von dem das Schicksal so vieler anderer Menschen abhängt, das macht ihn, wie es manchmal zu sein pflegt, unerreichbar, fremd, geheimnisvoll. Dieses Geheimnis ist aber sozusagen arm an Dichte und Nuancen.
Sein Wagen läßt die Fabrik hinter sich, die so weit ist wie der Horizont und fast am Himmel schwebt, und fährt über die zwischen den alten Pappeln neu angelegte Straße in Richtung Mailand.
2 WEITERE DATEN (I)
Die Glocken läuten den Mittag ein.
Pietro, die zweite Person in unserer Geschichte – Sohn der ersten Person –, kommt aus dem Parini-Gymnasium1 (oder vielleicht ist er schon draußen und geht durch die gewohnten Straßen nach Hause).
Wie schon beim Vater, steht auch auf seiner nicht sehr hohen (sogar recht unansehnlichen) Stirn die Intelligenz dessen geschrieben, der nicht ohne Nutzen in einer steinreichen Mailänder Familie aufgewachsen ist; der aber auch, viel deutlicher erkennbar als beim Vater, darunter gelitten hat. So daß kein selbstsicherer Junge aus ihm geworden ist, vielleicht sportlich wie der Vater, sondern ein Schwächling mit niedriger, blaßbläulicher Stirn, Augen, die bereits von Heuchelei verdorben sind, und einem Haarschopf, der zwar noch ein bißchen lausbübisch ist, aber doch schon gebändigt vom zukünftigen kampflosen Leben eines Bourgeois.
In seiner Gesamterscheinung erinnert Pietro an gewisse Typen aus der Stummfilmzeit; man könnte sogar sagen – rätselhaft und unweigerlich –, an Charlot: ohne jeden Grund, um der Wahrheit willen. Immerhin, wenn man ihn so sieht, kommt einem zwangsläufig der Gedanke, daß er wie Charlot dazu geschaffen sei, Mäntel und Jacken zu tragen, die ihm zu groß sind und deren Ärmel gleich einen halben Meter über die Hände herunterbaumeln – oder einer Straßenbahn nachzulaufen, die er nie erreichen wird – oder in einem grauen, tragisch-einsamen Stadtteil gravitätisch auf einer Bananenschale auszurutschen.
Aber das sind nichts weiter als lebhafte und extemporierte Assoziationen; der Leser möge sich davon nicht ablenken lassen. Für den Augenblick kann man sich Pietro noch sehr gut als irgendeinen Mailänder Jungen vorstellen, einen Schüler des Parini-Gymnasiums, der von seinen Mitschülern voll anerkannt wird als Bruder, Komplize, Mitstreiter in ihrem unschuldigen, eben erst begonnenen und schon entschiedenen Klassenkampf.
Mit vergnügt-durchtriebenem Gesicht geht er neben einer Blondine, die sichtlich auch zu seiner Gesellschaftsschicht und -tradition gehört und zur Zeit sein Mädchen ist. Kein Zweifel, während Pietro auf seinem Heimweg unter der brennenden Sonne (auch sie nicht greifbarer Besitz dessen, der über die Stadt verfügt) zwischen den gepflegten Rasenflächen einer Mailänder Anlage nach Hause geht, ist er ehrlich damit beschäftigt, seiner Schulkameradin den Hof zu machen. Freilich tut er dies, als verfolge er einen schmerzlichen Plan: Das ist aber nur die geheime, uneingestandene Erregtheit des Schüchternen, kaschiert durch Albernheit und selbstsicheres Auftreten, von dem er im übrigen gar nicht lassen könnte, auch wenn er es wollte.
Seine Kameraden sind bei allem unartikulierten Verlangen, sich als Gammler zu geben, doch korrekt gekleidet; und mit einer Miene, die – mag sie rührend oder abstoßend sein – vom vorzeitigen Fehlen jeder Selbstlosigkeit und Sauberkeit gezeichnet ist, lassen sie das Paar verständnisvoll zurück. So bleiben Pietro und sein Mädchen scherzend vor einem Strauch stehen; der ist ährengelb – falls es Herbst ist – und zart durchsichtig – falls es Frühling ist. Dann setzen sie sich auf eine einsame Bank; umarmen sich, küssen sich. Einige höchst unerwünschte Augenzeugen gehen vorüber (ein Paralytiker etwa, der in die Sonne will – sie wirkt auf ihn nur lindernd) und stören sie ausgerechnet bei ihren schuldhaftesten Bewegungen (ihre Hand an seinem Schoß, der jedoch bar jeden Ungestüms ist): Aber sie sind ja in ihrem Recht, und ihr Verhältnis ist im Grunde ehrlich, sympathisch und offen.
3 WEITERE DATEN (II)
Die Glocken läuten den Mittag ein.
Auch Odetta, Pietros jüngere Schwester, kommt aus der Schule (dem Istituto delle Marcelline2). Sie ist süß und erregend, das arme Kind; und ihre Stirn scheint wie ein Kästchen voll schmerzlicher Intelligenz, ja beinahe voller Weisheit zu sein.
Ebenso wie die Kinder der Armen gleich erwachsen sind und schon alles über das Leben wissen, sind auch die Kinder der Reichen zuweilen frühreif – alt vom Alter ihrer Gesellschaftsklasse: Und sie tragen ihr Leben wie eine Krankheit – aber heiter, entsprechend der sanften Heiterkeit der armen Kinder, gleichsam einem Kodex folgend, der zwar ungeschrieben ist, den sie aber aus Instinkt auswendig kennen.
Odetta scheint vordringlich darauf bedacht, dies alles zu verbergen: ein erfolgloses Bemühen, weil gerade seine Erkennbarkeit ihr wahres Inneres verrät. Zwar ist ihr Gesicht oval und schön (mit ein paar herkömmlich-poetischen Sommersprossen), mit großen Augen, langen Wimpern und kurzer, ausgeprägter Nase – doch der Mund ist eine fast verwirrende Zurschaustellung von Odettas wirklichem Sein. Nicht daß dieser Mund häßlich wäre, im Gegenteil, er ist ganz reizend; und doch eben ein wenig ungestalt; so auffällig und so eigen, daß man ihn, mit seiner fliehenden Unterlippe wie bei einem Kaninchen- oder Rattenmäulchen, nicht einen Augenblick unbeachtet lassen kann: Im Grunde genommen ist das der buffoneske Akzent der Heiterkeit – oder vielmehr der schmerzlichen und vertuschten Bewußtheit ihres eigenen Nichts; und ohne diese Heiterkeit könnte Odetta nicht leben.
So zeigt nun Odetta, die zur gleichen Zeit wie ihr Bruder Pietro nach Hause geht, unterwegs die üblichen äußeren Merkmale eines sehr reichen jungen Mädchens, dem es die Familie (mit einem Schuß Snobismus) erlaubt, sich (trotz der Marcelline-Schule), sagen wir, modern zu kleiden und zu benehmen.
Odetta hat auch einen Jungen, der ihr den Hof macht: ein weichliches, hochgeschossenes Idol seiner sozialen Klasse und Gattung. Auch um sie beide ist eine Gruppe von Kameraden und Kameradinnen, Halbwüchsige, die sich schon ganz natürlich »à la manière« und ohne Argwohn verhalten, perfekte Abbilder ihrer Eltern.
Das Gespräch zwischen Odetta und ihrem bartlosen Verehrer dreht sich um ein Fotoalbum, das Odetta zusammen mit ihren Schulbüchern eifersüchtig festhält. Ein Fotoalbum mit samtenem Einband voll rosa und roter Kringel im Jugendstil. Das Album ist noch ganz leer und offenbar soeben in einer Papierhandlung erworben. Nur die erste Seite ist schon eingeweiht: von einer großen Fotografie ihres Vaters.
Der Verehrer macht seine Witzchen über dieses Album, als wisse er genau, daß es sich hier um einen Tick des jungen Mädchens handelt. Sowie der Junge aber um eine Kleinigkeit forscher wird – eine einzige Bewegung, ein einziges Wort, vor einem dunklen Steinbrunnen unter einer Reihe metallisch scheinender Bäumchen –, läuft Odetta davon.
Ihre Flucht wirkt elegant und pikiert und ist eigentlich ausdruckslos, verbirgt aber in Wahrheit echten Schrecken. Auch die Worte, die sie zu ihren jungen Freunden und Freundinnen und zum entflammten Verehrer sagt, der sie verfolgt – »Ich mag Männer nicht« –, kommen schnippisch und eleganthumorvoll heraus; doch offenbar enthalten sie ein Körnchen Wahrheit.
4 WEITERE DATEN (III)
Wie der Leser sicher schon bemerkt hat, handelt es sich hier weniger um eine Erzählung als vielmehr um das, was man in der Wissenschaft einen »Bericht« nennt: also um etwas sehr Informatives; und darum, technisch und formal gesehen, eher um ein »Handbuch« als um eine »Botschaft«. Des weiteren ist die Form nicht realistisch, sondern ganz im Gegenteil emblematisch … rätselhaft …, so daß jede vorausgeschickte Bemerkung über die Beschaffenheit der Personen nur als Hinweis gelten mag: für die Konkretheit, nicht für die Substanz der Dinge.
Der Leser kann sich Lucia, Pietros und Odettas Mutter, vorstellen, während sie sich in einem stillen, abgesonderten Winkel des Hauses befindet – Schlafzimmer oder Boudoir oder Aufenthaltsraum oder Veranda – dazu schüchterne Reflexe vom Grün des Gartens usw. Aber Lucia hält sich dort auf – nicht als guter Geist des Hauses, sondern als gelangweilte Frau. Sie hat ein Buch gefunden, hat zu lesen begonnen, und die Lektüre nimmt sie ganz in Anspruch (ein gescheites, seltenes Buch über das Tierleben). So wartet sie auf die Essenszeit. Beim Lesen fällt ihr eine Locke über die Augen (eine kostbare Locke, vielleicht am selben Morgen unter den kunstfertigen Fingern des Friseurs entstanden). Wie sie so dasitzt, bietet sie – fast mit der Gier einer Kranken – dem einfallenden Licht ihre hohen, aber irgendwie ausgezehrten und leichenähnlichen Wangen dar; ihre Augen, stetig gesenkt, erscheinen länglich und schwarz und, vielleicht wegen ihrer dunklen Feuchte, etwas zyanotisch und barbarisch.
Aber wie sie sich jetzt bewegt, die Augen rasch vom Buch nimmt und auf ihre winzige Armbanduhr richtet (dazu muß sie den Arm heben und ihn weiter ins Licht halten), gewinnt man den flüchtigen und vielleicht ganz falschen Eindruck, daß sie wie ein Mädchen aus dem Volk aussieht.
Jedenfalls haben ihre Seßhaftigkeit, ihr Schönheitskult (bei ihr mehr eine Funktion, die ihr zufällt wie bei einer Gewaltenteilung) und ihre Verpflichtung zu einer aufgeklärten Intelligenz auf einer Grundlage, die unwillkürlich reaktionär bleibt, sie vielleicht nach und nach verkrampft: haben auch sie, ebenso wie ihren Mann, ein wenig geheimnisvoll werden lassen. Und ist dieses Geheimnisvolle an ihr ebenfalls etwas arm an Dichte und Nuancen, so ist es doch um so heiliger und unumstößlicher (obwohl dahinter vielleicht eine zerbrechliche Lucia irrlichtert, das kleine Mädchen aus finanziell weniger gesicherten Zeiten).
Wir fügen dem noch hinzu: Sowie das Dienstmädchen Emilia kommt und meldet, daß angerichtet ist (und gleich wieder, finsteren Blickes, hinter dem Türrahmen verschwindet), steht Lucia träge auf, wirft das Buch träge an die am wenigsten dafür geeignete Stelle – vielleicht läßt sie es einfach auf den Boden fallen – und bekreuzigt sich hastig, gleichsam abstrakt.
5 WEITERE DATEN (IV)
Auch diese und die nächste Szene unserer Geschichte soll der Leser nur als Hinweis auffassen. Die Schilderung ist demnach nicht minutiös und in allen Einzelheiten festgelegt wie bei jeder beliebigen anderen traditionellen oder ganz einfach normalen Erzählung. Wir wiederholen, es ist keine realistische Geschichte, sondern eine Parabel; im übrigen befinden wir uns noch gar nicht mitten im Geschehen: Wir sind erst bei der Ankündigung.
Die Familie macht sich den schönen Sonnenschein zunutze und speist im Freien; die Kinder sind eben aus der Schule gekommen, der Vater aus der Fabrik. Nun sitzen sie gemeinsam bei Tisch. Das Villenviertel sichert ihnen ländlichen Frieden. Rings um das Haus ein Garten. Den Tisch hat man auf einen Platz in der Sonne gestellt, weit weg von Büschen und Bäumen, in deren Schatten es noch ein wenig kühl ist.
Hinter dem Garten verläuft die Straße, eigentlich die Landstraße – eine vorstädtische, immerhin herrschaftlichvorstädtische –, die man nur bruchstückhaft erkennen kann, zusammen mit den Dächern anderer vornehmer und peinlich stummer Häuser und Villen.
Die Familie speist mit Andacht, und Emilia bedient. Emilia ist ein Mädchen ohne Alter, sie könnte ebensogut acht wie achtunddreißig Jahre alt sein: ein armes oberitalienisches Mädchen, eine in Apartheid lebende Weiße. (Aller Wahrscheinlichkeit nach stammt sie aus einem Dorf in der Bassa3 unweit von Mailand, aber noch ganz bäuerlich; vielleicht sogar aus der Gegend von Lodi, wo eine Heilige geboren wurde, die ihr ähnlich sah, die heilige Maria Cabrini.)
Es klingelt.
Emilia läuft zur Tür, um aufzumachen. Vor ihr steht Angiolino4, den wir als siebente Person unserer Erzählung bezeichnen können oder, besser noch, als eine Art Joker. Denn etwas Zauberhaftes ist an ihm: die dichten, bizarren Locken, die ihm über die Augen fallen wie bei einem Pudel, das drollige Gesicht voller Pickel und die halbmondförmigen Augen mit ihrem unerschöpflichen Vorrat an Fröhlichkeit. Es handelt sich um den Briefträger. Da steht er also, mit einem Telegramm in der Hand, vor Emilia, die aus den gleichen sozialen Verhältnissen wie er kommt; doch nichts an ihm leiden mag. Und statt ihr das Telegramm zu geben, zwinkert er ihr zu – strahlend vor überfließendem, zuckersüßem Lächeln – und deutet mit dem Kopf zum Garten, wo die Herrschaft speist. Dann läßt er die mit Schweigen gepanzerte Emilia stehen und rennt bis ans Eck der Villa; beobachtet von dort aus diejenigen, die das Essensritual der Reichen vollziehen, und sucht mit den Augen Odetta (der er aus purer Gedankenlosigkeit den Hof macht). Alsdann vergißt er Odetta samt allem anderen ebenso rasch, wie er sich zuvor an sie erinnert hat, kehrt mit Verschwörermiene zu Emilia zurück, schneidet ihr (die er in seine Verehrung für Odetta einbezieht) auch noch zwei lustige Grimassen, überreicht ihr endlich das Telegramm – und trollt sich wieder von dannen, läuft mit komischer, rastloser Eile zum Ausgang.
Emilia bringt das Telegramm der Familie, die immer noch im Sonnenschein schweigend ißt. Der Vater hebt den Blick von seiner bürgerlichen Tageszeitung und öffnet das Telegramm, das lautet: »MORGEN BIN ICH BEI EUCH« (der Name des Absenders ist durch des Vaters Daumen verdeckt). Offenbar haben sie alle auf das Telegramm gewartet, und so ist die Neugierde schon vor dieser Bestätigung verflogen. Folglich setzen sie ihr Essen im Freien unbeirrt fort.
6 ENDE DER ANKÜNDIGUNG
Im Haus unserer Familie ist überall Licht, obwohl erst Teestunde ist und der lange Sonnenuntergang noch seine Helligkeit aussendet, geschwängert vom Schweigen der Pappelreihen und der ebenen, grünen, wassergesättigten Wiesen. Da wahrscheinlich Sonntag ist, gibt man eine kleine Party, und die Gäste sind fast ausschließlich junge Leute. Das heißt, Schulkameraden von Pietro und Odetta.
Aber es sind auch Damen anwesend, Mütter der jungen Leute. In diesem Durcheinander (in derlei Fällen immer etwas elegisch, weil dann die Menschen die jämmerliche und oft verhaßte Last der eigenen Person verlieren, sie abstreifen unter der Milde der Atmosphäre – dieser Atmosphäre aus elektrischem Licht und dem Sonnenlicht, das von der Bassa kommt) erscheint die neue und außergewöhnliche Person unserer Erzählung.
Außergewöhnlich vor allem an Schönheit: eine Schönheit so einzigartig, daß ihr Kontrast zu allen übrigen schon fast ein Skandal ist. Und selbst bei genauem Hinsehen würde man ihn für einen Fremdling halten, nicht nur wegen seiner hohen Gestalt und seiner blauen Augen, sondern auch, weil er so gar nichts Durchschnittliches, Durchschaubares, Ordinäres an sich hat, so daß man ihn auch nicht für einen Jungen aus einer kleinbürgerlichen italienischen Familie halten könnte. Man kann aber auch nicht sagen, daß er die unschuldige Sinnlichkeit und die Anmut eines Jungen aus dem Volk besäße … Sozial gesehen, ist er also ein Rätsel, obwohl er sich all denen vollkommen anpaßt, die um ihn sind in diesem von der Sonne magisch beleuchteten Salon.
Schon seine Anwesenheit bei dieser völlig normalen Party ist also fast ein Skandal, ein Skandal allerdings, der noch erfreulich ist und ein ganz wohlgesinntes Innehalten hervorruft. Eigentlich besteht sein Anderssein nur in der Schönheit. Und alle, ob Frauen oder Mädchen, mustern ihn – natürlich diskret, weil doch jeder hier die wichtigste Spielregel kennt, sich nie und um gar keinen Preis eine Blöße zu geben.
In diesem Rahmen diskretester Unverbindlichkeit erkundigen sich jetzt ein paar Freundinnen von Odetta oder einige jüngere Freundinnen der Mutter, wer denn dieser unbekannte Junge sei. Doch Odetta zuckt die Achseln. Und Lucia beschränkt sich auf ein paar ebenso unverbindliche Hinweise oder auch auf ein nichtssagendes Lächeln. Wir erfahren also nichts über ihn. Im übrigen ist das auch nicht nötig. Demnach bleibt diese letzte Angabe in unserer Ankündigung unvollständig und offen.
7 DES HERRSCHAFTSGASTES HEILIGER SEX
Ein Nachmittag im Spätfrühling (oder, in Anbetracht der Doppelnatur dieser Geschichte, im Frühherbst), ein stiller Nachmittag. Man hört undeutlich – und von weit her – die Geräusche der Stadt.
Die Sonne scheint schräg in den Garten. Das Haus ist durch Schweigen entfremdet; wahrscheinlich sind alle fort. Im Garten ist nur noch der junge Gast. Er liegt in einem Liegestuhl oder sitzt auf einem Rohrsessel. Er liest. Sein Kopf ist im Schatten, sein Körper in der Sonne.
Wie wir bald besser sehen werden – wenn wir den Augen folgen, die ihn betrachten, und dicht an ihn herankommen, bis an die Einzelheiten seines Körpers in der Sonne –, ist er in eine Studienbroschüre über Medizin oder Technik vertieft.
Die Stille des Gartens mit den ersten Trieben seiner Geranien (oder ersten fallenden Blättern seiner Granatapfelbäume), ganz im tiefen Frieden der unbeteiligten, tröstlichen Sonne, wird verletzt durch ein unangenehmes, monotones, überlautes Geräusch: Es ist der kleine handbetriebene Rasenmäher; er quietscht beim Hin und Her über die Wiese, und unverändert nimmt er sein stetiges unsicheres Quietschen immer wieder von neuem auf.
Es ist Emilia, die den Mäher vor- und zurückschiebt.
Emilia befindet sich am einen Ende des Gartens, hinten auf der glatten Rasenfläche, die von einem so kräftigen Grün ist, daß man fast davon geblendet wird; am anderen Ende, dicht beim Haus, unter Efeuranken, sitzt der Junge.
Hin und wieder bricht das übertrieben laute Geräusch des Mähers ab: Dann bleibt Emilia für ein paar Augenblicke kerzengerade stehen. Eindringlich sieht sie den jungen Mann an; und ihr Blick ist ganz sonderbar: als habe sie nicht den Mut, hinzusehen, und sei doch gleichzeitig so ihres Bewußtseins beraubt, daß sie sich ihrer Zudringlichkeit gar nicht schämt. Ihr Blick verdunkelt sich sogar, aber so, als sei sie selbst beleidigt von ihrer Zudringlichkeit.
Wie lange Emilia mit dem Rasenmäher hin- und hergeht, stehenbleibt, hinüberstarrt und dann wieder hin- und hergeht, gekrümmt und verschwitzt? Und wie lange der Junge, ihrer und auch der Tatsache nicht bewußt, daß er sie ignoriert, in seine Studienbroschüre vertieft ist? Lange. Vielleicht den ganzen Morgen – nämlich den kurzen Morgen im Tagesablauf der Reichen, wo zehn Uhr eine fast noch nachtschlafende Zeit bedeutet. Die Sonne klettert immer höher am ungetrübten Himmel, bis sie brennend heiß wird – im sengend-sommerlichen Frieden.
Emilia schiebt immer noch, wie wahnsinnig, ungelenk ihren Rasenmäher herum. (Eigentlich ist das gar nicht ihre Aufgabe, sondern die des Gärtners. Aber sie hat die Zuständigkeit für den Rasen schon lange an sich gerissen, aus einer Art Rivalität zum Gärtner, denn sie ist eine Bauerntochter und kommt vom Lande.)
Der Junge merkt also nicht, daß man ihn betrachtet, so ganz und gar und beinahe unschuldig ist er in sein Buch vertieft – was in Emilias Augen schon fast ein unantastbares Privileg darstellt. Und jetzt – vielleicht um sich ein wenig zu entspannen – liest er auch nicht mehr in seinem Studienmaterial, sondern in einem Taschenbuch Gedichte von Rimbaud. Und diese Lektüre fesselt ihn mehr als die vorige.
Der erste Blick des Dienstmädchens, das seine Arbeit unterbricht, ist rasch und flüchtig und kann daher die Gestalt des Gastes nur als Ganzes wahrnehmen, mit dem Kopf im Schatten und dem Körper in der Sonne.
Doch dann schärft sich ihr Auge und verweilt länger auf diesem seinem fernen und reaktionslosen Objekt: Während sie sich mit dem Arm den Schweiß von der Stirn wischt, erforscht sie mit stumpfem Blick die Details jenes Körpers, der sich ihr dort drüben so in seiner Totalität und unbewußt darbietet.
Also werden ihre Bewegungen – dem Anschein nach bislang nur die trotzig-mechanischen eines einfachen Menschen – unverhüllt und fast betont monomanisch.
Mit anderen Worten, dieses Hin und Her während der unkomplizierten Verrichtung des Mähens verliert seine Natürlichkeit, den Sinn der Alltagsarbeit, und wird so fast zur äußeren Form einer dunklen Absicht.
Ihr unentwegtes Starren auf den Gast hat jetzt in der Tat etwas Verdächtiges und Wahnwitziges. Und als hielte sie es nicht mehr aus (aber der Gast, in seine Lektüre vertieft, merkt es noch nicht – und ist schließlich, sozial und geistig, so meilenweit von Emilia entfernt), läßt sie am Ende – theatralisch – den Mäher mitten auf dem Rasen stehen und kehrt beinahe rennend ins Haus zurück.