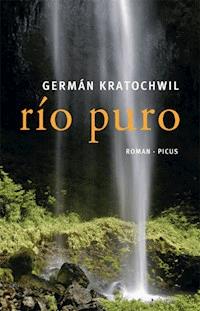Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
In seiner Blockhütte im tiefsten Patagonien lebt Eduard Böhm, 77, in ruhiger Beschaulichkeit. Aber in den Urwäldern, am nahen Vulkan und selbst in der bislang friedlichen, multikulturellen Gemeinde des Städtchens Quequemtréu zeichnet sich undeutlich etwas Bedrohliches ab. Auch die Mapuche-Schamanin kündigt eine große Gefahr an. Und gerade jetzt erhält er Besuch: Aus Pasadena kommt die attraktive, gut dreißig Jahre jüngere Seismologin Clara, aus Hamburg der Publizist und Jugendfreund Carl Gustav. Da bricht plötzlich ein Chaos aus – Naturgewalt, Liebeslust, Fremdenhass – und jeder sucht seinen intimen Fluchtweg. Germán Kratochwils Patagonien-Roman ist nicht nur schonungslos realistisch und politisch hochaktuell, sondern auch ein abgründig komisches Werk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GERMÁN KRATOCHWIL
TERRITORIUM
Copyright © 2016 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien Alle Rechte vorbehaltenGrafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien Umschlagabbildung: © plainpicture/Edith M. BalkISBN 978-3-7117-2043-6eISBN 978-3-7117-5329-8
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
Germán Kratochwil, geboren in Korneuburg und ausgewandert als Kind, lebt in Patagonien und Buenos Aires. In Hamburg 1973 zum Sozialwissenschaftler promoviert, war er für internationale Organisationen in Genf, Buenos Aires, Lima, Asunción, Santiago, Caracas und Montevideo tätig und veröffentlichte Fachliteratur. 2012 erschien im Picus Verlag sein erster Roman »Scherbengericht«, der für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. 2013 folgte »Río Puro«.
GERMÁN KRATOCHWIL
TERRITORIUM
ROMAN
PICUS VERLAG WIEN
Territorium would mean »a place which people are warned off«.
ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY
1
EIN MERKWÜRDIGER TAG HEUTE
An milden Herbsttagen wie diesem stehen die Fenster der Blockhütte offen. Ein hagerer, stoppelbärtiger Mann sitzt am Ecktisch und schaut in die Landschaft hinaus. Sein Blick durchstreift das bis zur Erschöpfung abgesuchte Panorama: Matten, Wiesen, Wälder, Berge – und blasse Pinselstriche über dem klaren Himmel. Nur einige Myrtenbäume und Trauerweiden verwehren ihm die Sicht auf den nahen See.
Für gewöhnlich ist es schon kühler um diese Jahreszeit. Aber den ganzen Sommer über herrschte eine unbarmherzige Trockenheit, und noch ist kein Wetterwechsel in Aussicht. Der schwache Morgennebel, der sonst zu Herbstbeginn lange über dem Tal liegt, dämpft an diesem Karsamstag 2014 die Sonnenstrahlen kaum. Es geht auf Mittag zu und er denkt wieder an das Graffito: frühmorgens in der Ortschaft, rot und schwarz über die weiße Wand des neuen Yabrud Market gesprayt. Er will mit dem Besitzer des Kaufhauses sprechen. Nadim Obeid kann diese militante Parole nicht dulden wollen, genauso wenig wie er, Eduard Böhm. Es war ihm, als ginge plötzlich ein haarfeiner Riss durch sein Umfeld und bräche, wie in einem Spiegelglas, das Bild seiner Idylle.
Harzduft weht herein. Er mag diesen Wind. Er streicht um die Hütte und durch die Bäume; es ist Luft aus dem Westen, vom Pazifik her, noch meerestrunken. Knapp fünfzig Meilen Luftlinie sind es bis zur Küste hinunter, enge Täler, dichter Regenwald, Bergseen. Ein von Vulkanausbrüchen und Erdbeben häufig gebeutelter Landstrich, der ihm dennoch – oder gar deshalb – herausfordernd paradiesisch erscheint und wohin er alle paar Monate zum Angeln reitet.
Meistens aber fegt der Wind stärker, ist kein milder Freund mit Harzduft mehr, geht ins Brausen über; dann krächzen und fauchen die Äste der hohen Monterey-Kiefern, die sein Vater um die Hütte herum gepflanzt hat. Schnell wachsende Nadelbäume wollte er, der damals schon über fünfzig war. Und ihn begleiten sie nun auch schon mehr als sechzig Jahre. Sie sind mächtig geworden, bald dreißig Meter hoch, und fangen die Windsbräute auf, die sich in ihre Arme werfen. Aber weiter nach Osten hin, wenn der Sturm von den letzten kahlen Bergrücken hinunterbraust, wirbelt er nur Staub und Sand über der dürren Steppe Patagoniens auf, dreihundert Meilen weit, bis hin zum Atlantik: Staub, Sand, Kiesel – und entwurzelten, irrwitzig dahinpurzelnden Dornbusch.
Einsamkeit erträgst du besser, wenn du ein Haustier besitzt. Am besten mit einem kastrierten Kater; keinesfalls mit einem Hund. Mit dem wirst du unweigerlich zu Herr und Hund, oder gar zu Hund und Herr. Die Abstammung vom Wolf hat den Hund zum Renegaten gemacht und sein hündisches Wesen erst entwickelt. Er bettelt um Aufmerksamkeit – und der Einsame vergibt sie leicht; bald kann dann von Einsamkeit nicht mehr die Rede sein. Dein Kater Zeno hingegen, schon acht Jahre alt, hat ein stahlgrau und weiß getigertes Fell, die geschmeidigen Bewegungen eines Raubtiers, und in seinem Gepardenkopf blitzen die Augen mit ungebrochenem Savannenblick. Keine Spur von Zutraulichkeit. Diese täuscht er allenfalls vor, wenn er, wie jetzt, um deine Hosenbeine streicht, aber in Wahrheit vor Anspannung zittert und sich mit herausgefahrenen Krallen rekelt, zum Sprung bereit.
Vielleicht solltest du einfach »ganz von vorne anfangen«, wie man so sagt. Solltest wieder über dein erstes Lebensjahrzehnt brüten, wie es dir einst der greise Therapeut geraten hat: über jene entscheidenden paar Jahre in deiner trotz Krieg und Not und Flucht verklärten »Geburtsheimat«. Damit hängt vielleicht – zeitlich wie fern auch immer – deine Reaktion auf das zusammen, was dir heute Morgen in der Ortschaft »ins Auge stach«.
Vor Jahren hatte ihm der Psychoanalytiker dazu geraten, den er aufgesucht hatte, weil er damals zunehmend unter einer Zwangsvorstellung litt. Es war ein häufig wiederkehrender Traum gewesen. »Ich kann in dem Traum durch die Luft schwimmen«, erzählte er dem Arzt, »wenn ich es nur inständig will; es gelingt mir, obgleich es anstrengend ist. Ich schwimme im Bruststil über Straßen, Bäume und Passanten hinweg. Die Leute schauen aufmunternd winkend zu mir herauf.« Wie aber mochte diese vermeintliche Fähigkeit allmählich aus seinen Träumen in den Wachzustand gesickert sein?, fragte er sich und seinen Zuhörer. Hinzu kam etwas Eigentümliches dieser Vorstellung: Sie erschien ihm in Schwarz-Weiß, wie die eingeschnittene Sequenz aus einer farblosen Totenwelt in seinem ansonsten lebensbunt ablaufenden Traumfilm. Und die Einbildung hatte begonnen, sich in ihm einzunisten, als drängende Versuchung zu fliegen, was ihn zugleich in Panik versetzte. »Wenn ich auf einen Balkon, auf eine Dachterrasse hinaustrete oder auf einem Felsvorsprung über einem Abgrund stehe – was ich alles schon längst vermeide –, will ich die Arme vorstrecken, mich abstoßen wie vom Rand eines Swimmingpools und mit kräftigen Arm- und Beinbewegungen durch die Luft rudern. Aber zugleich erfasst mich ein Entsetzen, sehe ich mich sofort verzweifelt umherschlagend in die Tiefe stürzen.« Ed besaß keineswegs den Übermut eines Basejumpers.
Diese Zwangsvorstellung kam auch manchmal mit Frau und Kindern zur Sprache. »Jag ihnen doch keine Angst ein«, bat ihn Matilda. Und er erzählte dem Therapeuten von einem extremen, schon länger zurückliegenden Vorfall. Mit seiner Frau und dem noch kleinen Sohn Antonio hatte er die Aussichtsplattform einer der Türme des World Trade Centers besucht. Dort oben aber, in den dunstigen Raumozean hinausblickend – über Betonprismen und gläserne Riffe hinweg, die aus der Tiefe heraufragten –, habe er nicht länger den in ihm aufschießenden Drang beherrschen können, sich gegen die schwere Verglasung zu werfen, um in diese Weite hinauszuschwimmen. Taumelnd, von Matilda, Antonio und einem uniformierten Kontrolleur gestützt, habe er sich mit schmerzender Schulter zum Fahrstuhl zurückbringen lassen. Er sehe immer noch die hellen Umrisse des Skeletts vor sich, das auf Antonios schwarzem T-Shirt abgebildet war.
»Meinen einzigen Anfall, diesen Rappel, hat der Kleine leider miterlebt. Und das hat ihn nicht losgelassen! Als wir Jahre später, nach dem Aufprall des zweiten Flugzeugs, Menschen aus den brennenden Türmen springen sahen, live im Fernsehen, wie sie geradewegs, aber nicht blitzschnell, hinuntersausten, hinuntertropften, ja noch Augenblicke hatten, um ins Handy zu schreien, stand Antonio neben mir, schlug plötzlich heftig mit der Faust auf mich ein und schrie: ›Siehst du, siehst du?! So ist das in der Wirklichkeit!‹«
Was er dem Psychiater aber nicht hatte verraten wollen, war die Niedertracht, die ihn in seinen eigenen Abgrund geworfen hatte: Wegen seiner Furcht vor Wolkenkratzern und seinem Hass auf sie hatte er beim Anblick der einstürzenden Twin Towers deutlich eine Spur von Genugtuung verspürt! Warum ließen sich die Menschen denn auch täglich in solche wahnsinnig hohen Türme pferchen? Und warum wurden immer noch weitere – höhere! – emsig errichtet und mit Menschen vollgestopft? Das war doch geradewegs eine Einladung für Terroristen.
Was nun hatte ihm Dr. Elias Königsberg – hinweggrinsend über dieses in seinem Sprechzimmer so oft beschworene Flugthema – aufgetragen? »Lieber Eduard, Sie haben sich mit Ihrem Sohn zu viele Superman-, Batman- und Spiderman-Filme angeschaut … Warum setzen Sie sich nicht so bald wie möglich ganz locker einmal vor ein leeres Blatt, schließen die Augen und stöbern mit äußerster Konzentration nach Ihrer allerersten Erinnerung, so winzig und undeutlich sie auch erscheinen mag? Das ist das erste Molekül, der früheste Baustein Ihres Selbst. Dann stöbern Sie nach einem weiteren und so fort. Versuchen Sie alles – alles!, ja? – genau so, wie Sie es erinnern, aufzuschreiben. Bohren Sie, bohren Sie! Lassen Sie nichts aus, aber notieren Sie nur das, was Sie allein finden, nicht was man Ihnen erzählt hat oder was Sie von Fotografien kennen. Werfen Sie alle Scham und Angst, jeden Verdacht und alle Ungläubigkeit ab, schreiben Sie, woran Sie sich und wie Sie es erinnern: Empfindungen, Menschen, Handlungen, Gegenstände, Umwelt und so weiter.« Und bald darauf, wieder einmal kurz vor einem Aufbruch Eduards ins patagonische Refugium, hatte ihm der greise Psychoanalytiker noch gedroht: »Kommen Sie mir diesmal nicht ohne die Hausaufgabe zurück! Nicht ohne Ihr Waldhüttenprotokoll!«
Das ist nun auch schon mehr als zehn Jahre her. Dr. Elias Königsberg ist tot, das Papier blieb lange leer. Vor zwei Wintern aber hat er neben das Blatt ein Glas Wein gestellt … Und, siehe da, gelockert und konzentriert gelang es ihm, das erste »Selbst-Molekül« aus den Ablagerungen seines Vergessens herauszutrennen – herauszupulen (wie es heute wohl treffender heißt). Aber mit wem könnte er es jetzt analysieren, ohne den Dr. K.? Gerade heute, wo er selbst schon alt war, hatte er wieder stark dieses Bedürfnis.
Und draußen beginnt der ärgerliche Widerspruch im Sturm: Zuerst die lispelnde Zeremonie der Bange gefolgt von einem vorauseilenden Pfeifen, das in Wahrheit, wie sich gleich herausstellen wird, nur das bloße Heranbrausen von gar nichts ankündigt. Ja, diese immer leer ausgehende Erwartung in Patagonien legt sich einem aufs Gemüt … Aber er kann nicht anders, er wartet auf die nahenden Luftstöße, lauscht, wie sie sich zuerst mit leisem Rascheln und Zischeln heranschleichen, hört ihre pfeifende Ankündigung, und wie sie kurz darauf voll in den Kronen tosen, bevor sie am Berg anbranden und über die Höhen weiterziehen. Nichtssagendes, sinnloses Lufttheater. Wenn er die Fenster schlösse, wüchse die innere Stille – obgleich im Holz niemals die Stille des Steines ruht. Du hörst, wie die Fasern und Risse in den Bohlen und Balken arbeiten, in den Brettern auf dem Boden und an der Decke. Und zum kleinen, knarrenden Kasten wird deine Kajüte, zum Spielball im Meer der Stürme, angeschwemmt an ein Waldufer am Fuß der Anden … Daraus spricht immerhin ein Sinn.
Vom Einschlagen dreizölliger Nägel, mit denen er eine Wand seines Werkzeugschuppens kurz zuvor repariert hat, ist er noch erschöpft, schwer liegen die Unterarme auf der Tischplatte. Die Nägel hat er sich heute Morgen in der Heimwerkerecke des Yabrud Market geholt.
Yellow Submarine: So ertönte das Signal seines Handys, beschwingt lauter werdend, und riss ihn hoch. Ein paar Stolperschritte brachten ihn zur Holzplatte neben der Geschirrspüle. Darauf einige Maronen und Butterpilze – die gestrige spärliche Ausbeute in dieser Trockenzeit, unter den Pinien, Zypressen und Südbuchen – und daneben der aufleuchtende und beinah hüpfende Apparat mit dem Beatles-Song. Den hat ihm Vicky hineinprogrammiert. »Das passt echt für dich, Pa, das ist doch deine Zeit gewesen!« Er drückte auf das grüne Knöpfchen, meldete sich und vernahm eine Frauenstimme – so nah, dass er unwillkürlich zum Fenster hinausschaute.
»Ed …?«
Clara Shuman! Sogleich wusste er, dass er auf diesen Anruf gewartet hatte, schon die ganze Zeit über, seit vier Wochen, als sie ihm angekündigt hatte, dass alles mit dem Andean Project gut gehe und sie zuerst einmal nach Quemquemtréu kommen wolle, »in deine paradiesische Oase«, um den alten Ortskundigen auszufragen. »Du kannst es nicht wissen, aber der südliche zweiundvierzigste Breitengrad, neben dem du dort nahe am Pazifik sitzt, ist für uns Geologen eine wichtige Marke.« Und jetzt war sie schon in Puerto Montt und kündigte sich für morgen an!
»Hast du das gehört, Zeno?«, rief Eduard dem Kater zu, der sich auf dem Sessel vor dem Kamin rekelte. »Morgen kommt …«
Roys Tochter, des befreundeten Architekten, mit dem er öfter mal zusammengearbeitet hat. Clara, anfangs noch Studentin, hatte er mehrmals bei Roy in Los Angeles angetroffen, und zuletzt, vor ein paar Jahren, in Wien. Er wusste, dass sie als Seismologin ihre »Frau« in diesem Männerberuf stand – eine dunkelblonde, schlanke Erscheinung, die bei ihrer ersten Begegnung in Santa Monica nur zu einem kurzen »Hi!« plus Küsschen für den Besucher über die Terrasse geflutscht war, denn sie hatte nach Pasadena zurückgemusst, in ihr seismologisches Labor im California Institute of Technology. Später erzählte ihm Roy von ihrem Forschungsaufenthalt am Conrad Observatorium der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien – »eine Art Rückkehr zu ihren Wurzeln«, hatte er sinniert. »Und am Caltech tritt sie in die Fußstapfen ihres Großvaters Norbert Shuman, der einst in seinem Geburtsland Österreich als Geologe gearbeitet hat und 1938 emigrieren musste.« Die aufblitzenden Erinnerungen wurden nun wieder vom gelben U-Boot unterbrochen, und zwar prompt: von Matilda aus Buenos Aires, die ihn manchmal um die Mittagszeit anrief.
»Eben war noch besetzt!«
»Ja, ich hab mit Ari Broda gesprochen«, fiel ihm nur ein.
Intuitiv hatte er Claras Anruf verschwiegen. In den letzten Jahren lebte er häufig mehrere Monate von seiner Frau getrennt. Sie könne sich einen gemeinsamen Alltag in dieser Waldeinsamkeit nicht vorstellen, hatte sie erklärt und nannte sein Leben hier ein »militant primitives Eigenbrötler-Hausen«. Aber es gab für beide, nach vier gemeinsam durchgestandenen Jahrzehnten, in der Schlussphase ihres Lebens keinen Grund mehr, sich weiterhin aneinander zu reiben, sich anzupassen oder unterzuordnen, sich dabei an den späten Auswüchsen ihrer Charaktere zu stoßen oder unter der Unvereinbarkeit ihrer letzten individuellen Interessen zu leiden. Das alles würde ja doch nur damit enden, dass irgendwann der eine die Krankenpflege des anderen antrat. Ohne ihn konnte Matilda sich freier auf ihre Praxis als Kinderärztin und auf ihre pädiatrische Forschungstätigkeit konzentrieren, er auf sein wolkiges »Grübeln«. Wie gewöhnlich berichtete sie nun von Vicky, von den beiden Enkelkindern und von Antonio. Sie fragte Eduardo (wie sie ihn nannte): »Hat dich Tse Ge erreicht?« Mit Tse Ge war ihr gemeinsamer Freund Dr. Carl Gustav Werneck gemeint. »Ja, gewiss«, erwiderte Ed. Tse Ge habe sich gemeldet. Er habe vor, in einigen Tagen bei ihm hier aufzutauchen.
Matilda fragte ihren Mann schon längst nicht mehr, wann er vorhabe, nach Buenos Aires zurückzukehren. Sie wünschte ihm für morgen »Frohe Ostern«, er ihr ebenfalls.
»Siehst du, die Ruhe des Einsiedlers ist dahin«, brummte Eduard dem Kater Zeno zu. Er machte sich daran, das Gemüse für sein Mittagsessen zu säubern. Beim Schälen und Zerkleinern der Karotten und Erdäpfel, dem Zerschneiden der Selleriestange und dem Abhäuten und Filetieren der Pilze – wobei ihm der modrig-süße Waldbodenduft ihres Fleisches in die Nase stieg – konnte er sich ablenken, konnte an Clara denken, an ihren professionell begründeten Wunsch, sich in seiner »paradiesischen Oase« umzuschauen. Ob sie Pilze mochte? Und an Tse Ge, den zwölf Jahre jüngeren Freund, der sich, nachdem er mit seinem nächsten präsumtiven Bestseller fertig geworden war, etwas ausruhen und endlich das vielgerühmte Patagonien kennenlernen wollte. Auf seine Art: »Ich will dort unten einmal hineinhören«, hatte er angekündigt, dieser Carl Gustav, der aus einer alten deutsch-argentinischen Familie stammte, aber schon als Student in die Bundesrepublik gereist und an der Universität in Hamburg hängen geblieben war. Er wurde in akademischen Kreisen und in den Medien bekannt, und als »Ohr am Puls der Zeit« saß er immer wieder lebhaft in Talkshows herum und meldete sich alle paar Jahre mit einer aufsehenerregenden Schwarte. Da erfuhr sein Publikum dann genauestens, wie und wo es zur Zeit mit der Globalisierung der Weltgesellschaft langging. Der Freund hatte öfters von der merkwürdigen Gegenläufigkeit ihrer Lebenswege gesprochen: Er, gebürtiger Argentinier, war 1970 nach Deutschland gegangen; die Böhms mit ihrem knapp elfjährigen Eduard schon 1947 von Österreich nach Argentinien ausgewandert. In Buenos Aires hatte Eduard Matilda Paoli-Fürst kennengelernt und später geheiratet. Carl Gustav, ihr einstiger Schulkamerad, war zur Hochzeit gekommen und Eduard hatte sich mit ihm angefreundet. »Er hat mich gleich mitgeheiratet«, pflegte Tse Ge anderen gegenüber den Beginn ihrer Freundschaft zuschildern. Jetzt wolle er endlich sehen, in welch harmonischer Enklave der einst im bürokratischen Kleinkrieg der »internationalen Zusammenarbeit« ringende Ed Böhm sich verkrochen habe. »Ob du gar in deinem verschlafenen Deep South Patagoniens inzwischen zum weltabgewandten Hagestolz geworden bist?«, hatte er den Freund übers Handy geneckt.
»Harmonische Enklave?«, wiederholte Eduard sich’s heute am Karsamstag ironisch. Was hatte er am frühen Morgen in Quemquemtréu lesen müssen? »TERRITORIUM UND FREIHEIT FÜR PALÄSTINA!«, in riesigen roten Lettern auf der weiß gestrichenen Mauer des Yabrud Market. Als gut gemeinten, wenn auch hier in Patagonien deplatzierten Wunsch hätte er das noch gelten lassen können – wäre unter den Schriftzeichen nicht in voller Länge und bis hin zum dicken Ausrufezeichen in übertriebener Größe ein schwarzes Sturmgewehr abgebildet gewesen. Wer erkennt da nicht gleich eine Kalaschnikow! Und zwar eine von links nach rechts zielende AK-47. Die Waffe war sichtlich mithilfe einer Schablone aufgesprüht worden, ein ausgereift stilisiertes Symbol für mörderischen Hass. Welche Lumpen laufen nachts in der Ortschaft mit Sprühdosen und mit den Teilen einer zwei Meter langen Kalaschnikow-Schablone unterm Arm herum? Und dann noch diese politische Forderung, die für den fernen »Nahen Osten« gilt! Palästina liegt doch vierzehntausend Kilometer nordöstlich von hier, auf der anderen Hälfte der Erdkugel, ihr Arschlöcher!
Nadim Obeid, der Besitzer, Nachkomme syrisch-libanesischer Einwanderer, war noch nicht eingetroffen. Aber das Menetekel musste so schnell wie möglich verschwinden. Wie peinlich, wenn Clara und Tse Ge darauf stoßen würden. Er wollte später auch im Hostel Currumahuida am Río Ñireco vorbeischauen und mit dem Betreiber Ari Broda darüber sprechen. Immerhin quartierten sich dort überwiegend junge Israelis ein, die nach ihrem Militärdienst zum Trauma-Abbau für ein paar Monate auf Weltenbummel gingen und gerne etwas länger in Patagonien hängen blieben. Die Kalaschnikow wäre eine üble Begrüßung für sie – in diesem weltfernen Winkel, der mit seiner paradiesischen Ruhe wirbt!
Dazu fiel ihm jetzt ein: Wie sollte er überhaupt, als quasi einheimischer Gastgeber, seine Besucher Clara und Carl Gustav auf Quemquemtréu einstimmen? Was sollten sie zuerst erfahren? Wie vor mehr als hundert Jahren einige Spanier, Italiener, Polen, Österreicher, Schweizer, Deutsche, Engländer und fahrende Händler aus dem Osmanischen Reich bis in dieses letzte, dicht bewaldete, fruchtbare Tal im Vorgebirge der Anden gekommen sind und sich nach und nach zu so etwas wie einer Dorfgemeinschaft zusammengesiedelt haben? Bald gingen in dämmrigen Buden, an einer einzigen Dorfstraße aufgereiht, die Produkte der Bauern, Handwerker und Jäger, die in der Umgebung ansässig geworden waren, über den Ladentisch – Schafwolle, Felle, Talg, Wachs, Honig, Trockenfleisch, Käse, Lederzeug – und wurden getauscht gegen Stoffe, Munition, Mehl, Zucker, Schnaps, Tabak, Mate-Tee, Nähzeug, Seife, Kerosin … Auch Chilenen kamen von der »anderen Seite« der Kordilleren herüber, um sich hier zu versorgen. Vor fünf Jahrzehnten noch hatte er die letzten müden Pferde vor den Läden angebunden gesehen und war hinter langsamen, quietschenden Ochsenkarren hergeschlendert. Samstagabends warteten Reittiere vor einem Schuppen. Die Reiter saßen drinnen, rauchten und tranken und genossen einen Western, der über ein aufgespanntes Leintuch flimmerte. Auch Eduard war oft unter ihnen gewesen. Jauchzend und johlend galoppierten sie hinterher in die Nacht hinaus, verfolgten imaginäre Banditen … Und bald kreuzten ja wirklich ein paar schräge Vögel aus dem Nachkriegseuropa auf und tauchten hier unter: Steckbrieflich Gesuchte, an fernen Gerichtshöfen Verurteilte, die sich ebenfalls in der Umgebung niederließen. Aber das waren allesamt keine Bösewichte von der Art, für die ein patagonischer Cowboy sich interessiert hätte.
Eduard hat einige dieser Typen noch gekannt. Ein sonderbares Häuflein: Der SS-Standartenführer Otto Sattler aus dem Reichspropagandaministerium, der in seinem Farm-Versteck den Untergang des Zionismus in Schmähschriften prophezeite und verschmierte Hektografien, zusammen mit Honig und Himbeerlikör aus eigener Produktion, an seine Kunden versandte; Marschall Pétains persönlicher Referent für Verfassungsfragen, Dr. Jean-Marie Rossignol, sowie der einstige Leibarzt des Vichy-Präsidenten, Dr. Roger Pellegrin, die hier als Erste den Anbau von Endivien einführten, Mohn säten und Alleen mit Walnussbäumen und Edelkastanien anlegten; schließlich der Südtiroler Gestapo-Mann Ercole Buchtler, der sich den »unauffälligsten« Unterschlupf, den Berchtesgadener Berghof, im Kleinformat nachgebaut hatte; auf der hohen Terrasse veranstaltete er alljährlich am 20. April einen gut besuchten Empfang.
Ende der siebziger Jahre wanderten dann Hippies in Gruppen und Großfamilien aus dem Norden zu, auf der Suche nach billigem Boden und laxen Kontrollen; sie wurden ansässig und gehören seither, musizierend und Joints rauchend, mit ihrem Kunsthandwerk, mit Gesang, Tanz und Biogemüse zum allwöchentlichen Markttreiben. Heute sind aus den Krämerläden Fachgeschäfte geworden, die schrägen Vögel sind allesamt tot, die Kiffer-Hippies hängen schlaff und ergraut herum, ihre Nachkommen bauen zwischen Mais und Gerste etwas Marihuana an, und aus dem großen Holzschuppen ist eine Backsteinhalle geworden. Wo einst Cowboys über das Betttuch ritten, dröhnt jetzt an manchen Wochenenden elektronisch verschärfter Hip-Hop, und die Jugend aus der Umgebung ruckelt unter Discoblitzen. Draußen warten keine Pferde mehr auf sie, sondern Geländewagen und Mopeds. Und seit Neuestem prunkt am Ort ein modern ausgestattetes Kaufhaus – mit Aire Acondicionado!
Deine Ortsgeschichte klänge ja ganz annehmbar nach Multikulti-Schmelztiegel, nach erfreulich gewaltlosem, historisch gewachsenem Zusammenleben von Einwanderern – aber vergiss nicht, lüg dir nicht in die Taschen, die ersten Pioniere sind auf ein kleines Hindernis gestoßen: Der Boden, auf dem sie sich niederlassen und den sie bebauen wollten, gehörte schon jemandem! Du wirst die Geschichte der Urbevölkerung einflechten müssen: Clane und Sippen, Tehuelche und Mapuche, nicht unbedingt eingeboren, selbst dauernd herumziehend und in Zwistigkeiten untereinander verwickelt, aber eben schon vorher da. Sie müssen schließlich weichen, werden zum Landverkauf gezwungen oder von den Zuwanderern verdrängt, vertrieben. Heute fordern sie unter günstigeren politischen Bedingungen diesen Boden wieder zurück.
Plötzlich ging ihm ein möglicher Doppelsinn (oder Hintersinn) in der Forderung des Graffitos auf. Ein Territorium beanspruchten nicht nur die Palästinenser … Dem »hineinhörenden« Carl Gustav Werneck würde das sicher sofort Anlass bieten, sich das Szenario nach seinem Geschmack auszumalen: Übereinstimmung und politische Solidarität mit den Verdrängten, Vertriebenen von »globalem Ausmaß«, selbst hier im weltfernen Patagonien – und die jüngere Clara aus dem migrationsbewegten Kalifornien würde ihm dabei sogar noch zustimmen. Kein erfreulicher Ausblick für das erwartete Wiedersehen am Ort des Friedens.
Eduard schob die gehackten Zwiebeln ins brodelnde Olivenöl. Im Wok vermischten sie sich zischend mit zwei zerquetschten Knoblauchzehen. So nahe an der Herdplatte wollte er sich rasch den schweren Pullover vom Leib ziehen, hielt aber mitten in der Bewegung inne … Im dunklen Bauch der dichten Schafwolle, durch die der Geruch des Geschmorten drang, erschien ihm Claras von den Pazifikstränden gebräuntes Gesicht, und gleich darauf ihr winterblasses aus der Begegnung in Wien … Hirngespinste und Wunschträume haben ja keine fixe Bühne für ihr Auftreten, sie erscheinen, wann und wo es ihnen gerade passt. Vor allem und zuallererst beeindruckten ihn Claras irisierend braungrüne Augen, der flüchtige, den Besucher überhuschende Blick – jugendlich forsch und zugleich eine Spur verletzlich … Ja: unsicher reif geworden! Und, wie bei jeder ihrer späteren Augenbegegnungen – ein sogenannter glimpse … Das ist genau der Augenblick, in den – in dem man sich verliebt, der »zündende Funke«, für immer … Ach, schon erloschen! Sein Kopf arbeitete sich aus dem verfilzten Pulli heraus. Neugeboren rief er in den Wokdunst hinein: »I am expecting you, Clara!«
Nachmittags fuhr Eduard wieder in die Ortschaft. Diesmal fiel ihm am Eingang zum Kaufhaus, an die gläserne Schiebetür geheftet, ein Zettel mit einer Mitteilung in hebräischer Schrift auf, den er bisher nicht bemerkt oder beachtet hatte. Nadim Obeid kam gerade heraus; er behauptete, noch nichts von der Schmiererei an seinem Gebäude zu wissen, zuckte nur mit den Schultern, als sie das Graffito betrachteten. Das sei vermutlich der gegenwärtigen Berichterstattung im Fernsehen über die israelischen Repressalien im Gazastreifen zuzuschreiben, meinte er. Aber niemanden in der Ortschaft interessiere das, keiner komme für einen derartigen Protest infrage. »Bei uns geht es doch erstens, zweitens und drittens um Fußball! Allenfalls in Wahlkampfzeiten um etwas Lokalpolitik. Aber damit hat das ja auch nichts zu tun. Vielleicht war es ein Durchreisender, ein Fanatiker aus der Hauptstadt, der das überall aufsprüht.« Er werde sofort einen Gehilfen anweisen, den befremdlichen Aufruf zu überpinseln.
»Ja, ich bitte dich!«, drängte ihn Eduard. »Es kommen doch viele Touristen zu uns, die das abstoßen muss. Was steht denn dort am Eingang auf dem Zettel?«
»Ach, das ist für die israelischen Tramper. Wir bitten sie, ihre Rucksäcke vor den Kassen in Aufbewahrung zu geben. Mit ihren prallen Ungetümen stoßen sie schon manchmal meine Regale um.« Dann kam Nadim auf seine Sorge über die letzten Nachrichten aus den Kampfgebieten in Syrien zu sprechen. Erst gestern habe die Regierungsarmee nach Dauerbeschuss seine Herkunftsstadt Yabrud wieder den Rebellen und der Al Qaida entreißen können. Er habe keine Möglichkeit, etwas über seine Verwandten zu erfahren. »Die leben in einer Hölle, wenn sie überhaupt noch leben. Im besten Fall haben sie noch in die Türkei flüchten können. Die sollten alle zu uns kommen, so wie wir vor hundert Jahren gekommen sind. Aber leider machen heute sämtliche Staaten den Flüchtlingen mehr Schwierigkeiten als damals. Dabei haben damals alle davon profitiert.« Er schüttelte seinen runden, glatt rasierten Schädel.
Es war zu spüren, dass Nadim von Ed – von dem er wusste, dass er sich einst mit Flüchtlingselend in aller Welt beschäftigt hatte – eine Meinung über seine Sorgen hören wollte. Aber Ed widerstand diesmal der Senioren-Versuchung, mit seinem Kenntnisschatz zu glänzen. Er wollte ohne Verzug weiter, zum Hostel Currumahuida.
Mit Miguel Broda und mit Ari, dessen ältestem Sohn, der hier den Betrieb aufgebaut hatte und führte, war er gut bekannt.
Der Vater hatte vor etwa zwölf Jahren Israel wieder verlassen und war in sein Geburtsland zurückgekehrt. In der argentinischen Provinz Entre Ríos hatten einst schon seine zu Beginn des vorigen Jahrhunderts aus Białystok eingewanderten Großeltern eine Hühnerfarm betrieben, aber Miguels Eltern fassten in den sechziger Jahren den Entschluss, alles zu verkaufen und in Israel einen Neuanfang zu wagen. Dort lebten sie mit anderen Argentiniern im Kibbuz von Gaash, in dessen Gärten sie auf die heimatlich vertrauten Florettseidenbäume trafen. Miguel hatte standgehalten, bis seine sozialistischen Ideale durch die Privatisierung der Genossenschaften ad absurdum geführt wurden. Als der zunehmend kapitalistischer verwaltete Kibbuz die ersten thailändischen Gastarbeiter einstellte, beschloss der inzwischen Verwitwete, nach Argentinien zurückzukehren. Sechzig Hektar unberührte patagonische Wildnis konnte er sich nach dem Verkauf seines Hauses und seiner Kibbuz-Anteile verschaffen – und darauf mit seinen drei Söhnen all ihre landwirtschaftlichen und handwerklichen Fertigkeiten zum Einsatz bringen. Ari, der Älteste und Kreativste, gründete bald auch ein Hostel; nach seinem Militärdienst hatte er Erfahrungen als Tramper gesammelt und wusste, was die gestressten jungen Menschen auf ihrem Bummel durch die Welt suchten und benötigten. Heute war sein Unternehmen zu einer im Internet empfohlenen Station auf der Südamerikaroute geworden: Zwischen November und Mai konnte er oft schon bis zu fünfzehnhundert Übernachtungen verbuchen.
Vor dem großen hellen Holzhaus mit bunten Blumenkästen unter den Fensterbrettern saßen ein paar Mädchen und Burschen bei Bier und Cola; ihr lautes Gespräch übertönte die Musik aus dem an einem Smartphone angeschlossenen Lautsprecher. Eduard fand Ari in der Küche. Er lehnte am Tisch und sprach mit einer jungen Frau. Wie immer stand er da im abgetragenen khakifarbenen Outfit, in schlotternder Hose und einer Jacke mit vielen prall gefüllten Taschen; aus einer lugte die kurze Antenne seines Walkie-Talkies hervor. Mit seinem schmalen geschorenen Schädel, den grauen Augen und den scharfen Falten, die sich beiderseits der Nasenflügel an den Mundwinkeln vorbei ins kantige Kinn gruben, sah er wie ein amerikanischer Marineinfanterist auf Heimaturlaub aus. Ständig beging er das weite, ihm und den Brüdern vom Vater überschriebene Gelände, ihren »Grund und Boden« – dieser einstmals undurchdringliche, mit Dornen- und Brombeergebüsch überwachsene, von fauligen Tümpeln durchzogene Streifen am Rand des Río Ñireco. Ari war immer erreichbar oder meldete sich aus der Werkstatt, von den Schaf-, Ziegenund Hühnerställen, aus den Schweinekoben, von der Pferdekoppel, von der Schleusenanlage am Fluss, aus dem Gemüsegarten und den Treibhäusern, aus dem Obstgarten, von der neuen Baustelle für Ein-Zimmer-Bungalows mit Doppelbett und Bad – screwing dens, wie er sie selbst mit einem Schmunzeln bezeichnete –, sowie aus dem Verwaltungsbüro. Auf dem Küchentisch sah Eduard eine riesige Schüssel mit hellrosafarbenem Inhalt. Daneben lag ein großer Laib Weißbrot.
»Das ist Ana«, stellte Ari die junge Frau vor. »Sie arbeitet jetzt bei uns. Und das ist Ed – aber ihr müsstet euch eigentlich kennen.«
Die schwarzhaarige Ana mit ihren dunkelbraunen Augen lächelte schüchtern. »Ich bin die Urenkelin von Kilakina Aurora. Wir waren einmal Nachbarn … Und jetzt sind wir es wieder.«
»Richtig! Du warst ein kleines Mädchen, als ich dich zuletzt gesehen habe.«
»Ich bin damals mit meiner Mutter nach Puerto Madryn gegangen, an den Atlantik. Aber, wie Sie sehen: Ich bin wieder zurückgekommen.« Die Finger ihrer rechten Hand spielten beim Sprechen heftig im vollen Haar, das auf ihre Schulter reichte.
Eduard sagte zu Ari gewandt: »Ihre Urgroßmutter ist die Witwe des letzten Mapuche-Kaziken in unserer Gegend, Tokikurá, und zugleich die letzte Tehuelche in der Region – eine Zauberin, eine Schamanin, eine Erzählerin. Eine Fundgrube für jeden, der sich für die untergegangene Tehuelche-Kultur und die der Mapuche interessiert.«
Ari ließ ihn ausreden. »Ja, ja, ich kenne die Alte doch, wer kennt sie nicht!« Er schüttelte den Kopf und strich mit der flachen Hand über seine rotblonden Haarstoppeln. Der gute Ed kann wohl keine Minute verstreichen lassen, ohne etwas »Wissenswertes« von sich zu geben. Da muss man ihm einfach zuhören. Er wechselte verschmitzte Blicke mit Ana.
»Ana und ich besprechen gerade das Menü für das Hochzeitsfest meines Bruders. Gewissermaßen in letzter Minute. Wir haben es auf morgen vorverlegt! Weißt du, es hat Ethan stark getroffen: Seine Shira muss ganz plötzlich für ein paar Tage nach Europa zurück. Die Arme ist doch erst vor einer Woche gekommen! Aber sie soll jetzt mit ihrer Mutter nach Dnjepropetrowsk – dort ist Shiras Großmutter gestorben und es scheint gewaltige bürokratische Probleme mit der Erbschaft zu geben. Stell dir vor, gerade jetzt, da die Russen in den Osten der Ukraine vordringen …! Aber okay, vor dem Abflug will sie meinen Bruder heiraten.« Er hüstelte etwas aufgeregt. »Ed, hoffentlich kannst du morgen kommen, ich hab heute Früh die Nachricht an alle Gäste verschickt.«
»Da war ich wohl gerade unterwegs, um mir Nägel zu kaufen. Ich komme natürlich gern. Übrigens …«
»Koste schon einmal von diesem Hummus«, unterbrach ihn Ari. Er riss eine Kruste vom Brot, pflügte damit durch die blassrosa Masse und hielt sie Eduard hin. »Na?«
Was für ein Typ dieser Ari, der den unaussprechlichen Namen dieser ostukrainischen Stadt ganz locker ausspricht und die großen Gefahren einer solchen Reise überspielt. Aber so zum Hummus kann ich’s ihm jetzt nicht sagen … »Schmeckt grandios! Schwer, damit aufzuhören …«
»Siehst du! Da kommt gerade unser Küchenchef Achmed!« Ari zeigte auf den tunesischen Koch, der über das ganze Gesicht strahlte und auf beiden Handflächen ein paar großer, schwarz und violett glänzender Auberginen balancierte.
»Aus unserem Garten«, verkündete Ari stolz.
»Großartig, Ari. – Dann also bis morgen!«
Ein flüchtiger Kuss auf Anas Wange noch. Rund, glatt, warm – so nah am Amorbogen ihrer vollen Oberlippe und dem Hauch von dunklem Flaum darüber …
»Was hat dich denn eigentlich hergebracht?«, besann sich Ari, aber Ed, schon auf dem Weg zu seinem Auto, winkte ab.
»Sehen uns morgen!«
Zurück in der Blockhütte begann Eduard mit seinem Spätnachmittagsritual. Das Versprechen Nadim Obeids, die schwarze Kalaschnikow und den Palästinenserappell sofort zu überpinseln, hat ihn beruhigt. Nicht gleich übertreiben! Es gelang ihm nach und nach, sich wieder in einen Wohlfühlmodus zu versetzen. Von seiner Bank am Waldrand kann er das Tal bis zu den gegenüberliegenden Höhen überblicken. Über ihren runden Rücken, bis zu denen der Urwald hinaufwächst und hinter denen erst die verschneiten Gipfel der Kordilleren liegen, wird bald die Sonne untergehen; im Sommer um zehn, aber jetzt, im April, so meldet ihm sein Zeitgefühl, schon kurz vor acht. Anders als die Normaluhr schenkt ihm dieses innere Maß ganz »seine« Zeit, die er hier versitzt. Kein Ritual ohne Pfeife und Whisky, diesmal den milden Glenfiddich.
Die Pfeife wird gestopft, der Whisky geschwenkt. Eingeschliffene Kerben im Glas verdoppeln sein Funkeln. Anzünden, saugen, nippen, schlucken, schmecken, sehen … Und ihm gegenüber diese gebuckelte Biomasse, anfangs in vielfältigen, harmonisch abgestimmten Grüntönen (nur ein Farbwechsel der von ihren Gesetzen bestimmten Natur), in die noch nie ein Mensch eingedrungen ist, wohl jemals eindringen wollte, die aber bald darauf dunstig graugrün wird im letzten Licht, oder oft nur dunkel und unförmig unter Regenschleiern ruht; zuletzt steht sie als schwarze Wand unter dem noch lichten Nachthimmel vor ihm. Das gilt ihm immer wieder als das Ereignis der reinen Erscheinung, da gibt es nichts zu deuteln. Was sich geologisch-geografisch-biologisch-tageszeitlich-sinnlich dort vor ihm aufbaut, ist der unzugängliche Selbstbezug der Natur, der dir nicht einmal einen Schatten zuwirft, wie ihn dir noch jeder brave Fels, Baum oder Strauch spendet – sondern vielmehr Schatten verschluckt. Demgegenüber verhalte man sich stumm, begriffslos, leer … Sag nichts zu dem, was dir nichts sagt. Nicht grübeln, da kommst du nicht durch, da stößt du dir nur den Schädel an. Besser du füllst dir Whisky nach, nimmst einen Zug aus der Pfeife.
In sein abdankendes Nachdenken tröpfelte, näher kommend, das vertraute Gebimmel eines Leithammel-Glöckchens. Er weiß, die hundertjährige Kilakina Aurora treibt ihre Schafe heim. Meist zieht er nur grüßend den Strohhut, manchmal aber geht er an den Zaun und versucht, ein paar Worte mit der verhutzelten, in bunt gewebte Tücher gehüllten, fast tauben Tehuelche-Zauberin zu wechseln. Eigentlich kann er nur der Fistelstimme aus dem zahnlosen Mund zuhören. Über das Wetter, dass sich ein Schaf verlaufen habe – vor Jahren riss manchmal noch der Puma eines –, über Schmerzen im Rücken und in den Knien (ja, das Alter!), ob sie ihm morgen etwas Gemüse aus ihrem Garten bringen solle oder wieder Schafskäse und Eier … Er braucht nur den Kopf zu bewegen, Grimassen zu schneiden, zu grinsen, die Augenbrauen hochzuziehen, nicken, verneinen.
»Hast du heute Nacht das tiefe Grollen gehört?«, hatte sie ihn gestern gefragt. Er erinnerte sich aber nur daran, dass der Himmel sternenklar gewesen war, der Orion prunkend wie immer über ihm gestanden war und dass ihn nach Mitternacht wieder einmal die Stille weckte, von der er sich eingesogen fühlte wie von einem der berüchtigten schwarzen Löcher im All. Er hatte den Kopf geschüttelt. »Ein besonders tiefes Grollen …«, hatte sie wiederholt und dabei heftig die im dichten Faltennetz eingefangenen Augen verdreht. Er hatte zur Antwort den Kopf auf seine gefalteten Hände geneigt. »Ja, ja, verstehe, du hast es verschlafen. Das ist schlimm. Der Große Geist sei mit dir, Eduardo« – und sie war weitergewatschelt.
Heute wollte er versuchen, ihr mitzuteilen, dass er ihrer Urenkelin Ana begegnet war. Wie hübsch sie doch geworden sei, so hübsch wie ihre unsterbliche Urgroßmutter … Nur, wie konnte er ihr in seiner Zeichensprache »hübsch« vermitteln?
Aber heute kam zu seiner Überraschung anstatt der Alten ein ihm unbekannter Bub heran und grüßte ihn schon von Weitem. Ein braunes, noch kindlich sanft gerundetes Gesicht mit klug blitzenden Augen. Sein Haar war kurz geschoren wie bei einem Heimkind. Er sei Cefo, eigentlich Ceferino Tokikurá, und heute hüte er die Schafe seiner Ururgroßmutter. Sie sei im Bett geblieben, er aber habe Osterferien. Ein Bock sei durch den Zaun gebrochen und in den Wald entflohen. Er, Cefo, kenne den Weg noch nicht und habe nicht gewusst, an welchen Stellen der Zaun ein Loch habe und wo er besonders aufpassen müsse. Der Schafsbock habe das wohl gewusst.
»Ich bin Ed«, sagte Eduard, hielt ihm die Hand hin und drückte die kleine des Jungen, die schmutzig war wie eine eben ausgebuddelte Kartoffel. »Ist Ana deine Mutter?«, erriet er. »Wie alt bist du?«
»Ich werde bald zwölf.« Der Junge forschte offen und neugierig in dem beschatteten Gesicht des Stoppelbarts unter dem Strohhut.
»Bist du mit deiner Mutter vom Meer heraufgekommen?«
»Ja, aus Bahía Bustamante. Dort bin ich geboren. Meine Mutter hat dort gearbeitet.« Die flinken Augen des Kleinen sahen vom Glas, das der Alte von den Lippen nahm, zur Pfeife, die er sich in den Mund steckte.
»Ihr kümmert euch um Aurora?«
Cefo nickte. »Heute ist sie im Bett geblieben. Ich treibe die Schafe zurück.«
»Und dein Vater?«
»Weiß ich nicht …«
»Weißt du, Cefo, ich wollte immer schon einmal diese Steilküste am Atlantik kennenlernen. Wie sieht es dort aus, in … Bahía Bustamante?«
»Nur Wasser, Pinguine, Seehunde, viele Fische und Algen, Muscheln, bei Ebbe komisches Geziefer in den Pfützen zwischen den Steinen. Und erst die Wale!« Cefo breitete die Arme aus, warf Kopf und Oberkörper zurück, als begrüßte er solch ein Ungetüm. Dabei guckte er auf den Alten, ob der wohl verstand, wie gewaltig das Ding war. »Im Schulheim bewahren sie den riesigen Knochen von einem Dinosaurier auf. Die sind noch größer gewesen als die Wale, aber die sind schon ausgestorben.«
»Und dann haben sie dich einfach so aus deiner vertrauten Welt herausgerissen?«
Cefo zuckte mit den Achseln, wusste darauf nichts zu sagen. Vielleicht hatte er ihn gar nicht verstanden.
»Und deine Freunde? Hattest du doch, und eine gute Zeit mit ihnen, oder?«
Überrascht und nachdenklich oder traurig schaute der Junge in Eds überschattetes Gesicht. Solche Fragen hatte ihm wohl noch niemand gestellt. Ed hatte vergessen, Kinder leben in die Zukunft gerichtet, auf das Neue zu. Schließlich nickte der Junge eifrig:
»Ja, ja, Néstor, Angélica, auch Paco …«
»Vergiss sie nicht.« Aber Eduard sagte ihm nicht dazu, was er noch dachte: Das ist der größte Schatz, den wir in unserem Reisekoffer verstauen können: die Illusion einer Freundschaft, einer Liebe, die uns die Kindheit verspricht und die uns, bevor Enttäuschung und Ernüchterung eintreten, verloren geht. Cefo sah zum rostroten Land Rover Discovery hinüber, der kaum fünfzig Schritte entfernt unter einer hohen Eiche stand.
»Toller Wagen, was der wohl kostet …«
»Ja, Cefo, eine Menge, aber mein einziger Luxus. Die Straßen hier, das Wetter im Winter … Wir fahren einmal ein bisschen herum, wenn du Lust hast!«
»Fein, danke … Die Hütte, hast du die gebaut?«
»Ja, zum Teil. Begonnen hat sie mein Vater …«
»Vier Blöcke an jeder Seite, oben neun«, nuschelte Cefo in sich hinein. »Und hast du auch eine Werkbank?«
»Freilich, die braucht man ständig. Die steht im Schuppen hinter der Hütte.«
»Du bist gut ausgerüstet … Darf ich jetzt meinen Bock suchen?«
»Ja, such ihn nur! Ruf mich, falls du Hilfe brauchst. Wir unterhalten uns bald wieder, Cefo. Es macht Spaß mit dir.«
Befreit sprang der Bub mit scharfen Pfiffen sofort den Wald hinauf; die Herde war inzwischen den vertrauten Pfad allein weitergetrottet; ihre Ausdünstung lag noch in der Luft. Da stand die Sonne bereits knapp über dem Bergrücken.
Bald war vom pfeifenden und rufenden Hirtenbuben nichts mehr zu hören. Aber andere Laute erreichten Eduard: Es war ein gepresstes, auf- und abschwellendes Zwitschern und Gurren und es kam von der südlichen Grenze des Anwesens, wo vereinzelt ein paar uralte, fast dürre Zypressen standen, abgesondert von der Walddichte, wie greise Elefanten auf dem Weg fort von ihrer Herde zu ihrem Sterbeort. Er trank seinen zweiten Whisky aus, verließ die Bank, näherte sich den Bäumen und staunte. Auf allen Ästen plusterten sich, dicht aneinandergedrängt, kleine braune Vögel auf. Er wusste nicht, wie sie hießen, aber sie erschienen ihm wie durchpulst von einer panischen Aufbruchsangst. Die Zeit der großen Wanderung in ein gastlicheres Land war noch nicht gekommen, aber dieses irre Gedränge und Geschrei schien ein bedrohliches Reisefieber, ein Wanderfieber zu verraten, das zur Unzeit ausgebrochen war. Ereignisse sollen warten, bis sie sich ereignen können. Aus dem Abendhimmel stießen immer noch weitere Artgenossen im Sturzflug hinzu, drückten und rüttelten sich in die Reihen hinein, und dabei wuchs das Gurren und Pfeifen zu großem Lärm an.
Gebannt stand Eduard vor dem Schauspiel und wartete. Er hätte ja klatschen und die Vögel aufscheuchen können … Aber würden sie dann nicht in einer Explosion kreischenden Entsetzens herumflattern und sich in einem Flugchaos verwirbeln und verfangen? Es ist doch, als wäre dieses an die Äste der dürren Zypressen gekrallte Vogelvolk am Verrücktwerden, einfach weil es aufbrechen soll, aber sein instinktives Startsignal noch nicht vernimmt. So aber kann es den richtigen Flugweg nicht anpeilen, kann es die Route nicht finden.
Lass doch einfach die Natur wirken, Alter, es wird schon seine Ordnung haben! Du hast ja nicht einmal die Natur der Menschen verstanden, ihnen nur selten etwas Richtiges weisen können: Weder den einen, die sich vor dem Anblick fruchtbarer Äcker, fetter Weiden, ertragreicher Plantagen, genussversprechender Weinberge, stattlicher Forste, lieblicher Flusstäler, blühender Industrien, überbordender Dienstleistungen und Konsumangebote in Slums, Favelas und Villas miseria verkriechen müssen, zusammengepfercht wie diese Vögel, noch den anderen, die zu wissen scheinen, wo es langgeht, die frei und frech die Produktionsmittel und den Großteil des erwirtschafteten Reichtums an sich reißen, gleichgültig, blind, unbekümmert angesichts des Elends der Menschen ringsum. Warten sie alle auf ein Signal, das ihrem Vogelhirn den Aufbruch zum Flug in eine gastlichere Welt ermöglicht? Ha, Alter, spinn dir was aus! Wie zahllose kleine, alltägliche menschliche Miseren und Konflikte zum Nährboden großer, grober Entwürfe der Vernichtung werden! Wie guter Wille durch zahllose kleine Widerstände sich in bösen Willen eintrübt und finsteren Vorstellungen und Zielen Raum gibt! Wie Zusammenleben, Zusammenschaffen zu Herrschaft über Territorium und Menschen mutieren!
Er schüttelte den Kopf über sein wirres Selbstgespräch, das ihn des Öfteren in dieser Dämmerstunde befiel, und wandte sich vom rätselhaften Treiben der Vogelschwärme ab.
Zurück in die Hütte, weiter mit den letzten Ritualen des Tages! Sie wachsen dem Einsamen schnell zu, niemand störte ihn dabei. Da saß er wieder an seinem Tisch, diesmal warteten Schafskäse, griechische Oliven, Weißbrot und Wein auf seinen letzten Hunger und Durst. Gegenwärtig bevorzugte er, was er sich unter frugaler mediterraner Esskultur vorstellte. Vor einem Jahr noch war es eine dicke Minestrone gewesen, und zuvor ein bunter Salat mit Feta-Käse. Vielleicht würde er demnächst zu Fischfilet oder Haferbrei übergehen. Kauend, mit der freien Hand die Granitkugeln befingernd, blickte er in den hellen Abendhimmel hinaus. Die kurze Begegnung mit Cefo beschäftigte ihn noch. Da hat Ana, die Mutter, den Elfjährigen so einfach von der Küste weg, wo er geboren und aufgewachsen ist, in dieses entlegene, fremde Andental gebracht. Ohne es lange mit ihm zu besprechen, vielleicht plötzlich, ohne dass er sich wirklich von seinen Freunden verabschieden konnte, von Jungen und Mädchen, die noch gar nicht so genau wissen, was Abschied ist … Auch er wird erst viel später wissen, wie das ist. Er dachte daran, das mit Cefo zu besprechen, der Bub konnte vielleicht so einen Alten für den Anfang ganz gut brauchen. Und wär’s nicht auch gut für ihn selbst? Wie selten spricht man mit Kindern ernsthaft, wenn man nicht durch Fach und Rolle dazu gezwungen ist?
Draußen beobachtete er Zeno: ein an den Wiesenboden gepresster, langsam voranschleichender Schatten. Aber dann riss ein Ereignis seinen Blick hoch: Mit einem Mal, und geballt wie eine Explosionswolke, hob der ganze Vogelschwarm unter einem einzigen Aufbruchsgeschrille von den Zypressen ab, schwenkte in ausschwärmender Formation nach Nordwesten, dem funkelnden Abendstern zu; hoch über den schwarzen Umrissen des Bergzuges spaltete sie sich nach hinten in zwei Streifen zu einem Schwalbenschwanz auf. Entzerrter, eine einzige keilförmige, scheinbar endlose Staffel bildend, suchte der Schwarm in weiten Slalombögen, wie ein Drachen an der Schnur im Sturm, seinen Kurs unter dem Firmament … Er war versucht, den Vogelflug zu deuten. Welche Auspizien könnte er aus ihm lesen? Vor allem für seine Begegnung mit Clara … Viel zu schnell war er seinem Blick entschwunden. Er wischte die Brösel von der Tischplatte, suchte in einer Mappe nach dem Blatt »Für Dr. K.« und las den ersten und bisher einzigen Satz seines einst in Auftrag gegebenen Waldhüttenprotokolls:
Ob es tatsächlich meine früheste Erinnerung ist oder ein späterer Albtraum – ich kann mir jedenfalls nichts vergegenwärtigen, was diesem Erlebnisfetzen vorausgegangen wäre: In meinen Ohren dröhnt ein anwachsendes, Entsetzen bereitendes Gebrüll, gurgelnd, tief und schrill ansteigend; ich liege auf dem Rücken unter einem sturmgepeitschten, von grauen und roten Wolken durchjagten Himmel; sie fegen, vom Horizont her, dicht und feuchtkalt über mich hinweg und dann … leuchtet fern ein Streifen gleißender Helle …
Das also wäre der Urkeim seiner Albträume? Das erste Molekül seines Selbst? Auf dem leeren Papierbogen unter diesen Zeilen bemerkte er ein paar braune Weinkleckse. Für einen Rorschachtest waren die wohl zu klein. Er konnte seinen Therapeuten sowieso nicht mehr konsultieren. Wie hätte der den ersten Satz gedeutet? Geburt als Urform der Vertreibung? Quäle ich mich etwa durch den Scheidenschlauch ans Licht der Welt? Damals, im Hochsommer 1937, in einer Wiener Klinik? Oder höre ich wenige Jahre darauf die feindlichen Verbände, die nachts aus dem Westen einfliegen und Bomben auf uns säen?
»Ein merkwürdiger Tag heute«, hätte er in sein Tagebuch notiert, das er längst nicht mehr führte. Ein Chronist in seinem Alter wiederholt meist nur Begegnungen mit ebenso alten und, wenn er Glück hat, gebrechlicheren Menschen; er notiert ihre und seine Beschwerden und versucht, die aussichtslose Lage mit sarkastischem Humor oder transzendenten Hoffnungen zu überwinden. Also dann schon lieber gar nichts festhalten!
In tiefer Nacht schreckte Eduard auf. Ein klopfendes Aufschlagen, das im Ohr noch nachklang, hatte ihn geweckt. Er machte Licht und sah eine der kleinen Granitkugeln auf dem Boden. War sie von der Tischplatte heruntergerollt? Wieder ein leichtes Erdbeben? Oder hatte sich jemand an der Tür gemeldet? Er stand auf und trat vor die Hütte: Da war niemand. Nur ruhige, duftende Nacht. Weit in der Ferne bellte ein Hund. »Uns hat dasselbe aufgeschreckt.« Beim Anblick des Sternenhimmels gefiel ihm die Vorstellung aus dem Altertum: Jenseits der schwarzen Kuppel sind alle Lichter zu einem großen Fest der Außerirdischen aufgegangen, sie blinken durch Tausende nadelstichkleine Löcher in der Decke. Staunend und rätselnd starren die irdischen Zaungäste hinauf, um etwas vom festlichen Gelage mitzubekommen. Zu hören ist nichts, nicht einmal eine Flöte; das Gewölbe ist lichtdurchlässig, aber schalldicht. Er kehrte in die Stube zurück und sank in seinen Polster. Das rhythmisch gleichmäßige Pumpen seines Herzens beruhigte ihn; dazu das Rauschen des Blutstrahls durch seine Adern. Zuneigung erfasste ihn für diesen vorläufig noch so treuen, dienstbaren Muskel, der da ganz freiwillig in seiner Brust arbeitete und zugleich ein hin- und fortfliehendes Empfinden für Clara auslöste – als wäre sie Teil seines Pulsschlags. Darüber hinaus hörte oder fühlte er nichts. Selbst das Holz schweigt ja bekanntlich zu dieser Stunde. Sein Denken setzte Traumgespinste an. Die Arche hat vom Festland des äußeren Geschehens abgelegt, eine Zeit schon driftet sie ab – sachte, in die unbekannten Gewässer des Universums hinaus. Sollte ich jetzt nicht doch den Absprung wagen? Es gibt kein Unten und kein Oben mehr. Ideale Flugbedingungen fürs Weiterschreiben des Waldhüttenprotokolls.
2
EINE HOCHZEIT AUF DEM LAND
»Das wird noch ein langer Tag bis zu deiner Hochzeitsnacht, donetschka!« Frühmorgens am Fluss schneidet Shira sich Ranken aus dem Brombeerstrauch für ihren Brautkranz. Die roten Fingerkuppen zucken zurück, wenn sie an Stacheln geraten. Heftig zieht sie Luft auf. »Wie die stechen, donetschka!«, setzt sie ihr Selbstgespräch fort. Drei kleine Bündel reifer Beeren – fast so schwarz wie ihre geweiteten Pupillen – verankert sie im Kranzgeflecht. Nebel hängt noch tief im Gestrüpp. Dahinter rauscht der Río Ñireco, das »Wasser aus den Buchwäldern«, wie ihn die Mapuche nennen.
Die Farm der Familie Broda grenzt direkt an den Fluss, keine Brücke führt in die Urwälder und Berge auf der anderen Seite. Aber im Herbst und Winter, hat ihr Ethan gesagt, bilde sich bei niedrigem Wasserstand eine Furt, durch die man das Gewässer leicht zu Pferd überqueren könne. Danach führe ein Saumweg bis zur chilenische Grenze, und von dort könne man gemächlich in zwei Tagen die Fjorde und die Küste am Pazifischen Ozean erreichen. Diesen Ritt zu zweit habe er für ihre Hochzeitsreise geplant. Doch nun soll Shira plötzlich wieder nach Israel zurück, und von dort in die Ukraine fliegen … Verrückt: Wo sie doch erst vor sechs Tagen angekommen und schon so glücklich ist, in ihrer neuen Familie und Umwelt … »Den Hochzeitsritt holen wir nach deiner Rückkehr sofort nach, donetschka!«, hat ihr Ethan versprochen.
Zwei Stunden später sitzt Shira neben Ethan im Amtszimmer des Friedensrichters von Quemquemtréu. Gleich werden sie die Ringe wechseln. Neben ihnen: Vater Miguel Broda und Ethans Brüder, Ari, der ältere, und Nathan, der jüngere; und dazu Achmed, der tunesische Koch, und die Chilenin Gladys, Zimmermädchen des Hostels Currumahuida. Jeder hat seine Gerüche mitgebracht – aus den Stallungen, aus der Waschküche, vom Grillfeuer. Nur Shira und der Friedensrichter verbreiten künstliche Düfte: Eternity und Kölnisch Wasser. Dank ihrer Französischkenntnisse bekommt sie ungefähr mit, was der kleine dürre Mann vor ihr auf Spanisch aus dem rot gebundenen Gesetzbuch zitiert. Schließlich heißt »amor« amour und »fidelidad« fidelité. An der graufleckigen Wand hinter dem Friedensrichter kann sie das Wappen dieser argentinischen Provinz studieren, in der sie jetzt verheiratet wird. Merkwürdig: Die ganze untere Hälfte wird von einem Staudamm eingenommen. Das erinnert sie an die Symbole aus der Sowjetzeit, die man in Dnjepropetrowsk immer noch entdecken kann – ebenso die stilisierte Weizenähre, die aus dem Beton sprießt. Lieber zum Fenster hinausschauen, auf das friedliche Idyll kleinbürgerlicher Häuser mit bunten Begonien in den Vorgärten, überragt von einem atemberaubenden Steilhang der Andenkette.
Es ging bereits auf Mittag zu, als sie aus der Ortschaft zurück waren. Die Sonne stand hoch am wolkenlosen Himmel, kaum spürbar wehte frische Luft vom Ñireco her. Höchste Zeit, wie vereinbart ihre Eltern in Haifa anzurufen. Mit Ethan überquerte sie den frisch gemähten Rasen vor Aris Haus. Er hatte es vor vier Jahren neben einem alten Walnussbaum errichtet. Darunter wurde soeben die lange Tafel gedeckt. Über aufgebockte Bauholzbretter hatten Ana, Aris neue Freundin, und Anahí, die Küchenhilfe des Hostels, weiße Betttücher gebreitet; sie waren gerade damit beschäftigt, Teller, Gläser und Besteck zu verteilen. Ein paar Kinder, die Shira noch nicht kannte, tollten um den Tisch herum und spielten Fangen, assistiert von Aris schwarzen Hunden unbestimmter Rasse. Nathan hatte vor allen anderen die Trauung verlassen, um sich um die Glut unter dem Grill zu kümmern. Neben ihm, in einer weiß emaillierten Waschschüssel, türmten sich Würste und Fleisch. Beim Begrüßungsfest vor sechs Tagen hatte Shira ihn bereits bewundert und geneckt: Wie konnte ein gebürtiger Israeli, der beim Heer nichts anderes gelernt hatte als das Reparieren von Merkava-Panzern, ein so wahnsinnig schmackhaftes Asado zubereiten! Andererseits fand man dergleichen heute ja auch in einem bekannten Steak-Restaurant in Tel Aviv – vorausgesetzt, man konnte es sich leisten. Ethan und sie hatten es vor zwei Monaten getan, um Shiras positiven Schwangerschaftstest zu feiern.
Im Hostel-Büro benutzte sie den Bildschirm des Computers als Spiegel, um sich ganz vorsichtig den Brombeerkranz aufs Haar zu setzen und den Ausschnitt ihres cremefarbenen Brautkleids zu lockern. Dieses teure Stück hatte sie mit ihrer Mutter in der Ayalon Mall gekauft. Die beiden Frauen hatten sich ja nicht vorstellen können, wie einfach und ländlich es auf einer patagonischen Hochzeitsfeier zugehen würde. Nach ein paar Klopfzeichen auf die Tastatur erschienen Shiras Eltern Kopf an Kopf und verblüfft dreinblickend auf dem Bildschirm.
Zuerst wandte die Mutter sich an den Vater: »Nimm doch die Brille ab, die blitzt und blendet ja nur.« Das tat er aber nicht, weil er für den Anblick seiner Tochter die maximale Sehschärfe haben wollte. »Aber du kannst sie doch hören!«, warf die Mutter noch ein, worauf Shira sich mit »Hallo, hallo, hier bin ich ja schon!« meldete. Da verstummten die Alten und starrten sie an.
Jetzt saßen die beiden also ganz dicht vor ihr, im vertrauten Wohnzimmer in Haifa, wo sie sich vor einer Woche erst von ihnen verabschiedet hatte: auf einem kleinen Familientreffen: ihr älterer Bruder Nicolai, seine Frau Dora und deren drei Kinder sowie das Ehepaar Kozak, das seit den gemeinsamen Jugendjahren in Dnjepropetrowsk mit ihren Eltern befreundet war. Ja, Shira, unser liebes Kind, die liebe Schwester und Tante, bricht nach dem fernen Argentinien auf, wird den Ethan Broda heiraten, der dort mit seinem Vater und seinen Brüdern lebt, und es ist völlig ungewiss, wann – ja wahrscheinlicher ob – die beiden jemals wieder zurückkommen werden.
Shiras Blick überflog das Regal hinter den Köpfen der Eltern. Da standen sie, der vertraute Nippes und Souvenirs, die kleinen Geschenke und Erinnerungsstücke, die ihre Mutter aufbewahrte: die Kopie einer Kipchak-Stele, eine ganze Reihe von Matrjoschka-Puppen, in der Mitte die kunstvoll aus Bronze gearbeitete Menorah, ein Familienerbstück der Karpovs. Nicht im Bild war das mächtige Bücherregal an der rechten Wandseite, das ohne Unterbrechung bis ins Arbeitszimmer des Vaters hinüberführte, ja eigentlich von dort ins Wohnzimmer hereingewachsen war – mit dem gerahmten Foto vor den Büchern: der Papa mit David Grossman, dessen Bücher er schätzte, dessen Aktivismus er teilte und auf dessen Freundschaft er so stolz war.
Es war selbstverständlich, dass man von Bildschirm zu Bildschirm zuerst von der babulitschka