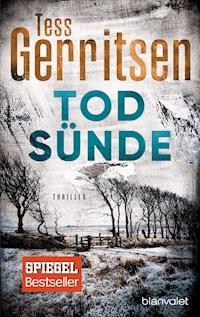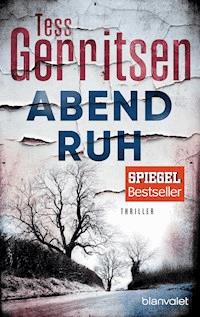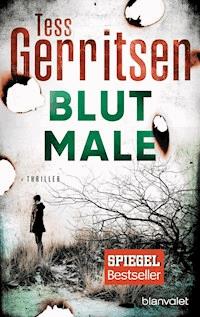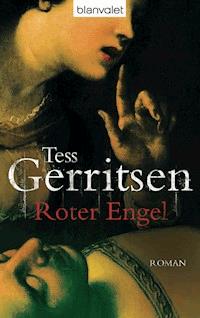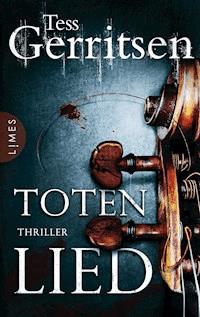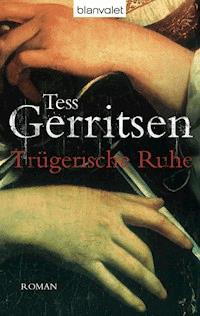18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: eBundle
- Sprache: Deutsch
DAS GEHEIMLABOR Erneut kämpfte er sich im Beifahrersitz hoch. "Bitte, lehnen sie sich zurück", flehte sie. "Dieser Wagen …" "Ist nicht mehr da." "Sind Sie sicher?" Sie blickte in den Rückspiegel. Durch den Regen sah sie nur ein schwaches Funkeln, aber das mussten nicht unbedingt Scheinwerfer sein. "Ich bin sicher", log sie. Ein Schuss! Weiter, nur weiter. Voller Panik stolpert Victor Holland durch den nächtlichen Wald. Die Schritte seines Verfolgers unerbittlich hinter ihm. Plötzlich Lichter; eine Straße, endlich in Sicherheit … Cathy kann den Aufprall nicht mehr verhindern, als der Mann aus der Dunkelheit vor ihr Auto stürzt. Auf der Fahrt ins Krankenhaus schaut er sich immer wieder um. Bevor man ihn in den OP schiebt, will er Cathy noch unbedingt etwas sagen — aber seine Kräfte verlassen ihn. Als Cathy am nächsten Tag ihre Schulfreundin tot auffindet, wird ihr klar: Victor wollte sie warnen! VERRAT IN PARIS All die Jahre hat Beryl Tavistock eine Lüge geglaubt: Ihre Eltern, die für den MI 6 arbeiteten, sind nicht bei einem Einsatz ums Leben gekommen. Stattdessen soll ihr Vater, zuvor als Doppelagent entlarvt, ihre Mutter erschossen haben, bevor er sich selbst richtete. Beryl beginnt in Paris eine gefährliche Suche nach der Wahrheit. Zusammen mit dem undurchsichtigen Amerikaner Richard Wolf verstrickt sie sich dabei immer tiefer in einem Netz aus Intrigen und längst überholt geglaubten Feindbildern. DIE MEISTERDIEBIN Jordan Tavistock ist sich nicht sicher, ob er der Frau trauen soll: Clea Rice sagt, sie ermittelt in einem Versicherungsbetrug und ist daher auf der Suche nach dem "Auge von Kaschmir", einem legendären Dolch. Aber muss sie dafür nachts in ein fremdes Schlafzimmer eindringen? Als kurz darauf eine Bombe explodiert, die für sie bestimmt war, weiß er immerhin, dass Clea in Gefahr schwebt und er sie beschützen muss. "Tess Gerritsen ist eine der Besten in ihrem Metier" USA Today
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1028
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Tess Gerritsen
Tess Gerritsen - Krimi-Paket (3in1)
Tess Gerritsen
Das Geheimlabor
Roman
Aus dem Amerikanischen von Rainer Nolden
HarperCollins®
HarperCollins® Bücher erscheinen in der HarperCollins Germany GmbH,
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright © 2016 by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe: Whistleblower
Copyright © 1992 by Terry Gerritsen erschienen bei: Harlequin Enterprises Ltd., Toronto
Published by arrangement with Harlequin Enterprises II B.V./S.ár.l
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner GmbH, Köln
Umschlaggestaltung: pecher und soiron, Köln
Redaktion: Thorben Buttke
Titelabbildung: Thinkstock/Getty Images, München
ISBN 978-3-959-67996-1
www.harpercollins.de
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
www.readbox.net
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle handelnden Personen in dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
PROLOG
Äste peitschten ihm ins Gesicht, und das Herz hämmerte ihm so heftig in der Brust, dass er das Gefühl hatte zu explodieren. Aber er musste weiterlaufen, denn der Mann hinter ihm kam immer näher. Jeden Moment rechnete er damit, dass eine Kugel durch die Dunkelheit flog und ihn im Rücken traf. Vielleicht war es sogar schon geschehen. Vielleicht hinterließ er eine Blutspur. Die Angst hatte ihn vollkommen gefühllos gemacht. Nur ein verzweifelter Überlebenswillen trieb ihn voran.
Eiskalter Winterregen prasselte ihm ins Gesicht und auf die verwelkten Blätter. Orientierungslos stolperte er durch die Nacht und landete bäuchlings im Schlamm. Das Geräusch seines Sturzes war ohrenbetäubend. Sein Verfolger, von den knackenden Ästen auf seine Fährte gelenkt, änderte die Richtung und kam nun direkt auf ihn zugelaufen. Das dumpfe Plopp eines Schalldämpfers und das Zischen einer Kugel, die an seiner Wange vorbeischoss, verrieten ihm, dass er entdeckt worden war. Mühsam rappelte er sich wieder auf, wandte sich nach rechts und lief im Zickzack zurück zur Autobahn. Hier im Wald war er ein toter Mann. Aber wenn er Aufmerksamkeit auf sich lenken und ein Auto anhalten konnte, hatte er vielleicht eine Chance.
Brechende Zweige, ein unterdrückter Fluch. Sein Verfolger war gestürzt. Er hatte ein paar kostbare Sekunden gewonnen. Trotzdem verlangsamte er sein Tempo nicht, obwohl er nur erahnen konnte, wohin er lief. Abgesehen vom schwachen Schimmer der Wolken wies ihm kein Licht den Weg. Weiter vorne musste die Straße sein. Jeden Moment würde er den Asphalt unter seinen Sohlen spüren.
Und dann? Wenn kein Auto vorbeifährt, mir keiner zu Hilfe kommt?
Aber dann sah er tatsächlich durch die Bäume zwei kleine Lichtpunkte, die rasch größer wurden.
Mit letzter Kraft hastete er dem Auto entgegen. Seine Lungen brannten, seine Sicht war getrübt von den tief hängenden Zweigen und dem strömenden Regen. Eine zweite Kugel pfiff an ihm vorbei und blieb mit einem hohlen Knall in einem Baumstamm stecken. Aber der Schütze hinter ihm war auf einmal völlig bedeutungslos. Nur diese Scheinwerfer waren wichtig, die durch die Dunkelheit stachen und Rettung versprachen.
Er erschrak, als er den Asphalt unter den Schuhsohlen spürte. Die Lichter zitterten immer noch irgendwo weit hinter den Baumstämmen. Hatte er das Auto verpasst? War es schon um die nächste Kurve gefahren? Nein, die beiden Punkte wurden heller. Der Wagen näherte sich. Er rannte ihm entgegen, folgte der Biegung in dem Bewusstsein, dass er auf freier Straße ein leichtes Ziel war. Seine eigenen Schritte auf dem nassen Asphalt dröhnten ihm in den Ohren. Die Scheinwerfer kamen schwankend näher. In diesem Moment hörte er den dritten Schuss. Er fiel auf die Knie, und wie durch einen dichten Nebel spürte er, dass ihn die Kugel in die Schulter getroffen hatte. Warm floss das Blut über seinen Arm, doch er achtete nicht auf den Schmerz. Er musste sich darauf konzentrieren, seinem Verfolger zu entkommen. Mit letzter Kraft rappelte er sich wieder auf und machte einen Schritt nach vorn …
… und wurde vom grellen Scheinwerferlicht geblendet. Es war zu spät, um beiseitezuspringen, sogar, um in Panik zu geraten. Reifen quietschten über den Asphalt und spritzten einen Schwall von Regenwasser hoch.
Er spürte den Aufprall nicht. Plötzlich lag er auf dem Rücken. Regen tropfte ihm in den Mund, und ihm war sehr, sehr kalt.
Und er wusste, dass er noch etwas zu tun hatte. Etwas sehr Wichtiges.
Mit letzter Kraft griff er in die Tasche seines Anoraks. Seine Finger umklammerten den kleinen Plastikzylinder. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, warum er so wichtig war, aber er war noch da, und das erfüllte ihn mit Erleichterung. Er schloss ihn fest in seine Hand.
Jemand rief etwas. Eine Frau. Durch den Regen konnte er ihr Gesicht nicht erkennen, aber er hörte ihre Stimme, heiser vor Panik, durch das Brummen in seinem Schädel. Er versuchte zu sprechen, wollte sie warnen vor dem Tod, der irgendwo im Wald lauerte. Doch er brachte nur ein Stöhnen hervor.
1. KAPITEL
Drei Meilen vor Redwood Valley war ein Baum auf die Straße gestürzt. Das Unwetter und ein Stau sorgten dafür, dass Catherine Weaver fast drei Stunden benötigte, ehe Willits hinter ihr lag. Da war es bereits zehn Uhr, und ihr war klar, dass sie Garberville nicht vor Mitternacht erreichen würde. Hoffentlich wartete Sarah nicht die ganze Nacht auf sie. Aber wie sie ihre Freundin kannte, hatte sie noch Essen auf dem Herd stehen und ein Feuer im Kamin lodern. Wie mochte ihr wohl die Schwangerschaft bekommen? Ausgezeichnet bestimmt. Seit Jahren sprach Sarah schon von diesem Baby; lange vor der Befruchtung hatte sie sich bereits für einen Namen entschieden. Sam oder Emma. Dass sie keinen Ehemann mehr hatte, war eher nebensächlich. „Man kann nur eine gewisse Zeit auf den richtigen Vater warten“, hatte Sarah erklärt. „Irgendwann muss man die Sache selbst in die Hand nehmen.“
Und das hatte sie getan. Während die biologische Uhr immer lauter tickte, war Sarah zu ihr nach San Francisco gefahren und hatte in den Gelben Seiten nach einer Samenbank gesucht. Selbstverständlich eine der liberaleren, in der man Verständnis hatte für die Sehnsüchte einer alleinstehenden Neununddreißigjährigen. Die Befruchtung selbst sei eine rein medizinische Angelegenheit gewesen, hatte sie später erzählt. Rauf auf den Tisch, die Füße in die Halterung gesteckt, und fünf Minuten später war man schwanger. Nun ja, fast. Aber es war eine simple Prozedur; die Spender verfügten alle über ein Gesundheitszeugnis, und das Beste war, dass eine Frau ihre mütterlichen Instinkte ohne dieses ganze Brimborium einer Hochzeit ausleben konnte.
Ach ja, die gute alte Ehe. Sie hatten sie beide durchlitten. Und nach den jeweiligen Scheidungen einfach weitergemacht – wenn auch mit Narben und blauen Flecken auf der Seele.
Wie mutig Sarah ist, dachte Cathy. Sie hat wenigstens den Mumm, das alleine durchzuziehen.
Die alte Wut flammte wieder auf – so stark, dass sie ihre Lippen zusammenpresste. Ihrem Exmann Jack konnte sie eine Menge Dinge verzeihen. Seinen Egoismus. Seine herrische Art. Seine Untreue. Aber dass er kein Kind mit ihr haben wollte, würde sie ihm nie vergeben können. Sie hätte sich natürlich über seine Wünsche hinwegsetzen und trotzdem schwanger werden können, aber ihr war es wichtig gewesen, dass er es auch wollte. Während ihrer zehnjährigen Ehe war er allerdings nie „so weit“ gewesen, noch war jemals der „richtige Zeitpunkt“ gewesen.
Er hätte ihr besser die Wahrheit gesagt: dass er viel zu selbstsüchtig war, um mit einem Baby belastet werden zu wollen.
Ich bin siebenunddreißig, dachte sie. Ich bin geschieden. Ich habe nicht mal einen festen Freund. Und doch wäre mir das alles egal, wenn ich nur mein eigenes Kind in den Armen halten könnte.
Zumindest würde Sarah bald Mutter werden.
In vier Monaten sollte das Kind zur Welt kommen. Sarahs Baby. Trotz des nervigen Regens, der unentwegt auf ihre Windschutzscheibe trommelte, musste Cathy lächeln. Obwohl sie die Scheibenwischer auf die höchste Stufe geschaltet hatte, schafften sie die Wassermassen kaum. Die Straße konnte sie nur noch verschwommen erkennen. Beim Blick auf ihre Armbanduhr stellte sie fest, dass es bereits halb zwölf war. Außer ihr war niemand mehr unterwegs. Wenn sie jetzt eine Panne hätte, würde sie die ganze Nacht hier draußen verbringen und zusammengekauert auf dem Rücksitz auf Hilfe warten müssen.
Angestrengt starrte sie in die Dunkelheit hinaus und versuchte, den Mittelstreifen zu erkennen. Doch alles, was sie sah, war eine undurchdringliche Wand aus Wasser. Zu blöd. Sie wäre besser in dem Motel in Willits abgestiegen. Aber die Tatsache, nur noch fünfzig Meilen vom Ziel entfernt zu sein, ließ ihr keine Ruhe, zumal sie schon so weit gefahren war.
Vor ihr tauchte ein Schild auf: Garberville 10 Meilen. Sie war also schon näher als gedacht. In fünfundzwanzig Meilen kam die Abzweigung, und dann waren es nur noch fünf Meilen durch einen dichten Wald bis zu Sarahs Holzhaus. Dass sie so nahe war, ließ sie ungeduldig werden. Sie drückte aufs Gaspedal und peitschte ihren alten Datsun auf fünfundvierzig Meilen hoch. Ziemlich riskant, besonders unter diesen Wetterbedingungen, aber der Gedanke an ein warmes Haus und eine heiße Schokolade war zu verführerisch.
Sie hatte nicht mit der Kurve gerechnet. Erschrocken riss sie das Steuer nach rechts. Das Auto geriet ins Schlingern und zog Zickzacklinien über den nassen Asphalt. Sie war geistesgegenwärtig genug, nicht die Bremse durchzutreten. Stattdessen umklammerte sie das Lenkrad und versuchte, die Kontrolle zurückzugewinnen. Dabei rutschte sie ein paar Meter über den unbefestigten Straßenrand. Das Herz hämmerte ihr bis zum Hals. Gerade als sie glaubte, an einem Baum entlangzuschrammen, gerieten die rechten Reifen wieder auf festen Untergrund. Die Tachonadel zeigte immer noch zwanzig Meilen an, aber wenigstens fuhr sie keine Schlangenlinien mehr. Mit klammen Händen bewältigte sie den Rest der Kurve.
Doch was dann geschah, brachte sie vollkommen aus der Fassung. Hatte sie sich gerade noch dazu beglückwünscht, eine Katastrophe vermieden zu haben, starrte sie nun entsetzt durch die Windschutzscheibe.
Der Mann war aus dem Nichts aufgetaucht. Er hockte zusammengekrümmt auf der Straße, erstarrt wie ein wildes Tier im Licht ihrer Scheinwerfer. Reflexartig trat sie auf die Bremse, doch es war bereits zu spät. Das Quietschen der Reifen wurde übertönt von dem dumpfen Schlag, als sie mit der Kühlerhaube gegen den Körper prallte.
Eine Weile lang – es kam ihr wie eine Ewigkeit vor – blieb sie wie erstarrt sitzen, umklammerte das Steuer und starrte durch die Scheibe, auf der die Wischerblätter hektisch hin und her fuhren. Als ihr bewusst wurde, was soeben geschehen war, öffnete sie die Tür und stürzte hinaus in den Regen.
Durch die dichten Schleier konnte sie zunächst gar nichts erkennen – bis auf einen Streifen glänzenden Asphalts im schwachen Schein der Rücklichter. Wo ist er, dachte sie voller Panik. Der Regen verwischte ihren Blick, als sie an der dunklen Straße entlanglief. Plötzlich hörte sie durch das Rauschen des Regens ein leises Stöhnen. Es kam vom Straßenrand nahe der Bäume.
Sie drehte sich um, tauchte ein in den Schatten und versank knöcheltief in weicher Erde und Tannennadeln. Wieder vernahm sie das Stöhnen, näher jetzt, zum Greifen nahe.
„Wo sind Sie?“, schrie sie. „Helfen Sie mir, damit ich Sie finden kann.“
„Hier …“ Die Antwort kam so leise, dass sie sie kaum hören konnte. Aber mehr brauchte sie nicht. Erneut änderte sie die Richtung, und nach ein paar Schritten wäre sie in der Dunkelheit fast über den zusammengekrümmten Körper gestolpert. Zuerst erschien er ihr lediglich wie ein verwirrendes Knäuel aus durchgeweichten Kleidern, doch dann fand sie seine Hand und tastete nach seinem Puls. Er ging schnell, aber gleichmäßig – vermutlich gleichmäßiger als ihr eigener, der wie wild galoppierte. Unvermittelt griffen seine Finger verzweifelt nach ihrer Hand. Beim Versuch hochzukommen, zog er sie näher zu sich.
„Bewegen Sie sich nicht“, bat sie. „Bitte.“
„K…kann nicht hierbleiben …“
„Wo sind Sie verletzt?“
„Keine Zeit. Helfen Sie mir. Schnell …“
„Erst müssen Sie mir sagen, wo Sie verletzt sind.“ Er griff nach ihrer Schulter und versuchte mühsam, auf die Füße zu kommen. Zu ihrer Verblüffung gelang ihm das tatsächlich. Schwankend standen sie nebeneinander. Doch dann verließen ihn seine Kräfte, und zusammen sanken sie auf die Knie in den Schlamm. Sein Atem ging keuchend und unregelmäßig, und sie überlegte, wie schwer seine Verletzung wohl sein mochte. An inneren Blutungen konnte er innerhalb kürzester Zeit sterben. Sie musste ihn so schnell wie möglich in ein Krankenhaus bringen, selbst wenn es bedeutete, dass sie ihn zu ihrem Wagen schleifen musste.
„Versuchen wir es noch mal“, sagte sie, nahm seinen linken Arm und legte ihn sich über die Schultern. Sie zuckte zusammen, als er vor Schmerz aufschrie. Sofort ließ sie ihn los. Sein Arm hinterließ eine klebrige warme Flüssigkeit in ihrem Nacken. Blut.
„Die andere Seite ist in Ordnung“, ächzte er. „Noch mal.“
Sie wechselte auf seine rechte Seite und legte den anderen Arm um den Hals. Wäre sie nicht so panisch gewesen, hätte sie die Szene durchaus als komisch empfunden: Sie mühten sich ab wie zwei Betrunkene, die aufstehen wollten. Als ihnen das endlich gelungen war, fragte sie sich, ob er stark genug sei, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Alleine würde sie es nicht bis zum Wagen schaffen. Er war zwar schlank, aber auch sehr viel größer, als sie erwartet hatte. Mit ihren Einsfünfundsechzig konnte sie ihn unmöglich ohne Hilfe bewegen.
Doch etwas schien ihn vorwärtszutreiben; ein Aufgebot seiner letzten Kraftreserven. Selbst durch ihre nasse Kleidung hindurch spürte sie die Hitze seines Körpers und seinen Willen durchzuhalten. Zahllose Fragen schossen ihr durch den Kopf, aber sie keuchte zu sehr, um sprechen zu können. Sie musste sich voll und ganz darauf konzentrieren, ihn in ihren Wagen zu setzen und schnellstmöglich ins Krankenhaus zu bringen.
Sie legte den Arm um seine Hüfte und schob die Finger durch seinen Gürtel. Mühsam kämpften sie sich Schritt für Schritt bis zur Straße vor. Schwer wie eine Eisenstange lag sein Arm auf ihrer Schulter. Alles an ihm schien sich zu verkrampfen. Die Art, wie er seine Muskeln anspannte, um vorwärtszukommen, hatte etwas Verzweifeltes. Seine Willenskraft übertrug sich auf sie. Seine Furcht war ebenso spürbar wie die Wärme seines Körpers, und plötzlich hatte sie den gleichen dringenden Wunsch, so schnell wie möglich von hier wegzukommen – ein Drang, der durch den Umstand, dass sie kaum vorwärtskamen, noch verstärkt wurde. Alle paar Schritte musste sie anhalten und sich die nassen Haare aus dem Gesicht schieben, um sehen zu können, in welche Richtung sie ging. Die Dunkelheit und der heftige Regen um sie herum verbargen die Gefahr, die möglicherweise auf sie lauerte.
Die Rücklichter ihres Wagens glühten wie rubinrote Augen in der Nacht. Mit jedem Schritt wurde der Mann schwerer, und sie hatte das Gefühl, ihre Beine seien aus Gummi. Hoffentlich fielen sie nicht wieder hin. Sie hätte nicht mehr die Energie gehabt, ihn noch einmal hochzuziehen. Kraftlos sank sein Kopf an ihre Wange, und das Wasser aus seinem Haar lief ihr in den Nacken. Das Gehen war zu einem Automatismus geworden, sodass ihr nicht einmal der Gedanke kam, den Fremden auf die Straße zu setzen und ihren Wagen zu holen. Außerdem waren die Rücklichter schon nah – nur noch wenige Meter durch den dichten Schleier aus Regen.
Als sie mit ihm auf der Beifahrerseite angelangt war, befürchtete sie, der Arm würde ihr abfallen. Sie schaffte es kaum, die Tür zu öffnen, ohne dass der Mann auf den Boden zu rutschen drohte. Zu schwach, um behutsam mit ihm umzugehen, schob sie ihn kurzerhand ins Auto.
Er sank auf dem Beifahrersitz zusammen. Seine Beine waren noch draußen. Sie hockte sich hin, umklammerte erst die eine, dann die andere Wade und schob sie in den Wagen. Bei diesen großen Füßen kann er sich unmöglich elegant bewegen, dachte sie unwillkürlich.
Als sie sich hinters Steuer setzte, versuchte er, seinen Kopf zu heben. Da ihm die Kraft fehlte, ließ er ihn sofort zurück auf die Brust sinken. „Schnell“, flüsterte er.
Sie drehte den Zündschlüssel. Der Motor begann zu stottern und erstarb. Um Himmels willen, dachte sie. Spring an! Spring an! Sie drehte den Schlüssel zurück, zählte langsam bis drei und versuchte es erneut. Dieses Mal sprang der Motor an. Vor Erleichterung hätte sie fast gejubelt. Sie legte den Gang ein und startete mit quietschenden Reifen Richtung Garberville. Selbst in einer so kleinen Stadt musste es doch ein Krankenhaus geben. Die Frage war bloß: Würde sie es in diesem Unwetter finden? Und wenn sie sich irrte? Wenn das nächstgelegene Krankenhaus in Willits war – also in der entgegengesetzten Richtung? Dann würde sie kostbare Minuten verschwenden, während der Mann in ihrem Wagen verblutete.
Die Vorstellung ließ die Panik wieder in ihr aufflammen. Besorgt schaute sie ihren Beifahrer an. Im schwachen Licht des Armaturenbretts bemerkte sie, dass sein Kopf nach hinten gesunken war. Er bewegte sich nicht.
„Alles in Ordnung mit Ihnen?“, rief sie.
Die Antwort war ein bloßes Flüstern. „Ich bin noch da.“
„Himmel. Ich habe gerade befürchtet …“ Sie schaute auf die Straße. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. „Hier muss doch irgendwo ein Krankenhaus sein.“
„In der Nähe von … Garberville … gibt es eins.“
„Wissen Sie, wo genau?“
„Ich bin daran vorbeigefahren – etwa fünfzehn Meilen von hier.“
Wenn er daran vorbeigefahren ist – wo ist dann sein Wagen? „Was ist denn passiert?“, erkundigte sie sich. „Hatten Sie einen Unfall?“
Gerade als er antworten wollte, flackerte ein schwaches Licht durch den Wagen. Mühsam richtete er sich auf, drehte den Kopf nach hinten und starrte auf die Scheinwerfer des Wagens, der in weitem Abstand hinter ihnen herfuhr. Als er einen Fluch ausstieß, warf sie einen besorgten Blick in den Außenspiegel.
„Was ist los?“
„Dieser Wagen.“
Sie schaute in den Innenrückspiegel. „Was ist damit?“
„Wie lange folgt er uns schon?“
„Ich weiß nicht. Seit ein paar Meilen? Warum?“
Die Anstrengung, den Kopf gedreht zu halten, schien plötzlich zu viel für ihn zu sein. Stöhnend ließ er ihn sinken. „Ich kann nicht mehr klar denken“, wisperte er. „Himmel, ich kann nicht mehr klar denken.“
Er hat zu viel Blut verloren. Sie trat auf das Gaspedal. Der Wagen machte einen Satz nach vorn. Das Steuerrad vibrierte unter ihrem Griff, und Gischt spritzte von den Reifen hoch. Nahezu blind raste sie durch die Dunkelheit, die sich vor der Windschutzscheibe ausbreitete. Langsam! Fahr langsam. Oder wir landen an einem Baum.
Sie nahm den Fuß vom Gaspedal, bis sich die Tachonadel bei fünfundvierzig Meilen einpendelte. So hatte sie den Wagen besser unter Kontrolle. Erneut kämpfte der Mann sich im Beifahrersitz hoch.
„Halten Sie Ihren Kopf unten“, flehte sie.
„Dieser Wagen …“
„Ist nicht mehr da.“
„Sind Sie sicher?“
Sie schaute in den Rückspiegel. Durch den dichten Regen nahm sie nur einen schwachen Lichtpunkt wahr, der nicht unbedingt ein Autoscheinwerfer sein musste. „Ich bin mir sicher“, log sie und war erleichtert, als er wieder nach vorn schaute. Wie weit ist es noch? überlegte sie. Fünf Meilen? Zehn? Ein anderer Gedanke gewann die Oberhand: Er könnte vorher sterben.
Sein Schweigen jagte ihr Angst ein. Sie musste seine Stimme hören, um sicher zu sein, dass er nicht ohnmächtig geworden war. „Reden Sie mit mir“, beschwor sie ihn. „Bitte.“
„Ich bin müde …“
„Hören Sie nicht auf. Reden Sie weiter. Wie … wie heißen Sie?“
Die Antwort war ein bloßes Flüstern: „Victor.“
„Victor. Ein schöner Name. Er gefällt mir. Was machen Sie beruflich, Victor?“
Er schwieg. Das Reden strengte ihn sehr an. Er durfte das Bewusstsein nicht verlieren! Aus irgendeinem Grund erschien es ihr plötzlich sehr wichtig, dass er wach blieb. Die Stimme war seine einzige Verbindung zum Leben. Wenn dieser fragile Kontakt abbrach, würde ihr der Mann vermutlich endgültig entgleiten.
„Na gut.“ Sie zwang sich, ruhig und leise zu sprechen. „Dann werde ich Ihnen etwas erzählen. Sie brauchen gar nichts zu sagen. Hören Sie einfach nur zu. Ich heiße Catherine. Cathy Weaver. Ich lebe in San Francisco – in Richmond. Kennen Sie die Stadt?“ Sie erhielt keine Antwort, aber aus den Augenwinkeln bemerkte sie eine Bewegung seines Kopfes, als wollte er ihre Frage bejahen. „Gut“, fuhr sie fort, um die Stille mit Worten zu füllen, „vielleicht kennen Sie die Stadt ja auch nicht. Spielt auch keine Rolle. Ich arbeite bei einer Independent-Filmgesellschaft. Genauer gesagt, es ist Jacks Filmgesellschaft. Jack ist mein Exmann. Wir produzieren Horrorfilme. Eigentlich nur B-Movies, aber sie sind ganz profitabel. Unser letzter hieß Das Reptil. Ich war für die Spezial-Make-ups verantwortlich. Ziemlich schreckliches Zeug. Jede Menge grüner Schuppen und Schleim …“ Sie lachte. Ihr Lachen klang seltsam angespannt. Beinahe schon hysterisch.
Es kostete sie eine ungeheure Anstrengung, die Kontrolle zu bewahren.
Ein Lichtreflex blitzte im Rückspiegel auf. Sofort sah sie hoch. Die Scheinwerfer waren durch den Regen kaum zu erkennen. Ein paar Sekunden lang ließ sie sie nicht aus den Augen und überlegte, ob sie Victor darauf hinweisen sollte. Doch dann verschwanden die Lichtpunkte in der Dunkelheit wie zwei Phantome.
„Victor?“, rief sie leise. Die Antwort war ein undefinierbares Grunzen, aber das reichte ihr schon. Er lebte noch. Er hörte ihr zu. Ich muss ihn wach halten. Krampfhaft dachte sie über ein neues Gesprächsthema nach. Belangloser Small Talk, den die Filmleute auf ihren Cocktailpartys perfekt beherrschten, war noch nie ihre Stärke gewesen. Fieberhaft versuchte sie, sich einen Witz ins Gedächtnis zu rufen – egal, wie albern er war. Hauptsache, er war halbwegs lustig. Lachen heilt. Hatte sie das nicht irgendwo gelesen? Dass man mit viel Gelächter sogar einen Tumor zum Schrumpfen bringen konnte? Klar, schalt sie sich selbst. Bring ihn zum Lachen, und seine Wunde hört auf wundersame Weise auf zu bluten …
Aber ihr fiel kein Witz ein – nicht ein einziger. Also kehrte sie zu dem Thema zurück, das ihr als Erstes eingefallen war: ihre Arbeit.
„Unser nächstes Projekt ist für Januar vorgesehen. Der Leichenfresser. Wir drehen in Mexiko, was mir überhaupt nicht gefällt. Dort ist es so heiß, dass das Make-up ständig zerfließt …“
Sie schaute zu Victor, aber er reagierte nicht. Er bewegte sich nicht einmal. Erneut geriet sie in Panik. Sie durfte ihn nicht verlieren. Sie tastete nach seinem Puls und stellte fest, dass er seine Hand tief in der Tasche seines Anoraks vergraben hatte. Überraschenderweise reagierte er sofort mit heftigem Widerstand, als sie versuchte, die Hand herauszuziehen. Mit geschlossenen Augen schlug er unkontrolliert nach ihr und versuchte, ihre Hand wegzudrücken.
„Es ist alles in Ordnung, Victor“, beschwichtigte sie ihn, während sie versuchte, seine Attacke abzuwehren und gleichzeitig den Wagen in der Spur zu halten. „Alles okay. Ich bin’s, Cathy. Ich versuche nur, Ihnen zu helfen.“
Beim Klang ihrer Stimme wurden seine Schläge schwächer. Die Anspannung in seinem Körper ließ nach, und er lehnte den Kopf an ihre Schulter. „Cathy“, wisperte er. Er klang verwundert, erleichtert. „Cathy …“
„Stimmt. Ich bin’s nur.“ Vorsichtig strich sie ihm die nassen Haarsträhnen aus der Stirn. Welche Farbe mochten sie haben? Es war zwar vollkommen irrelevant, aber trotzdem beschäftigte sie der Gedanke. Er griff nach ihrer Hand. Seine Finger umschlossen sie erstaunlich fest und beruhigend. Ich bin noch da, gab er ihr mit seiner Berührung zu verstehen. Mir ist warm, ich lebe und atme. Er drückte ihre Handfläche an seine Lippen. Die Geste war so zärtlich, dass sie erschrak, als seine unrasierten Wangen ihre Haut streiften. Es war eine Berührung zwischen Fremden, die sie verwirrte und erbeben ließ.
Erneut umklammerte sie das Lenkrad und konzentrierte sich auf die Straße. Er sagte nichts mehr, aber das Gewicht seines Kopfes auf ihrer Schulter und der warme Atem in ihrem Haar irritierten sie.
Der Wolkenbruch war in einen gleichmäßigen Dauerregen übergegangen, und sie beschleunigte auf fünfzig Meilen pro Stunde. Sie fuhren am Sunnyside Up Café vorbei, einem kleinen Kiosk unter einer einsamen Straßenlaterne, die Victors Gesicht kurz erhellte. Sie sah nur sein Profil: eine hohe Stirn, eine scharf geschnittene Nase, ein vorspringendes Kinn – und dann wurde es wieder dunkel, und er war nur noch ein Schatten, der leise an ihrer Schulter atmete. Aber sie hatte genug gesehen, um zu wissen, dass sie dieses Gesicht nie vergessen würde. Sein Profil hatte sich ihr ins Gedächtnis eingebrannt, sodass sie es auch dann noch vor sich sah, als sie wieder in die Dunkelheit schaute.
„Wir müssen bald da sein.“ Sie sagte es mehr, um sich selbst zu beruhigen. „Wo ein Café ist, kann eine Stadt nicht weit sein.“ Keine Antwort. „Victor?“ Immer noch keine Antwort. Sie schluckte ihre Panik herunter und beschleunigte auf fünfundfünfzig Meilen.
Das Sunnyside Up Café lag bereits mehr als eine Meile hinter ihnen, doch die Straßenlaterne war immer noch nicht aus ihrem Rückspiegel verschwunden. Es dauerte eine Weile, bis ihr klar wurde, dass sie nicht ein, sondern zwei Lichter sah – und dass sie sich bewegten: das Licht von zwei Autoscheinwerfern, das über die Straße huschte. War es das Auto von vorhin?
Wie gebannt betrachtete sie die beiden Lichtstreifen, die zwischen den Baumstämmen aufblitzten. Dann waren sie plötzlich verschwunden, und zurück blieb komplette Dunkelheit. Ein Geist? fragte sie sich. Wie albern! Sie rechnete damit, dass die beiden Lichtkegel jeden Moment wieder auftauchten und das gespenstische Flackern im Wald weiterging. So sehr war sie auf den Rückspiegel konzentriert, dass sie fast das Ortsschild übersehen hätte:
Garberville (5750 Einwohner)
Tankstellen – Restaurants – Motels
Eine halbe Meile weiter standen Straßenlaternen und tauchten die Umgebung in fahles gelbes Licht. Ein Tieflader donnerte in die entgegengesetzte Richtung vorbei. Obwohl hier nur noch fünfunddreißig Meilen erlaubt waren, hielt sie den Fuß fest auf dem Gaspedal. Zum ersten Mal in ihrem Leben betete sie darum, von einem Streifenwagen verfolgt zu werden.
Wie aus dem Nichts tauchte das Schild mit dem Hinweis Krankenhaus auf. Sie trat auf die Bremse und schlitterte auf die Abzweigung. Nach einer weiteren Viertelmeile führte ein Hinweis mit der Aufschrift Notaufnahme zu einem Seiteneingang. Sie ließ Victor auf dem Beifahrersitz zurück, hastete durch die Tür in einen menschenleeren Warteraum und rief einer Schwester, die am Schreibtisch saß, zu: „Bitte helfen Sie mir. Ich habe einen Mann in meinem Wagen …“
Die Schwester reagierte sofort. Sie folgte Cathy nach draußen, warf nur einen kurzen Blick auf den zusammengesunkenen Mann und verständigte sofort den diensthabenden Arzt.
Selbst mit Unterstützung des stämmigen Mediziners hatten sie Probleme, Victor aus dem Wagen zu hieven. Er war zur Seite gerutscht, und sein Arm steckte unter der Handbremse.
„Miss, gehen Sie auf die andere Seite, und befreien Sie seinen Arm“, wies der Arzt Cathy an.
Cathy kletterte auf den Fahrersitz. Dort zögerte sie, weil sie seinen verletzten Arm bewegen musste. Vorsichtig griff sie nach seinem Ellbogen und versuchte, ihn von der Handbremse zu lösen. Dabei entdeckte sie, dass sich seine Armbanduhr in der Tasche seines Anoraks verhakt hatte. Nachdem sie das Uhrband geöffnet hatte, griff sie nach dem Arm und hob ihn über die Bremse. Vor Schmerzen stöhnte er laut auf. Kraftlos fiel der Arm zurück.
„Gut, der Arm ist frei“, stellte der Doktor fest. „Schieben Sie ihn vorsichtig in meine Richtung, und ich übernehme.“
Über die Handbremse hinweg hob sie behutsam Victors Kopf und Schultern. Dann kroch sie wieder hinaus und half den anderen, ihn auf die Trage zu legen. Mit drei Gurten wurde er fixiert. Laut dröhnte es in ihren Ohren, als die Trage durch die geöffneten Doppeltüren ins Krankenhaus gerollt wurde, und auf einmal sah sie alles wie durch einen Nebel.
„Was ist passiert?“, fragte der Arzt über seine Schulter hinweg.
„Ich habe ihn angefahren … auf der Straße.“
„Wann?“
„Vor fünfzehn oder zwanzig Minuten.“
„Wie schnell sind Sie gefahren?“
„Ungefähr fünfunddreißig Meilen.“
„War er bei Bewusstsein, als Sie ihn fanden?“
„Noch etwa zehn Minuten … dann ist er ohnmächtig geworden.“
Eine Krankenschwester sagte: „Sein Hemd ist blutdurchtränkt. Und er hat Glasscherben in der Schulter.“
In der von grellem Neonlicht beschienenen Hektik konnte Cathy Victor zum ersten Mal deutlich erkennen: das schlanke, dreckverschmierte Gesicht, ein vor Schmerz verkrampfter Kiefer, eine breite Stirn, auf der hellbraune Haarsträhnen klebten. Er streckte den Arm aus und griff nach ihrer Hand.
„Cathy …“
„Ich bin hier, Victor.“
Fest hielt er ihre Hand umklammert. Der Druck seiner Finger tat ihr fast weh. Gequält blinzelte er sie an. „Ich muss Ihnen etwas sagen …“
„Später“, fuhr der Doktor dazwischen.
„Nein, warten Sie.“ Victor versuchte, Blickkontakt zu ihr zu halten. Das Sprechen fiel ihm sichtbar schwer. Vor Schmerzen verzog er das Gesicht.
Cathy beugte sich zu ihm. Seine verzweifelte Miene ging ihr ans Herz. „Ja, Victor?“, flüsterte sie, während sie ihm durchs Haar strich, um seine Schmerzen zu mildern. Die Berührung ihrer Hände und der Blickkontakt schienen ewig zu dauern. „Sagen Sie es mir.“
„Wir können nicht länger warten“, entschied der Arzt. „Rollen Sie ihn in den OP.“
Unvermittelt wurde ihr Victors Hand entrissen. Sie schoben ihn in den Operationssaal, der mit seinen Apparaturen aus Edelstahl und dem grellen Licht wie aus einem Albtraum zu stammen schien. Victor wurde vorsichtig auf den Operationstisch gelegt.
„Puls hundertzehn“, verkündete eine Krankenschwester. „Blutdruck fünfundachtzig zu fünfzig.“
„Wir legen zwei Kanülen“, befahl der Arzt. „Blutgruppe bestimmen und sechs Einheiten bestellen. Verständigen Sie einen Chirurgen. Wir brauchen Unterstützung …“
Das Stimmengewirr und das Geklapper von Gerätschaften waren ohrenbetäubend. Niemand beachtete Cathy, die an der Tür stand und ebenso entsetzt wie fasziniert zusah, als eine Krankenschwester begann, Victors blutige Kleidung aufzuschneiden. Mit jedem Schnitt wurde mehr Haut freigelegt, bis das Hemd und der Anorak vollständig abgestreift waren. Der breite Brustkorb war mit dichtem braunen Haar bedeckt.
Für die Ärzte und Krankenschwestern war es nur ein Körper, um den sie sich kümmern mussten – ein weiterer Patient, der gerettet werden musste. Für Cathy dagegen war er ein Mensch, der ihr etwas bedeutete – und sei es nur, weil sie die vergangenen schrecklichen Minuten gemeinsam durchgestanden hatten. Die Krankenschwester konzentrierte sich auf seinen Gürtel, den sie rasch löste. Mit einem energischen Ruck zog sie seine Hose und Boxershorts hinunter und warf sie auf den Haufen der anderen schmutzigen Kleidungsstücke.
Cathy registrierte die Nacktheit des Mannes kaum – ebenso wenig wie die Krankenschwestern und die Ärzte, die in den Behandlungsraum eilten. Entsetzt starrte sie auf Victors linke Schulter, aus der frisches Blut auf den Tisch rann. Sie erinnerte sich an die Abwehrreaktion seines Körpers, als sie ihn bei dieser Schulter gepackt hatte. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie sehr er gelitten haben musste.
Ein saurer Geschmack stieg ihr in die Kehle. Jeden Augenblick würde sie sich übergeben müssen.
Irgendwie gelang es ihr, zum nächsten Stuhl zu wanken und darauf Platz zu nehmen, während sie die Übelkeit bekämpfte. Die chaotische Hektik um sie herum nahm sie gar nicht wahr. Entsetzt stellte sie fest, dass ihre Hände blutverschmiert waren.
„Da sind Sie ja“, sagte jemand. Eine Schwester trat aus dem Operationssaal, in den Händen die persönlichen Dinge des Patienten. Sie winkte Cathy zu einem Schreibtisch. „Wir brauchen Ihren Namen und Ihre Anschrift, falls die Ärzte noch Fragen haben. Außerdem muss die Polizei verständigt werden. Oder haben Sie das bereits getan?“
Wie betäubt schüttelte Cathy den Kopf. „Ich … ich denke, ich sollte …“
„Sie können dieses Telefon benutzen.“
„Danke.“
Es läutete achtmal, ehe jemand antwortete. Die Stimme am anderen Ende klang rau, als sei ihr Besitzer aus dem Tiefschlaf gerissen worden. Offenbar war in Garberville zu wenig los, als dass es sich für die Polizei gelohnt hätte, die ganze Nacht wach zu bleiben. Der diensthabende Beamte notierte Cathys Angaben und sagte, man würde sich später bei ihr melden, wenn seine Kollegen den Unfallort besichtigt hatten.
Die Krankenschwester hatte damit begonnen, Victors Brieftasche nach Kredit- und Visitenkarten zu durchsuchen, um mehr über ihn zu erfahren. Cathy sah ihr dabei zu, wie sie die Felder auf dem Patientenformular ausfüllte. Name: Victor Holland. Alter: 41. Beruf: Biochemiker. Nächste Angehörige: unbekannt.
Das war also sein voller Name. Victor Holland. Cathy betrachtete den Stapel Karten. Eine erregte ihre Aufmerksamkeit: Es schien ein Sicherheitsausweis für eine Firma namens Viratek zu sein. Ein farbiges Passfoto zeigte Victors ausdrucksloses Gesicht. Die grünen Augen blickten direkt in die Kamera. Selbst wenn sie ihn nicht kennen würde, hätte sie sich ihn genau so vorgestellt: neutrale Miene, durchdringender Blick. Sie berührte ihre Handfläche an der Stelle, wo er sie geküsst hatte. Fast glaubte sie, noch die Bartstoppeln auf der Haut zu spüren.
Leise fragte sie: „Wird er durchkommen?“
Die Krankenschwester schrieb weiter. „Er hat eine Menge Blut verloren. Aber er sieht ziemlich zäh aus …“
Cathy nickte. Selbst die höllischen Schmerzen hatten Victor nicht davon abgehalten, all seine Kräfte zu mobilisieren und durch den Regen zu laufen. Ja, sie wusste, was für ein zäher Brocken er war.
Die Krankenschwester reichte ihr einen Kugelschreiber und das Formular. „Schreiben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse ganz unten hin. Falls der Doktor noch Fragen an Sie hat.“
Cathy holte eine Karte aus ihrem Portemonnaie und notierte Sarahs Adresse und Telefonnummer auf das Papier. „Ich heiße Cathy Weaver. Unter dieser Nummer können Sie mich erreichen.“
„Sie bleiben in Garberville?“
„Drei Wochen. Auf Besuch.“
„Oh. Ein großartiger Start für einen Urlaub.“
Seufzend stand Cathy auf. „In der Tat. Wirklich großartig.“
Vor dem Behandlungszimmer blieb sie kurz stehen. Was mochte da drinnen wohl passieren? Sie wusste, dass Victor um sein Leben kämpfte. Ob er noch bei Bewusstsein war? Würde er sich noch an sie erinnern? Auf einmal war es ihr sehr wichtig, dass er sich an sie erinnerte.
Cathy wandte sich an die Schwester. „Sie rufen mich doch an, nicht wahr? Ich meine, Sie sagen mir Bescheid, ob er …“
Die Schwester nickte. „Wir halten Sie auf dem Laufenden.“
Sie trat ins Freie. Der Regen hatte aufgehört, und durch den Riss in der Wolkendecke schimmerten ein paar Sterne. Trotz ihrer Müdigkeit schaute sie fasziniert zum Himmel. Nach einem Sturm herrschte stets eine ganz eigenartige Stimmung. Als sie vom Parkplatz des Krankenhauses fuhr, zitterte sie beinahe vor Erschöpfung. Den Wagen, der auf der anderen Straßenseite stand, bemerkte sie nicht – ebenso wenig das kurze Aufglühen einer Zigarette, ehe sie ausgedrückt wurde.
2. KAPITEL
Nur eine Minute nachdem Cathy das Krankenhaus verlassen hatte, betrat ein Mann die Notaufnahme. Mit ihm wehte das Ambiente einer sturmgepeitschten Nacht durch die Flügeltüren. Die diensthabende Schwester war damit beschäftigt, den Aufnahmebogen des neuen Patienten auszufüllen. Als die kühle Nachtluft über den Schreibtisch hinwegzog, schaute sie auf. Ein Mann kam auf sie zu. Er war etwa fünfunddreißig und hatte ein hageres, verschlossenes Gesicht. Sein dunkles Haar war grau gesprenkelt. Wassertropfen glänzten auf seinem braunen Burberry-Regenmantel.
„Kann ich Ihnen helfen, Sir?“ Sie schaute ihm in die Augen, die aussahen wie schwarze Kiesel in einem Teich.
Er nickte. „Ist hier eben ein Mann eingeliefert worden? Victor Holland?“
Die Schwester blickte auf das Formular auf ihrem Schreibtisch. Der Name stimmte. Victor Holland. „Ja“, bestätigte sie. „Sind Sie ein Verwandter?“
„Ich bin sein Bruder. Wie geht es ihm?“
„Er ist erst vor Kurzem gebracht worden. Er wird gerade operiert. Wenn Sie warten wollen, erkundige ich mich, wie es ihm geht …“ Sie unterbrach sich, als das Telefon läutete. Es war einer der Assistenzärzte, der ihr die Laborteste des neuen Patienten mitteilte. Sie notierte die Zahlen. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie, dass der Besucher sich zu der verschlossenen Tür des Operationssaals umgedreht hatte. Die wurde jetzt aufgerissen, und ein Krankenpfleger mit einem prall gefüllten und blutverschmierten Plastikbeutel stürzte heraus. Aus dem Raum drangen erregte Stimmen:
„Blutdruck auf hundertzehn zu siebzig.“
„Wir können mit der OP beginnen.“
„Wo ist der Chirurg?“
„Unterwegs. Er hatte Probleme mit seinem Wagen.“
„Wir röntgen. Alle zurücktreten.“
Langsam schloss sich die Tür. Die Stimmen klangen wieder gedämpft. Die Schwester legte den Hörer auf, als der Krankenpfleger den Plastikbeutel auf ihren Schreibtisch legte. „Was ist das?“, wollte sie wissen.
„Die Kleider des Patienten. Sie sind ziemlich verdreckt. Soll ich sie entsorgen?“
„Ich nehme sie mit nach Hause“, schaltete der Mann im Regenmantel sich ein. „Ist das alles?“
Der Krankenpfleger warf der Schwester einen verunsicherten Blick zu. „Ich weiß nicht, ob er das … ob er das möchte. Sie sind ziemlich … schmutzig …“
„Mr Holland, sollen wir uns nicht lieber um die Kleidung kümmern?“, unterbrach ihn die Schwester. „In dem Beutel sind keine Wertsachen. Die habe ich hier.“ Sie schloss eine Schublade auf und holte einen braunen Umschlag hervor. Darauf stand: Holland, Victor; Inhalt: Brieftasche, Armbanduhr. „Die können Sie mitnehmen. Wenn Sie mir diese Empfangsbestätigung unterschreiben wollen …“
Der Mann nickte und signierte mit seinem Namen: David Holland. „Sagen Sie, ist Victor wach?“ Er steckte den Umschlag ein. „Hat er irgendwas gesagt?“
„Ich fürchte, nein. Er war halb bewusstlos, als er hergebracht wurde.“
Der Mann nahm die Auskunft schweigend zur Kenntnis. Seine Reaktion irritierte die Schwester plötzlich. „Entschuldigen Sie, Mr Holland, aber wie haben Sie eigentlich von dem Unfall Ihres Bruders erfahren?“, fragte sie. „Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, irgendwelche Familienmitglieder zu benachrichtigen …“
„Die Polizei hat mich verständigt. Victor war mit meinem Wagen unterwegs. Sie haben ihn am Straßenrand gefunden. Totalschaden.“
„Oh. Das ist keine angenehme Art, es zu erfahren.“
„Ja. Der Stoff, aus dem Albträume sind.“
„Jedenfalls hat Sie jemand kontaktiert.“ Sie blätterte durch die Papiere auf ihrem Schreibtisch. „Geben Sie mir Ihre Adresse und Telefonnummer? Falls wir mit Ihnen in Verbindung treten müssen.“
„Natürlich.“ Der Mann nahm das Formular zur Hand und überflog es mit einem raschen Blick, ehe er seinen Namen und seine Telefonnummer in die Rubrik Nächste Angehörige kritzelte. „Wer ist diese Catherine Weaver?“ Er deutete auf den Namen und die Adresse, die unten auf dem Blatt standen.
„Die Frau, die ihn hierhergebracht hat.“
„Ich muss mich bei ihr bedanken.“ Er gab ihr das Formular zurück.
„Schwester?“
Sie drehte sich um. Der Doktor stand an der Tür zum Behandlungszimmer. „Ja?“
„Rufen Sie bitte die Polizei an. Sie sollen so schnell wie möglich herkommen.“
„Die Polizei ist schon verständigt, Doktor. Sie sind über den Unfall informiert.“
„Rufen Sie sie noch mal an. Das war nämlich kein Unfall.“
„Wie bitte?“
„Wir haben gerade die Röntgenaufnahmen bekommen. Der Mann hat eine Kugel in der Schulter.“
„Eine Kugel?“ Der Schwester lief eine Gänsehaut über den Rücken, als ob ein eisiger Wind hereinwehte. Langsam drehte sie sich zu dem Mann im Regenmantel um – dem Mann, der behauptete, Victor Hollands Bruder zu sein. Zu ihrer Verblüffung stand niemand mehr vor ihr. Dafür kam nun eine kühle nächtliche Brise durch die Flügeltüren, die sich langsam schlossen.
„Wohin, zum Teufel, ist er verschwunden?“, flüsterte der Krankenpfleger.
Ein paar Sekunden lang starrte sie nur auf die geschlossene Tür. Dann fiel ihr Blick auf die leere Stelle auf ihrem Schreibtisch. Der Beutel mit Victor Hollands Kleidung war verschwunden.
„Warum hat die Polizei noch mal angerufen?“
Langsam legte Cathy den Hörer zurück. Obwohl sie einen kuscheligen Morgenmantel trug, zitterte sie vor Kälte. Sie drehte sich um und schaute in die Küche zu Sarah. „Der Mann auf der Straße … sie haben eine Kugel in seiner Schulter gefunden.“
Überrascht hielt Sarah im Teegießen inne. „Du meinst, jemand hat auf ihn … geschossen?“
Wie betäubt ging Cathy zum Küchentisch und starrte blicklos auf die Tasse Zimttee, die Sarah ihr zugeschoben hatte. Ein heißes Bad und eine Stunde vor dem gemütlich knisternden Feuer im Kamin hatten dafür gesorgt, dass ihr die Ereignisse der Nacht nur noch wie ein schlimmer Traum vorkamen. In Sarahs Küche mit den Chintzvorhängen und dem Duft von Zimt und anderen Gewürzen schien die Brutalität der Welt meilenweit entfernt.
Sarah beugte sich zu ihr. „Wissen sie, was passiert ist? Hat er irgendetwas gesagt?“
„Er ist gerade aus dem OP gekommen.“ Sie schaute zum Telefon. „Vielleicht sollte ich noch mal im Krankenhaus anrufen …“
„Nein, das solltest du nicht. Du hast alles getan, was du tun konntest.“ Sanft berührte Sarah ihren Arm. „Außerdem wird dein Tee kalt.“
Mit zitternden Fingern wischte Cathy sich eine feuchte Strähne aus der Stirn und ließ sich auf ihren Stuhl sinken. Eine Kugel in der Schulter. War es der willkürliche Angriff eines Heckenschützen, der aus seinem Wagen auf einen völlig Fremden geschossen hatte? In der Zeitung hatte sie von solchen Vorfällen auf den Highways gelesen.
Oder war es ein gezielter Angriff gewesen? Hatte man Victor Holland erschießen wollen?
Von draußen drangen ein Klappern und ein metallisches Scheppern herein. Sofort saß Cathy kerzengrade. „Was war das?“
Sarah lachte. „Ganz bestimmt nichts, wovor man Angst haben müsste.“ Sie ging zur Küchentür und griff zur Klinke.
„Sarah!“, rief Cathy panisch, als ihre Freundin die Tür öffnete. „Warte.“
„Schau selbst.“ Sarah öffnete die Tür. Das Licht der Küchenlampe fiel auf einige Mülltonnen im Carport. Ein Schatten glitt zu Boden und huschte davon. Er hinterließ eine Spur von leeren Pizza- und Fast-Food-Kartons auf der Straße. „Waschbären“, erklärte Sarah. „Wenn ich die Mülltonnendeckel nicht verschließe, verteilen diese Biester den Abfall im ganzen Garten.“
Ein weiterer Schatten lugte aus einer Mülltonne. Glühende Augen starrten sie aus der Dunkelheit an. Sarah klatschte in die Hände und schrie: „Verschwinde, hau ab!“ Der Waschbär rührte sich nicht. „Hast du kein Zuhause?“ Endlich ließ sich der Waschbär zu Boden fallen und verschwand zwischen den Bäumen. „Von Jahr zu Jahr werden sie kühner“, seufzte Sarah und schloss die Tür. Dann drehte sie sich zu Cathy und zwinkerte ihr zu. „Mach dir nichts draus. Das hier ist nun mal nicht die Großstadt.“
„Daran wirst du mich öfter erinnern müssen.“ Cathy nahm eine Scheibe Bananenbrot und bestrich sie mit Butter. „Ich glaube, Sarah, Weihnachten mit dir zu feiern ist tausendmal schöner als mit Jack.“
„Oje. Wenn wir schon von unseren Exmännern sprechen …“, Sarah schlurfte zu einem Schrank, „… sollten wir uns auch in die richtige Stimmung bringen. Ein Tee ist da wenig hilfreich.“ Grinsend schwenkte sie eine Flasche mit Brandy.
„Sarah, du trinkst doch nicht etwa Alkohol?“
„Der ist nicht für mich.“ Sarah stellte die Flasche und ein Glas vor sie hin. „Aber ich glaube, du könntest einen Schluck gebrauchen. Nach dieser ungemütlichen und schrecklichen Nacht. Dafür sitzen wir jetzt hier im Warmen und können über die Deppen herziehen – soweit sie männlich sind.“
„Na ja, wenn du es so siehst …“ Cathy goss sich einen großzügigen Schluck ein. „Auf die Deppen dieser Welt“, verkündete sie und trank. Sie spürte, wie der Brandy die Kehle hinunterlief. Es fühlte sich gut an.
„Wie geht’s denn dem guten Jack?“, erkundigte Sarah sich.
„Wie immer.“
„Blondinen?“
„Er hat zu Brünetten gewechselt.“
„Er brauchte nur ein Jahr, um alle Blondinen dieser Welt abzuhaken?“
Cathy zuckte mit den Achseln. „Möglicherweise hat er ein paar ausgelassen.“
Beide mussten lachen – ein unbeschwertes Lachen, welches verriet, dass ihre Wunden allmählich verheilten und Männer für sie Geschöpfe waren, über die man ohne Wut und Trauer reden konnte.
Cathy betrachtete ihr Glas. „Glaubst du, dass es noch anständige Männer gibt? Ich meine, einer müsste doch irgendwo da draußen herumlaufen. Vielleicht eine Mutation. Ein halbwegs anständiger Kerl?“
„Sicher. Wahrscheinlich in Sibirien. Aber er ist bestimmt hundertzwanzig Jahre alt.“
„Ältere Männer habe ich schon immer attraktiver gefunden.“
Wieder lachten sie, doch dieses Mal klang es nicht so unbeschwert. Als sie vor vielen Jahren zusammen auf dem College waren, hatten sie noch nicht daran gezweifelt – nein, sie waren davon überzeugt gewesen, dass es überall nur so von Märchenprinzen wimmelte.
Cathy leerte ihr Glas und stellte es ab. „Was bin ich für eine rücksichtslose Freundin. Eine Hochschwangere vom Schlaf abzuhalten. Wie spät ist es eigentlich?“
„Erst halb drei früh.“
„Um Himmels willen, Sarah. Ab ins Bett mit dir!“ Cathy ging zum Spülbecken und befeuchtete eine Handvoll Papiertücher.
„Was hast du vor?“, wollte Sarah wissen.
„Ich möchte die Wagensitze reinigen. Ich habe noch nicht das ganze Blut wegwischen können.“
„Das habe ich schon getan.“
„Wie bitte? Wann?“
„Als du gebadet hast.“
„Sarah, du bist verrückt.“
„He, ich hatte keine Fehlgeburt oder sonst etwas Außerplanmäßiges. Ach, das hätte ich fast vergessen.“ Sarah zeigte auf eine winzige Filmdose auf der Küchentheke. „Das lag auf dem Boden deines Autos.“
Seufzend schüttelte Cathy den Kopf. „Die gehört Hickey.“
„Hickey! Dieser Mann ist die reinste Verschwendung.“
„Er ist ein guter Freund.“
„Mehr als ein Freund wird er für eine Frau auch nie sein. Was ist denn auf dem Film drauf? Nackte Frauen – wie immer?“
„Ich will es gar nicht wissen. Als ich ihn am Flughafen abgesetzt habe, hat er mir ein halbes Dutzend Filmrollen in die Hand gedrückt und gesagt, er würde sie bei mir abholen, wenn er wieder zurück ist. Wahrscheinlich wollte er sie nicht mit nach Nairobi nehmen.“
„Nairobi? Dorthin ist er geflogen?“
„Er fotografiert ‚fantastische Afrikanerinnen‘ oder so ähnlich.“ Cathy steckte die Filmdose in die Tasche ihres Bademantels. „Die muss aus dem Handschuhfach gefallen sein. Hoffentlich ist es nichts Pornografisches.“
„Wie ich Hickey kenne, wahrscheinlich doch.“
Wieder mussten sie lachen. Ironischerweise war Hickman von Trapp, dessen Beruf es war, Frauen in erotischen Posen zu fotografieren, überhaupt nicht am anderen Geschlecht interessiert – mit Ausnahme vielleicht seiner Mutter.
„Einer wie Hickey ist doch der beste Beweis für mein Argument“, meinte Sarah über ihre Schulter, während sie durch den Flur ins Schlafzimmer ging.
„Und das wäre?“
„Dass es auf der Welt keine anständigen Männer mehr gibt.“
Es war das Licht, das Victor aus den Tiefen seiner Bewusstlosigkeit holte – ein Licht, das heller strahlte als ein Dutzend Sonnen und durch seine Lider drang. Er wollte nicht aufwachen. Tief im Unterbewusstsein spürte er, dass er Schmerzen und Übelkeit und noch einiges Unangenehme mehr spüren würde, wenn er gegen diese angenehme Bewusstlosigkeit kämpfen würde: nämlich pure Angst. An den Grund dafür konnte er sich allerdings nicht erinnern. Der Tod? Nein, das hier war der Tod – oder zumindest war es nahe daran, und es fühlte sich warm und schwarz und behaglich an. Aber er hatte etwas Wichtiges zu tun – etwas, das er auf keinen Fall vergessen durfte. Angestrengt überlegte er, doch das Einzige, an das er sich erinnern konnte, war eine Hand, die ihn sanft, aber nachdrücklich streichelte, über seine Stirn fuhr, und eine Stimme, die leise in der Dunkelheit zu ihm sprach.
„Ich heiße Catherine …“
Mit der Erinnerung an ihre Berührung und ihre Stimme kam auch die Angst zurück. Nicht seinetwegen (er war ja schließlich tot, oder?), sondern wegen ihr. Die starke, freundliche Catherine. Er hatte ihr Gesicht nur kurz gesehen und konnte sich kaum daran erinnern, aber dennoch wusste er, dass sie wunderschön war – das instinktive Wissen eines Blinden, der ohne sehen zu können ahnt, dass ein Regenbogen oder der Himmel oder das Gesicht seines eigenen Kindes wunderschön ist. Und jetzt hatte er Angst um sie.
Wo sind Sie? hätte er am liebsten gerufen.
„Er kommt zu sich“, sagte eine weibliche Stimme (nicht die von Catherine, sie klang zu harsch und schrill), und ein verwirrendes Stimmengewirr setzte ein.
„Achten Sie auf die Kanüle.“
„Mr Holland, bleiben Sie ganz ruhig. Alles wird gut …“
„Die Kanüle, habe ich gesagt.“
„Geben Sie mir die zweite Blutkonserve.“
„Bewegen Sie sich nicht, Mr Holland …“
Wo bist du, Catherine? Die Frage explodierte in seinem Kopf. Er kämpfte gegen die Versuchung an, zurück in die Bewusstlosigkeit zu sinken. Mühsam öffnete er die Augen. Zunächst sah er Licht und Farben nur verschwommen, und dennoch war der Eindruck so intensiv, dass es ihm wie ein Stich durch die Augenhöhlen ins Gehirn erschien. Allmählich wurden durch den Nebel Gesichter deutlich, Fremde in blauer Kleidung, die ihn stirnrunzelnd betrachteten. Als er versuchte, sich auf sie zu konzentrieren, rebellierte sein Magen.
„Mr Holland, bleiben Sie ganz ruhig“, hörte er eine energische Stimme. „Sie sind im Krankenhaus – im Aufwachzimmer. Ihre Schulter ist gerade operiert worden. Ruhen Sie sich einfach nur aus und schlafen noch ein bisschen …“
Nein, ich kann nicht, wollte er sagen.
„Gebt ihm fünf Milligramm Morphium“, befahl jemand, und Victor spürte ein warmes Gefühl in seinem Arm, das sich bis zum Brustkorb ausbreitete.
„Das müsste wirken“, hörte er. „Und jetzt schlafen Sie. Alles ist wunderbar gelaufen …“
Sie verstehen überhaupt nichts, hätte er am liebsten geschrien. Ich muss sie warnen … Es war sein letzter Gedanke, ehe die Lichter erneut von einer weichen Dunkelheit verschluckt wurden.
Lächelnd lag Sarah in ihrem männerlosen Ehebett. Nein, sie lachte! Ihr ganzer Körper schien in dieser Nacht vor Lachen zu beben. Am liebsten hätte sie gesungen und getanzt, am offenen Fenster gestanden und ihre Freude in die Welt hinausgeschrien! Man hatte ihr gesagt, dass es die Hormone seien – das chemische Chaos der Schwangerschaft hatte in ihrem Körper eine Achterbahnfahrt der Gefühle verursacht. Sie sollte sich besser ausruhen und ihren Zustand mit Gelassenheit sehen, aber heute Nacht war sie überhaupt nicht müde. Die arme Cathy dagegen war so erschöpft gewesen, dass sie nur mit Mühe die Stufen ins Dachzimmer geschafft hatte, in dem ihr Bett stand. Und Sarah war hellwach!
Sie schloss die Augen und konzentrierte ihre Gedanken auf das Kind in ihrem Bauch. Wie geht es dir, mein Schatz? Schläfst du? Oder lauschst du meinen Gedanken?
Das Baby bewegte sich in ihrem Bauch. Dann wurde es wieder ruhig. Es war eine Antwort – heimliche Worte, die nur sie beide miteinander tauschten. Fast war Sarah froh, dass es keinen Ehemann gab, der sie von dieser stummen Unterhaltung ablenken konnte, der als unbeteiligter Außenseiter eifersüchtig neben ihr lag. Es gab nur Mutter und Kind, das uralte Band, die mystische Verbindung.
Arme Cathy. Die Achterbahn raste vom Gipfel der Freude in ein Tal der Trauer, die sie für ihre Freundin empfand. Sie wusste, dass Cathy sich ebenfalls sehnlichst ein Kind wünschte, aber die biologische Uhr tickte immer lauter. Cathy war zu sehr Romantikerin, um zuzugeben, dass der Mann und die Umstände möglicherweise niemals perfekt sein würden. Hatte sie nicht zehn lange Jahre gebraucht, bis sie endlich eingesehen hatte, dass ihre Ehe ein schreckliches Desaster war? Dabei hatte sie sich ständig bemüht, ihre Beziehung zu retten. Sie war, nein, sie wollte blind sein gegenüber Jacks Fehlern – vor allem gegenüber seinem Egoismus. Erstaunlich, dass eine so intelligente und einfühlsame Frau die Dinge so lange hatte schleifen lassen. Aber so war Cathy nun mal. Selbst mit siebenunddreißig war sie auf geradezu idiotische Weise loyal und vertrauensselig.
Das Knirschen von Kies auf der Einfahrt erregte ihre Aufmerksamkeit. Mucksmäuschenstill lag sie im Bett und lauschte. Einen Moment lang hörte sie nur das vertraute Ächzen der Bäume und das Rascheln der Blätter, wenn die Zweige gegen das Schindeldach schlugen. Da – schon wieder dieses Geräusch. Steine kullerten über die Straße und dann das leise Quietschen von Metall. Schon wieder diese Waschbären! Wenn sie sie nicht verjagte, würden sie den Müll über die gesamte Fahrbahn verteilen.
Seufzend setzte sie sich auf und tastete in der Dunkelheit nach ihren Pantoffeln. Geräuschlos schlurfte sie aus dem Schlafzimmer hinaus in den Korridor und schlug instinktiv den Weg zur Küche ein. Sie fand die Dunkelheit zu anheimelnd, um sie durch unnötiges Licht zu vertreiben. Anstatt die Lampe im Carport einzuschalten, griff sie zu der Taschenlampe, die am gewohnten Platz auf dem Küchenregal lag, und schloss die Tür auf.
Der Mond warf ein milchiges Licht durch die Wolkendecke. Sie richtete die Lampe auf die Mülltonnen, aber im Strahl leuchteten keine Waschbäraugen auf, und ebenso wenig entdeckte sie verräterischen Abfall. Der Schein der Lampe spiegelte sich im Metall der Tonnen. Ratlos durchquerte sie den Carport und blieb vor Cathys Datsun stehen, den sie in der Einfahrt geparkt hatte.
In diesem Moment bemerkte sie das schwache Licht im Wagen. Durch die Scheibe konnte sie erkennen, dass das Handschuhfach offen stand. Zuerst dachte sie, dass es von selbst aufgegangen war oder Cathy vergessen hatte, es zu schließen. Dann entdeckte sie die Straßenkarten, die über den Beifahrersitz verstreut waren.
Entsetzt fuhr sie zurück. Die Angst war auf einmal so überwältigend, dass sie das Gefühl hatte, keinen Schritt tun zu können. Unvermittelt spürte sie eine unheimliche Nähe. Jemand wartete in der Dunkelheit. Sie fühlte seine Gegenwart wie einen kühlen Windstoß in der Nacht.
Rasch machte sie kehrt. Das Licht der Taschenlampe wischte durch die Dunkelheit – und gefror auf dem Gesicht eines Mannes. Die Augen, die auf sie herabschauten, waren kalt und schwarz wie Kieselsteine. Den Rest seines Gesichts nahm sie kaum wahr: weder die Hakennase noch die dünnen blutleeren Lippen. Sie sah nur die Augen. Es waren die Augen eines Mannes ohne Seele.
„Guten Abend, Catherine“, flüsterte er. In seiner Stimme hörte sie den herannahenden Tod.
Bitte, wollte sie schreien, als er ihr Haar nach hinten riss und ihren Hals freilegte. Lass mich leben.
Aber sie brachte keinen Ton hervor. Die Worte blieben ihr ebenso in der Kehle stecken wie seine Klinge.
Am nächsten Morgen wurde Cathy vom Gezänk der Blauhäher geweckt. Sie musste lächeln, als sie diese merkwürdigen Geräusche hörte – Flügel, die aufgeregt gegen die Fensterscheibe schlugen, das hektische Kreischen gefiederter Gegner. Es klang ganz anders als das Dröhnen der Busse und Autos, an das sie gewöhnt war. Das Krächzen der Blauhäher entfernte sich aufs Dach, und ihre Flügel flatterten gegen die Schindeln, während sie ihre Kämpfe ausfochten. Sie lauschte den Klängen des Streits – hinauf auf der einen Seite des Daches und zur anderen Seite wieder hinunter. Schließlich wurde ihr langweilig, und sie schaute zum Fenster.
Die Strahlen der Morgensonne tauchten das Dachzimmer in sanftes Licht. Es war das perfekte Kinderzimmer. Sarah hatte schon eine Menge geändert … die Vorhänge mit den Märchenmotiven, die Tierbilder an der Wand. Plötzlich empfand sie eine tiefe Freude bei dem Gedanken, dass demnächst hier ein Baby schlafen würde. Lächelnd wickelte sie sich die Bettdecke um die Knie. Ihr Blick fiel auf ihre Armbanduhr auf dem Nachttisch. Schon halb zehn. Der halbe Morgen war bereits vorbei!
Zögernd verließ sie die Wärme des Betts und suchte in ihrem Koffer nach einem Sweatshirt und einer Jeans. Mit dem Gezänk der Blauhäher als Hintergrundmusik zog sie sich an. Die Vögel hatten sich mittlerweile in die Baumkronen verzogen. Durch das Fenster beobachtete sie sie dabei, wie sie von Ast zu Ast hüpften, bis einer von ihnen sozusagen die weiße Flagge hisste und geschlagen das Feld räumte. Der Sieger, dessen Autorität nicht länger infrage gestellt wurde, stieß einen letzten Schrei aus und machte sich wieder daran, sein Gefieder zu putzen.
Erst jetzt fiel Cathy die Stille im Haus auf – eine Stille, in der ihr jeder Herzschlag und jeder Atemzug erschreckend laut erschienen.
Sie verließ die Dachstube und stieg die Treppe hinunter. Das Wohnzimmer war leer. Im Kamin lag die Asche vom Feuer der vergangenen Nacht. Eine silberne Girlande war vom Weihnachtsbaum gerutscht. Auf dem Kaminsims stand ein Engel aus Papier mit glitzernden Flügeln. Sie durchquerte den Korridor und bemerkte, dass die Tür zu Sarahs Zimmer offen war. Stirnrunzelnd betrachtete sie das zerwühlte Bett und das Laken auf dem Boden. „Sarah?“
Die Stille verschluckte ihre Stimme. Konnte ein Cottage wirklich so geräumig sein? Sie ging zurück durchs Wohnzimmer in die Küche. Die Teetassen vom Abend zuvor standen noch in der Spüle. Auf der Fensterbank zitterte Spargelkraut im Luftzug, der durch die offene Tür wehte.
Cathy trat in den Carport, in dem Sarahs alter Dodge stand. „Sarah?“, rief sie.
Etwas raschelte auf dem Dach. Erschrocken schaute sie hoch und musste lachen, als sie den Blauhäher im Baum über ihr kreischen sah – zweifellos eine Triumphrede. Selbst im Tierreich gab es selbstgefällige Kreaturen.
Gerade als sie ins Haus zurückgehen wollte, bemerkte sie den Fleck auf dem Kies neben dem Hinterreifen des Wagens. Ein paar Sekunden lang starrte sie verständnislos auf die rostbraune Stelle. Langsam ging sie am Wagen vorbei und entdeckte weitere Flecken. Ihr Blick folgte der sich schlängelnden Spur.
Sie umrundete das Heck des Wagens und konnte die gesamte Einfahrt überschauen. Der getrocknete rotbraune Bach mündete in einen purpurroten See, in dem eine einzige Schwimmerin lag – reglos und mit weit geöffneten Augen.
Unvermittelt hörte der Blauhäher mit seinem Gezeter auf, als ein anderer Laut in die Baumkronen stieg: Cathys Schrei.
„He, Mister. Mister, hallo!“
Victor versuchte, die Stimme zu ignorieren, aber sie blieb hartnäckig in seinem Ohr – wie eine lästige Fliege, die sich nicht vertreiben ließ.
„He, Mister. Sind Sie wach?“
Victor öffnete die Augen. Es kostete ihn ungeheure Mühe, das krumme Gesicht mit dem grauen Backenbart klar und deutlich erkennen zu können. Die Erscheinung grinste, und schwarze Lücken wurden sichtbar, wo eigentlich Zähne sein sollten. Victor starrte in dieses dunkle Loch, das ein Mund war, und dachte: Ich bin gestorben und in der Hölle gelandet.
„He, Mister, haben Sie eine Zigarette?“
Victor schüttelte den Kopf und presste mühsam hervor: „Ich glaube nicht.“
„Können Sie mir dann einen Dollar leihen?“
„Lassen Sie mich in Ruhe“, stöhnte Victor und schloss die Augen, um das grelle Tageslicht auszublenden. Angestrengt versuchte er, sich zu erinnern, wo er war, aber sein Kopf schmerzte höllisch, und die Stimme des kleinen Mannes ließ ihn nicht zur Ruhe kommen.
„Ich krieg hier nirgendwo Zigaretten. Ist wie im Knast. Warum stehe ich nicht einfach auf und gehe hinaus? Aber wissen Sie, um diese Jahreszeit ist es draußen auf der Straße verdammt kalt. Die ganze Nacht hat’s geregnet. Hier drinnen ist es wenigstens warm …“
Die ganze Nacht hat’s geregnet … Plötzlich erinnerte Victor sich wieder. Der Regen. Er war durch den Regen gelaufen … immer weitergelaufen.
Victor riss die Augen auf. „Wo bin ich?“
„Station Nummer drei, Ostflügel. Das Reich der Hexen.“
Mühsam richtete er sich auf. Vor Schmerz hätte er beinahe laut gestöhnt. Der Metallständer, an dem die Infusionsflüssigkeit hing, die in das Röhrchen tropfte, verschwamm vor seinen Augen. Er drehte den Kopf und bemerkte den Verband an seiner linken Schulter. Und bei einem Blick aus dem Fenster stellte er fest, dass es bereits heller Tag war. „Wie spät ist es?“
„Keine Ahnung. Neun Uhr vielleicht. Das Frühstück haben Sie jedenfalls verpasst.“
„Ich muss hier raus.“ Victor schwang die Beine aus dem Bett und stellte fest, dass er unter dem dünnen Krankenhaushemd nackt war. „Wo sind meine Sachen? Meine Brieftasche?“
Der alte Mann zuckte mit den Schultern. „Das sollte die Schwester wissen. Fragen Sie sie.“
Victor fand den Rufknopf zwischen den Laken. Er drückte ein paarmal darauf. Danach begann er, das Pflaster abzuziehen, mit dem die Kanüle an seinem Arm befestigt war.
Die Tür flog auf, und eine weibliche Stimme erklang: „Mr Holland! Was machen Sie da?“
„Ich verschwinde von hier“, erwiderte Victor, während er das letzte Pflaster abriss. Ehe er die Kanüle herausziehen konnte, eilte die Schwester an sein Bett, so schnell es ihre stämmigen Beine erlaubten, und legte eine Gazebinde über den Katheter.
„Machen Sie mir bloß keine Vorwürfe“, kreischte der kleine Mann.
„Lenny, gehen Sie sofort in Ihr Bett zurück. Und Sie, Mr Holland“, wandte sie sich an ihn und richtete den stahlblauen Blick ihrer Augen auf Victor, „haben zu viel Blut verloren.“ Sie drückte seinen Arm gegen ihren wuchtigen Bizeps und begann, den Katheter wieder zu befestigen.
„Holen Sie mir einfach meine Kleidung.“
„Keine Diskussionen, Mr Holland. Sie müssen hierbleiben.“
„Warum?“
„Weil Sie eine Transfusion bekommen“, blaffte sie ihn an, als ob dies eine Entscheidung wäre, die nicht rückgängig gemacht werden konnte.
„Ich will meine Sachen haben.“
„Da muss ich in der Notaufnahme nachfragen. Die haben nichts von Ihnen hier hochgebracht.“
„Dann rufen Sie die Notaufnahme an, verdammt noch mal.“ Als er ihr missbilligendes Stirnrunzeln sah, fügte er hinzu: „Wenn es Ihnen nichts ausmacht.“
Es dauerte eine weitere halbe Stunde, ehe eine Frau von der Patientenaufnahme auftauchte, um zu erklären, was mit Victors Sachen geschehen war.
„Ich fürchte, wir … nun ja, wir scheinen Ihre persönlichen Dinge … sie sind jedenfalls nicht mehr da, Mr Holland“, stammelte sie verlegen.
„Was soll das heißen – sie sind nicht mehr da?“
„Sie wurden …“, sie räusperte sich „… gestohlen. Aus der Notaufnahme. Glauben Sie mir, das ist noch nie passiert. Es tut uns sehr leid, Mr Holland, und ich bin sicher, dass wir für Ersatz sorgen können …“
Sie war zu sehr damit beschäftigt, sich zu entschuldigen, um Victors alarmierten Gesichtsausdruck zu bemerken. Fieberhaft versuchte er, sich zu erinnern. Die Ereignisse der vergangenen Nacht lagen wie in einem dichten Nebel. Was war mit der Filmrolle passiert? Er wusste, dass er sie auf der endlos langen Fahrt zum Krankenhaus in seiner Tasche gehabt hatte. Er erinnerte sich daran, dass er sie fest in der Hand gehalten und ziellos nach der Frau geschlagen hatte, als sie versucht hatte, die Hand aus seiner Tasche zu ziehen. Und dann … war da nur noch eine große Leere, ein dunkles Loch. Habe ich sie verloren? Habe ich meinen einzigen Beweis verloren?
„Ihr Geld ist weg, aber die Kreditkarten sind noch alle vorhanden. Glücklicherweise.“
Verständnislos schaute er sie an. „Was?“
„Ihre Wertsachen, Mr Holland.“ Sie zeigte auf seine Brieftasche und die Armbanduhr, die sie auf den Nachttisch gelegt hatte. „Einer der Sicherheitsleute hat sie in der Mülltonne neben dem Krankenhaus gefunden. Sieht so aus, als hätte es der Dieb nur auf Ihr Bargeld abgesehen.“
„Und meine Klamotten. Stimmt.“
Kaum hatte die Frau das Zimmer verlassen, drückte Victor den Knopf, um die Krankenschwester, Ms Redfern, zu holen. Sie kam mit einem Frühstückstablett zurück. „Essen Sie etwas, Mr Holland“, befahl sie. „Vielleicht sind Sie unterzuckert. Das würde Ihr Verhalten erklären.“
„Eine Frau hat mich in die Notaufnahme gefahren“, sagte er. „Ihr Vorname war Catherine. Ich muss unbedingt mit ihr reden.“
„Oh, schauen Sie nur: Rührei und Cornflakes. Hier ist Ihre Gabel …“