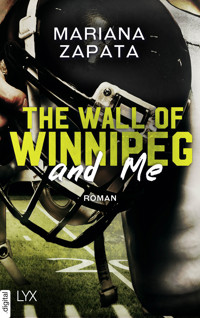
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der riesige TIKTOK-Hype - endlich auf Deutsch!
Vanessa Mazur weiß, dass ihre Kündigung das einzig Richtige war! Schließlich war ihr Job als Assistentin (und Köchin und Putzfrau und Social-Media-Managerin) von Football-Superstar Aiden Graves nur als Übergangslösung gedacht. Doch jetzt steht Aiden vor ihr und bittet sie, ihn zu heiraten! Aiden? Ihren launischen, unfreundlichen - und zugegeben unheimlich attraktiven - Ex-Chef, der sie zwei Jahre lang wie Luft behandelt hat? Doch was sagt man zu einem Mann, der nicht nur gewohnt ist, immer zu bekommen, was er will, sondern auch Vanessas größtes Geheimnis kennt - und ihr Leben von einem Tag auf den anderen verändern könnte?
"Dieses Buch hat mich zum Mariana-Zapata-Stan gemacht! Alles, was sie schreibt ist aus purem Gold, und meine Lieblings-Tropes liebe ich wegen ihr: Slowburn Romance, Enemies to Lovers und Grumpy/Sunshine. Mariana Zapata ist ein Geschenk für Liebesroman-Leser:innen auf der ganzen Welt!" Ali Hazelwood
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 756
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmung123456789101112131415161718192021222324252627282930EpilogDanksagungDie AutorinImpressumMARIANA ZAPATA
The Wall of Winnipeg and Me
Roman
Ins Deutsche übertragen von Barbara Först
Zu diesem Buch
Vanessa Mazur weiß, dass ihre Kündigung das einzig Richtige war – und dass sie sich deswegen nicht schlecht fühlen sollte! Wie oft hatte sie in den letzten zwei Jahren davon geträumt, den Schlüsselbund auf die Kücheninsel zu knallen und ihrem Chef zum Abschied den Mittelfinger zu zeigen – oder ihn im Schlaf mit einem Kissen zu ersticken! Ihren Job als Assistentin (und Köchin und Putzfrau und Social-Media-Managerin) von Aiden »Arschloch« Graves an den Nagel zu hängen, war definitiv die beste Entscheidung ihres Lebens. Seitdem sie endlich wieder ihren Traum von einer eigenen Grafikagentur verfolgt und nicht mehr Mädchen für alles für Amerikas größten Football-Superstar spielen muss, fühlt sie sich das erste Mal in ihrem Leben wirklich frei und unabhängig. Doch als Aiden eines Abends in ihrem kleinen Apartment auftaucht und sie bittet, zurückzukommen und ihn zu heiraten, glaubt sie, sich verhört zu haben! Sie soll Aiden heiraten? Den launischsten, unfreundlichsten – und zugegeben attraktivsten – Mann, der ihr je begegnet ist? Denjenigen, der sie zwei Jahre lang wie Luft behandelt hat, der sich zu keinem einzigen »Guten Morgen« überwinden konnte? Doch was sagt man zu einem Mann, der nicht nur gewohnt ist, immer zu bekommen, was er will, sondern auch Vanessas größtes Geheimnis kennt – und ihr Leben von einem Tag auf den anderen verändern könnte?
Im Gedenken an Alan
1
Ich würde ihn umbringen.
Irgendwann.
Lange nach meiner Kündigung, damit ich nicht in Verdacht geriet.
»Aiden«, maulte ich, obwohl ich es besser wissen sollte. Denn mit Unmutsäußerungen handelte ich mir lediglich seinen berüchtigten, herablassenden Blick ein, der in der Vergangenheit dafür gesorgt hatte, dass Aiden mehr als nur ein Mal Ärger bekommen hatte – so hatte man mir jedenfalls erzählt. Wenn seine Mundwinkel herabfielen und sich seine braunen Augen halb schlossen, wollte ich ihm am liebsten die Faust ins Gesicht rammen.
Der Mann, der entweder kurz vor einem blutigen Ende stand oder vor einem sorgfältig geplanten, bei dem Spülmittel, seine Mahlzeiten und ein langer Zeitraum eine Rolle spielten, grunzte hinter seiner Schüssel mit Quinoa-Salat. »Sie haben es gehört. Sagen Sie es ab«, wiederholte er, als wäre ich beim ersten Mal, als er es mir aufgetragen hatte, mit Taubheit geschlagen gewesen.
Oh, ich hatte ihn durchaus vernommen. Klar und deutlich. Eben deshalb wollte ich ihn ja ermorden.
Worin sich nur zu deutlich das Wunder des menschlichen Verstandes spiegelt: Man mag einen Menschen zwar, will ihm aber gleichzeitig die Kehle durchschneiden. Wie zum Beispiel eine Schwester, der du am liebsten in die Eierstöcke boxen würdest. Um ihr eine Lektion zu erteilen, würdest du sie volle Kanne in ihre Brutfabrik boxen – nicht, dass ich in solchen Dingen Erfahrung hätte.
Da ich schwieg, fühlte er sich offenbar bemüßigt, seine Weigerung zu untermauern. »Ist mir egal, was Sie denen erzählen müssen. Tun Sie’s einfach.«
Ich schob die Brille mit dem linken Zeigefinger höher, während ich die rechte Hand hinter den Küchenblock senkte, die Hand, die ihm den Stinkefinger zeigte. Es war sein Ton, der mich am meisten ärgerte. Dieser Ton besagte, dass es absolut keinen Sinn hatte, mit Aiden zu diskutieren – weder jetzt noch jemals würde er seine Meinung ändern, und damit hatte ich mich abzufinden. Wie immer.
Bevor ich anfing, für den dreimaligen Defensive Player of the Year der National Football Organization zu arbeiten, hatte es nur zwei Dinge gegeben, die ich ungern tat: mich mit Leuten herumzustreiten und ihnen ein Nein ins Gesicht zu schleudern und meine Hand in den Häcksler für Küchenabfälle zu stecken.
Ich war zwar sowohl Köchin als auch Putzfrau des Hauses. Jetzt aber war etwas hinzugekommen, das ich aus tiefstem Herzen hasste: die Aufgabe, Leuten in allerletzter Minute abzusagen. Es nervte mich unsäglich und verstieß gegen meine Überzeugungen. Ich meine – ein Versprechen ist schließlich ein Versprechen, oder etwa nicht? Andererseits ließ nicht ich die Fans hängen, sondern Aiden.
Der verdammte Aiden, der soeben sorglos sein zweites Mittagessen in sich hineinschaufelte, blind gegenüber der Verzweiflung, die für mich das Gespräch mit seinem Agenten bedeutete. Nach all der Mühe, die uns die Planung gekostet hatte, musste ich ihm nun die frohe Botschaft überbringen, dass Aiden in dem Sportartikelgeschäft in San Antonio überhaupt nichts signieren würde.
Ich seufzte. Schuldgefühle plagten mich. Ich rieb mein steifes Knie mit der Hand, die gerade nicht damit beschäftigt war, meinem Frust Ausdruck zu verleihen. »Sie haben es aber versprochen …«
»Ist mir schnuppe, Vanessa.« Wieder warf er mir diesen Blick zu. Mein Mittelfinger zuckte. »Lassen Sie es von Rob absagen«, beharrte er und hob den Unterarm, um sich eine riesige Portion Quinoa-Salat in den Mund zu schaufeln. Die Gabel verharrte sekundenlang in der Luft, während er mir seinen dunklen, störrischen Blick zuwarf. »Ist das ein Problem für Sie?«
Vanessa, machen Sie dies. Vanessa, machen Sie das.
Sagen Sie ab. Sagen Sie Rob, er soll es absagen.
Bu-huu.
Ich hasste die Telefonate mit Aidens miesem Agenten ohnehin. Aber wenn es darum ging, einen Auftritt zwei Tage vorher abzusagen, würde Rob glatt den Verstand verlieren und seinen Frust an mir ablassen. Als besäße ich irgendeinen Einfluss auf Aiden »Die Mauer von Winnipeg« Graves! Ich hatte ihm nur einmal eine bestimmte Kamera empfehlen können, und das auch nur deshalb, weil Aiden »Besseres zu tun hatte, als sich mit Kameras zu befassen« und »weil ich Sie dafür bezahle«.
Damit hatte er natürlich irgendwie recht. Mit meinem Gehalt und dem, was Zac mir von Zeit zu Zeit zuschoss, konnte ich es mir leisten zu lächeln – wenn auch gequält – und zu tun, was man von mir verlangte. Hin und wieder knickste ich sogar, was Aiden geflissentlich übersah.
Ich fand nicht, dass er die enorme Geduld zu schätzen wusste, die ich in den letzten beiden Jahren mit ihm gehabt hatte. Jemand anders hätte ihn längst im Schlaf erstochen. Immerhin gedachte ich, es auf schmerzlose Weise zu tun, wenn ich etwas in der Richtung plante. Zumindest war das bisher so gewesen.
Aber jetzt dachte ich anders.
Seit Aiden direkt zu Beginn der letztjährigen Saison die Achillessehne gerissen war, hatte er sich stark verändert. Ich versuchte, ihm das nicht zum Vorwurf zu machen, ich gab mir wirklich alle Mühe. Es war auch wirklich schwer zu verpacken, dass er fast drei Monate der regulären Saison verpasst hatte und von seinem Team dafür verantwortlich gemacht wurde, dass sie es nicht in die Post Season, die Playoffs, geschafft hatten. Obendrein hatten einige Leute geglaubt, dass Aiden nach sechs Monaten Schonung und Reha kein volles Comeback hinlegen würde.
Aber im Unterschied zu anderen Sportlern, die sogar länger als ein halbes Jahr gebraucht hatten, um wieder auf die Beine zu kommen, hatte Aiden es geschafft. Doch in der Zeit, in der er an Krücken gehumpelt war und zu unzähligen Reha- und anderen Terminen hatte gefahren werden müssen, hatte er meine Geduld mehr als einmal auf eine harte Probe gestellt.
Es gibt eben nur ein gewisses Maß an Launenhaftigkeit, das man an einem Tag ertragen kann. Aiden liebte und lebte für den Football, und ich sagte mir immer wieder, dass er halt Angst davor hatte, nie wieder spielen zu können oder zumindest niemals wieder auf dem gleichen Level. Er sprach es zwar nie laut aus, ich verstand es aber dennoch. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich mir die Hände brechen und vielleicht nie mehr zeichnen könnte.
Trotzdem hatte Aidens Launenhaftigkeit ein Maß erreicht, das in der Geschichte des Universums einmalig war. Und das will einiges besagen, denn ich bin mit drei älteren Schwestern aufgewachsen, die gefühlt immer zur gleichen Zeit ihre Tage hatten. Ihretwegen kann ich die meisten Dinge – oder Leute – ganz gut ertragen. Denn ich weiß, was es heißt, gepiesackt zu werden, und Aiden überschritt nie die Grenze zur Gemeinheit. Er war nur manchmal so ein richtig bornierter Idiot.
Er hatte Glück, dass ich ein ganz kleines bisschen in ihn verknallt war, sonst hätte er schon vor langer Zeit die Quittung bekommen. Andererseits hatte jeder Mensch, der Augen im Kopf hatte und zufällig auf Männer stand, eine kleine Schwäche für Aiden Graves.
Wenn er die Brauen hochzog und mich durch den Vorhang seiner langen schwarzen Wimpern aus tiefbraunen Augen anschaute, musste ich schlucken und langsam den Kopf schütteln, während ich seine stattliche Erscheinung in mich aufnahm. Aiden, den ich nur in Gegenwart von Hunden je hatte lächeln sehen, war so groß wie ein Haus und hätte eigentlich die grob zugehauenen Züge eines Höhlenmenschen haben müssen, aber so sah er natürlich nicht aus. Auch gefiel es ihm, diesem Klischee mit aller Macht zu trotzen. Aiden war schlau, schnell, verfügte über eine ausgezeichnete Motorik und hatte – soweit ich wusste – in seinem Leben noch kein einziges Eishockeyspiel gesehen. Das kanadische »Jau« hatte er in meiner Gegenwart bis dato nur zweimal von sich gegeben, und er nahm niemals tierische Proteine zu sich. Der Mann aß schlicht keinen Bacon. Ihn höflich zu nennen wäre eine glatte Beleidigung, und er bat niemals um Entschuldigung.
Im Grunde war er eine Anomalie: ein Football spielender Kanadier, der sich ausschließlich pflanzlich ernährte – den Begriff Veganer lehnte er ab – und dabei derart wohlproportioniert und gut aussah, dass ich Gott bei wiederkehrenden Gelegenheiten für mein Augenlicht gedankt hatte.
»Was immer Sie möchten, Big Guy«, erwiderte ich mit einem falschen Lächeln und flatternden Wimpern, obwohl ich ihm immer noch den Stinkefinger zeigte.
»Sie werden’s schon überleben«, sagte Aiden lässig, ohne auf seinen Spitznamen zu reagieren. Er nahm seine immens muskulösen Schultern zurück, die, das schwöre ich, einem kleinen Menschen in Querlage Platz geboten hätten. »Ist doch keine große Sache.«
Keine große Sache? Das würden die Veranstalter allerdings anders sehen und sein Agent erst recht, aber Aiden war es ja gewohnt, seinen Willen zu bekommen. Ihm kam niemand mit einem »Nein«. Mir wurde dieses Wörtchen zugeschanzt, und dann musste ich mir überlegen, wie ich den Schlamassel abwenden konnte.
Entgegen der Ansicht so mancher Leute war der Außenverteidiger der Three Hundreds, dem Profiliga-Team von Dallas, nicht wirklich ein Ekelpaket oder schwierig im Umgang. Obwohl Aiden oft eine mürrische Miene machte oder murrte, schimpfte er nie und verlor niemals ohne guten Grund die Beherrschung. Er war anspruchsvoll und wusste genau, was er wollte, plante jeden Tag seines Lebens. Eigentlich eine bewundernswerte Eigenschaft, aber andererseits blieb es an mir hängen, seine zahlreichen Forderungen zu erfüllen.
Nur noch ein Weilchen, sagte ich mir. Ich stand so kurz vor der Kündigung, dass ich sie förmlich in den Knochen spürte. Der Gedanke ließ mich wieder ein wenig aufleben.
Vor zwei Monaten hatte mein Bankkonto endlich ein bequemes Guthaben aufgewiesen: dank meiner Willenskraft, eiserner Sparsamkeit und vieler, vieler Überstunden, die ich nicht als Aidens Assistentin, Haushälterin und Köchin geleistet hatte. Ich hatte mein Ziel erreicht: ein ganzes Jahresgehalt gespart. Endlich. Halleluja. Ich roch sozusagen schon die Freiheit.
Dummerweise hatte ich Aiden noch nichts von meiner Kündigung gesagt.
»Warum machen Sie so ein Gesicht?«, fragte er plötzlich.
Ich starrte ihn verblüfft an, zog die Brauen hoch, versuchte, mich dumm zu stellen. »Was für ein Gesicht?«
Netter Versuch.
Während ihm die Gabel noch im Mund hing, kniff er die Augen ein ganz kleines bisschen zusammen. »Das da.« Er ruckte mit dem Kinn in meine Richtung.
Ich zuckte mit den Schultern, als wüsste ich nicht, was er meinte. »Gibt es etwas, das Sie mir sagen wollen?«
Es gab hundert Dinge, die ich ihm regelmäßig sagen wollte, aber ich kannte Aiden zu gut. Es kümmerte ihn nicht wirklich, ob ich ihm etwas zu sagen hatte oder nicht. Es kümmerte ihn nicht, ob ich anderer Meinung war oder glaubte, er sollte etwas anders machen. Er erinnerte mich nur schlicht daran, wer hier der Boss war.
Nämlich nicht ich.
Arschgeige.
»Ich?«, fragte ich verblüfft. »Aber nein.«
Aiden blitzte mich kurz an, bevor er den Blick auf meine Hand senkte, die ich hinter der Kücheninsel verborgen hielt. »Dann hören Sie auf, mir den Stinkefinger zu zeigen. Ich werde mir das mit dem Signieren nicht anders überlegen.«
Ich biss mir auf die Lippen, während ich die Hand sinken ließ. Er war ein gottverdammter Hexenmeister. Ich schwör’s bei meinem Leben, er war ein Hexenmeister. Ein Zauberer. Ein Hellseher. Ein Mensch mit dem Zweiten Gesicht. Jedes Mal, wenn ich ihm heimlich den Stinkefinger gezeigt hatte, hatte er es gewusst. Und ich hatte nicht geahnt, dass ich so leicht zu durchschauen war.
Ich zeigte ihm den Stinkefinger ja nicht zum Spaß. Denn es bereitete mir ernsthafte Sorgen, dass Aiden einen Auftritt ohne hinreichenden Grund absagte. Dass er sich anders besonnen und sein Nachmittagstraining nicht ausfallen lassen wollte, schien mir als Begründung nicht auszureichen. Aber was wusste ich denn schon?
»Na schön«, brummelte ich.
Aiden, der bestimmt nicht einmal wusste, wie alt ich in diesem Jahr geworden war oder wann ich Geburtstag hatte, verzog für einen Sekundenbruchteil das Gesicht. Seine dichten schwarzen Brauen zogen sich zusammen, und seine Mundwinkel senkten sich. Dann zog er die Schultern hoch, als wäre ihm die Sache mit dem Stinkefinger plötzlich egal.
Das Lustige daran war: Wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, dass ich einmal für jemanden die Drecksarbeit machen würde, hätte ich ihn ausgelacht. Mir wollte keine Zeit in meinem Leben einfallen, in der ich keine Ziele oder Zukunftspläne gehabt hätte. Ich musste immer etwas haben, nach dem ich streben konnte, und mein eigener Boss zu sein gehörte dazu.
Das wusste ich, seit ich im Alter von sechzehn Jahren bei meinem ersten Ferienjob in einem Kino angebrüllt worden war, weil ich nicht genug Eis in den Becher gefüllt hatte. Ich lasse mir nicht gern etwas vorschreiben. Das war schon immer so. Ich war eigensinnig und stur; zumindest mein Pflegevater behauptete, dass dies mein hervorstechendster und schlimmster Charakterzug sei.
Ich wollte ja nicht nach den Sternen greifen oder Milliardärin werden. Auch keine Berühmtheit oder etwas in der Art. Ich wollte nur meine eigene kleine Firma haben, wollte mit Grafikdesign-Aufträgen genug verdienen, um meine Rechnungen zu bezahlen, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und trotzdem noch ein wenig Geld für schöne Dinge übrig zu haben. Ich wollte nicht von der Großzügigkeit oder den Launen anderer abhängig sein. Das hatte ich als Kind lange genug mitgemacht, wenn ich darauf hoffte, dass meine Mutter nüchtern nach Hause kam, dass meine Schwestern mir, solange Mom abwesend war, etwas kochen würden, und schließlich darauf, dass die Dame vom Sozialamt wenigstens dafür sorgte, dass ich nicht von meinem kleinen Bruder getrennt wurde … Warum dachte ich überhaupt jetzt daran?
Meistens hatte ich gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen wollte, also hatte ich naiverweise angenommen, der halbe Kampf sei schon so gut wie ausgestanden. Meinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen konnte doch nicht so schwer sein.
Aber niemand sagt dir, dass der Weg zur Erreichung deiner Ziele kein gerader ist, sondern eher eine Art Maislabyrinth. Du hältst an, du gehst voran, du weichst zurück und biegst einige Male falsch ab, aber das Wichtigste ist, dass du immer daran denkst, dass es einen Ausgang gibt. Irgendwo.
Und du kannst nie aufhören, ihn zu suchen.
Und ganz besonders dann nicht, wenn es einfacher und weniger aufreibend wäre, sich mit der Menge treiben zu lassen, anstatt deinen ganz eigenen Weg zu erkämpfen.
Aiden schob den Stuhl zurück, auf dem er gesessen hatte, und stand mit dem leeren Glas in der Hand auf. Seine Gestalt ließ die keineswegs kleine Küche wie eine Puppenstube wirken … und er hielt sich fast ständig in ihr auf. Was nicht überraschend war, denn er futterte beinahe ständig etwas; er nahm am Tag mehr als doppelt so viele Kalorien wie andere Menschen zu sich. Während der regulären Spielsaison locker drei Mal so viel. Wo sollte er die bekommen, wenn nicht in der Küche? Und ebenso oft hielt ich mich dort auf – denn ich bereitete ja seine Mahlzeiten zu.
»Haben Sie Birnen gekauft?«, fragte er und schob damit mühelos unser ursprüngliches Gesprächsthema und den Stinkefinger-Vorfall beiseite, während er sein Glas aus dem Wasserfilter des Kühlschranks auffüllte.
Ich hatte nicht die geringsten Gewissensbisse wegen meines Stinkefingers. Als es mir zum ersten Mal passiert war, hatte ich geglaubt, ich müsste vor Beschämung sterben, bevor ich gefeuert wurde, doch inzwischen kannte ich Aiden. Ihm war es schnurzegal, ob ich es tat oder nicht, zumindest war das mein Eindruck, da ich meinen Job immer noch hatte. Ich hatte erlebt, wie Leute Aiden zu reizen versuchten und mit Schimpfnamen belegten, die sogar mich zusammenzucken ließen. Aber was tat Aiden, wenn er derart angegangen wurde? Er zuckte nicht mal mit der Wimper; er gab einfach vor, nichts gehört zu haben.
Ehrlich, so viel Rückgrat war schlicht beeindruckend. Ich zuckte ja schon zusammen, wenn mich ein anderer Autofahrer anhupte.
Doch so eindrucksvoll Aiden auch war, so oft ihm die Frauen auf den Hintern starrten und so dämlich es war, einen Job bei einem Mann hinzuschmeißen, der in Werbespots für eine Sportartikelfirma die Hauptrolle spielte – ich wollte kündigen. Mit jedem Tag wurde der Drang stärker.
Ich hatte mich verdammt angestrengt, und niemand hatte mir geholfen. Das war es, was ich wollte, was ich immer schon gewollt hatte: Seit Jahren behielt ich jegliche Chance im Blick, mein eigener Boss zu werden. Irgendwelche Blödmänner anzurufen, die mir das Gefühl gaben, lästig zu sein, oder Unterhosen zu falten, die den beeindruckendsten Hintern der Nation umhüllten, gehörte nicht dazu.
Sag es ihm, sag ihm jetzt gleich, dass du aufhören willst!, stachelte mich mein Verstand an.
Aber jene leise Stimme der Unentschlossenheit und des Selbstzweifels, die sich so gern in den Regionen aufhielt, wo mein nicht existentes Rückgrat sein sollte, antwortete wieder einmal: Wozu die Eile?
Als ich »Die Mauer von Winnipeg« zum ersten Mal sah, war seine zweite Frage: »Können Sie kochen?«
Er hatte mir weder die Hand geschüttelt noch mich gebeten, Platz zu nehmen oder Ähnliches. In der Rückschau hätte mir das eine Warnung sein sollen, wie sich unser Verhältnis gestalten würde.
Aiden hatte als Erstes nach meinem Namen gefragt, als er mir die Tür öffnete und mich geradewegs in eine schöne, topmoderne Küche in Offenbauweise führte. Dann hatte er umgehend nach meinen Kochkünsten gefragt.
Vor diesem Tag war ich schon zweimal von seinem Manager interviewt worden. Die Stelle lag einkommensmäßig im gewünschten Bereich, und etwas anderes war mir damals nicht wichtig gewesen. Die Arbeitsvermittlung, bei der ich gemeldet war, hatte mich auch dreimal herbeizitiert, um sicherzugehen, dass ich die passende Assistentin für eine »Berühmtheit« war, wie sie ihn nannten.
Mein Bachelorabschluss, eine breite Palette an Jobs, wie zum Beispiel Sekretärin bei einem Scheidungsanwalt (drei Jahre während meiner Collegezeit), Sommerjobs als Fotografin und ein ziemlich lukratives Nebeneinkommen als Kosmetik- und Katalogverkäuferin, dazu exzellente Referenzen, hatten mir den Rückruf der Vermittlung eingebracht.
Ich war mir allerdings ziemlich sicher, dass all dies nicht der eigentliche Grund für meine Einstellung war, sondern meine absolute Ahnungslosigkeit in Sachen Football. Falls im Fernsehen ein Spiel kam, standen die Chancen gut, dass ich ihm nicht die geringste Aufmerksamkeit schenkte. Vor meinem ersten Arbeitstag war mir Aiden Graves kein Begriff gewesen. Die einzigen Spiele, die ich je verfolgt hatte, waren jene der Mannschaft meiner Highschool gewesen.
Als sein Manager also den Namen meines potenziellen Arbeitgebers erwähnte, hatte ich ihn nur verständnislos angestarrt. Ich werde nie mit Sicherheit wissen, ob es meine mangelnde Begeisterung war, die mir die Stelle sicherte, aber ich glaube schon.
Selbst nachdem sein Manager mir den Job angeboten hatte, hatte ich mich nicht über Aiden informiert. Wozu auch? Nichts, was im Internet stand, hätte mich davon abgehalten, seine Assistentin zu werden. Wirklich gar nichts. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich bei gutem Gehalt sogar einen Job bei einem Massenmörder angenommen hätte.
Am Ende stellte sich heraus, dass ich gut daran getan hatte, Aiden nicht in die Suchmaschine einzugeben. Wie ich später feststellen sollte, als ich fleißig Promo-Bilder an seine Fans schickte, wurden ihm Fotos überhaupt nicht gerecht.
Mit gut einem Meter vierundneunzig und einem Gewicht, das in der spielfreien Zeit auf hundertfünfundzwanzig Kilo steigen konnte, mit einer Präsenz, die eher einem Sagenhelden als einem normalen Sterblichen glich, war Aiden das reinste Tier, auch in bekleidetem Zustand. Er hatte keine kosmetischen Vorzeigemuskeln, sondern war einfach nur groß. Überall. Ich hätte nicht gestaunt, wenn seine Knochen beim Röntgen eine größere Dichte als die normaler Menschen aufgewiesen hätten. Seine Muskeln waren zu dem einzigen Zweck geschliffen und gemeißelt worden, um so effektiv wie möglich Pässe zu blocken und gegnerische Quarterbacks zu tacklen.
Sein T-Shirt konnte bei unserer ersten Begegnung weder die Masse seines Trapezius, seiner Brust- und Deltamuskeln noch seine Bi- und Trizepse verbergen. Der Kerl war einfach muskelbepackt. Seine Oberschenkel dehnten seine Sweatpants. Ich weiß noch, dass seine Fäuste mich an Ziegelsteine erinnerten und dass seine Handgelenke die größten waren, die ich je gesehen hatte.
Dann war da das Gesicht, das ich in den nächsten Jahren meines Lebens täglich anschauen würde. Im Gegensatz zu den grob behauenen Zügen vieler Hünen war Aiden auf eine Art gut aussehend, die es mit jedem Männermodel aufnehmen konnte. Seine Züge waren eher fein, und die Wangenknochen traten deutlich hervor, ebenso der Kiefer. Seine tief liegenden Augen wurden von dichten schwarzen Wimpern beschattet. Kurzes, gestutztes Barthaar, das immer nach Dreitagebart aussah, auch wenn er sich gerade erst rasiert hatte, bedeckte die untere Hälfte seines Gesichts.
Eine weiße Narbe am Haaransatz, die von der Schläfe bis hinters Ohr reichte, war das Einzige, was die kurzen Stoppeln nicht verbergen konnten. Dann war da der Mund, der bei jedem anderen Mann wie ein Schmollmund gewirkt hätte – bei einem kleineren Mann, der nicht so oft finster dreinschaute. Aiden hatte braune Haare und eine olivfarbene Haut. Eine dünne Goldkette hatte unter dem Hemdkragen aufgeblitzt, aber ich war damals so abgelenkt gewesen von allem anderen, was Aiden Graves ausmachte, dass ich erst Monate später erfuhr, es handele sich um ein Medaillon des heiligen Lukas, das er stets und ständig trug.
Allein seine Größe hatte ausgereicht, um mich von vornherein einzuschüchtern. Sein stechender brauner Blick verstärkte nur den Eindruck von Bedrohung, der permanent von ihm auszugehen schien.
Deshalb war mein erster Gedanke gewesen: Holy Shit. Doch dann hatte ich ihn beiseitegeschoben, denn es geht nicht an, so etwas über seinen neuen Boss zu denken.
An jenem ersten Tag, bei unserer ersten Begegnung, hatte ich lediglich wiederholt nicken können. Denn ich war mit der Überzeugung angetreten, alles Menschenmögliche zu tun, um den Job zu ergattern. Aidens Manager und die Arbeitsvermittlung hatten schon während der Vorstellungsgespräche darauf hingewiesen, dass Kochen zum Job gehörte, was für mich kein Problem darstellte. Als Kind hatte ich auf die harte Tour lernen müssen, dass ich mich, wenn ich Hunger hatte, gefälligst selbst darum kümmern musste, denn auf meine älteren Schwestern war in dieser Hinsicht kein Verlass, und auch bei Mom konnte man nie wissen. Später, auf dem College, hatte ich die Kunst des Kochens mittels einer eingeschmuggelten Kochplatte im Schlafsaal vervollkommnet.
Aiden hatte mich bloß angestarrt. Dann hatte er die Bombe gelegt, auf die mich niemand vorbereitet hatte. »Ich esse keine tierischen Produkte. Ist das ein Problem?«
Kannte ich irgendwelche Rezepte, die ohne Eier, Fleisch oder Käse auskamen? Nicht, dass ich wüsste. Niemand hatte diese Bedingung erwähnt – und in meiner Ignoranz beschloss ich, dass Aiden durchaus nicht wie ein Veganer aussah –, aber ich wollte auf keinen Fall zu meinen drei Simultan-Jobs zurückkehren. Also log ich, was das Zeug hielt. »Nein, Sir.«
Er hatte vor mir in der Küche gestanden und auf mich herabgeschaut, wie ich da stand in meiner dunkelblauen Chinohose und meiner hochgeschlossenen weißen Bluse und auf meinen braunen High Heels balancierte. Ich war so nervös gewesen, dass ich sogar die Hände faltete. Die Vermittlung hatte leicht gemäßigte Businesskleidung für den Job vorgeschlagen, und so hatte ich mir die größte Mühe gegeben. »Sind Sie sicher?«, hakte er nach.
Ich hatte genickt, weil ich bereits plante, auf meinem Smartphone nach Rezepten zu suchen.
Er hatte leicht zweifelnd dreingeschaut, mich aber nicht auf meine offenkundige Lüge hingewiesen, und das war mehr als ich zu hoffen gewagt hatte. »Ich koche nicht gern und gehe auch nicht gern essen. Ich esse vier Mahlzeiten am Tag und trinke außerdem zwei große Smoothies. Sie werden sich um die Mahlzeiten kümmern – und ich um das, was ich zwischendurch esse«, verkündete er, während er die Arme vor einer Brust verschränkte, die locker einen Meter zwanzig breit war.
»Auf dem Computer im oberen Stock sind meine sämtlichen Passwörter gespeichert. Sie müssen alle meine E-Mails lesen und beantworten. Mein Postfach muss mehrmals die Woche geleert werden; der Schlüssel dazu liegt in der Schublade neben dem Kühlschrank. Ich schreibe Ihnen später noch Filiale und Postfachnummer auf. Wenn ich zurückkehre, können Sie sich einen Nachschlüssel vom Haus machen lassen. Die Seiten meiner sozialen Netzwerke müssen täglich upgedatet werden. Es ist mir egal, was Sie posten, solange es nur einigermaßen vernünftig ist.«
Er hatte mir bei seiner letzten Bemerkung forschend in die Augen gesehen. Aber ich hatte sie nicht persönlich genommen.
»Die Wäsche, der Terminkalender …« Er fuhr fort, weitere Pflichten aufzuzählen, die ich in meinem Hirn verstaute. »Ich habe einen Mitbewohner. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Wenn Sie sich dem gewachsen fühlen, können Sie auch ihm hin und wieder etwas zu essen zubereiten. Er gibt Ihnen eine kleine Zulage, wenn Sie es machen.«
Ein Extra? Zu einer kleinen Zulage hatte ich noch nie Nein gesagt. Es sei denn, es handelte sich um einen Blowjob.
»Haben Sie noch Fragen?«
Ich hatte nur ein Kopfschütteln zustande bringen können. Alles, was er aufgezählt hatte, war in diesem Job üblich. Vielleicht verschlug mir aber schlicht seine Präsenz die Sprache. Ich hatte noch nie einen Profi-Footballer von Angesicht zu Angesicht erlebt, obwohl ich während der Collegezeit mit Mitgliedern der Mannschaft befreundet gewesen war. Damals hätte ich nicht geglaubt, dass es solche Hünen geben könnte. Vielleicht hatte ich mir aber auch nur den Kopf zerbrochen, wie viel Aiden täglich für die benötigte Kalorienzufuhr essen musste.
Sein Blick war über mein Gesicht und meine Schultern gewandert, bevor er mir wieder in die Augen gesehen hatte. Hart und unnachgiebig. »Sie reden nicht viel, wie?«
Ich hatte einfach nur gelächelt und eine Schulter hochgezogen. Ich rede tatsächlich nicht viel, aber man kann nicht sagen, dass ich schüchtern oder zu still wäre. Außerdem wollte ich mir die Aussicht auf den Job nicht vermasseln.
In der Rückschau würde ich sagen, dass der Eindruck, den ich vermittelte, nicht gerade der beste war, aber was soll’s? Ich konnte mein Verhalten ja nicht zurücknehmen und ganz von vorn anfangen.
Jedenfalls senkte mein neuer Boss Aiden am Ende des Gesprächs das Kinn. Später sollte ich herausfinden, dass dies seine Art des Nickens war. »Schön.«
In den letzten beiden Jahren hatte sich nur wenig verändert.
Unsere Arbeitsbeziehung hatte Fortschritte gemacht, indem ich aufhörte, Aiden mit »Sir« anzureden, und inzwischen über eine Kommunikation von zwei Worten hinausging.
Ich wusste alles, was ich über Aiden in Erfahrung bringen konnte, denn ihm eine persönliche Information zu entlocken war so mühselig wie Zähneziehen. Ich wusste, wie alt er war, wie viel Geld er auf dem Konto hatte, welche Gewürze ihm zuwider waren und welche Unterwäschemarke er bevorzugte. Ich kannte seine Lieblingsspeisen, seine Schuhgröße, die Farben, die er nicht tragen wollte, und sogar die Art Pornofilme, die er gern sah. Ich wusste auch, was er unbedingt haben wollte, wenn er einmal mehr Zeit haben würde: keine Familie. Aiden wollte einen Hund.
Aber all das hätte ein Stalker oder ein aufmerksamer Beobachter ebenso leicht herausfinden können. Aiden hielt die Details seines Lebens mit der ganzen Kraft seiner tellergroßen Hände fest. Ich ahnte schon, dass die Dinge, die ich nicht über ihn wusste, mich für den Rest meines Lebens beschäftigen würden, sollte ich versuchen, sie ihm zu entlocken.
Ich hatte mich um Freundlichkeit bemüht, sobald mir klar war, dass er mich nicht auffressen würde, wenn ich Fragen stellte. Aber es war alles vergeblich gewesen. In den beiden Jahren war nie ein Lächeln zurückgekommen; jede Erkundigung nach seinem Befinden war unbeantwortet geblieben, und abgesehen von jenem berüchtigten Blick, bei dem sich mir die Nackenhaare aufstellten, gab es diesen Ton, diesen fast arroganten Ton, in den er zuweilen verfiel und der geradezu nach einer Tracht Prügel schrie … Aber von jemandem, der viel größer sein musste als ich.
Unsere Rollen als Boss und Angestellte traten mit jedem Tag deutlicher hervor. Ich kümmerte mich um ihn, so gut ich mich um einen Menschen kümmern konnte, den ich mindestens fünfmal pro Woche sah, der mich jedoch wie die Freundin einer lästigen kleinen Schwester behandelte. Zwei Jahre lang war es ganz in Ordnung gewesen, Pflichten zu erfüllen, die ich zwar nicht rasend toll fand, aber die Kocherei, die E-Mails und alles, was mit seinen Fans zu tun hatte, waren meine Lieblingsbeschäftigungen als Aidens Assistentin.
Und das war der halbe Grund, warum ich mir immer wieder ausredete, meine Kündigung einzureichen: weil ich immer wieder seinen Facebook- oder Twitter-Account öffnete und ein Posting eines Fans sah, das mich zum Lachen brachte. Über das Internet hatte ich im Laufe der Jahre einige von ihnen kennengelernt, und so war es leicht, mich zu ermahnen, dass die Arbeit für Aiden so übel ja gar nicht war.
Es war nicht der schlechteste Job der Welt – nicht einmal annähernd. Das Gehalt war mehr als okay, die Arbeitsstunden waren in Ordnung … und nach den Worten jeder Frau, die zufällig herausfand, für wen ich arbeitete, hatte ich »den heißesten Boss der Welt«. Das war nicht zu leugnen. Wenn ich schon dauernd einen Menschen anstarren musste, dann durfte es ruhig jemand mit einem Körper und einem Gesicht sein, der sämtliche Models in den Schatten stellte, deren Konterfeis ich auf die Buchcover anderer Leute brachte.
Aber es gibt Dinge im Leben, die du nicht erreichst, wenn du nicht deine Komfortzone verlässt und ein Risiko eingehst, und was ich erreichen wollte, war, für mich selbst zu arbeiten.
Andererseits hatte ich Angst davor. Deshalb hatte ich es noch nicht durchgezogen und »Sayonara, Big Boy« zu Aiden gesagt, obwohl es mir schon mindestens achtzig Mal durch den Kopf gegangen war.
Ich war nervös. Einen gut bezahlten Job aufzugeben – und einen sicheren dazu, zumindest solange Aidens Laufbahn andauerte – machte mir Angst. Aber diese Entschuldigung klang allmählich lahm.
Aiden und ich waren ja keine Freunde, wir waren nicht einmal besonders vertraut miteinander. Wie denn auch? Dieser Mann hatte vermutlich nicht mehr als drei Menschen, mit denen er außerhalb des Trainings und der Spiele Zeit verbrachte. Urlaub? Nahm er nicht. Ich glaube, er wusste nicht einmal, was das war.
Es gab kein einziges Foto von Familie oder Freunden im Haus. Sein ganzes Leben drehte sich um Football. Das Zentrum seines Universums.
Im großen Plan von Aiden Graves’ Leben war ich ein Niemand. Wir fanden uns irgendwie miteinander ab. Offenkundig. Er brauchte eine Assistentin, ich brauchte einen Job. Aiden sagte mir, was er erledigt haben wollte, und ich erledigte es, ob es mir passte oder nicht. Hin und wieder versuchte ich vergebens, ihn umzustimmen, behielt dabei aber stets im Hinterkopf, wie wenig er auf meine Meinung gab.
Du kannst nur eine gewisse Zeit lang freundlich zu einem Menschen sein, und wenn dieser dich ständig mit Gleichgültigkeit straft, gibst du irgendwann auf. Das hier war schließlich ein Job und mehr nicht. Ich arbeitete nur deshalb so schwer, um eines Tages mein eigener Boss sein zu können und mit Menschen zu arbeiten, die meinen Einsatz zu schätzen wussten.
Und dennoch war ich nach wie vor hier, erledigte Aufträge, die mich wahnsinnig machten, und verschob meine Träume immer wieder in die Zukunft, Tag um Tag um Tag …
Was zum Teufel tat ich mir selbst an?
»Der Einzige, den du hier bescheißt, bist du selbst«, hatte Diana mir bei unserem letzten Treffen gesagt. Sie hatte gefragt, ob ich Aiden endlich gesagt hatte, dass ich aufhören wollte, und ich hatte ihr wahrheitsgemäß geantwortet: »Nein, noch nicht.«
Ihre Bemerkung hatte schwer an mir genagt. Der Einzige, dem ich schadete, war ich selbst. Ich wusste, dass ich es Aiden sagen musste. Das würde mir niemand abnehmen, natürlich nicht. Aber …
Okay, es gab kein »Aber«. Was, wenn ich den Karren an die Wand fuhr, sobald ich auf eigenen Füßen stand?
Ich hatte doch alles genau geplant und meine Firma im Kopf aufgebaut, damit dieser Fall nicht eintreten sollte. Ich wusste, was ich tat. Ich hatte genug Geld gespart. Ich war eine gute Grafikdesignerin und liebte es zu zeichnen.
Es würde gut gehen.
Es würde gut gehen.
Worauf wartete ich noch? Jedes Mal, wenn ich es Aiden sagen wollte, schien nicht der passende Moment zu sein. Als er nach seiner Verletzung endlich wieder trainieren durfte, wollte ich ihn nicht zusätzlich belasten. Ich hätte das Gefühl gehabt, ihn im Stich zu lassen, nachdem er gerade wieder auf die Beine gekommen war. Danach waren wir nach Colorado aufgebrochen, wo er in Frieden und Ruhe trainieren sollte. Bei einer anderen Gelegenheit war gerade Wochenanfang gewesen. Oder Aiden hatte einen schlechten Tag gehabt. Oder … was auch immer. Irgendeinen Grund gab es jedes Mal.
Ich blieb ja nicht, weil ich in ihn verliebt war oder so. Vielleicht war ich irgendwann, kurz nachdem ich die Stelle angetreten hatte, heftig in ihn verknallt gewesen. Aber seine kühle Haltung hatte erfolgreich verhindert, dass mein Herz sich zu Verrücktheiten verstieg. Nie hätte ich erwartet, dass Aiden mich anschaute und plötzlich erkannte, dass ich der erstaunlichste Mensch in seinem Leben war. Für derart unrealistischen Mist hatte ich keine Zeit. Nein, mein Ziel hatte stets darin bestanden, die mir gestellten Aufgaben zu erfüllen … und vielleicht den Mann, der nie lächelte, zum Lächeln zu bringen. Natürlich hatte ich nur mit Ersterem Erfolg gehabt.
Mit der Zeit war seine Anziehung schwächer geworden, sodass das Einzige, wonach ich mich sehnte – korrigiere: was ich in einer gesunden Weise zu schätzen wusste –, seine Arbeitsmoral war.
Und sein Gesicht.
Und sein Körper.
Aber es gibt viele Männer auf der Welt mit einem faszinierenden Gesicht und einem tollen Body. Gerade ich sollte das wissen, da ich beinahe täglich Fotos von Models bearbeitete.
Und körperliche Vorzüge brachten mich in keiner Weise vorwärts. Heiße Typen würden mir nicht dabei helfen, meine Träume zu verwirklichen.
Ich schluckte schwer und ballte die Hände zu Fäusten.
Sag es!, befahl mein Kopf.
Was wäre denn das Schlimmste, was mir passieren konnte? Dass ich mir einen anderen Job suchen musste, falls mich meine Kunden im Stich ließen? Wie schrecklich. Wie sollte ich wissen, was geschehen konnte, wenn ich es gar nicht erst versuchte?
Das Leben ist ein Wagnis. Und ich hatte es stets so gewollt.
Also holte ich tief Luft, fasste den Mann, der seit zwei Jahren mein Boss war, ins Auge und sprach es aus. »Aiden, ich habe Ihnen etwas zu sagen.«
Denn mal ehrlich, was wollte er denn dagegen unternehmen? Mir erklären, dass ich nicht kündigen konnte?
2
»Das können Sie nicht.«
»Doch«, beharrte ich vollkommen gefasst, während ich den Mann auf dem Monitor fest anschaute. »Aiden hat gesagt, ich soll es Ihnen ausrichten.«
Trevors Blick sprach Bände. Er glaubte mir nicht einmal ansatzweise. Ich aber merkte, dass es mir verdammt egal war, was er glaubte. Obwohl schon so einiges zusammenkommen muss, damit ich einen Menschen nicht leiden kann, gehörte Aidens Manager zu den Leuten, die ich nach Möglichkeit mied wie die Pest. Jedes Mal, wenn wir miteinander zu tun hatten, wollte ich den Kontakt am liebsten sofort abbrechen. Einmal hatte ich wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, warum ich ihn nicht ausstehen konnte, doch die Gründe waren immer die gleichen: Trevor war ein Snob und sonderte jede Menge Arschloch-Vibes ab.
Jetzt beugte er sich vor und stützte die Ellenbogen auf seinen Schreibtisch, wie ich annahm. Er formte mit seinen Händen ein Zelt, hinter dem er den Mund verbarg. Atmete hörbar aus. Dann ein.
Vielleicht, nur vielleicht bedauerte er all jene Gelegenheiten, bei denen er sich mir gegenüber wie ein Oberarsch verhalten hatte – zum Beispiel die vielen Male, wo er mich zusammengestaucht oder angebrüllt hatte, weil Aiden etwas getan haben wollte, das ihn zur Verzweiflung brachte. Das war seit meiner Einstellung so ungefähr jede Woche ein Mal vorgekommen.
Aber wie ich Trevor kannte, war das nicht der Fall. Etwas zu bedauern heißt zunächst mal, dass du Anteil daran genommen hast, und Trevor … ihn kümmerte nichts anderes als sein Gehaltsscheck. Seine Körpersprache und die Art, wie er schon beim Einstellungsgespräch mit mir geredet hatte, machten überdeutlich klar, dass ich auf seiner Prioritätenliste ganz unten rangierte.
Meine Kündigung würde ihm das Leben für eine kurze Weile ein wenig schwerer machen, und das war’s, was er nicht vertrug.
Offensichtlich war er aber betroffener, als Aiden am Vorabend gewesen war, nachdem ich mich zusammengerissen und ihm das dunkle Geheimnis mitgeteilt hatte, das ich bislang verschwiegen hatte.
»Ich möchte Ihnen für alles danken, was Sie für mich getan haben« – in der Rückschau war das ganz nett geschleimt von mir, denn Aiden hatte für mich nicht mehr getan, als mir ein fürstliches Gehalt zu zahlen, aber sei’s drum – »und es wäre mir sehr lieb, wenn Sie einen Ersatz für mich fänden.«
Obwohl ich stets gewusst und akzeptiert hatte, dass wir keine Freunde waren, war ein kleiner Teil von mir doch töricht genug gewesen zu glauben, ich würde ihm wenigstens ein klein wenig bedeuten. Ich hatte eine Menge für Aiden getan. Ich zumindest würde die Vertrautheit in diesem Job ein bisschen vermissen. Er nicht?
Die Antwort auf diese Frage war ein großes, fettes Nein.
Aiden hatte mich nach meinem Geständnis nicht einmal angeschaut, sondern seine Aufmerksamkeit immer noch auf die Schüssel vor ihm gerichtet, während er ungerührt gesagt hatte: »Geben Sie Trevor Bescheid!«
Und das war’s.
Zwei Jahre. Ich hatte ihm zwei Jahre meines Lebens geopfert. Stunden um Stunden. Hatte monatelang keinen meiner Liebsten gesehen. Ich hatte ihn gepflegt, wenn er krank gewesen war. Ich war diejenige, die nach seiner Verletzung bei ihm im Krankenhaus geblieben war. Ich hatte ihn nach der Operation abgeholt, mich über Entzündungen kundig gemacht und darüber, welche Nahrung nun angebracht war, damit seine Sehne schneller ausheilte.
Wenn Aiden ein Spiel verloren hatte, bereitete ich ihm am Morgen danach sein Lieblingsfrühstück zu. Ich hatte ihm ein Geburtstagsgeschenk gekauft, das ich vielleicht oder vielleicht auch nicht auf sein Bett gelegt hatte, denn es sollte nicht peinlich wirken. Wenn man weiß, dass jemand Geburtstag hat, dann schenkt man ihm was – auch wenn man dafür niemals ein Dankeschön erhält.
Und was hat er mir im Gegenzug gegeben? Meinen letzten Geburtstag hatte ich im Dauerregen in einem Park in Colorado verbracht, weil Aiden einen Werbespot drehte und mich dabeihaben wollte. Ich hatte allein in meinem Hotelzimmer zu Abend gegessen. Was erwartete ich denn von ihm?
Aiden hatte mich keinesfalls gebeten, bei ihm zu bleiben – was ich ja auch nicht vorhatte –, oder so etwas gesagt wie: »Tut mir leid, das zu hören«, wie ich es bei jedem früheren Arbeitgeber erlebt hatte.
Nichts. Kein Kommentar. Nicht einmal ein verfluchtes Schulterzucken.
Das hatte wehgetan, und zwar mehr, als es sollte. Sehr viel mehr. Ich hatte schon vorher gewusst, dass wir nicht unbedingt Seelengefährten waren, doch danach war es sonnenklar.
Mit diesem Gedanken, mit diesem bitteren Gefühl, dass ich offensichtlich so leicht zu ersetzen war, schluckte ich und wandte mich wieder dem Video-Chat zu.
»Vanessa, überlegen Sie sich das noch einmal«, beschwor mich Aidens Manager.
»Habe ich schon. Ich hör ja nicht in zwei Wochen auf. Finden Sie einfach jemanden. Ich arbeite ihn oder sie ein, und dann gehe ich.«
Trevor hob das Kinn und starrte geradeaus in die Bildschirmkamera. Die Sonne spiegelte sich in seinem Haargel oder was immer das war. »Ist das ein Aprilscherz?«
»Wir haben Juni«, sagte ich behutsam. Idiot. »Ich will hier nicht mehr arbeiten.«
Er legte die Stirn in Falten und zog gleichzeitig die Schultern auf eine Art und Weise hoch, als hätten ihn meine Worte endlich erreicht. Ein Auge spähte mich über die verschränkten Finger hinweg an. »Wollen Sie mehr Geld?«, fragte er.
Natürlich wollte ich mehr Geld. Wer nicht? Nur wollte ich es nicht gerade von Aiden. »Nein.«
»Sagen Sie mir, was Sie brauchen.«
»Nichts.«
»Ich versuche hier, mit Ihnen zu verhandeln.«
»Da gibt es nichts zu verhandeln. Nichts, was Sie mir anbieten, könnte mich zum Bleiben veranlassen.« So groß war meine Entschlossenheit, mich nicht mehr in Aiden Graves’ Welt hineinziehen zu lassen. Trevor wurde dafür bezahlt, Dinge Wirklichkeit werden zu lassen, und wenn ich ihm den kleinen Finger reichte, würde er versuchen, die ganze Hand zu nehmen. Vermutlich war es leichter für ihn, mich vom Bleiben zu überzeugen, als jemand anders zu finden. Aber ich kannte seine Tricks, und ich würde nicht auf sie hereinfallen.
Ich nahm das Wasserglas, das auf der Küchentheke neben meinem Tablet stand, trank einen Schluck und musterte Trevor über den Rand des Glases hinweg. Ich konnte es durchziehen, verdammt. Ich würde diesen Job nicht behalten, bloß weil mich Trevor mit treuherzigen Hundeaugen anschaute, sofern sein böses Naturell dies überhaupt zuließ.
»Was kann ich tun, damit Sie bleiben?«, fragte er schließlich und ließ die Hände sinken.
»Nichts.« Falls noch eine leise Ergebenheit gegenüber Aiden bestanden und mich zum Bleiben gezwungen hatte, seit ich begriffen hatte, dass ich mir die Kündigung leisten konnte, so hatte der gestrige Abend meinen Entschluss erhärtet.
Ich wollte nicht noch mehr Zeit verschwenden.
Wieder setzte Trevor diese gequälte Miene auf. Als wir uns vor zwei Jahren kennenlernten, hatte er nur wenige graue Haare gehabt, die sich strategisch über den ganzen Kopf verteilt hatten. Jetzt waren es bereits mehr geworden, und plötzlich verstand ich: Wenn ich mich schon als gute Fee sah, so musste Trevor sich wie ein Gott vorkommen – ein Gott, der aus dem ärgsten Schlamassel Wunder hervorzaubern konnte.
Und jetzt fungierte ich als Bremsklotz, indem ich die Arbeit bei einem Mann aufkündigte, der gewiss einer seiner schwierigsten Klienten war.
»Hat er etwas gesagt?«, wollte Trevor unvermittelt wissen. »Oder gemacht?«
Ich schüttelte den Kopf. Trevors Schmierentheater beeindruckte mich nicht im Geringsten. Ihm war doch alles piepegal. Bevor ich ihn gebeten hatte, mich anzurufen – und er stattdessen auf dem Video-Chat bestanden hatte –, hatte ich mich gefragt, ob ich den wahren Grund für meine Kündigung offenbaren sollte. Jetzt jedoch beschloss ich binnen Sekunden, dass ihn das einen feuchten Kehricht anginge. »Es gibt andere Ziele in meinem Leben, die ich verfolgen will. Das ist der Grund.«
»Sie wissen ja, dass er sich nach der Operation schlimme Sorgen wegen seines Comebacks macht. Wenn er also ein bisschen reizbar ist, dann ist das völlig normal. Übersehen Sie’s einfach«, empfahl Trevor.
Normal? Es gab sehr unterschiedliche Maßstäbe dessen, was man im Verkehr mit Profisportlern für »normal« halten konnte, besonders bei Sportlern wie Aiden, der nur für den Football lebte. Er nahm alles persönlich. Er war kein Junkie, der spielte, weil er nichts Besseres zu tun hatte und Geld verdienen wollte. Vielleicht hatte ich das besser verstanden als Trevor.
Außerdem: Wenn einer von uns beiden mehr unmittelbare Erfahrung mit dem Aiden nach dem Achillessehnenriss besaß, dann ich. Ich hatte alles unmittelbar aus erster Hand mitbekommen. Ich wusste, wie intensiv er sich auf das Trainingscamp vorbereitete, das bald wieder anstand. Trevor arbeitete zwar schon länger für Aiden, doch er wohnte in New York und schaute nur ein paar Mal im Jahr vorbei. Sie telefonierten allenfalls einmal im Monat, wenn überhaupt, denn ansonsten hatte Aiden ja mich als Prügelknaben.
»Ich bin sicher, dass es mindestens hundert Leute gibt, die mit Freuden für ihn arbeiten würden. Ich glaube wirklich nicht, dass Sie Probleme haben werden, einen Ersatz für mich zu finden. Es wird schon alles gut«, sagte ich geschmeidig.
Gab es nicht vielmehr tausend Leute auf der Welt, die mit Kusshand für Aiden Graves arbeiten würden? Ja. Mindestens.
Würde Trevor Probleme haben, einen neuen Assistenten für Aiden zu finden? Nein.
Das Problem war eher, jemanden zu finden, der oder die mit den langen Arbeitszeiten und Aidens dorniger Persönlichkeit zurechtkam.
»Es wird kein einfacher Job«, hatte Trevor damals gesagt, nachdem mich die Arbeitsvermittlung zu ihm geschickt hatte. »Sportler sind anspruchsvoll. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeitsauflagen. Kommen Sie damit klar?«
Damals hatte ich drei Jobs gehabt, mit Diana und Rodrigo in einem winzigen Häuschen gelebt und nachts manchmal nicht schlafen können, weil mich immerzu Albträume von dem gewaltigen Studiendarlehen heimsuchten, das ich zurückzahlen musste. Um aus dieser Lage herauszukommen, hätte ich fast alles getan, auch wenn es bedeutete, mit einem Menschen auszukommen, der nach Meinung mancher ein Verrückter war.
Obwohl Trevor nicht unbedingt gelogen hatte – so schlimm war Aiden gar nicht, wenn man erst mal heraushatte, wie er tickte –, hatte er mir immerhin eine Warnung zukommen lassen, was auf mich zukam.
Nämlich ein fordernder, launenhafter, perfektionistischer, arbeitssüchtiger, arroganter, distanzierter, von Sauberkeit besessener Boss.
Keine große Sache.
Aiden Graves brauchte eine persönliche Assistentin, und ich hatte das große Glück gehabt, den Job zu ergattern.
Zu jenem Zeitpunkt hatte ich einen Zukunftsplan, der mich zu Tode ängstigte, und ein Studiendarlehen, das mir Magenschmerzen bereitete. Ich dachte ungefähr eine Million Mal über mein Dilemma nach und kam zu dem Schluss, dass ich am besten vorwärtskommen würde, zumindest für eine Weile, indem ich für Aiden arbeitete, während ich gleichzeitig versuchte, meine eigene kleine Firma aufzuziehen.
Der Rest war Geschichte.
So viel wie möglich zu sparen und siebzig Stunden in der Woche zu arbeiten hatte sich schließlich bezahlt gemacht. Ich hatte genug Erspartes, um schuldenfrei zu bleiben, falls meine Firma vor sich hin dümpelte, und außerdem hatte ich Ziele, die mich leiteten. Wenn es hart auf hart kam, dann würden meine Sehnsüchte und die damit verbundenen Hoffnungen mich aufrechterhalten.
Doch um an diesen Punkt zu gelangen, hatte ich das getan, was er von mir verlangte – selbst in solchen Momenten, wenn ich hinter Aiden stand und mir vorstellte, ihm ein Messer in den Rücken zu jagen, weil er irgendetwas ganz Lächerliches von mir wollte: Ich musste nur an mein Studiendarlehen und meine Pläne denken, und schon blieb ich bei der Stange und erfüllte ihm selbst den dümmsten Wunsch (wie zum Beispiel, seine Laken noch einmal zu waschen, weil ich sie seiner Meinung nach zu lange in der Maschine gelassen hatte).
Bis jetzt.
»Sie machen mich fertig, Vanessa. Sie machen mich total fertig!« Trevor stöhnte buchstäblich. Stöhnte. Normalerweise meckerte und lamentierte er bloß.
»Wird schon schiefgehen. Ihm ist es wurscht, ob ich aufhöre. Wahrscheinlich wird er’s nicht einmal merken«, sagte ich so verständnisvoll wie möglich, während es mir im Grunde völlig gleichgültig war, ob Trevor vor Angst schwitzte.
Die Trauermiene verschwand wie weggewischt. Ich hatte recht gehabt: Alles war nur Show gewesen. Unter der wütenden Miene kam der wahre Trevor zum Vorschein. »Das möchte ich doch sehr bezweifeln«, schoss er aus dem Hinterhalt.
Ich wusste schon, warum ich gut für Aiden war. Ich war ziemlich geduldig und hielt ihm seine ruppige, anspruchsvolle Art nicht vor. Dank meiner Familie wusste ich, wie ich mit Verrücktheit in all ihren Ausprägungen umzugehen hatte, aber vielleicht hatte ich von Aiden anfänglich auch viel Schlimmeres erwartet, und er hatte sich eben im Zaum gehalten.
Jedenfalls würde ich mich nach dem gestrigen Abend nicht mehr im Zaum halten. Vielleicht würde ich meinen Entschluss bedauern, wenn Aiden sich freundschaftlich verhalten oder Trevor wenigstens einmal nett gewesen wäre, aber in zwei Monaten würde doch keiner der beiden überhaupt noch wissen, wer ich war. Ich wusste, wer mich gern hatte und wer mir etwas bedeutete, und auf meiner Liste standen die beiden auch nicht besonders weit oben … was ich natürlich doch ein wenig bedauerte. Aber – nur die Stärksten überleben, nicht wahr?
Sowohl Aiden als auch Trevor würden mich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, wenn die Rollen anders verteilt wären. Ich hatte mich von fehlgeleiteter Loyalität, von Paranoia und Selbstzweifeln dazu verleiten lassen, in meinem gar nicht so unkomfortablen Gefängnis zu bleiben.
Alles, was Aiden brauchte, war jemand, der tat, was er wollte. Kochen, putzen, waschen, Wäsche falten, E-Mails beantworten, Trevor oder Rob anrufen, wenn es um Dinge außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs ging, und auf Facebook, Twitter und Instagram posten. Dann gab es noch die Dinge, die während einer Reise zu erledigen waren. Es war ja nichts Verrücktes dabei.
Jeder mit ein bisschen Geduld konnte das.
Doch Trevors stechender Blick verriet mir, dass er durchaus anderer Meinung war. Hauptsächlich wahrscheinlich wegen seiner Faulheit. Er stieß vernehmlich den Atem aus und fing an, sich die Schläfen zu massieren. In diesem Moment führte das Programm eine Zwischenspeicherung durch, und das Bild wurde kurz unscharf. »Sind Sie wirklich sicher, dass Sie das tun wollen? Ich kann mit ihm über eine Reduzierung Ihrer Arbeitsstunden reden …« Seine Stimme drang vernehmlich aus dem Lautsprecher, obwohl das Bild einfror.
Ich konnte mich gerade noch davon abhalten, Trevor um Bedenkzeit zu bitten. »Nein.« Es ging einfach nicht. Ich wollte diese Gelegenheit, endlich unabhängig zu werden, nicht halbherzig verspielen. Ich wollte nicht das Versagen in mein Haus einladen, indem ich zögerte.
»Vanessa …«, stöhnte er. »Ist das wirklich Ihre Absicht?«
Ja, das war sie, denn ich hatte darauf hingearbeitet seit dem Augenblick, als ich das College mit einem Bachelor in Grafikdesign verlassen hatte. Der Weg bis zur Prüfung war ein schwerer Kampf gewesen, der manchmal geradezu in Quälerei ausgeartet war, und ich hatte verwerfliche Dinge getan, um meine Ausbildung beenden zu können. Deshalb hatte ich mehrere Jobs gleichzeitig gehabt, deshalb hatte ich jetzt offiziell bloß zwei, und deshalb hatte ich in den letzten vier Jahren nie mehr als vier Stunden am Stück geschlafen und hart am Existenzminimum gelebt. Ich hatte fast jeden Auftrag angenommen, der über meine Mailbox und andere Kanäle hereingekommen war: Buchcover, Webbanner, Poster, Lesezeichen, Visitenkarten, Postkarten, Logos, T-Shirt-Designs, Auftragswerke, Tattoo-Designs. Alles.
»Ja, absolut.« Ich musste den Drang niederkämpfen, über die Zuversicht und Entschlossenheit in meiner Stimme zu lächeln, obwohl ich mich alles andere als zuversichtlich fühlte.
Trevor, der sich schon wieder die Schläfen massierte, seufzte vernehmlich. »Wenn Sie der Meinung sind, dann muss ich mich wohl um einen Ersatz kümmern.«
Ich nickte und gestattete mir das köstliche Gefühl des nahenden Sieges, der mir in der Kehle kribbelte. Durch seinen Klugscheißer-Kommentar würde ich mich nicht von meinen Zielen abbringen lassen.
Trevor machte eine wegwerfende Handbewegung in Richtung Bildschirm. »Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald ich jemanden gefunden habe.«
Und damit loggte er sich aus, dieser grobe Klotz ohne Manieren. Irgendwie erinnerte er mich an einen anderen Mann, der unter einem ebensolchen Mangel litt. Hätte Aiden mich nicht im Laufe der Jahre Zac und anderen aus dem Team der Three Hundreds vorgestellt, so hätte ich sämtliche Spieler und Betreuer für ungeheuerlich selbstbezogen gehalten. Aber nach meiner inzwischen gewonnenen Erfahrung galt dies nur für einige wenige, besonders jene, mit denen ich mich abgeben musste. Macht euch einen Reim darauf.
Es war ohnehin nicht mehr mein Problem, nicht wahr?
»Vanessa!«, brüllte eine mir wohlbekannte Stimme aus dem oberen Stock.
»Ja?«, rief ich zurück, während ich die App auf meinem Tablet schloss und mich fragte, ob Aiden mein Gespräch mit Trevor gehört hatte oder nicht. Aber schließlich war es sein Vorschlag gewesen, dass ich Trevor anrufen sollte.
»Haben Sie die Laken gewaschen?«, schrie er – aus seinem Schlafzimmer, wie ich annahm.
Ich wusch Aidens Laken montags, mittwochs und freitags und hatte das seit dem Tag meiner Einstellung getan. Für einen Menschen, der beinahe jeden Tag Work-out machte und für den Schwitzen so normal war wie Atmen, war Aiden geradezu zwanghaft auf ultrasaubere Bettlaken bedacht. Das hatte ich von Anfang an begriffen und vergaß daher niemals, sie rechtzeitig zu waschen. »Ja.«
»Heute?«
»Ja.« Warum zum Teufel fragte er? Ich legte doch immer … oh. Ich pflegte Aiden eines seiner mit Schokolade überzogenen Lieblingsminzplätzchen auf das frisch bezogene Kopfkissen zu legen – weil ich es so amüsant fand –, hatte es heute Nachmittag aber unterlassen. Im Geschäft waren sie ausverkauft gewesen. Ich schätze mal, ich konnte ihm nicht vorwerfen, dass er bezüglich der Laken unsicher war – mir jedoch konnte ich den Vorwurf machen, ihn zu verwöhnen. Aiden hatte mein kleines Geschenk nie erwähnt oder gesagt, ich solle es doch sein lassen, also hatte ich angenommen, es sei ihm egal. Jetzt wusste ich es besser.
Er antwortete nicht sogleich, und ich stellte mir schon bildlich vor, wie er unsicher vor sich hin brummte und dann an den Laken schnüffelte, um zu prüfen, ob ich auch die Wahrheit sagte. Dann fing er wieder an zu brüllen. »Haben Sie meine Sachen aus der Reinigung geholt?«
»Ja. Liegen im Schrank.« Ich zuckte weder zusammen, noch verdrehte ich die Augen oder antwortete in genervtem Ton. Manchmal hatte ich die Selbstbeherrschung eines Samurai. Eines Samurai, der seinen Herrn loswerden wollte.
Kaum hatte ich mein Tablet in die Tasche gestopft, als er schon wieder brüllte. »Wo sind meine orangen Laufschuhe?«
Nun allerdings schielte ich doch vor Verzweiflung. Aiden erinnerte mich oft an mich selbst als kleines Kind, wenn ich Mom gefragt hatte, ob sie mir beim Suchen helfen konnte, nachdem ich gerade mal fünf Sekunden nach dem gewünschten Gegenstand Ausschau gehalten hatte. Die Schuhe lagen dort, wo er sie liegen gelassen hatte. »In Ihrem Bad.«
Ich hörte ihn oben rumoren. Zac konnte es ja nicht sein, er war noch nicht wieder nach Dallas zurückgekehrt. Also konnte es nur Big Guy sein, der seine Tennisschuhe oder runners, wie sie auf Kanadisch hießen, suchte. Ich fasste seine Schuhe nicht an, wenn es nicht unbedingt sein musste. Es lag nicht daran, dass seine Füße stanken – was sie merkwürdigerweise nicht taten –, sondern daran, dass sie schwitzten, ich meine, wirklich schwitzten. Aiden hatte die letzten beiden Monate so hart trainiert, dass seine Schweißraten einen neuen Höchststand erreicht hatten. Meine Hände versuchten, möglichst nicht in die Nähe seiner Schuhe zu geraten, wenn es sich irgend vermeiden ließ.
Ich blätterte in einem Kochbuch auf der Suche nach einem Rezept fürs Abendessen, als der Donner einsetzte, der einen so großen Mann im Treppablauf zwangsläufig begleiten musste. Ehrlich, jedes Mal, wenn Aiden die Treppen ein bisschen schneller als schleichend herunterkam, wackelten die Wände. Mir war nicht ganz klar, wie die Stufen das aushielten. Welches Material der Baumeister auch verwendet haben mochte, es war erstklassiges Zeug.
Ich musste mich gar nicht erst umdrehen, um zu wissen, dass Aiden in die Küche gekommen war. Die Kühlschranktür wurde geöffnet und wieder zugeschlagen, und dann hörte ich, wie er irgendwas kaute.
»Holen Sie neuen Sunblocker. Hab bald keinen mehr«, sagte er. Er klang zerstreut.
Ich hatte schon vor Tagen welchen bestellt, sah aber keinen Sinn darin, Aiden zu informieren, dass es billiger war, Sunblocker zu bestellen, statt welchen im Laden zu kaufen. »Alles klar, Big Guy. Ich bring später noch zwei von Ihren Shorts zur Schneiderin.« Bei seinem Sportpensum wunderte es mich nicht, dass auch die neuen Shorts schon wieder geflickt werden mussten.
Während er mit der Birne in der einen und zwei Äpfeln in der anderen Hand jonglierte, hob er das Kinn. »Hab heute Abend ’ne ziemliche Strecke vor. Muss ich noch was wissen, bevor ich loslege?«
Ich fummelte an meinem Brillenbügel herum, während ich überlegte, was ich ihm sagen sollte. »Ein paar Briefe sind gekommen. Ich hab sie heute Morgen auf Ihren Schreibtisch gelegt. Ich weiß nicht, ob Sie sie schon gesehen haben, aber sie sehen wichtig aus.«
Das große, gut aussehende Gesicht versank für eine Sekunde in Nachdenken, dann nickte es. »Hat Rob die Signierstunde gecancelt?«
Bei der Erinnerung an das Gespräch mit seinem Agenten wäre ich fast zusammengezuckt. Noch so ein Typ, den ich nicht ausstehen konnte. Ehrlich gesagt wäre ich nicht überrascht zu hören, dass selbst Robs Mutter ihn nicht leiden konnte. »Ich hab’s ihm gesagt, aber er hat mich bis jetzt nicht zurückgerufen, um Bescheid zu geben, wie die Reaktion war. Ich kümmere mich drum.«
Wieder nickte Aiden und bückte sich, um seinen Matchbeutel aufzuheben. »Denken Sie dran.« Dann stutzte er. »Leslie hat diesen Monat Geburtstag. Schicken Sie ihm eine Karte und einen Geschenkgutschein, ja?«
»Ihr Wunsch ist mir Befehl.« Soweit ich wusste, war Leslie der einzige Mensch, der Geschenke von Aiden erhielt. Mir wünschte er nicht einmal Glück, wenn ich Geburtstag hatte. Auch Zac bekam nichts geschenkt. Wäre es anders, hätte ich davon gewusst, weil ich nämlich das Geschenk hätte kaufen müssen. »Ach, übrigens, ich hab diese Müsliriegel gemacht, die Sie so gern essen, falls Sie etwas zum Laufen mitnehmen möchten«, setzte ich hinzu und zeigte auf die Plastikdose, die neben dem Kühlschrank stand.
Aiden tappte in die bezeichnete Richtung, öffnete die Dose und holte zwei in Wachspapier gewickelte Müsliriegel heraus, die er zusammen mit den anderen Snacks in seinen Matchbeutel stopfte. »Kommen Sie morgen mit dem Fotoapparat und meinem Frühstück zum Fitnessstudio. Ich fange früh an und bleibe bis zum Lunch.«
»Klar.« Ich musste unbedingt daran denken, meinen Wecker eine halbe Stunde vorzustellen. An den meisten Tagen der spielfreien Zeit und wenn er in Dallas war, absolvierte Aiden zu Hause sein Kardiotraining, frühstückte und begab sich zum Gewichtheben und anderen Work-outs mit irgendeinem Trainer, der vor seinen Augen Gnade fand. An manchen Tagen stand er jedoch früher auf und ging direkt ins Studio, wohin ich ihm dann sein Frühstück bringen sollte.
Das Fitnessstudio lag auf der anderen Seite der Stadt, also musste ich Aiden entweder mit einem Frühstück aus meiner Wohnung verköstigen oder sogar noch früher aufstehen, um erst zu Aiden zu fahren, dessen Haus total abseits lag, und von dort aus ins Studio. Nein danke. Da war mir Option eins schon lieber. Ich ging ja schon auf dem Zahnfleisch mit meinen üblichen vier oder fünf Stunden Schlaf pro Nacht. Auf das bisschen, das ich hatte, wollte ich nicht auch noch verzichten.
Ich trat von der Küchentheke zurück, nahm den Wasserkanister, den ich vorher aufgefüllt hatte, und hielt ihn Aiden hin. Mein Blick ruhte kurz auf seinem kräftigen Hals, bevor ich mich zwang, Aiden in die Augen zu schauen. »Ach, übrigens, ich hab mit Trevor über meine Kündigung gesprochen, und er meinte, er würde sich nach jemand anders umschauen.«
Er sah mich eine Sekunde, ach was, nur den Bruchteil einer Sekunde an, wie immer kühl und distanziert. Dann wandte Aiden den Blick ab. »Okay.« Er nahm den Kanister entgegen, während er gleichzeitig den Beutel über die Schulter warf.
Als er an der Tür war, die von der Küche in die Garage führte, rief ich ihm ein »Bye« hinterher.
Er sagte nichts, während er die Tür hinter sich schloss, aber ich hatte einen Moment den Eindruck, er hätte mit einem oder zwei Fingern gewinkt. Alles wahrscheinlich reine Einbildung.
Natürlich! Was denn sonst? Es war einfach nur dämlich zu glauben, er hätte für mich auch nur einen Finger gerührt. Ich war ja nicht gerade die empfindsamste Person, Aiden jedoch schlug mich um Längen.
Mit einem resignierten Seufzer schüttelte ich den Kopf über mich selbst. Dann machte ich mich in der Küche nützlich, als plötzlich mein Privathandy klingelte. Ich warf einen raschen Blick aufs Display, dann drückte ich auf Annahme.
»Hi«, meldete ich mich, das Handy zwischen Ohr und Schulter geklemmt.
»Vanny, ich hab nicht viel Zeit. Hab gleich einen Termin«, erwiderte die helle Stimme am anderen Ende. »Ich wollte dir nur sagen, dass Rodrigo Susie gesehen hat.«
Ein Schweigen entstand zwischen Diana und mir. Zwei Augenblicke, drei Augenblicke, vier Augenblicke. Es war ein lastendes, unnatürliches Schweigen. Aber das war es ja auch, was Susie am besten konnte – alles durcheinanderbringen.
Ich wollte Diana fragen, ob es denn sicher sei, dass ihr Bruder Rodrigo Susie gesehen hätte, aber ich stellte die Frage nicht. Wenn Rodrigo es sagte, dann stimmte das. Susie hatte kein Gesicht, das man so leicht verwechseln konnte, selbst nach all den Jahren nicht.
Ich räusperte mich, beschloss, dass ich nicht bis zehn zählen musste, ja nicht einmal bis fünf. »Wo?«, brachte ich leicht krächzend heraus.
»Gestern, in El Paso. Er war mit Louie und Josh zu Besuch bei seinen Schwiegereltern und sagte, er hätte sie im Lebensmittelladen in unserem alten Viertel gesehen.«
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
Nein. Das reichte nicht.
Ich musste von Neuem anfangen zu zählen, diesmal bis zehn. Tausend Gedanken schossen mir bei der Erwähnung von Susie durch den Kopf, und keiner davon war erbaulich. Man musste kein Genie sein, um zu ahnen, was sie in dem alten Viertel machte. Nur noch ein Mensch, den wir kannten, wohnte dort. Ich konnte mich noch so gut an unser ehemaliges Revier erinnern.





























