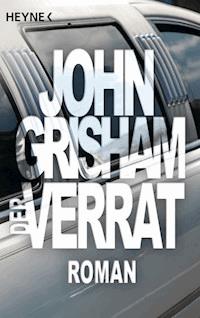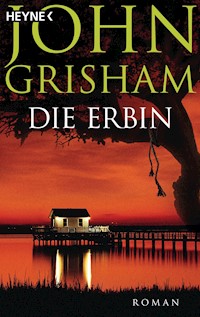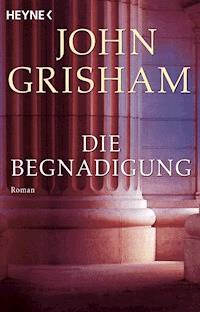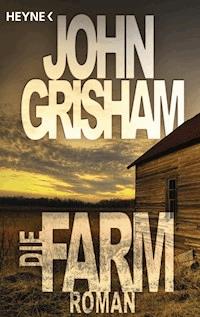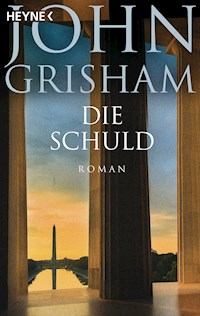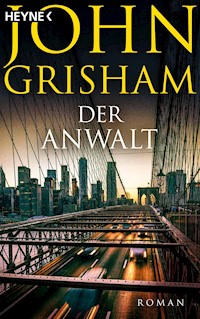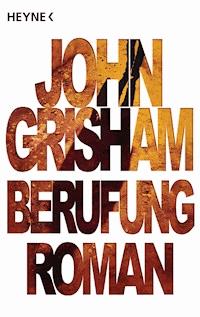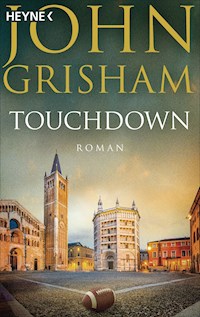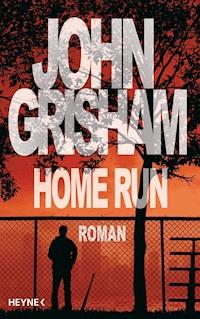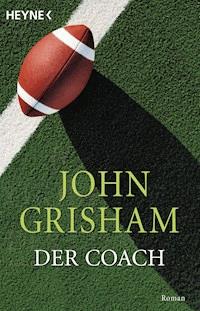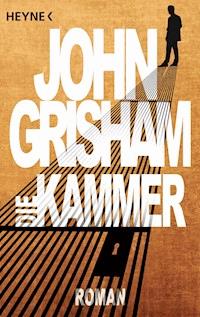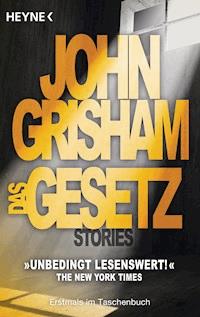8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Jugendbücher - Theo Boone
- Sprache: Deutsch
Spannend wie nie: Theo Boone im Kampf gegen skrupellose Großunternehmer
In seinem neuen Fall begibt sich Theo Boone, der jüngste und cleverste »Anwalt« von Strattenburg, in höchste Gefahr: Als die Farm seines Freundes Hardie einer neuen Umgehungsstraße weichen soll, setzen sich Theo und seine Freunde, immer aufseiten der Gerechtigkeit, für ihn und seine Familie ein. Mit ungeahnten Folgen, denn mit diesen Gegnern ist nicht zu spaßen…
Der dreizehnjährige Theo Boone interessiert sich nicht nur für Aufsehen erregende Kriminalfälle und Gerichtsverfahren, sondern stellt sein Wissen in Rechtsdingen auch gern im Alltag unter Beweis – was sich in seiner Schule längst herumgesprochen hat. Für den verzweifelten Hardie liegt es daher nahe, sich mit seinem Problem an Theo zu wenden: Seit anderthalb Jahrhunderten ist die Farm, auf der er mit seinen Eltern lebt, bereits im Familienbesitz. Doch nun soll sie einer neuen Umgehungsstraße weichen, die Unternehmer und Lokalpolitiker gegen den Widerstand der Bevölkerung bauen wollen. Als Theo seinen Freund Hardie zu einer Ortsbegehung besucht, bekommt er einen ersten Eindruck davon, mit wem er sich anlegt: Männer, die bereits eine inoffizielle Landvermessung auf Hardies Grundstück vornehmen, werden handgreiflich, als Theo die Polizei rufen will. Im Handgemenge schlagen sie brutal auf Theos Hund Judge ein, der schwer verletzt wird. Theo wird klar, dass seine Gegner vor nichts zurückschrecken und dass ihn sein Kampf für die Gerechtigkeit diesmal ernsthaft in Gefahr bringen kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Eins
Ihr Gegner war das Team der Central Middleschool, der »anderen« Schule der Stadt, die immer mit der Strattenburg Middleschool rivalisierte. Wenn es bei Spielen oder Wettbewerben gegen Central ging, lag eine besondere Spannung in der Luft, das Publikum strömte in Scharen herbei, und überhaupt schien alles wichtiger zu sein als sonst. Das galt sogar für eine Debatte. Einen Monat zuvor hatte das Debattierteam der achten Klasse der Strattenburg Middleschool in der Central Middleschool vor vollem Haus gewonnen, und als die Jury ihre Entscheidung verkündete, regte sich Unmut im Publikum. Es gab ein paar Buhrufer, die aber schnell zum Schweigen gebracht wurden. Gutes Benehmen und Fairness wurden vorausgesetzt, egal um welchen Wettbewerb es sich handelte.
Kapitän des Teams der Strattenburg Middleschool war Theo Boone, tragende Säule und Rettungsanker, wenn es hart auf hart kam. Theo und sein Team hatten noch nie verloren, waren allerdings auch nicht immer siegreich gewesen. Zwei Monate zuvor hatte eine hitzige Debatte gegen das Mädchenteam ihrer eigenen Schule, bei der es um die Heraufsetzung des Führerscheinalters von sechzehn auf achtzehn Jahre ging, unentschieden geendet.
Aber im Augenblick verschwendete Theo keinen Gedanken an andere Debatten. Er saß auf dem Podium an einem Klapptisch, flankiert von Aaron und Joey, die wie er Blazer und Krawatte trugen und sehr schick aussahen. Die drei ließen das Team der Central Middleschool auf der anderen Seite des Podiums nicht aus den Augen.
Mr. Mount, Theos Klassenlehrer, Freund und Debattiertrainer, sprach in ein Mikrofon. »Und nun der Schlussvortrag von Strattenburg– Theodore Boone, bitte.«
Theo warf einen Blick ins Publikum. Sein Vater saß in der ersten Reihe. Seine Mutter, eine viel beschäftigte Scheidungsanwältin, hatte einen unaufschiebbaren Gerichtstermin und ärgerte sich sehr, dass sie ihr einziges Kind nicht in Aktion sehen konnte. In der Reihe hinter Mr. Boone saßen ausschließlich Mädchen, darunter auch Theos beste Freundin April Finnemore und Hallie Kershaw, das beliebteste Mädchen der gesamten achten Jahrgangsstufe. Hinter ihnen hatten die Lehrer Platz genommen, unter anderem Madame Monique aus Kamerun, die Spanisch unterrichtete und– natürlich nach Mr. Mount– Theos Lieblingslehrerin war, Mrs. Garman, die Geometrie lehrte, und die Englischlehrerin Mrs. Everly. Sogar Mrs. Gladwell, die Direktorin, war anwesend. Alles in allem war das Publikum zahlreich erschienen, wenn man bedachte, dass es nur um eine Debatte ging. Bei einem Basketball- oder Footballspiel wären doppelt so viele Zuschauer gekommen, aber da bestanden die Mannschaften nicht nur aus drei Kandidaten und, offen gesagt, war auch mehr zu sehen.
Theo versuchte, das zu ignorieren, was nicht immer ganz einfach war. Wegen seiner Asthmaerkrankung konnte er nicht am Schulsport teilnehmen, dies hier war also seine einzige Chance, vor Publikum Leistung zu zeigen. Die meisten seiner Klassenkameraden hatten panische Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen, während er es genoss. Justin konnte einen Basketball durch die Beine dribbeln und legte einen Drei-Punkte-Wurf nach dem anderen hin, aber wenn er im Unterricht aufgerufen wurde, war er schüchtern wie ein Vierjähriger. Brian schwamm so schnell wie kein anderer Dreizehnjähriger in Strattenburg und ließ gern den großen Athleten heraushängen, aber wenn er vor Publikum sprechen sollte, wurde er plötzlich ganz klein.
Theo war da anders. Theo saß nur selten auf der Tribüne, um seine Mitschüler anzufeuern, stattdessen trieb er sich lieber im Gericht herum und sah zu, wie Verteidigung und Staatsanwaltschaft vor Geschworenen und Richtern miteinander rangen. Er hatte fest vor, einmal ein berühmter Anwalt zu werden, und obwohl er erst dreizehn war, hatte er schon gelernt, dass ein erfolgreicher Anwalt zwangsläufig auch ein guter Redner sein musste. Dabei fiel es selbst ihm nicht leicht, vor Publikum zu sprechen. Als Theo aufstand und zum Rednerpult ging, rebellierte sein Magen, und sein Herz raste. Er hatte davon gelesen, wie sich Spitzensportler auf ihre Wettbewerbe vorbereiteten und dass sich viele von ihnen vor Anspannung und Nervosität übergeben mussten. Ganz so schlimm war es bei Theo nicht, aber eine gewisse Unruhe, ein unbehagliches Gefühl, beschlich auch ihn.
»Wer kein Lampenfieber hat, bei dem stimmt etwas nicht, Junge«, hatte ein sehr erfahrener Prozessanwalt einmal zu ihm gesagt.
Nervös war Theo auf jeden Fall, aber er wusste aus Erfahrung, dass das vorüberging. Wenn es begann, war das Kribbeln im Bauch rasch verflogen. Er tippte gegen das Mikrofon und sah den Moderator an.
»Danke, Mr. Mount«, sagte er.
Dann wandte er sich dem Team der Central Middleschool zu, räusperte sich, ermahnte sich noch einmal, langsam und deutlich zu sprechen, und begann seine Erwiderung.
»Ich muss Mr. Bledsoe zustimmen: Menschen, die gegen unsere Gesetze verstoßen, sollten nicht von unseren Gesetzen profitieren. Und es ist auch richtig, dass sich viele amerikanische Schüler, die– wie ihre Eltern– hier geboren sind, ein Studium nicht leisten können. Das sind Argumente, die wir nicht ignorieren dürfen.«
Theo holte kurz Luft und richtete seine Aufmerksamkeit auf die Zuschauer, ohne jedoch Blickkontakt aufzunehmen. Er hatte sich in seiner Zeit im Debattierclub einige Tricks angeeignet, und zu den wichtigsten gehörte, die Gesichter in der Menge zu ignorieren. Sie konnten einen ablenken und aus dem Konzept bringen. Stattdessen nahm Theo Gegenstände ins Visier– einen leeren Stuhl auf der rechten Seite, eine Uhr an der hinteren Wand des Saals, ein Fenster auf der linken Seite– und ließ während seiner Rede den Blick von einem Objekt zum anderen wandern. Das vermittelte den überzeugenden Eindruck, dass Theo mit seinem Publikum auf einer Wellenlänge war, dass ihm die Kommunikation mit seinen Zuhörern aufrichtig am Herzen lag. Er schien am Pult in seinem Element zu sein, das kam bei den Juroren immer gut an.
»Allerdings haben sich die Kinder von Arbeitnehmern ohne Papiere– früher wurden sie als illegale Einwanderer bezeichnet– nicht ausgesucht, wo sie geboren wurden und wo sie leben. Ihre Eltern haben die Entscheidung getroffen, illegal in die Vereinigten Staaten einzuwandern, und zwar vor allem, weil sie nicht genug zu essen hatten und auf der Suche nach Arbeit waren. An unserer Schule wie auch an der Central Middleschool und an praktisch jeder Schule im Bezirk gibt es Kinder, die eigentlich nicht dort sein dürften, weil ihre Eltern gegen das Gesetz verstoßen haben. Aber wir nehmen sie auf, akzeptieren sie, und unser System bildet sie aus. Oft sind sie unsere Freunde.«
Es war ein brandaktuelles Thema. Im Bundesstaat machte sich eine Bewegung breit, die lautstark forderte, Kindern von Arbeitnehmern ohne Papiere den Zugang zu staatlichen Hochschulen zu verwehren. Die Befürworter dieses Verbots behaupteten, die »Illegalen« würden erstens in Massen die Universitäten überschwemmen, zweitens amerikanische Studenten verdrängen, die den erforderlichen Notendurchschnitt nur mit Mühe erreicht hatten, und drittens von »richtigen« US-Bürgern gezahlte Steuergelder in Millionenhöhe verschlingen. Das Team der Central Middleschool hatte diese Punkte in der Debatte bereits überzeugend dargelegt.
»Laut Gesetz«, fuhr Theo fort, »sind unsere Schulen wie alle Schulen dieses Bundesstaates verpflichtet, alle Schüler unabhängig von ihrer Herkunft aufzunehmen und zu unterrichten. Wenn der Staat für die ersten zwölf Jahre zahlt, wie könnte er dann diesen jungen Leuten die Tür vor der Nase zuschlagen, wenn sie ein Studium aufnehmen wollen?«
Theo hatte ein Blatt Papier mit Notizen vor sich auf dem Pult liegen, vermied aber jeden Blick darauf. Die Juroren legten Wert auf freie Rede, und Theo wusste, dass er Punkte sammelte. Alle drei Jungen von der Central Middleschool hatten sich auf ihre Notizen verlassen.
Er hob einen Finger. »Erstens ist es eine Frage der Fairness. Unsere Eltern sagen uns allen immer, wir sollen studieren. Das ist Teil des amerikanischen Traums. Deswegen finde ich es unfair, unsere Mitschüler und Freunde per Gesetz daran zu hindern, an die Uni zu gehen.« Er hob den zweiten Finger. »Zweitens ist Wettbewerb immer von Vorteil. Mr. Bledsoe ist der Ansicht, dass US-amerikanische Bürger Vorrang bei der Hochschulzulassung bekommen müssen, weil ihre Eltern zuerst hier waren, auch wenn manche dieser Schüler nicht so qualifiziert sind wie die Kinder von Arbeitnehmern ohne Papiere. Sollten unsere Hochschulen nicht die Besten aufnehmen– ohne Wenn und Aber? In diesem Bundesstaat gibt es jedes Jahr Plätze für dreißigtausend Studienanfänger. Warum sollte irgendwer bevorzugt werden? Ist es nicht zu ihrem eigenen Vorteil, wenn unsere Hochschulen die besten Schulabgänger aufnehmen? Natürlich ist es das! Niemand darf zugelassen werden, der es nicht verdient, und niemand darf abgelehnt werden, nur weil seine Eltern am falschen Ort geboren wurden.«
Mr. Mount konnte ein Lächeln kaum unterdrücken. Theo war auf der Erfolgsspur, und er wusste es. In seiner Stimme lag genau die richtige Spur von Empörung, keine überzogene Dramatik, nur so viel, dass klar wurde, was er dachte: Das liegt doch auf der Hand, wie kann jemand das nicht kapieren? Mr. Mount kannte das von früher. Theo setzte zum vernichtenden Schlag an.
Der dritte Finger stach in die Luft. »Mein letzter Punkt ist…« Er legte eine Pause ein, holte Luft und blickte sich im Auditorium um– sichtlich davon überzeugt, dass sein letztes Argument, was auch immer es sein mochte, so einleuchtend und zutreffend war, dass im Saal nicht der geringste Zweifel mehr möglich sein würde.
»In zahlreichen Studien konnte nachgewiesen werden, dass Menschen mit Hochschulabschluss mehr Chancen, bessere berufliche Möglichkeiten und ein höheres Gehalt haben als andere. Ein Studium ist das Sprungbrett zu einem besseren Leben. Und höhere Gehälter bedeuten höhere Steuereinnahmen, mit denen wiederum bessere Schulen und Universitäten finanziert werden können. Menschen ohne gute Ausbildung sind stärker von Arbeitslosigkeit bedroht, mit allen Problemen, die dies mit sich bringt.«
Theo legte erneut eine Pause ein und griff mit der Hand bedächtig an den obersten Knopf seines Sakkos. Er wusste, dass der Knopf perfekt saß, aber er wollte absolute Gelassenheit demonstrieren.
»Zum Abschluss möchte ich betonen, dass der Versuch, Studenten, deren Eltern illegal ins Land gekommen sind, den Zugang zu unseren Hochschulen zu verwehren, schon im Ansatz falsch ist. Mehr als zwanzig Bundesstaaten haben solche Gesetzesvorlagen bereits abgelehnt. Aus diesem Grund hat das Justizministerium in Washington vorsorglich angekündigt, unseren Bundesstaat zu verklagen, falls ein derartiges Gesetz verabschiedet wird. Die Vereinigten Staaten sind das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und wir haben alle Vorfahren, die irgendwann einmal als Einwanderer hierhergekommen sind. Wir sind eine Nation von Einwanderern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.«
Mr. Mount erschien am Rand der Bühne, als Theo zu seinem Platz zurückkehrte. Er lächelte.
»Applaus für beide Teams, bitte!«
Das Publikum, das ausdrücklich darauf hingewiesen worden war, dass während der Debatte weder positive noch negative Meinungsäußerungen zulässig waren, klatschte begeistert.
»Eine kurze Pause«, verkündete Mr. Mount.
Theo, Aaron und Joey sprangen auf und gingen zur anderen Seite des Podiums, wo sie dem Team der Central Middleschool die Hand schüttelten. Alle sechs waren froh, dass sie es hinter sich hatten. Theo nickte seinem Vater zu, der den Daumen hob. Gut gemacht!
Wenige Minuten später verkündeten die Juroren ihre Entscheidung.
Zwei
Krawatte und Sakko hatte er abgelegt, und in seiner normalen Hose fühlte Theo sich deutlich wohler, obwohl das Hemd mit dem weißen geknöpften Kragen ihm noch etwas zu schick war. Der Unterricht war vorbei, der Schlussgong verhallt, und Theo war an diesem Mittwoch unterwegs zu seinem Wahlkurs im Musiksaal. Dabei traf er immer wieder Achtklässler, die ihm zu seiner – wie üblich – hervorragenden Leistung gratulierten. Theo lächelte und gab sich unbeeindruckt, doch im tiefsten Inneren war er recht zufrieden mit sich. Er genoss den Sieg, aber ohne jede Eitelkeit.
»Werd bloß nicht überheblich«, hatte ihn ein erfahrener Prozessanwalt einst gewarnt. »Schon beim nächsten Geschworenenprozess kannst du mit Pauken und Trompeten untergehen.« Und die nächste Debatte konnte sich als Desaster erweisen.
Er ging durch den großen Musiksaal in ein kleineres Übungszimmer, in dem einige Schüler ihre Instrumente auspackten und sich für den Unterricht vorbereiteten. April Finnemore inspizierte gerade ihre Geige, als Theo hereinkam.
»Tolle Leistung«, sagte sie leise. April sprach selten so laut, dass Umstehende mithören konnten. »Du warst der Beste.«
»Danke. Und danke, dass du gekommen bist. Es waren ganz schön viele Leute da.«
»Du wirst ein großer Anwalt sein, Theo.«
»Das habe ich fest vor. Wie das mit Musik zu vereinbaren ist, weiß ich allerdings nicht so genau.«
»Musik ist immer gut«, sagte sie.
»Wenn du meinst.« Theo öffnete einen großen Koffer und holte vorsichtig ein Cello heraus, das er von der Schule ausgeliehen hatte. April und ein paar weitere Schüler hatten sich ihre Instrumente gekauft. Andere, so wie Theo, spielten auf Leihinstrumenten, weil sie nicht sicher waren, ob sie dabeibleiben würden. Theo ging in den Unterricht, weil April ihn überredet hatte und weil seine Mutter gern wollte, dass ihr Sohn ein Instrument lernte.
Warum Cello? Theo hätte es nicht sagen können, er wusste nicht so recht, warum er sich für dieses Instrument entschieden hatte. Falls er die Entscheidung überhaupt selbst getroffen hatte. In einem Streichorchester gibt es mehrere Violinen und Bratschen, einen Kontrabass, mindestens ein Cello und normalerweise ein Klavier. Die Mädchen schienen Violinen und Bratschen zu bevorzugen, und Drake Brown hatte den Kontrabass in Beschlag genommen. Blieb nur noch das Cello. Theo wusste vom ersten Augenblick an, dass er nie ein guter Cellist werden würde.
Theos Kurs war nachträglich in den Lehrplan aufgenommen worden und für Schüler gedacht, die kein Instrument beherrschten. Echte Anfänger, blutige Neulinge, Schüler, die keine großen musikalischen Kenntnisse und noch weniger Talent besaßen. Theo war hier genau richtig, wie auch die meisten anderen. Die Anforderungen waren gering, und der Unterricht beschränkte sich auf eine Stunde pro Woche, die vor allem Spaß machen sollte. Umso besser, wenn die Jugendlichen dabei zumindest ein wenig lernten.
Für den Spaß sorgte der Lehrer, Mr. Sasstrunk, ein drahtiger, kleiner alter Mann mit langem grauem Haar, wild blickenden braunen Augen und verschiedenen nervösen Ticks, der jede Woche in demselben verblichenen braun karierten Sakko erschien. Angeblich hatte er in seiner langen Laufbahn mehrere Orchester geleitet; seit zehn Jahren unterrichtete er am Stratten College Musik. Er hatte viel Sinn für Humor und lachte, wenn den Jugendlichen Fehler unterliefen, was ständig geschah. Seine Aufgabe sei es, so sagte er, sie mit der Musik bekannt zu machen, ihnen »einen kleinen Vorgeschmack zu vermitteln«. Er hatte keine Ambitionen, richtige Musiker aus ihnen zu machen. »Ich bringe euch ein paar Grundlagen bei, Kinder, wir üben ein bisschen, dann sehen wir schon, was passiert«, sagte er jede Woche. Nach vier Stunden hatten die Schüler nicht nur Spaß am Unterricht gefunden, sie setzten sich tatsächlich ernsthaft mit der Musik auseinander.
All das sollte sich von Grund auf ändern.
Mr. Sasstrunk kam zehn Minuten zu spät, und als er das Übungszimmer betrat, wirkte er müde und besorgt. Von seinem üblichen Lächeln keine Spur. Er blickte die Jugendlichen an, als wüsste er nicht, wie er es ihnen beibringen sollte.
»Ich komme gerade von der Direktorin: Sieht so aus, als wäre ich meinen Job los.«
Die zwölf Schüler im Raum wechselten unsichere Blicke.
Mr. Sasstrunk sah aus, als wollte er in Tränen ausbrechen. »Mir wurde erklärt, die städtischen Schulen müssten Einsparungen vornehmen. Offenbar entsprechen die Einnahmen nicht den Erwartungen, daher werden einige der weniger wichtigen Fächer und Kurse mit sofortiger Wirkung gestrichen. Es tut mir leid, Kinder, aber diese Stunde findet nicht mehr statt. Es ist vorbei.«
Den Schülern verschlug es die Sprache. Sie waren traurig, weil ihnen der Unterricht Spaß gemacht hatte, und außerdem tat ihnen Mr. Sasstrunk leid. In einer der vorigen Stunden hatte er scherzhaft erwähnt, mit dem bescheidenen Honorar, das ihm die Schule zahlte, wolle er seine CD-Sammlung mit den Werken der großen Komponisten vervollständigen.
»Das ist nicht fair«, beschwerte sich Drake Brown. »Wieso wird der Kurs überhaupt erst angeboten, wenn dann mittendrin Schluss ist?«
Das wusste Mr. Sasstrunk auch nicht. »Da musst du jemand anderen fragen.«
»Haben Sie denn keinen Vertrag?«, fragte Theo und bereute es sofort wieder. Ob Mr. Sasstrunk einen Vertrag hatte oder nicht, ging Theo nichts an. Allerdings wusste Theo, dass an den städtischen Schulen alle Lehrer einen auf ein Jahr befristeten Vertrag erhielten. Mr. Mount hatte ihnen das im Sozialkundeunterricht erklärt.
Mr. Sasstrunk knurrte etwas und lächelte gequält. »Schon, aber der ist nicht viel wert. Darin steht nur, dass die Schule den Kurs aus gutem Grund jederzeit absagen kann. Eine Standardklausel.«
»Auf so einen Vertrag kann man auch verzichten«, murmelte Theo.
»Allerdings. Tut mir leid, Kinder. Das war’s wohl. Die Arbeit mit euch hat mir großen Spaß gemacht, und ich wünsche euch das Beste. Manche von euch haben Talent, andere nicht, aber, wie gesagt, jeder von euch kann ein Instrument erlernen, wenn er fleißig übt. Denkt daran, mit harter Arbeit kann man alles erreichen. Alles Gute.« Damit wandte sich Mr. Sasstrunk zum Gehen und verließ langsam und traurig den Raum.
Die Tür schloss sich leise hinter ihm, und einige Sekunden lang sahen sich die Schüler wortlos an.
»Tu etwas, Theo«, sagte April schließlich. »Das ist nicht fair.«
Theo war schon aufgestanden. »Kommt, wir gehen zu Mrs. Gladwell. Alle zusammen. Wir besetzen ihr Büro und ziehen erst wieder ab, wenn sie mit uns geredet hat.«
»Gute Idee.«
Mit Theo an der Spitze verließen sie das Übungszimmer, trotteten geschlossen durch den Musiksaal und den Eingangsbereich, überquerten einen offenen Innenhof und folgten im Hauptgebäude einem langen Gang, der sie in die große Halle führte, an der die Direktorin, ganz in der Nähe des Haupteingangs der Schule, ihr Büro hatte. Sie marschierten durch die Tür und bauten sich vor dem Schreibtisch von Miss Gloria, der Schulsekretärin, auf. Zu ihren vielen Aufgaben gehörte es, die Tür zu Mrs. Gladwells Büro zu bewachen. Theo kannte Miss Gloria gut und hatte sie einmal beraten, als ihr Bruder wegen Alkohols am Steuer in Schwierigkeiten gewesen war.
»Hallo allerseits.« Miss Gloria spähte über die Lesebrille auf ihrer Nasenspitze. Sie hatte emsig vor sich hin getippt und wirkte nicht gerade begeistert, dass plötzlich ein Dutzend empörter Achtklässler vor ihrem Schreibtisch stand.
»Hallo, Miss Gloria«, sagte Theo, ohne zu lächeln. »Wir möchten Mrs. Gladwell sprechen.«
»In welcher Angelegenheit?«
Typisch Miss Gloria. Immer wollte sie wissen, worum es ging, bevor man mit Mrs. Gladwell darüber reden konnte. Sie galt als der neugierigste Mensch an der ganzen Schule. Theo wusste aus Erfahrung, dass sie früher oder später ohnehin herausfinden würde, was die Schüler auf dem Herzen hatten, und rückte daher gleich damit heraus.
»Wir waren in Mr. Sasstrunks Musikunterricht«, erklärte er. »In dem Kurs, den die Schule gerade gestrichen hat; darüber wollen wir mit Mrs. Gladwell reden.«
Miss Gloria zog missbilligend die Brauen hoch. »Sie ist beschäftigt, sie hat eine sehr wichtige Besprechung.« Dabei deutete sie mit dem Kopf auf die Tür zu Mrs. Gladwells Büro. Die war natürlich wie immer geschlossen. Theo war schon oft bei der Direktorin gewesen, normalerweise zu konstruktiven Gesprächen, manchmal jedoch auch aus weniger erfreulichem Anlass. Erst im vergangenen Monat war er– zum ersten Mal seit der vierten Klasse– in eine Schlägerei verwickelt gewesen, und Mrs. Gladwell hatte ihn hinter eben dieser geschlossenen Tür ins Gebet genommen.
»Wir warten«, sagte er.
»Sie ist sehr beschäftigt.«
»Sie ist immer beschäftigt. Sagen Sie ihr, dass wir da sind.«
»Ich kann jetzt nicht stören.«
»Gut, dann warten wir.« Theo sah sich in dem großen Raum um. Im Sekretariat gab es mehrere Bänke und ein Sammelsurium von Stühlen, die schon bessere Tage gesehen hatten. »Und zwar hier«, sagte er, und seine Klassenkameraden ergriffen sofort von Bänken und Stühlen Besitz. Diejenigen, die keinen Platz mehr fanden, ließen sich einfach auf dem Boden nieder.
Wenn Miss Gloria schlechte Laune hatte, war nicht gut Kirschen essen mit ihr, und genau das war jetzt offenbar der Fall. Diese Invasion aufgebrachter Schüler gefiel ihr ganz und gar nicht.
»Theo«, befahl sie brüsk, »ihr geht jetzt nach draußen und wartet in der Eingangshalle.«
»Und warum nicht hier?«, konterte Theo.
»Ich habe gesagt, ihr sollt draußen warten«, fauchte sie aufgebracht.
»Wer sagt, dass wir nicht im Sekretariat warten können?«
Miss Gloria lief rot an und platzte fast vor Wut. Klugerweise biss sie sich auf die Zunge und holte erst einmal tief Luft. Sie war nicht befugt, die Schüler aus dem Sekretariat zu verweisen, und ihr war klar, dass Theo das wusste. Ihr war auch bekannt, dass Theos Eltern angesehene Anwälte waren, die ihren Sohn durchaus vor Erwachsenen in Schutz nahmen– wenn diese Erwachsenen im Unrecht waren und Theo im Recht. Vor allem Mrs. Boone hielt mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg, wenn Theo für eine gerechte Sache kämpfte.
»Also gut«, sagte sie. »Aber verhaltet euch ruhig. Ich habe zu tun.«
»Danke«, erwiderte Theo. Fast hätte er hinzugesetzt, dass sie bisher noch keinen Mucks von sich gegeben hatten, aber er verkniff sich jede Bemerkung. Die Schlacht war gewonnen, damit wollte er es gut sein lassen.
Fünf Minuten lang sahen sie Miss Gloria zu, die sich alle Mühe gab, beschäftigt zu wirken. Aber es war schon fast vier Uhr, und der Unterricht war seit einer halben Stunde zu Ende. Viel war nicht mehr los. Einige Minuten später öffnete sich die Tür zu Mrs. Gladwells Büro, und ein junges Elternpaar kam heraus.
Die beiden gönnten Theo und seinen Freunden kaum einen Blick– offenbar hatten sie ein unangenehmes Gespräch hinter sich und wollten nur noch weg. Mrs. Gladwell kam ins Sekretariat, sah das Gedränge und wandte sich an Theo.
»Tolle Leistung bei der Debatte heute.«
»Danke.«
»Was ist hier los?«
»Mrs. Gladwell, wir sind Mr. Sasstrunks Musikgruppe und wir möchten wissen, warum der Kurs gestrichen wurde.«
Sie seufzte und lächelte. »Irgendwie habe ich so was erwartet«, sagte sie geduldig. »Kommt rein.«
Die Schüler trotteten im Gänsemarsch in ihr Büro, mit Theo als Schlusslicht. Als er die Tür schloss, stellte er fest, dass Miss Gloria sie beobachtete, und konnte sich ein triumphierendes Lächeln nicht verkneifen. Immerhin erwiderte sie das Lächeln.
Drinnen bauten sich die Schüler vor Mrs. Gladwells Schreibtisch auf. Es gab nur drei Besucherstühle, und keiner wollte sich vordrängen. Mrs. Gladwell hatte Verständnis dafür.
»Danke, dass ihr gekommen seid, Kinder. Das mit der Musikgruppe tut mir wirklich leid«, sagte sie und griff nach einem Dokument. »Das hier ist eine Mitteilung, die ich heute Morgen vom städtischen Amt für Schulwesen erhalten habe. Sie stammt direkt von der Nummer eins, Mr. Ortis McCord, dem Leiter der Behörde und meinem Chef. Der Schulbeirat ist vergangene Nacht zu einer Sondersitzung zusammengetreten, um dringende Finanzfragen zu klären. Offenbar erhalten die Strattenburger Schulen etwa eine Million Dollar weniger als ihnen ursprünglich von der Stadt, dem County und dem Bundesstaat zugesagt worden war. Alle drei sind für das Budget der Schulen zuständig, und aus verschiedenen Gründen wurden die Mittel gekürzt. Überall in der Stadt werden Teilzeitlehrkräfte entlassen. Exkursionen werden abgesagt. Arbeitsgemeinschaften und Wahlkurse wie Mr. Sasstrunks Musikunterricht werden gestrichen. Die Liste ist endlos. Das ist sehr ärgerlich, aber ich bin machtlos.«
Mrs. Gladwell verstand sich wirklich darauf, Dinge zu erklären. Die Schüler hingen an ihren Lippen, und allmählich dämmerte ihnen, dass sie nichts dagegen unternehmen konnten.
»Wie ist das mit der Finanzierung passiert?«, fragte Theo.
»Das ist eine schwierige Frage. Die einen machen die Rezession und die schwächelnde Wirtschaft dafür verantwortlich. Die Steuereinnahmen sind eingebrochen, deswegen fehlt es an allen Ecken und Enden. Andere behaupten, die Schulen würden das Geld zum Fenster hinauswerfen, besonders das Schulamt ist dieser Meinung. Ich weiß selbst nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall bin ich an die Weisungen gebunden. Ihr seid nicht die einzigen Betroffenen, ich muss einen Hausmeister, zwei Kantinenangestellte und vier Teilzeittrainer entlassen und sechs andere Wahlkurse streichen. Außerdem musste ich Mr. Pearce gerade mitteilen, dass er mit seiner siebten Klasse im Naturkundeunterricht nicht wie jedes Jahr zum Atomkraftwerk Rustenburg fahren kann.«
»Das ist ja furchtbar«, sagte Susan. »Das ist so eine interessante Exkursion.«
»Ich weiß, ich weiß. Mr. Pearce fährt da seit Jahren hin.«
»Ich finde es nicht in Ordnung, Leute einzustellen, ihnen Zusagen zu machen, und dann mittendrin den Kurs platzen zu lassen«, sagte Theo.
»Nein, ich finde das auch nicht in Ordnung, Theo. Aber für die Verträge bin ich nicht zuständig. Im Schulamt gibt es einen Anwalt, der sich um diese Dinge kümmert.«
Die Schüler sahen einander an, das mussten sie erst einmal verdauen.
»Es tut mir wirklich leid«, sagte Mrs. Gladwell. »Ich würde gern etwas für euch tun, aber es liegt nicht in meiner Hand. Bestimmt werden sich Mr. McCord und der Schulbeirat vor Beschwerden kaum retten können, dieser Weg steht euch natürlich auch offen.« Sie legte eine lange Pause ein. »Wenn das alles ist, würde ich jetzt gern zu meiner nächsten Besprechung gehen.«
»Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, Mrs. Gladwell«, sagte Theo.
»Dafür bin ich da.«
Niedergeschlagen und mit düsteren Mienen verließen die Schüler das Büro.
Drei
Schon seit der Zeit vor Theos Geburt arbeiteten seine Eltern gemeinsam in einer kleinen Kanzlei, die sich Boone & Boone nannte. Die Büroräume waren in einem umgebauten alten Wohnhaus in einer ruhigen, schattigen Straße mit vielen ähnlichen Kanzleien und Büros untergebracht, nur wenige hundert Meter von der Main Street und dem Zentrum von Strattenburg entfernt. Bei schönem Wetter füllten sich die Gehwege der Park Street mit Anwälten, die mit ihren Aktenkoffern dem nur zehn Minuten entfernten Gericht zustrebten oder von dort kamen. Und um die Mittagszeit schlenderten ganze Gruppen von Anwälten, Steuerberatern und Architekten lachend und plaudernd zum Essen. Immer wieder hasteten Sekretärinnen und Anwaltsgehilfen mit wichtigen Papieren zu anderen Kanzleien oder zum Gericht.
Dagegen besaßen Kinder auf Fahrrädern in der Park Street Seltenheitswert. An Wochentagen kam jedoch zumindest eines jeden Nachmittag angeflitzt: Theo.
Soweit Theo wusste, war er der einzige Achtklässler in Strattenburg, der sein eigenes Rechtsanwaltsbüro hatte. Eigentlich war es kein richtiges Büro, sondern nur eine Kammer hinten im Haus, von der eine Tür auf den Parkplatz führte, wo seine Eltern und die Angestellten der Kanzlei ihre Fahrzeuge abstellten. In Kanzleien fehlt es grundsätzlich an Archivraum, weil Rechtsanwälte es nicht über sich bringen, Sachen wegzuwerfen und außerdem jede Menge Papier produzieren. Deswegen war Theos Büro früher als Abstellkammer genutzt worden, in der alte Akten und Putzmittel aufbewahrt wurden. Nachdem er den Raum in Beschlag genommen und ausgeräumt hatte, hatte er einen Kartentisch aufgestellt, der ihm als Schreibtisch diente. Auf dem Dachboden hatte er einen ausrangierten Drehstuhl gefunden und ihn mit Draht und Sekundenkleber notdürftig repariert. An einer Wand hing ein Poster der Baseball-Mannschaft Minnesota Twins, deren treuer Fan Theo war, an der anderen eine Zeichnung von Theo im Cartoonstil, die ihm April Finnemore zu seinem zwölften Geburtstag geschenkt hatte.
Auf dem Schreibtisch lagen üblicherweise Hefte und andere Schulsachen, darunter war normalerweise ein Hund zu finden: Judge. Judges Alter und Herkunft würden wohl für immer ein Rätsel bleiben, bekannt war nur, dass er aus dem Tierheim stammte und kurz davor gestanden hatte, eingeschläfert zu werden. Theo hatte ihn zwei Jahre zuvor in letzter Sekunde im Tiergericht gerettet, ihm einen neuen Namen gegeben und ihn mit nach Hause genommen, wo er nachts friedlich unter Theos Bett schlummerte. Tagsüber streifte Judge unauffällig durch die Räume der Kanzlei Boone & Boone, hielt gelegentlich ein Nickerchen in seinem Körbchen unter Elsas Schreibtisch am Eingang oder, wenn der Besprechungsraum nicht genutzt wurde, unter dem großen Konferenztisch. Manchmal trieb er sich in der kleinen Küche herum, in der Hoffnung, dass etwas Essbares für ihn abfiel. Judge wog achtzehn Kilo, und obwohl er dasselbe aß wie die Menschen um ihn herum, nahm er nie auch nur ein Gramm zu– das sagte zumindest der Tierarzt, der ihn alle vier Monate untersuchte. Judge liebte herzhafte Speisen wie Chips, Cracker und Wurst- oder Schinkenbrote, war aber nicht wählerisch. Wenn Geburtstag gefeiert wurde, fiel für ihn immer ein Stück Kuchen ab. Wenn jemand, meist Theo, Frozen Yoghurt bei Guff holte, bekam Judge seine eigene Kugel, am liebsten Vanille. Und Judge war das einzige Mitglied der Kanzlei, das die grässlichen Haferkekse herunterbekam, mit denen Mr. Boones Sekretärin Dorothy mindestens einmal im Monat Angst und Schrecken verbreitete.
Das Einzige, was Judge verschmähte, war Hundefutter. Stattdessen aß er, wie Theo, Cheerios mit Milch zum Frühstück– allerdings mit Vollmilch statt fettarmer Milch–, und schloss sich der Familie auch beim Abendessen an. Dazwischen fiel in der Kanzlei immer wieder eine Kleinigkeit für ihn ab, während Theo in der Schule war.
Von den Anwälten um ihn herum hatte Judge gelernt, wie wichtig Pünktlichkeit war. Termine, Konferenzen, Gerichtsverhandlungen, Besprechungen, Zeitpläne und so weiter. In der Kanzlei behielt jeder stets die Uhr im Blick, und die Uhr bestimmte alles. Judge hatte seine eigene Uhr und wusste, dass Theo mittwochs, wie an den meisten Tagen, gegen vier Uhr aus der Schule kam. Deshalb verschwand er pünktlich um halb vier unter Elsas Schreibtisch und döste wieder ein. Aber es war ein Hundeschlaf, der nicht sehr tief war, eher ein Nickerchen, bei dem Judge die Augen halb geöffnet hielt und lauschte, bis Theo endlich draußen die Treppe vor dem Haus heraufkam und sein Rad auf der Veranda anschloss.
Wenn Judge das hörte, stand er auf, streckte sich, als hätte er sich seit Stunden nicht von der Stelle gerührt, und wartete gespannt.
Theo kam mit dem Rucksack zur Tür herein und sagte »Hallo, Elsa«, wie er es jeden Tag tat.
Elsa sprang auf, kniff ihn in die Wange und wollte wissen, wie es ihm in der Schule ergangen war.
Ging so.
Sie rückte seinen geknöpften Kragen zurecht. »Dein Vater sagt, du hast eine überragende Debatte abgeliefert. Stimmt das?«
»Wird schon so sein«, erwiderte Theo. »Wir haben gewonnen.«
Judge saß mittlerweile schwanzwedelnd vor Theo und wartete darauf, dass der Junge mit ihm redete und ihm den Kopf kraulte.
»In einem richtigen Hemd siehst du gleich ganz anders aus«, lobte Elsa.
Theo hatte das erwartet, weil Elsa seine Kleidung so gut wie immer kommentierte. Sie war älter als seine Eltern, kleidete sich aber wie eine Zwanzigjährige mit exotischem Geschmack. Für Theo war Elsa wie eine Großmutter, ein sehr wichtiger Mensch in seinem Leben.
Theo sagte ein paar Worte zu seinem Hund und kraulte ihm den Kopf.
»Ist meine Mutter da?«, fragte er dann.
»Ist sie, und sie wartet schon auf dich«, verkündete Elsa voller Elan. Die Frau hatte einfach zu viel Energie. »Und sie ist sehr enttäuscht, dass sie die Debatte verpasst hat, Theo.«
»Macht nichts. Sie muss ja auch mal arbeiten.«
»Ja, das muss sie. In der Küche stehen Brownies.«
»Wer hat die gebacken?«
»Die Freundin von Vince.«
Theo nickte erfreut und verschwand im Gang, wo seine Mutter ihr Büro hatte. Die Tür stand offen, und sie winkte ihn herein. Er setzte sich, Judge ließ sich neben ihm auf den Boden fallen. Mrs. Boone war am Telefon und lauschte aufmerksam. Ihre Stöckelschuhe standen neben dem Schreibtisch, was bedeutete, dass sie einen langen Tag am Gericht hinter sich hatte. Mit siebenundvierzig war Marcella Boone etwas älter als die meisten Mütter von Theos Freunden und sie legte Wert darauf, bei Gerichtsterminen gut angezogen zu sein. Im Büro sah sie das nicht so streng, aber in Verhandlungen trat sie sehr elegant auf, und dazu gehörten auch Schuhe mit hohen Absätzen.
Mr. Boone, der sein Büro oben hatte, ging nur selten vor Gericht, und sein Äußeres war ihm weitgehend gleichgültig.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte sie, während sie auflegte. »Dein Vater sagt, du warst brillant. Es tut mir furchtbar leid, dass ich nicht da sein konnte, Theo.«
Sie unterhielten sich eine Weile über die Debatte, wobei Theo die Argumentation des Teams der Central Middleschool und die Gegenargumente seines eigenen Teams erläuterte. Nach ein paar Minuten bemerkte seine Mutter jedoch einen Unterton. Theo wunderte sich oft über ihr Gespür dafür, dass etwas nicht stimmte. Wenn er versuchte, ihr einen Streich zu spielen oder ihr etwas vorzumachen, war das meist vergebliche Liebesmüh. Sie brauchte ihn nur anzusehen und wusste sofort, was in ihm vorging.
»Was ist los, Theo?«, fragte sie.
»Das mit mir und dem Cello kannst du vergessen«, sagte er und erzählte ihr die Geschichte von dem Musikkurs, den es nicht mehr gab. »Ich finde das nicht in Ordnung. Mr. Sasstrunk war ein hervorragender Lehrer. Die Arbeit hat ihm Spaß gemacht, und ich glaube, er war auf das zusätzliche Einkommen angewiesen.«
»Das ist furchtbar, Theo.«
»Wir haben mit Mrs. Gladwell gesprochen, und sie hat uns von den Kürzungen erzählt, die das Schulamt angeordnet hat. Trainer, Hausmeister, Kantinenpersonal. Es ist ganz schlimm, und sie kann nichts dagegen unternehmen. Sie meinte, wir könnten uns beim Schulbeirat beschweren, aber wenn kein Geld da ist, ist keins da.«
Mrs. Boone drehte ihren Stuhl zu einem schmalen, eleganten Aktenschrank und fing an zu suchen. Wenn Mr. Boone im ersten Stock eine Akte brauchte, wühlte er sich einfach durch die chaotischen Papierberge, die sich nach einem nur ihm selbst bekannten System auf seinem Schreibtisch türmten. Auch unter und neben seinem Schreibtisch stapelten sich die Unterlagen, und immer wieder rutschten Dokumente von einem Haufen einfach auf den Boden. Mrs. Boones Büro war hochmodern und absolut ordentlich, alles lag an seinem Platz. Mr. Boones Büro war alt, angestaubt und chaotisch. Trotzdem hatte Theo oft festgestellt, dass sein Vater Akten fast ebenso schnell fand wie seine Frau.
Sie drehte sich zu ihrem Schreibtisch zurück und studierte ein paar Unterlagen. »Letzte Woche kam eine junge Frau zu mir, die sich scheiden lassen wollte. Eine sehr traurige Geschichte. Sie ist vierundzwanzig, hat ein kleines Kind und erwartet das zweite. Sie ist nicht berufstätig, weil sie sich um das Kind kümmert. Ihr Mann ist Polizeianwärter hier in der Stadt und Alleinverdiener. Sie kommen schon als Familie kaum zurecht und können sich eine Scheidung auf keinen Fall leisten. Ich habe ihnen empfohlen, zur Eheberatung zu gehen und sich zusammenzuraufen. Gestern hat sie mich angerufen, um mir zu sagen, dass ihr Mann gerade eben von der Stadt gekündigt wurde. Der Bürgermeister hat alle Dienststellen angewiesen, ihre Ausgaben in sämtlichen Bereichen um fünf Prozent zu reduzieren. Wir haben sechzig Polizeibeamte, drei verlieren also ihren Job. Einer davon ist der Ehemann meiner Mandantin.«
»Was wird sie tun?«, fragte Theo.
»Irgendwie durchhalten. Ich weiß es nicht. Es ist sehr traurig. Sie sagt, es kommt ihr wie gestern vor, dass sie zur Highschool gegangen ist und von Studium und Beruf geträumt hat. Jetzt ist sie außer sich vor Angst und hat keine Ahnung, wie es weitergehen soll.«
»Hat sie studiert?«
»Sie hat es versucht, aber die Beihilfe wurde gestrichen.«
»All diese Einsparungen. Was ist da los, Mom?«
»In der Wirtschaft gibt es Hochs und Tiefs, Theo. In guten Zeiten verdienen die Menschen mehr Geld und geben auch mehr aus, und das bedeutet, dass die Stadt mehr Steuern einnimmt. Mehr Umsatzsteuer, mehr Grundsteuer, mehr…«
»Was ist eigentlich Grundsteuer?«
»Das ist ganz einfach. Dieses Haus gehört deinem Vater und mir. Es gilt als Grundbesitz. Grundstücke und deren Bebauung sind Grundbesitz, während Autos, Boote, Motorräder und Lastwagen als bewegliches Vermögen bezeichnet werden. Das wird ebenfalls besteuert, aber erst mal zurück zu diesem Gebäude. Jedes Jahr nimmt die Stadt eine Bewertung vor. Gegenwärtig ist ein Wert von vierhunderttausend Dollar angesetzt, was wesentlich mehr ist, als wir vor vielen Jahren dafür bezahlt haben. Die Stadt setzt einen Wert fest, anhand dessen sie die Steuer berechnet. Im vergangenen Jahr lag der Steuersatz bei rund einem Prozent, wir haben also etwa viertausend Dollar Steuern bezahlt. Für das Haus, in dem wir wohnen, zahlen wir ebenfalls Steuern, aber der Satz ist etwas niedriger. Deswegen haben wir dafür nur rund zweitausend Dollar Grundsteuer entrichtet. Unser bewegliches Vermögen besteht aus den beiden Autos, die wir mit etwa tausend Dollar versteuert haben. Insgesamt haben wir also vergangenes Jahr siebentausend Dollar an die Stadt bezahlt.«
»Was passiert mit dem Geld?«
»Der größte Teil geht an die Schulen, aber Dinge wie Feuerwehr und Polizei, Krankenhäuser, Parks und Freizeiteinrichtungen, Straßenbau und Müllabfuhr werden ebenfalls aus Steuergeldern finanziert. Es ist eine lange Liste.«
»Könnt ihr mitbestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird?«
Mrs. Boone lächelte und überlegte einen Augenblick. »Ein wenig schon. Nicht direkt, aber wir wählen den Bürgermeister und die Stadträte, die zumindest in der Theorie auf die Bürger hören sollen. In der Praxis zahlen wir aber, weil wir keine Wahl haben, und hoffen das Beste.«
»Ärgert es dich, dass ihr Steuern zahlen müsst?«
Sie lächelte erneut über seine naive Frage. »Theo, niemand zahlt gern Steuern, aber andererseits will jeder gute Schulen, kompetente Polizisten und Feuerwehrleute, schöne Parks, hervorragende Krankenhäuser und so weiter.«
»Siebentausend Dollar im Jahr sind ja noch zu verkraften.«
»Theo, wir zahlen siebentausend Dollar nur an die Stadt. Wir zahlen auch Steuern an das County, den Bundesstaat und die Zentralregierung in Washington. Und da wir gerade in einer Wirtschaftskrise stecken, werden auf allen Ebenen die Gelder gekürzt. Das ist nicht nur hier in Strattenburg so.«
»Es sieht also generell schlecht aus?«
»Es war schon schlimmer. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Aber es kommt einem dramatischer vor, wenn Leute betroffen sind, die man kennt, wie Mr. Sasstrunk und meine junge Mandantin. Wenn Menschen, die man kennt, ihre Arbeit verlieren, fühlt man sich persönlich betroffen.«
»Hat Boone & Boone auch unter der Wirtschaftskrise zu leiden?«
»O ja, besonders dein Vater. Wenn weder Häuser noch Baumaterial gekauft werden, wirkt sich das auf die gesamte Immobilienbranche aus. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Theo. Das haben wir schon oft erlebt.«
»Ich finde es trotzdem nicht fair.«
»Ist es auch nicht, Theo, aber das Leben ist eben ungerecht.« Ihr Telefon summte, Elsa wollte einen Anruf durchstellen. »Den muss ich annehmen, Theo. Ich glaube, dein Vater möchte dich sehen.«
»Okay, Mom. Was gibt’s zum Abendessen?«
Das war ein Scherz. Es war Mittwoch, und mittwochs holten sie sich immer chinesisches Essen vom Golden Dragon. Mrs. Boone war zu beschäftigt, um sich in der Küche zu betätigen.
»Ich glaube, heute Abend nehme ich Shrimps süß-sauer«, meinte sie.
»Klingt gut«, verkündete Theo, während er und Judge aufstanden und das Büro verließen.
Vier
In letzter Minute entschied sich Theo gegen Shrimps süß-sauer und nahm stattdessen das knusprig gebratene Rindfleisch. Es war eine von Judges Leibspeisen. Sein Vater holte das Essen vom Chinesen, und Punkt sieben Uhr saßen die Boones mit ihren hölzernen Klapptabletts im Fernsehzimmer. Mr. Boone sprach wie üblich ein kurzes Dankgebet, und alle griffen zu. Judge wartete geduldig neben Theos Stuhl, freute sich aber offenkundig schon aufs Essen.
Die Fernbedienung hatte Mrs. Boone. Vor einigen Monaten hatte die Familie ein Friedensabkommen geschlossen und vereinbart, dass jeden Mittwoch ein anderes Familienmitglied die Kontrolle übernehmen durfte. Wenn einer die Fernbedienung hatte, mussten sich die beiden anderen jeden Kommentar verkneifen. Nachdem sie ein paar Bissen gegessen und ein paar Bemerkungen über die große Debatte geäußert hatte, schaltete Mrs. Boone schließlich den Fernseher ein und fing an, ziellos herumzuzappen. Der Ton war aus. Das einzige Geräusch machte Judge, der das knusprige Rindfleisch verschlang. Wenn Mr. Boone oder Theo die Fernbedienung hatten, schalteten sie sofort ihre Lieblingssendung ein: die Wiederholungen von Perry Mason. Aber Mrs. Boone surfte nur und interessierte sich im Grunde für gar nichts. Sie sah nur wenig fern und hatte immer versucht, Theo davon abzuhalten.
Schließlich blieb sie bei einer Sendung hängen, die sich Strattenburg Today nannte, einer schlecht gemachten Zusammenfassung brandaktueller Nachrichten, sofern es die in Strattenburg gab. Normalerweise war das nicht der Fall. Mrs. Boone schaltete den Ton ein, und plötzlich blickten sie in das aufgesetzte Grinsen ihres Gouverneurs. Dazu ertönte die Stimme eines unsichtbaren Reporters.
»