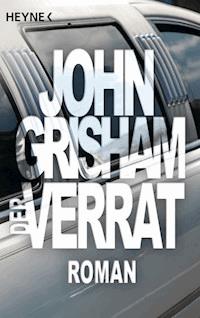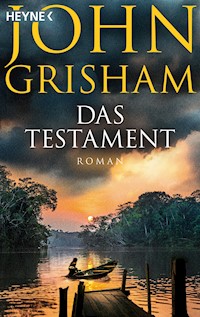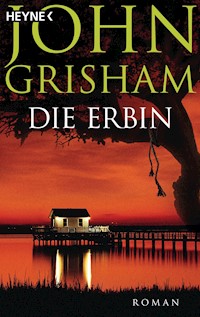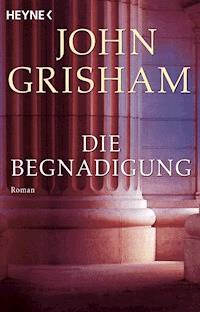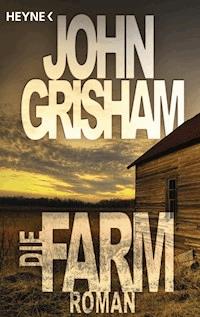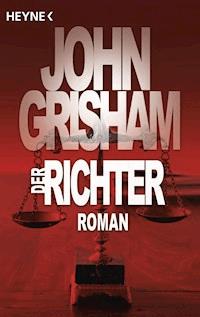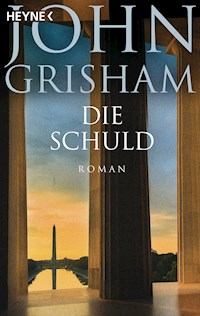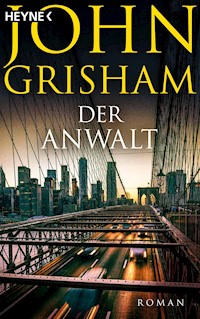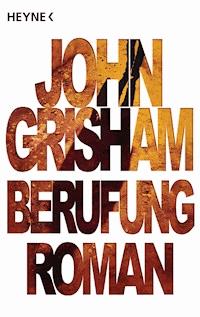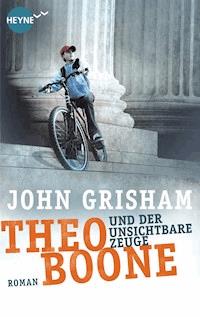
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Jugendbücher - Theo Boone
- Sprache: Deutsch
Verbrecher, aufgepasst: Hier kommt Theo Boone.
Theo Boone, Anwaltssohn mit ausgeprägtem Sinn für Recht und Gerechtigkeit, löst die schwierigsten Fälle – und er ist erst dreizehn! Als in seinem Heimatstädtchen Strattenburg, Louisiana, ein aufsehenerregendes Verbrechen geschieht, ist Theo wie elektrisiert – nun endlich kann er aus nächster Nähe einen großen Prozess verfolgen. Es scheint das perfekte Verbrechen zu sein, und schnell zeichnet sich ab, dass der Angeklagte seiner gerechten Strafe entkommen wird. Doch niemand hat mit Theo gerechnet: Er allein weiß, dass es einen Augenzeugen gibt – und er hat eine so geniale wie gefährliche Idee …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Eins
Theodore Boone war Einzelkind und frühstückte deswegen meist allein. Sein Vater, ein viel beschäftigter Anwalt, ging früh aus dem Haus, weil er sich jeden Morgen um sieben in einem Diner in der Innenstadt mit Freunden traf, um seinen Kaffee zu trinken und den neuesten Tratsch zu erfahren. Theos Mutter, selbst eine viel beschäftigte Anwältin, wollte seit zehn Jahren zehn Pfund abnehmen und hatte deswegen beschlossen, dass Kaffee und die Zeitung zum Frühstück reichten. Also saß Theo allein am Küchentisch, aß seine Cornflakes mit kalter Milch und trank seinen Orangensaft, ohne dabei die Uhr aus den Augen zu lassen. Bei den Boones gab es überall Uhren, wie es sich für eine gut organisierte Familie gehörte.
Ganz allein war er jedoch nicht. Der Hund neben seinem Stuhl leistete ihm Gesellschaft. Judge war eine undefinierbare Promenadenmischung, deren Alter und Herkunft wohl für immer ein Rätsel bleiben würden. Theo hatte ihn zwei Jahre zuvor mit seinem Auftritt vor Gericht in letzter Sekunde vor dem sicheren Tod gerettet, was ihm Judge nie vergessen würde. Genau wie Theo mochte er am liebsten Cheerios mit Vollmilch– bloß nicht mit fettarmer Milch–, und so frühstückten sie jeden Morgen gemeinsam schweigend.
Um acht wusch Theo das Geschirr im Spülbecken aus, stellte Milch und Saft in den Kühlschrank zurück, ging ins Fernsehzimmer und küsste seine Mutter auf die Wange.
»Ich muss los«, sagte er.
»Hast du Geld fürs Mittagessen?«, fragte sie– eine Frage, die sie ihm fünfmal pro Woche stellte.
»Wie immer.«
»Und die Hausaufgaben?«
»Alles unter Kontrolle, Mom.«
»Wann sehe ich dich?«
»Ich komme nach der Schule in die Kanzlei.« Theo ging nach der Schule immer in die Kanzlei, an jedem einzelnen Tag, aber Mrs. Boone fragte trotzdem jeden Morgen.
»Pass auf dich auf«, sagte sie. »Und vergiss nicht: Immer lächeln.«
Theo trug seit mittlerweile über zwei Jahren eine Zahnspange und sehnte sich verzweifelt danach, das Ding endlich loszuwerden. Da das aber noch dauerte, fühlte sich seine Mutter verpflichtet, ihn ständig daran zu erinnern, dass ein Lächeln Sonnenschein in die Welt brachte.
»Ich lächle doch, Mom.«
»Hab dich lieb, Teddy.«
»Ich dich auch.«
Theo, der immer noch lächelte, obwohl sie ihn »Teddy« genannt hatte, schnallte sich schwungvoll seinen Rucksack auf den Rücken, kraulte Judge am Kopf und verabschiedete sich. Dann lief er durch die Küchentür nach draußen, schwang sich aufs Rad und flitzte durch die Mallard Lane, eine schmale Straße mit vielen Bäumen im ältesten Teil der Stadt. Er winkte Mr. Nunnery zu, der es sich bereits auf der Veranda gemütlich machte, von wo aus er den lieben langen Tag das bisschen Verkehr beobachtete, das sich ins Viertel verirrte. An Mrs. Goodloe, die am Straßenrand stand, sauste Theo wortlos vorbei, weil sie so gut wie taub war und auch so nicht mehr viel mitbekam. Dafür warf er ihr ein Lächeln zu, das sie jedoch nicht erwiderte, weil ihr Gebiss irgendwo im Haus lag.
Der Frühling hatte gerade erst begonnen, und die Luft war klar und kühl. Theo trat so kräftig in die Pedale, dass der Wind in seinem Gesicht brannte. Um 8.40 Uhr musste er im Klassenzimmer sein, und er hatte vor der Schule noch wichtige Dinge zu erledigen. Er nahm eine Abkürzung durch eine Seitenstraße, schoss durch eine Passage, wich ein paar Autos aus und überfuhr ein Stoppschild. Für ihn war es ein Heimspiel, die Strecke fuhr er jeden Tag. Vier Straßen weiter wurden die Wohnhäuser von Büros und Geschäften abgelöst.
Das Gericht war das größte Gebäude in der Innenstadt von Strattenburg, gefolgt von der Post und der Bücherei. Majestätisch thronte es auf der Nordseite der Main Street, auf halbem Weg zwischen einer Brücke über den Fluss und einem Park mit Pavillons, Vogelbädern und Kriegerdenkmälern. Theo liebte das Gerichtsgebäude mit seiner Aura der Autorität, den mit wichtiger Miene umherhastenden Menschen und den Anschlagtafeln mit ihren bedeutungsschweren Mitteilungen und Sitzungsplänen. Vor allem aber liebte er die Sitzungssäle selbst. Für Sachen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Geschworene verhandelt wurden, standen kleinere Räume zur Verfügung, aber es gab auch einen großen Saal im ersten Stock, in dem Staatsanwälte und Verteidiger miteinander rangen wie Gladiatoren und die Richter herrschten wie Könige.
Theo war dreizehn und hatte noch nicht entschieden, was er werden wollte. Manchmal träumte er davon, ein berühmter Prozessanwalt zu werden, der sich nur mit ganz großen Fällen befasste und jeden Prozess vor einem Geschworenengericht gewann. Dann wieder sah er sich als Richter, der für seine Weisheit und seinen Gerechtigkeitssinn berühmt war. Dazwischen schwankte er hin und her, wobei er praktisch täglich seine Meinung änderte.
An diesem Montagmorgen herrschte in der großen Eingangshalle bereits geschäftiges Treiben. Es sah aus, als wollten die Anwälte und ihre Mandanten möglichst früh in die neue Woche starten. Da sich am Aufzug schon eine Schlange gebildet hatte, sprintete Theo die beiden Treppen zum Ostflügel hinauf, wo das Familiengericht tagte. Seine Mutter war eine bekannte Scheidungsanwältin, deswegen kannte Theo diesen Teil des Gebäudes gut. Scheidungsverfahren wurden vom Einzelrichter ohne Geschworene entschieden, und da die meisten Richter bei solch sensiblen Angelegenheiten keine Zuschauer dabeihaben wollten, war der Sitzungssaal klein. An der Tür standen mit wichtiger Miene einige Anwälte zusammen, die sich offenbar nicht einigen konnten. Theo sah sich im Gang um, bog um eine Ecke– und hatte seine Freundin gefunden.
Sie saß allein auf einer alten Holzbank und wirkte sehr klein, verletzlich und nervös. Bei seinem Anblick lächelte sie und legte eine Hand vor den Mund. Theo setzte sich so dicht neben sie, dass sich ihre Knie berührten. Bei jedem anderen Mädchen hätte er mindestens einen halben Meter Abstand gehalten, um jeden zufälligen Körperkontakt zu vermeiden.
Aber April Finnemore war nicht einfach irgendein Mädchen. Sie waren mit vier Jahren zusammen in einen kirchlichen Kindergarten in der Nähe gekommen und dicke Freunde gewesen, seit er denken konnte. Eine Romanze war das nicht, dafür waren sie zu jung. Theo kannte keinen einzigen Jungen in seiner Klasse, der zugegeben hätte, eine Freundin zu haben. Ganz im Gegenteil. Mit Mädchen wollte keiner was zu tun haben. Und den Mädchen ging es genauso. Theo hatte zwar gehört, dass sich das gründlich ändern würde, aber vorstellen konnte er sich das nicht.
April war einfach eine Freundin, und zwar eine, die im Augenblick dringend Hilfe brauchte. Ihre Eltern ließen sich scheiden. Theo war nur froh, dass seine Mutter nichts damit zu tun hatte.
Keiner, der die Finnemores kannte, war von der Scheidung überrascht. Aprils Vater war ein exzentrischer Antiquitätenhändler und Schlagzeuger einer alten Rockband, die immer noch in Nachtclubs spielte und wochenlang auf Tournee ging. Ihre Mutter züchtete Ziegen und fuhr mit einem knallgelb lackierten umgebauten Leichenwagen in der Stadt herum, um ihren selbst gemachten Ziegenkäse zu verkaufen. Auf dem Beifahrersitz thronte dann ein uralter Klammeraffe mit grauen Schnurrhaaren und mampfte den Käse, der sich noch nie besonders gut verkauft hatte. Mr. Boone hatte die Familie einmal »unkonventionell« genannt, was für Theo »seltsam« hieß. Aprils Eltern waren bereits beide wegen Drogenbesitzes festgenommen worden, hatten jedoch nie im Gefängnis gesessen.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte Theo.
»Nein«, sagte sie. »Ich hasse das hier.«
April hatte einen älteren Bruder namens August und eine ältere Schwester namens March, die sich beide abgesetzt hatten. August war am Tag nach seinem Highschool-Abschluss weggegangen. March hatte mit sechzehn die Schule abgebrochen und die Stadt verlassen, sodass ihre Eltern nur noch April schikanieren konnten. Das wusste Theo, weil April ihm alles erzählte. Ihr blieb nichts anderes übrig. Sie brauchte jemanden außerhalb ihrer Familie, dem sie sich anvertrauen konnte, und Theo war ein guter Zuhörer.
»Ich will bei keinem von denen leben«, sagte sie. Es war furchtbar, so über seine Eltern zu reden, aber Theo hatte volles Verständnis. Er verachtete Aprils Eltern dafür, wie sie ihre Tochter behandelten. Er verachtete sie dafür, dass sie ihr Leben nicht in den Griff bekamen, ihre Tochter vernachlässigten und gemein zu ihr waren. Die Liste der Schandtaten war lang. Er wäre lieber weggelaufen, als bei solchen Leuten zu leben. In der ganzen Stadt kannte er kein einziges Kind, das je einen Fuß ins Haus der Finnemores gesetzt hatte.
Es war bereits der dritte Verhandlungstag, und April würde bald als Zeugin im Scheidungsverfahren aufgerufen werden. Dann würde der Richter die Schicksalsfrage stellen: »April, bei welchem Elternteil möchtest du leben?«
Sie hatte keine Ahnung, was sie antworten sollte. Stundenlang hatte sie die Frage mit Theo diskutiert, wusste aber immer noch nicht, was sie sagen sollte.
Theo war völlig unklar, warum diese Leute, die sich nie um April gekümmert hatten, überhaupt das Sorgerecht haben wollten. Ihm waren diesbezüglich Dinge zu Ohren gekommen, über die er mit niemandem sprach.
»Was wirst du antworten?«, fragte er.
»Ich sage dem Richter, dass ich zu meiner Tante Peg in Denver gehe.«
»Ich denke, die will dich nicht.«
»Stimmt.«
»Dann ist das keine Option.«
»Was soll ich bloß sagen, Theo?«
»Meine Mutter findet, du sollst deine Mutter nehmen. Ich weiß, dass sie nicht deine erste Wahl ist, aber du hast keine erste Wahl.«
»Der Richter entscheidet doch sowieso, wie er will.«
»Stimmt. Wenn du vierzehn wärst, wäre deine Entscheidung bindend, aber mit dreizehn muss der Richter nur deine Wünsche berücksichtigen. Meine Mutter sagt, der Vater bekommt praktisch nie das Sorgerecht. Nimm deine Mutter, dann bist du auf der sicheren Seite.«
April trug Jeans, Trekkingstiefel und einen blauen Pulli. Sie kleidete sich selten mädchenhaft, sah aber trotzdem nie wie ein Junge aus.
»Danke, Theo«, sagte sie.
»Ich würde gern dableiben.«
»Und ich würde gern zur Schule gehen.«
Beide lachten gezwungen.
»Ich denk an dich. Du schaffst das.«
»Danke, Theo.«
Theos Lieblingsrichter war Richter Henry Gantry. Um zwanzig nach acht betrat er das Vorzimmer dieses bedeutenden Mannes.
»Guten Morgen, Theo«, sagte Mrs. Hardy, die gerade ihren Kaffee umrührte und ihre Arbeit vorbereitete.
»Guten Morgen, Mrs. Hardy.« Theo lächelte.
»Was verschafft uns die Ehre?«, erkundigte sie sich.
Theo schätzte Mrs. Hardy etwas jünger als seine Mutter und fand sie sehr hübsch. Von den Sekretärinnen am Gericht mochte er sie am liebsten. Seine bevorzugte Geschäftsstellenbeamtin war Jenny vom Familiengericht.
»Ich muss Richter Gantry sprechen«, erwiderte er. »Ist er da?«
»Ja, aber er ist sehr beschäftigt.«
»Bitte. Nur eine Minute.«
Sie nippte an ihrem Kaffee. »Hat das irgendwas mit dem großen Prozess morgen zu tun?«
»Ja, genau. Ich will mit meiner Schulklasse zum ersten Verhandlungstag kommen, aber das geht nur, wenn es genügend Sitzplätze gibt.«
»Das wird schwierig, Theo.« Mrs. Hardy schüttelte stirnrunzelnd den Kopf. »Der Saal wird überfüllt sein, da wird es eng mit den Sitzplätzen.«
»Kann ich den Richter sprechen?«
»Wie viele seid ihr in deiner Klasse?«
»Sechzehn. Ich dachte, vielleicht dürfen wir auf die Galerie.«
Immer noch die Stirn runzelnd, griff sie zum Telefon und drückte eine Taste. »Ja, Richter Gantry«, sagte sie nach einem Augenblick. »Theodore Boone ist hier und möchte Sie sprechen. Ich habe ihm schon gesagt, dass Sie viel zu tun haben.« Sie lauschte kurz und legte dann auf.
»Beeil dich!« Damit deutete sie auf die Tür zum Büro des Richters.
Sekunden später stand Theo vor dem größten Schreibtisch der Stadt, auf dem sich alle möglichen Papiere, Akten und Ordner stapelten– einem Schreibtisch, der die gewaltige Macht von Richter Henry Gantry widerspiegelte. Im Augenblick blickte der sehr ernst drein. Bestimmt hatte er nicht mehr gelächelt, seit Theo ihn bei der Arbeit gestört hatte. Im Gegensatz zu ihm lächelte Theo so angestrengt, dass das Metall von einem Ohr zum anderen blitzte.
»Du hast das Wort«, sagte Richter Gantry. Theo war oft dabei gewesen, wenn der Richter Staatsanwälten oder Verteidigern auf diese Weise das Wort erteilte. Immer wieder gerieten selbst kompetente Juristen unter dem strengen Blick von Richter Gantry ins Stottern. Obwohl er im Augenblick gar nicht so finster dreinsah und auch keine schwarze Robe trug, blieb er eine Respekt einflößende Erscheinung. Doch als sich Theo räusperte, entdeckte er ein unverkennbares Funkeln in den Augen seines Freundes.
»Wissen Sie, Richter Gantry, unser Sozialkundelehrer Mr. Mount meint, der Direktor würde uns den ganzen Tag freigeben, damit wir morgen zum ersten Verhandlungstag kommen können.« Theo legte eine Pause ein, holte tief Luft und rief sich ins Gedächtnis, dass ein erfolgreicher Prozessanwalt langsam, deutlich und voller Überzeugung sprechen musste. »Aber nur, wenn wir garantierte Sitzplätze haben. Ich dachte, wir könnten auf der Galerie sitzen.«
»Das hast du dir gedacht?«
»Ja, Sir.«
»Wie viele seid ihr?«
»Sechzehn und Mr. Mount.«
Der Richter griff nach einer Akte, öffnete sie und fing an zu lesen, als hätte er Theo plötzlich vergessen, der in strammer Haltung vor seinem Schreibtisch stand. Theo wartete verlegen.
»Siebzehn Plätze, vordere Galerie links«, sagte der Richter nach fünfzehn Sekunden abrupt. »Ich gebe dem Gerichtsdiener Bescheid, dass er euch um zehn vor neun einweisen soll. Aber dass mir keine Klagen über euer Benehmen kommen!«
»Ganz bestimmt nicht, Sir.«
»Ich sorge dafür, dass Mrs. Hardy eine Mitteilung an euren Direktor schickt.«
»Danke!«
»Jetzt musst du aber gehen, Theo. Tut mir leid, dass ich so beschäftigt bin.«
»Macht nichts, Sir.«
Theo war schon unterwegs zur Tür, als der Richter ihn noch einmal ansprach: »Sag mal, Theo, hältst du Mr. Duffy für schuldig?«
Theo blieb stehen, drehte sich um und antwortete, ohne zu zögern. »Für Mr. Duffy gilt die Unschuldsvermutung.«
»Ist mir klar. Aber was ist deine persönliche Meinung?«
»Ich glaube, er war es.«
Der Richter nickte leicht, ließ sich aber nicht anmerken, ob er derselben Meinung war.
»Was ist mit Ihnen?«, fragte Theo.
Endlich lächelte Richter Gantry doch. »Ich bin ein fairer, unparteiischer Richter, Theo. Was Schuld oder Unschuld angeht, bin ich unvoreingenommen.«
»Habe ich mir gedacht, dass Sie das sagen würden.«
»Bis morgen.«
Theo öffnete die Tür einen Spaltbreit und schlüpfte hindurch.
Draußen hatte sich Mrs. Hardy mit strenger Miene und in die Hüften gestemmten Händen vor zwei aufgeregten Anwälten aufgebaut, die den Richter sprechen wollten. Alle drei verstummten, als Theo aus Richter Gantrys Büro kam. Im Vorübergehen lächelte er Mrs. Hardy zu.
»Danke!« Damit öffnete er die Tür und verschwand.
Zwei
Vom Gericht zur Schule brauchte Theo eigentlich fünfzehn Minuten– wenn er die Verkehrsregeln beachtete und sich von fremden Grundstücken fernhielt. Normalerweise tat er das auch, außer wenn er spät dran war. Jetzt raste er gegen die Fahrtrichtung durch die Market Street, fuhr direkt vor einem Auto auf den Bürgersteig und über einen Parkplatz, benutzte, wo immer möglich, die Gehwege, und flitzte in der Elm Street über ein Privatgrundstück zwischen zwei Häusern hindurch. Auf der Veranda hinter ihm ertönte wütendes Gebrüll, aber dann hatte er die Durchfahrt erreicht, die in den Lehrerparkplatz hinter seiner Schule mündete. Er sah auf die Uhr: neun Minuten. Nicht schlecht.
Er stellte sein Rad am Ständer an der Fahnenstange ab, schloss es mit einer Kette an und schwamm im Strom der Schüler mit, die gerade mit dem Bus gekommen waren. Es war 8.40 Uhr, und die Schulglocke klingelte, als er das Klassenzimmer betrat und Mr. Mount begrüßte, der nicht nur sein Sozialkunde-, sondern auch sein Klassenlehrer war.
»Ich habe eben mit Richter Gantry gesprochen.« Theo blieb vor Mr. Mounts Schreibtisch stehen, der deutlich kleiner war als der eben im Gericht. Im Raum herrschte das übliche morgendliche Chaos. Alle sechzehn Jungen waren versammelt und blödelten, rauften und schubsten nach Kräften.
»Und?«
»Ich habe die Plätze für morgen früh.«
»Super. Gut gemacht, Theo.«
Mr. Mount rief die Schüler zur Ordnung, verlas die Anwesenheitsliste und schickte die Jungen zehn Minuten später, nach den Bekanntmachungen, zum Spanischunterricht von Madame Monique, der in einem anderen Raum im selben Gang stattfand. Unterwegs gab es ein paar unbeholfene Flirtversuche, als sich Mädchen unter die Gruppe mischten. Während des Unterrichts blieben die Geschlechter getrennt, weil die klugen Leute, die in der Stadt für Schulpolitik zuständig waren, das so beschlossen hatten. Für die unterrichtsfreien Zeiten gab es keine Beschränkungen.
Madame Monique war eine große, dunkle Frau aus Kamerun in Westafrika. Sie war drei Jahre zuvor nach Strattenburg gezogen, weil ihr Ehemann, der ebenfalls aus Kamerun stammte, eine Stelle am örtlichen College angenommen hatte, wo er Sprachen unterrichtete. Für eine amerikanische Middleschool war sie nicht gerade die typische Lehrerin. Als Kind in Afrika hatte sie Beti, ihren Stammesdialekt, gesprochen, aber auch Französisch und Englisch, die in Kamerun Amtssprachen waren. Ihr Vater war Arzt und hatte es sich daher leisten können, sie in der Schweiz auf ein Internat zu schicken, wo sie Deutsch und Italienisch gelernt hatte. Ihr Spanisch hatte sie bei ihrem Studium in Madrid vervollkommnet. Im Augenblick arbeitete sie an ihren Russischkenntnissen, und auch Mandarin, die offizielle Sprache der Volksrepublik China, hatte sie bereits ins Auge gefasst. In ihrem Klassenzimmer hingen große, bunte Weltkarten, und ihre Schüler waren davon überzeugt, dass sie überall gewesen war, alles gesehen hatte und alle Sprachen sprach. Die Welt ist groß, sagte sie immer wieder, und in anderen Ländern beherrschen die meisten Menschen mehr als eine Sprache. Im Unterricht konzentrierte sie sich auf Spanisch, ermutigte die Schüler aber, sich auch mit anderen Sprachen zu befassen.
Theos Mutter hatte viele Jahre lang Spanisch gelernt und ihm schon im Vorschulalter wichtige Vokabeln und Ausdrücke beigebracht. Manche ihrer Mandanten stammten aus Mittelamerika, und wenn Theo ihnen in der Kanzlei begegnete, nutzte er die Gelegenheit, seine Sprachkenntnisse auszuprobieren. Das kam immer gut an.
Madame Monique meinte, er habe ein Ohr für Sprachen, was ihn motivierte, sich noch mehr anzustrengen.
Oft drängten die Schüler sie aus Neugier, etwas auf Deutsch oder Italienisch zu sagen. Das tat sie auch, aber zuerst ließ sie diese Schüler aufstehen und selbst etwas in den betreffenden Sprachen sagen. Dafür gab es Bonuspunkte, ein großer Ansporn. Die meisten Jungen in Theos Klasse kannten ein paar Dutzend Wörter in verschiedenen Sprachen. Aaron, der eine spanische Mutter und einen deutschen Vater hatte, war mit Abstand der Sprachbegabteste. Aber Theo war fest entschlossen, es mit ihm aufzunehmen. Neben Sozialkunde war Spanisch sein Lieblingsfach, und Madame Monique mochte er fast so gern wie Mr. Mount.
Heute fiel es ihm jedoch schwer, sich zu konzentrieren. Sie lernten spanische Verben, schon an guten Tagen eine mühsame Angelegenheit, und Theo war mit seinen Gedanken woanders. Er sorgte sich um April, für die es ein harter Tag werden würde. Es musste furchtbar sein, sich zwischen seinen Eltern entscheiden zu müssen. Und als es ihm schließlich gelang, April aus seinen Gedanken zu verbannen, ging ihm der Mordprozess nicht aus dem Sinn. Morgen würde er die Eröffnungsplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hören. Er konnte es kaum erwarten.
Die meisten seiner Klassenkameraden träumten von Endspiel- oder Konzertkarten. Theo Boone lebte für die großen Prozesse.
Die zweite Stunde war Geometrie bei Miss Garman. Es folgte eine kurze Pause im Freien, und dann kehrten die Jungen in ihr Klassenzimmer zurück, zu Mr. Mount und der besten Stunde des Tages– das fand zumindest Theo. Mr. Mount war Mitte dreißig und hatte früher bei einer riesigen Kanzlei in einem Wolkenkratzer in Chicago als Anwalt gearbeitet. Sein Bruder war Anwalt. Sein Vater und sein Großvater waren Anwalt und Richter gewesen. Mr. Mount hatte jedoch irgendwann genug gehabt von den langen Arbeitstagen und dem enormen Druck und seinen Job gekündigt. Er hatte sein dickes Gehalt gegen eine Aufgabe eingetauscht, die ihm lohnender erschien. Er unterrichtete für sein Leben gern, und obwohl er sich immer noch als Jurist fühlte, fand er das Klassenzimmer viel wichtiger als den Gerichtssaal.
Weil er sich mit dem Thema Recht so gut auskannte, wurde in seinem Sozialkundeunterricht die meiste Zeit über historische und aktuelle Fälle und sogar fiktive Verfahren im Fernsehen gesprochen.
»Also gut, Männer«, begann er, als alle saßen und Ruhe eingekehrt war. Er bezeichnete die Jungen immer als »Männer«, was die Dreizehnjährigen als großes Kompliment empfanden. »Morgen seid ihr bitte spätestens um 8.15 Uhr hier. Wir fahren mit dem Bus zum Gericht, damit wir pünktlich auf unseren Plätzen sitzen. Es handelt sich um eine vom Direktorat genehmigte Exkursion, ihr habt also sonst keinen Unterricht. Nehmt Geld mit, damit wir im Pappy’s Deli zu Mittag essen können. Noch Fragen?«
Die »Männer« hingen wie gebannt an seinen Lippen, die Aufregung stand ihnen ins Gesicht geschrieben.
»Was ist mit Rucksäcken?«, wollte einer wissen.
»Keine Rucksäcke«, erwiderte Mr. Mount. »In den Sitzungssaal dürft ihr nichts mitnehmen. Es wird strenge Sicherheitskontrollen geben. Immerhin ist es seit Langem der erste Mordprozess hier. Sonst noch Fragen?«
»Was sollen wir anziehen?«
Alle Blicke– einschließlich dem von Mr. Mount– wanderten zu Theo. Es war allgemein bekannt, dass Theo mehr Zeit im Gericht verbrachte als die meisten Anwälte.
»Sakko und Krawatte, Theo?«, fragte Mr. Mount.
»Nein, das ist nicht nötig. Wir können so gehen, wie wir sind.«
»Ausgezeichnet. Noch Fragen? Gut. Ich habe Theo gebeten, uns das Szenario morgen zu skizzieren. Würdest du uns bitte den Sitzungssaal und die wichtigsten Akteure beschreiben, damit wir wissen, was uns erwartet, Theo?«
Theo hatte seinen Laptop bereits an den Beamer angeschlossen. Jetzt stellte er sich vor die Klasse und drückte eine Taste, woraufhin auf dem digitalen Breitwand-Whiteboard eine große Grafik erschien.
»Das hier ist der Hauptsitzungssaal«, begann Theo mit seiner professionellsten Juristenstimme. Er hielt einen Laserpointer in der Hand und deutete mit dem roten Punkt auf die entsprechenden Bereiche des Diagramms. »Hier oben in der Mitte befindet sich der Richtertisch, von dem aus der Richter die Verhandlung leitet. Warum das Tisch heißt, weiß ich auch nicht so recht. Eigentlich ist es eher ein Podium. Aber bleiben wir bei Tisch. Der Richter heißt Henry Gantry.« Er drückte eine Taste, und ein großes offizielles Foto von Richter Gantry wurde eingeblendet. Schwarze Robe, ernste Miene. Theo verkleinerte es und zog es zum Richtertisch. Als der Richter an seinem Platz war, fuhr er fort: »Richter Gantry ist seit über zwanzig Jahren Richter und befasst sich nur mit Strafverfahren. In seinen Verhandlungen herrscht strenge Disziplin, aber die meisten Anwälte mögen ihn.« Der Laserpointer wanderte in die Mitte des Sitzungssaals. »Hier sitzt die Verteidigung mit Mr. Duffy, der des Mordes angeklagt ist.« Theo drückte erneut eine Taste und rief ein Schwarz-Weiß-Foto auf, das er aus einer Zeitung kopiert hatte. »Das ist Mr. Duffy. Neunundvierzig, früherer Ehemann der verstorbenen Mrs. Duffy. Wie wir alle wissen, wird Mr. Duffy beschuldigt, seine Frau ermordet zu haben.« Er verkleinerte das Foto und zog es zum Tisch der Verteidigung. »Sein Anwalt ist Clifford Nance, wohl der beste Strafverteidiger in der Gegend.« Nance erschien in Farbe; er steckte in einem dunklen Anzug und lächelte verschlagen. Das graue, lockige Haar trug er lang. »Neben der Verteidigung hat die Anklage ihren Platz. Chefankläger ist Bezirksstaatsanwalt Jack Hogan.« Hogans Foto tauchte für ein paar Sekunden auf, bevor es verkleinert und zum Tisch neben dem der Verteidigung gezogen wurde.
»Wo hast du die Fotos her?«, erkundigte sich jemand.
»Die Anwaltskammer veröffentlicht jedes Jahr ein Verzeichnis aller Rechtsanwälte, Staatsanwälte und Richter«, erwiderte Theo.
»Stehst du da auch drin?« Ein paar seiner Mitschüler lachten kurz auf.
»Nein. An den Tischen von Anklage und Verteidigung sitzen noch weitere Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Anwaltsassistenten. Da geht es normalerweise ziemlich eng zu. Hier drüben neben der Verteidigung sind die Geschworenenbänke. Die bestehen aus vierzehn Sitzen, zwölf für die Geschworenen und zwei für die Ersatzleute. In den meisten Bundesstaaten besteht die Jury nach wie vor aus zwölf Personen, aber es können auch weniger oder mehr sein. Unabhängig von der Zahl muss das Urteil einstimmig sein, zumindest bei Strafverfahren. Die Ersatzleute werden für den Fall benannt, dass einer der zwölf krank wird oder aus einem anderen Grund ausfällt. Die Geschworenen sind letzte Woche ausgewählt worden, davon bekommen wir also nichts mit. Ist auch ziemlich langweilig.« Der Laserpointer wanderte zu einem Punkt vor dem Richtertisch. »Hier sitzt die Gerichtsschreiberin an einer Maschine, einem sogenannten Stenografen. Sieht so ähnlich aus wie eine Schreibmaschine, funktioniert aber ganz anders. Ihre Aufgabe ist es, jedes Wort festzuhalten, das während der Verhandlung gesprochen wird. Das klingt unmöglich, aber bei ihr sieht es ganz einfach aus. Später erstellt sie ein sogenanntes Transkript, ein Protokoll für Verteidigung, Anklage und Richter, in dem alles aufgezeichnet ist. Manche Transkripte sind Tausende von Seiten lang.« Der Laserpointer bewegte sich erneut. »Hier, in der Nähe der Gerichtsschreiberin und praktisch unter dem Richtertisch, befindet sich der Zeugenstand. Dort nehmen die Zeugen Platz, nachdem sie vereidigt worden sind.«
»Wo sitzen wir?«
Der Laserpointer wanderte in die Mitte des Diagramms. »Das hier nennt sich ›Bar‹. Auch so eine komische Bezeichnung. Es handelt sich um ein Holzgeländer, das die Zuschauer vom eigentlichen Verhandlungsraum trennt. Normalerweise gibt es im Zuschauerraum mehr als genug Platz, aber nicht bei diesem Prozess.« Der Laserpointer wanderte zum hinteren Teil des Sitzungssaals. »Hier oben, hinter den letzten Reihen, befindet sich die Galerie mit drei langen Bänken. Da oben sitzen wir, aber keine Sorge: Von dort hört und sieht man alles.«
»Noch Fragen?«, erkundigte sich Mr. Mount.
Die Jungen fixierten die Grafik. »Wer fängt an?«, fragte einer.
Theo begann, auf und ab zu gehen. »Da die Beweislast beim Staat liegt, muss die Anklage ihre Argumente zuerst vortragen. Morgen früh wird der Staatsanwalt vor den Geschworenen stehen und sie direkt ansprechen. Das wird als Eröffnungsplädoyer bezeichnet. Er wird den Fall aus seiner Sicht schildern. Dann tut der Verteidiger dasselbe. Danach ruft die Anklage ihre Zeugen auf. Wie ihr wisst, gilt für Mr. Duffy die Unschuldsvermutung. Deswegen muss die Staatsanwaltschaft seine Schuld nachweisen, und zwar so, dass kein begründeter Zweifel möglich ist. Er plädiert auf ›nicht schuldig‹, was in der Praxis nicht oft vorkommt. Etwa achtzig Prozent der des Mordes Beschuldigten bekennen sich irgendwann schuldig, weil sie es nämlich sind. Gegen die übrigen zwanzig Prozent wird Anklage erhoben, und neunzig Prozent von ihnen werden verurteilt. Es kommt also nur selten vor, dass ein Angeklagter in einem Mordprozess für nicht schuldig befunden wird.«
»Mein Dad meint, er ist schuldig«, sagte Brian.
»Da ist er nicht der Einzige«, erwiderte Theo.
»Bei wie vielen Verhandlungen warst du dabei, Theo?«
»Keine Ahnung. Dutzenden.«
Da keiner der anderen fünfzehn je auch nur einen Sitzungssaal von innen gesehen hatte, konnten sie das kaum fassen.
»Falls ihr viel fernseht, dürft ihr nicht zu viel erwarten«, fuhr Theo fort. »Eine echte Verhandlung ist ganz anders und nicht halb so aufregend wie im Fernsehen. Es werden keine Zeugen aus dem Hut gezaubert, es gibt keine dramatischen Geständnisse, und die Verteidiger prügeln sich auch nicht mit den Staatsanwälten. Bei diesem Prozess gibt es keine Augenzeugen. Das bedeutet, dass die Anklage auf Indizienbeweisen beruht. Dieses Wort werdet ihr oft zu hören bekommen, vor allem von Mr. Clifford Nance, dem Verteidiger. Er wird darauf herumreiten, dass die Staatsanwaltschaft keine unmittelbaren Beweise hat und dass die Anklage nur auf Indizien beruht.«
»Was heißt das eigentlich?«, wollte einer wissen.
»Das bedeutet, dass es sich um mittelbare, nicht um unmittelbare Beweise handelt. Bist du zum Beispiel heute mit dem Rad zur Schule gefahren?«
»Ja.«
»Und hast du es am Fahrradständer an der Fahnenstange festgekettet?«
»Ja.«
»Wenn du also heute Nachmittag aus der Schule kommst, zum Fahrradständer gehst und feststellst, dass dein Rad weg und die Kette durchgeschnitten ist, liegt ein mittelbarer Beweis dafür vor, dass jemand dein Rad gestohlen hat. Keiner hat den Dieb gesehen, deswegen gibt es keinen unmittelbaren Beweis. Nehmen wir mal an, die Polizei findet dein Rad morgen in einer Pfandleihe in der Raleigh Street, einem Laden, der dafür bekannt ist, dass dort gestohlene Fahrräder verkauft werden. Der Eigentümer nennt der Polizei einen Namen, die ermittelt und stößt auf einen Typen, der schon früher Räder gestohlen hat. Dann hast du überzeugende mittelbare Beweise dafür, dass der Kerl dein Dieb ist. Keine unmittelbaren Beweise, sondern Indizienbeweise.«
Selbst Mr. Mount nickte dazu. Er leitete als Fachschaftsberater den Debattierkreis der achten Klasse, und sein Star war Theodore Boone– wie hätte es auch anders sein können. Er hatte nie einen Schüler gehabt, der so messerscharf argumentieren konnte.
»Danke, Theo«, sagte Mr. Mount. »Und danke, dass du uns die Plätze für morgen besorgt hast.«
»Keine Ursache«, erwiderte Theo voller Stolz und setzte sich.
Es war eine begabte Klasse an einer ausgezeichneten staatlichen Schule. Justin war mit Abstand der beste Sportler, wobei Brian der schnellere Schwimmer war. Ricardo schlug alle bei Golf und Tennis. Edward spielte Cello, Woody E-Gitarre, Darren Schlagzeug, Jarvis Trompete. Joey hatte den höchsten IQ und die besten Noten. Chase war der verrückte Professor, der ständig fast das Labor in die Luft sprengte. Aaron sprach Spanisch wie seine Mutter, Deutsch wie sein Vater und natürlich Englisch. Brandon trug vor der Schule Zeitungen aus, handelte online mit Wertpapieren und hatte fest vor, der erste Millionär der Gruppe zu werden.
Natürlich gab es auch zwei hoffnungslose Nerds und mindestens einen potenziellen Kriminellen.
Diese Klasse hatte sogar ihren eigenen Anwalt, was Mr. Mount noch nie erlebt hatte.
Drei
Die Kanzlei Boone & Boone hatte ihre Büroräume in einem umgebauten alten Wohnhaus in der Park Street, dreihundert Meter von der Main Street und zehn Gehminuten vom Gericht entfernt. In diesem Viertel gab es jede Menge Anwälte, und die Wohnhäuser in der Park Street beherbergten mittlerweile nur noch Geschäftsräume– Anwälte, Architekten, Steuerberater, Ingenieure und andere hatten sich dort niedergelassen.
Die Kanzlei bestand aus zwei Anwälten, Mr. und Mrs. Boone, die in jeder Hinsicht gleichberechtigte Partner waren. Mr. Boone, Theos Vater, war Anfang fünfzig, wirkte aber viel älter. Zumindest fand Theo das, obwohl er es wohlweislich für sich behielt. Sein Vorname war Woods, was in Theos Ohren wie ein Familienname klang. Tiger Woods, der Golfer. James Woods, der Schauspieler. Bisher war ihm noch kein anderes menschliches Wesen untergekommen, das den Vornamen Woods trug, weswegen er sich jedoch keine grauen Haare wachsen ließ. Er versuchte, sich nicht über Dinge aufzuregen, die er nicht ändern konnte.
Woods Boone. Manchmal sagte Theo den Namen schnell vor sich hin, dann klang er wie woodspoon. Er hatte nachgesehen: woodspoon war eigentlich kein Wort, hätte aber gut eines sein können. Ein Holzlöffel war kein woodspoon, sondern ein wooden spoon. Aber wer benutzte schon Holzlöffel? Außerdem war das Ganze sowieso nebensächlich. Trotzdem dachte Theo jedes Mal, wenn er den Namen seines Vaters in schwarzen Lettern an der Bürotür prangen sah, unwillkürlich an das Wort woodspoon. Er konnte es sich einfach nicht abgewöhnen.