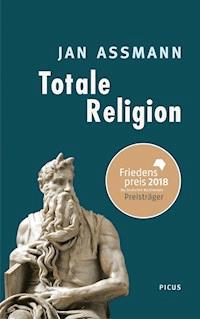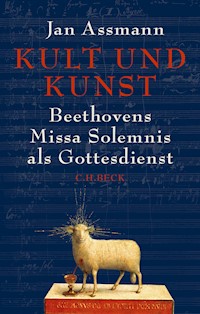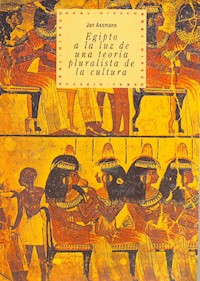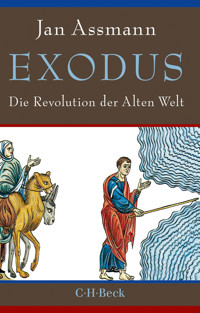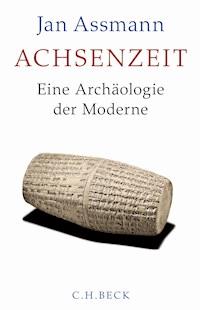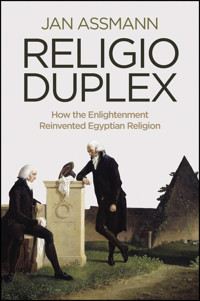18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jan Assmann geht den bahnbrechenden religions- und kulturwissenschaftlichen Einsichten Thomas Manns nach, die dieser vor allem in seinem Romanzyklus Joseph und seine Brüder vermittelt. Auf faszinierende Weise läßt er seine Leser nicht nur das literarische Kunstwerk der Josephsromane mit neuen Augen sehen, sondern vor allem auch den Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Thomas Mann. In der Begegnung mit dem Alten Ägypten erschloß sich Thomas Mann eine kulturelle Tiefendimension der Zeit. Seine Josephsromane kreisen um die Frage, die auch Proust, Bergson und Freud beschäftigte: in welcher Weise die Vergangenheit unsere Gegenwart bestimmt, und sie geben darauf einige der klügsten, reflektiertesten und differenziertesten Antworten. Gerade in seinen Einsichten zum Wesen des Mythos, zur Entstehung des Monotheismus, zum kulturellen Gedächtnis und zur historischen Anthropologie und Psychologie erweist sich Thomas Mann als einer der bedeutendsten Kultur- und Religionswissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Den bislang noch wenig erschlossenen Dimensionen seines Werkes geht Jan Assmann in seinem neuen Buch nach. Es geht hier um ´"das mythische Selbst", einen der kühnsten Entwürfe historischer Anthropologie, die "mythische Zeit", ein Problem, das Thomas Mann auch in anderen Romanen und Essays beschäftigte, sowie um das spannungsreiche, aber für Mann in keiner Weise sich ausschließende Verhältnis von Mythos und Monotheismus. Assmann beschreibt das Ägyptenbild der Josephsromane und vergleicht die Josephsgeschichte Manns mit der biblischen Erzählung sowie ihrer ägyptischen Urgestalt. Höchst aufschlußreich sind auch die abschließenden Vergleiche mit zeitgenössischen Werken wie Arnold Schönbergs Moses und Aron und Sigmund Freuds Der Mann Moses.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jan Assmann
Thomas Mann und Ägypten
Mythos und Monotheismus in den Josephsromanen
Verlag C.H.Beck
Zum Buch
Jan Assmann geht den bahnbrechenden religions- und kulturwissenschaftlichen Einsichten Thomas Manns nach, die dieser vor allem in seinem Romanzyklus Joseph und seine Brüder vermittelt. Auf faszinierende Weise läßt er seine Leser nicht nur das literarische Kunstwerk der Josephsromane mit neuen Augen sehen, sondern vor allem auch den Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Thomas Mann.
In der Begegnung mit dem Alten Ägypten erschloß sich Thomas Mann eine kulturelle Tiefendimension der Zeit. Seine Josephsromane kreisen um die Frage, die auch Proust, Bergson und Freud beschäftigte: in welcher Weise die Vergangenheit unsere Gegenwart bestimmt, und sie geben darauf einige der klügsten Antworten. Gerade in seinen Einsichten zum Wesen des Mythos, zur Entstehung des Monotheismus, zum kulturellen Gedächtnis und zur historischen Anthropologie und Psychologie erweist sich Thomas Mann als einer der bedeutendsten Kultur- und Religionswissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Den bislang noch wenig erschlossenen Dimensionen seines Werkes geht Jan Assmann in seinem neuen Buch nach. Er beschreibt das Ägyptenbild der Josephsromane und vergleicht die Josephsgeschichte Thomas Manns mit der biblischen Erzählung sowie ihrer ägyptischen Urgestalt. Höchst aufschlußreich sind auch die abschließenden Vergleiche mit zeitgenössischen Werken wie Arnold Schönbergs Moses und Aron und Sigmund Freuds Der Mann Moses.
„Assmanns glänzend geschriebenes Buch … zeigt, daß viele von Thomas Manns erzählerischen Konzepten den Erkenntnissen der neuesten Wissenschaft entsprechen.“ Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung
Über den Autor
Jan Assmann ist Professor em. für Ägyptologie an der Universität Heidelberg und Professor für allgemeine Kulturwissenschaft an der Universität Konstanz. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Historikerpreis (1998), Thomas-Mann-Preis (2011), Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa (2016), Karl-Jaspers-Preis (mit Aleida Assmann, 2017) und dem Balzan Preis (mit Aleida Assmann, 2017). Zahlreiche Gastprofessuren und Forschungsaufenthalte vor allem in den USA, Frankreich und Israel. Er ist Mitherausgeber der kritischen Ausgabe von „Joseph und seine Brüder“ im Rahmen der „Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe“ der Werke Thomas Manns (2018). Zu Jan Assmanns bekanntesten Büchern gehören „Das kulturelle Gedächtnis“ (72013), „Ägypten. Eine Sinngeschichte“ (42005), „Moses der Ägypter“ (72011), „Tod und Jenseits im Alten Ägypten“ (32010) sowie „Exodus. Die Revolution der Alten Welt“ (32015).
WOLF-DANIEL HARTWICH(1968–2006)in memoriam
Inhalt
Vorwort
IDer Brunnen der Vergangenheit
Zum Ursprung der Dinge – und zurück
Ironie, Wissenschaft und tiefere Bedeutung
Bruch contra Kontinuität
Fiktion und Fest
IIDas mythische Ich
Die mythische Würde des Ich
Mondgrammatik und das «nach hinten offene Ich»
Schrift und Selbst
Mythische und rituelle Identität
IIIDie mythische Zeit
Mythische Gleichzeitigkeit
Das kulturelle Gedächtnis
Das Unbewußte – die «kotigen Wurzeln»
IVÄgypten: Urteile und Vorurteile
Erste Initiation: Jaakobs Vorurteil und Josephs Vorbehalt
Zweite Initiation: der midianitische Kaufmann
Dritte Initiation: die Reise nach Theben
VVersuchung
Die biblische Geschichte von Potiphars Weib
Die griechische Version: Bellerophontes und Anteia
Die ägyptische Urform: der Hirte und das Weib des Ackermanns
Joseph und Mut-em-enet
Keuschheit, Scham und Sünde
VIMonotheismus bei Echnaton und bei Abraham
Joseph und Echnaton
Abrahams Gott und der Weg des Monotheismus
VIIMonotheismus und Widerstand:Sigmund Freud, Thomas Mann, Arnold Schönberg
Sigmund Freud: der Fortschritt in der Geistigkeit
Thomas Mann: Gott ist die Zukunft
Arnold Schönberg: das Denkbare und das Lehrbare
Abkürzungen und Zitierweise
Anmerkungen
Zitierte Literatur
Namenregister
Sachregister
Vorwort
«Höchst anmutig ist diese natürliche Erzählung», schrieb Goethe in Dichtung und Wahrheit über die Geschichte Josephs in den letzten 14 Kapiteln des 1. Buchs Mose, «nur scheint sie zu kurz, und man fühlt sich berufen, sie ins einzelne auszumalen.» Dieser Berufung hat sich Thomas Mann, der ja gern in den Spuren Goethes ging, ab 1925, kurz nach Erscheinen des Zauberberg gestellt. Was zunächst als Novelle geplant war, wuchs sich schnell zu einem vierbändigen Riesenwerk aus; das Ende 1926 geschriebene «Vorspiel» setzt bereits die Proportionen der Tetralogie voraus. Nach ausgedehnten Vorstudien und einer Mittelmeerreise im Jahre 1925 begann Thomas Mann 1926 mit der Niederschrift.[1] Der erste Band, Die Geschichten Jaakobs, erscheint erst 1933, aber Lesungen und Erstabdrucke einzelner Kapitel gehen bis 1927 zurück. 1934 folgt der zweite Band, Der junge Joseph. Der 1936 erschienene dritte Band ist dann bereits weitgehend im Schweizer, der vierte Band, der nach einem langen Intervall erst 1943 erschien, im kalifornischen Exil entstanden. Nicht nur nach ihren Proportionen, sondern auch nach ihrem künstlerischen und vor allem intellektuellen Anspruch steht die Joseph-Tetralogie neben den großen Romanwerken der Moderne, Prousts Recherche und Joyces Ulysses;was jedoch den Stoff und die Form seiner Behandlung betrifft, stehen die vier Josephsromane in der Literaturgeschichte ziemlich einzigartig dar. Es handelt sich hier ja nicht nur um einen Zyklus historischer Romane, die in einer ganz ungewöhnlich weit zurückliegenden Epoche spielen, sondern auch um eine Art literarischen Recyclings, die ausschmückende Erzählung einer altbekannten Geschichte, die denn auch weniger erzählt, als vielmehr «zelebriert» wird im «Fest der Erzählung», das den feierlich gestimmten, archaisierenden Ton der Erzählung bestimmt.
Diese Sonderstellung, der ehrfurchtgebietende Umfang und vielleicht auch die archaisierende Sprache haben einer breiten, den anderen Hauptwerken – Buddenbrooks, Der Zauberberg, Doktor Faustus – vergleichbaren Rezeption der Josephsromane lange Zeit im Wege gestanden. Vor allem haben die Wissenschaften, bei denen sich Thomas Mann für diese Romane bedient hat, also alttestamentliche Theologie, Judaistik, Assyriologie, Ägyptologie und Religionsgeschichte auf diese einzigartige Anregung und Herausforderung kaum reagiert, die diese Romane für sie darstellen sollten. Obwohl Thomas Mann auf diesen Gebieten im allgemeinen der Nehmende war, geht man trotzdem sicher nicht fehl, wenn man ihn zu den bedeutendsten Religions- und Mythostheoretikern seiner Zeit rechnet.
An diesem Punkt setzt das vorliegende Buch an. Ich strebe keine literaturwissenschaftliche Behandlung der Josephsromane an, setze mich also weder mit Fragen von Form und Stil, Aufbau und Erzählperspektive auseinander noch mit der Frage der Quellen, die Thomas Mann in seinem Werk verarbeitet hat, auch wenn es sich im Fortgang der Untersuchung immer wieder als unmöglich erwiesen hat, von diesen beiden Aspekten ganz abzusehen. Zweitens will ich weder die bestehenden Kommentare zu den Josephsromanen (vor allem den kleinen, unschätzbaren Kommentar von Hermann Kurzke, Mondwanderungen, und das monumentale Handbuch zu Thomas Manns Josephsromanen von Bernd-Jürgen Fischer) ergänzen noch dem Kommentar zur Großen Frankfurter Ausgabe, an dem ich (mit Dieter Borchmeyer, Peter Huber und bis zu seinem Tod am 15.1.2006 Wolf-Daniel Hartwich) selbst mitarbeite, in irgendeiner Weise vorgreifen. Mein Ziel ist vielmehr, einige der großen Themen zur Geschichte Gottes und des Menschen aufzugreifen, die Thomas Mann in diesen Romanen anschneidet und die er nicht nur mit der unvergleichlichen Sprachkunst des Dichters, sondern auch mit der bewundernswerten Kühnheit und Gescheitheit eines ungewöhnlich gebildeten Intellektuellen behandelt. Darüber will ich mit dem Autor von der anderen Seite der historischen Wissenschaft, besonders der Ägyptologie und der Religionsgeschichte, ins Gespräch kommen und so einige der zahllosen Anregungen aufnehmen, die Thomas Mann in dieser Richtung ausgestreut hat.
Diese Studie ist aus einer Vorlesungsreihe hervorgegangen, die ich auf Einladung der Münchner Universitätsgesellschaft und des Thomas-Mann-Förderkreises im November 2005 an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität gehalten habe. Ich danke Inka Mülder-Bach sehr herzlich für die Vermittlung dieser Einladung und die ebenso gastliche wie intellektuell inspirierende Rahmung der Vorlesungen. Mein Dank gilt ferner dem Verlag C.H.Beck für die Drucklegung und großzügige Ausstattung meines Textes und Ulrich Nolte für die sorgfältige Betreuung im Lektorat. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meinen Freunden Nicole und Florian Ebeling, die mich bei meinen Münchner Vorlesungen nicht nur begleitet und betreut, sondern auch noch beherbergt und verwöhnt haben. Zweimal, 1992/93 und 2002/03, hatte ich das Glück, mit dem Heidelberger Germanisten Dieter Borchmeyer, der zu den hervorragendsten Thomas-Mann-Kennern gehört, Seminare über die Josephsromane zu veranstalten, an denen auch Wolf-Daniel Hartwich, beim ersten als Student, beim zweiten als Privatdozent, sehr maßgeblich beteiligt war. Am zweiten Seminar nahmen darüber hinaus der Neutestamentler Klaus Berger und der Assyriologe Stefan Maul teil. Dieter Borchmeyer, Peter Huber und Hermann Kurzke nahmen die Mühen einer kritischen Lektüre des Manuskripts auf sich. Ihnen allen bin ich für zahlreiche Anregungen und Hinweise zu Dank verpflichtet. Widmen möchte ich dieses Buch in Trauer und Dankbarkeit dem Andenken des allzu früh verstorbenen, genialen Germanisten und Religionswissenschaftlers Wolf-Daniel Hartwich, mit dem mich in diesem wie in vielen anderen Themen ein enger, langjähriger Gedankenaustausch verband.
IDer Brunnen der Vergangenheit
Die Frage des Menschen aber, woher er kommt, wohin er geht, die Frage nach seiner Stellung im All ist uns allen in diesen aufwühlenden Jahrzehnten zum geistig-religiösen Anliegen geworden, zum Problem, das sich jeder Lösung entziehen und bestimmt sein mag, ein Geheimnis zu bleiben, dem aber der Denker, der Anthropolog, der Altertumsforscher und Paläontolog, der Gesellschaftsphilosoph, der Dichter, jeder auf seine Art und mit seinen Mitteln seinen produktiven Tribut darzubringen sich gedrängt fühlt.[1]
Zum Ursprung der Dinge – und zurück
«Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?» Mit diesen Worten – einem der ganz großen Anfänge der Romanliteratur – beginnt Thomas Manns Tetralogie der Josephsromane. Die Seiten, die mit diesen Sätzen anheben, sind als «Vorspiel: Höllenfahrt» überschrieben. Dieses «Vorspiel» ist etwas ganz Einzigartiges, wie der ganze Roman ja in seiner Art ein kühnes, nie dagewesenes und einzigartiges Unterfangen ist. Eine der Besonderheiten dieses Vorspiels ist, daß es keine Einleitung in die mit dem ersten Kapitel anhebende Romanhandlung darstellt und auch gar nicht dem erzählenden Genre angehört. Der Roman könnte ebensogut ohne dieses Präludium anfangen, das den Leser mit Themen und Gedankengängen befrachtet, die zunächst einmal in dem was folgt kaum eine Rolle spielen und den Einstieg eher erschweren als erleichtern. Und tatsächlich ist der erste, «Ischtar» überschriebene Abschnitt des ersten Hauptstücks ein klassischer, einleitender Romananfang, der in großen geographischen und astronomischen Linien die raumzeitlichen Koordinaten absteckt, in denen sich die folgenden Szenen abspielen. Dies ist zweifellos der eigentliche Anfang der Erzählung; das «Vorspiel» ist ein Stück für sich und steht auf einer anderen Ebene. Bei einer Oper unterscheidet man zwischen einer «Ouvertüre», die vor geschlossenem Vorhang erklingt, auch allein für sich gespielt werden kann und dem symphonischen Genre angehört, und einer «Introduktion», die bei sich öffnendem Vorhang erklingt, bereits zur ersten Szene und zum dramatischen Genre gehört. Genau so läßt auch Thomas Mann seine Joseph-Tetralogie anheben: Das Vorspiel der Höllenfahrt, ein Essay im erörternden Genre, der auch für sich allein gelesen werden könnte, bildet die Ouvertüre, und der einleitende, «Ischtar» überschrie-bene Abschnitt des ersten Kapitels im erzählenden Genre bildet die Introduktion. Dazu hat aber Thomas Mann die beiden so verschiedenen Formen durch einen Trick miteinander verknüpft, indem er das erörternde Vorspiel unmittelbar, in musikalischer Terminologie würde man sagen «attacca», in das erste Kapitel übergehen läßt, wobei das Stichwort «Brunnen» die Brücke bildet. Vom allegorischen Brunnen der Vergangenheit, dessen unergründliche Tiefe das Vorspiel andeutet, versetzt uns das erste Kapitel an einen echten Brunnen, an dem sich die ersten Szenen der Handlung abspielen. Das Vorspiel verhält sich also zum Roman wie eine Ouvertüre zur folgenden Oper, in der ja auch einzelne wichtige Motive schon anklingen, die aber auch für sich allein aufgeführt werden kann und ihre eigene Struktur mit Anfang, Mitte und Ende hat.[2]
In der Tat ist ja die «Höllenfahrt» dem Vorspiel zur Ring-Tetralogie Richard Wagners nachempfunden, diesem in tiefster Tiefe auf dem Contra-Es anhebenden und dann über schier endlose Takte hin ausgefalteten Es-Dur-Akkord,[3] aber bei Wagner ist die thematische Nähe des gurgelnden und sprudelnden Es-Dur zum Thema Rhein (Rheingold, Rheintöchter), das sich in der folgenden Szene auftut, sehr viel leichter nachzuvollziehen. Thomas Mann dagegen gibt sich alle Mühe, sein Vorspiel zu einem ganz und gar eigenständigen und anspruchsvollen Essay auszugestalten. So locker nun aber die Beziehung des Vorspiels zu den ersten Kapiteln, so dicht ist sie zur Tetralogie insgesamt.
Worum geht es in diesem Essay? Es geht um die Vergangenheit und den Versuch, sich in ihr zu orientieren. Erzählen hat ja, wie wir von Harald Weinrich gelernt haben, mit der Vergangenheit zu tun. Alles Erzählen ist eine Rekonstruktion der verlorenen Vergangenheit und eine Exploration jener Dimension, die Thomas Mann mit der Brunnentiefe oder auch mit den Dünenkulissen einer Strandwanderung vergleicht. Die erzählende oder mythische Erinnerung macht sich an «Ursprüngen» und Erstmaligkeiten fest, die sich bei näherer Betrachtung als bloße «Kulissen» oder «Vorgebirge» erweisen, hinter denen sich immer weitere Kulissen auftun, ohne daß die forschende Rückbesinnung jemals an absoluten Anfängen haltmachen könnte. Im zweiten Band seiner Philosophie der symbolischen Formen, der dem mythischen Denken gewidmet ist und 1925, also gleichzeitig mit Thomas Manns Vorarbeiten zum Joseph-Projekt erschien, hat Ernst Cassirer etwas ganz Ahnliches als den Gegensatz von Mythos und Geschichte beschrieben:
Wenn die Geschichte das Sein in die stetige Reihe des Werdens auflöst, innerhalb dessen es keinen ausgezeichneten Punkt gibt, in dem vielmehr jeder Punkt auf einen weiter zurückliegenden hinweist, so daß der Regreß in die Vergangenheit zu einem regressus in infinitum wird – so vollzieht der Mythos zwar den Schnitt zwischen Sein und Gewordensein, zwischen Gegenwart und Vergangenheit, aber er ruht in der letzteren, sobald sie einmal erreicht ist, als einem in sich Beharrenden und Fraglosen aus.[4]
Der Mythos löst das Sein nicht ins Gewordensein auf, sondern verleiht ihm Tiefe, Bedeutung und Farbe. Der Forscher aber, der durch die mythischen Bilder hindurch den Stufen des Gewordenseins nachgeht, läuft Gefahr, sich in den anfangslosen Abgründen der Geschichte zu verlieren. Spielerisch, oder, wie er selbst es nennt, «in einer Art von pseudowissenschaftlich-humoristischer Fundamentlegung»[5] schlüpft Thomas Manns Erzähler-Persona in diesem Vorspiel in die Rolle des Forschers, der sich auf eine solche Zeitreise in die scheinbar bodenlose Vergangenheit begibt.
Dieses als «Höllenfahrt» überschriebene Vorspiel inszeniert das Vorhaben der Erzählung als eine Zeitreise, und diese als eine senkrechte Fahrt hinab in den Brunnenschacht der Vergangenheit. An die christliche «Hölle» dürfen wir dabei nicht denken; der Titel zitiert einen babylonischen Mythos, der als «Ischtars Höllenfahrt» bekannt war. Der Abstieg in die Unterwelt (Descensus ad inferos) ist ein in der ganzen Alten Welt und weit darüber hinaus verbreitetes mythisches Ur-Motiv, das im Christentum bis heute lebendig ist.[6] Zugleich ist ein Leit- und Zentralmotiv des ganzen Romanzyklus, wie im letzten Abschnitt des dritten Kapitels gezeigt werden soll, die Grundstruktur des Mythos, den Joseph seinem Selbstverständnis und seiner Lebensführung zugrunde legt, der Weg vom Leben durch Tod und Unterwelt zu neuem Leben. Thomas Mann läßt in seinen Josephsromanen konsequent drei verschiedene Bedeutungen von «Tiefe» ineinander übergehen: Welttiefe, Zeittiefe und Seelentiefe. Der Begriff «Hölle» bezieht sich auf die Welttiefe oder das Totenreich; hier aber steht er für die Zeittiefe, «die Unterwelt des Vergangenen» (7/IX), und der Abstieg wird zur Zeitreise. Das Motiv der Zeitreise ist plausibel genug: Das kühne Unterfangen, einen Roman in einer dreieinhalb Jahrtausende zurückliegenden Zeit spielen zu lassen, erfordert eine erklärende Vorbereitung. Dieses Thema wird aber erst am Ende des Vorspiels wiederaufgenommen, wo dem Leser erklärt wird, daß es gar so weit hinab ja nicht geht und daß er es letzten Endes mit Menschen wie unser einem zu tun haben wird, «einige träumerische Ungenauigkeiten ihres Denkens als leicht verzeihlich in Abzug gebracht» (40/LVIII). Das Motiv der Zeitreise bildet nur das Rahmenthema für Erörterungen sehr viel allgemeineren und grundsätzlicheren Charakters.
Ich kann mir keine bessere Einleitung in mein eigenes Projekt denken als eine etwas eingehendere Betrachtung der in diesem Vorspiel angeschnittenen Themen. Es handelt sich da um einen durchaus philosophischen Text, der um die Frage kreist, in welcher Weise uns die Vergangenheit gegeben ist, dieselbe Frage, die auch Proust, Bergson und Freud beschäftigte und der die moderne Kulturwissenschaft unter dem Stichwort des kulturellen Gedächtnisses nachgeht. In diesem Buch möchte ich die Josephsromane als einen Beitrag zu derartigen Fragen diskutieren, und zwar – unabhängig von jeder literarischen Qualität, die hier, wie gesagt, gar nicht zur Debatte steht – als einen der klügsten, reflektiertesten und differenziertesten, den sie nur irgend erfahren haben. Für das Thema des kulturellen Gedächtnisses kann man es nur als einen ganz einzigartigen Glücksfall bezeichnen, daß sich ein Dichter, ein Meister der Sprache seiner angenommen hat.
Ziehen wir also, um diese Fragestellung zu beleuchten, die großen argumentativen Linien des Vorspiels nach. Den Hauptteil zwischen dem Rahmenthema der Zeitreise bildet eine zweifache Bewegung. Zunächst wird am Beispiel dreier Ursprungsmythen der Gedanke der Kulissenbildung illustriert. Der biblische Mythos der Sintflut erweist sich als Umschrift eines viel älteren babylonischen Originals, und dieses wiederum zeigt durch seine vielen kommentierenden Glossen, daß ihm ein noch viel älteres, inzwischen unverständlich gewordenes Original vorausliegen muß. Von einer großen Flut wissen auch chinesische Quellen – sie liegt um 4200 Jahre zurück. Viel weiter in die Vergangenheit verweist der Mythos von Atlantis, das vor 11.000 Jahren in den Fluten versunken sein soll. «Chaldäische Berechnungen» setzen die Flut gar 39 180 Jahre vor der ersten babylonischen Dynastie an. Jede dieser Fluterzählungen ist nur Erinnerung an weiter zurückliegende Erzählungen. Nicht viel anders steht es mit der Erzählung vom Turmbau zu Babel. Wann und von wem wurde der Turm gebaut? Von Nimrod, dem ersten König von Babel? Auch dies ist nur eine Dünenkulisse; hinter ihr erhebt sich die große Pyramide des ägyptischen Königs Cheops, und auch die Leute von Cholula in Mittelamerika hatten ihren großen Turm und sahen in ihm das Bauwerk von Einwanderern aus dem Osten, wohl Kolonisten aus Atlantis. Schließlich die Erzählung vom Paradies. Wo lag der Garten Eden? Handelt es sich um die Oase von Damaskus? Ist damit das Niltal gemeint? Oder Babylon, das «Tor der Götter»? Oder das armenische Hochland? «Mit solcher Einsicht aber», schreibt Thomas Mann, «und indem man dem Lande Armenien die Palme reichte, wäre höchstens der Schritt zur nächstfolgenden Wahrheit getan; man hielte eben nur eine Kulisse und Verwechselung weiter.» Wie in der Zeit, so tun sich auch im Raum immer neue Distanzen auf. Für ihn ist klar, daß
der da und dort angesiedelte Paradiesgedanke seine Anschaulichkeit aus der Erinnerung der Völker an ein entschwundenes Land bezog, wo eine weise fortgeschrittene Menschheit in ebenso milder wie heiliger Ordnung glückselige Zeiten verbracht hatte. Daß hier eine Vermengung der Uberlieferung vom eigentlichen Paradiese mit der Sage eines Goldenen Zeitalters der Menschheit walte, ist nicht zu verkennen. Der Brunnen der Zeiten erweist sich als ausgelotet, bevor das End- und Anfangsziel erreicht wird, das wir erstreben; die Geschichte des Menschen ist älter als die materielle Welt, die seines Willens Werk ist, älter als das Leben, das auf seinem Willen steht. (28/XLf.)
Dreimal setzt der Erzähler, vom Heute ausgehend, an, um in der Zeit zurückdenkend einen Anfang festzumachen, und dreimal muß er erkennen, daß sich hinter diesem scheinbaren Anfang weitere Abgründe auftun. Damit wird die Unergründlichkeit der Brunnentiefe erwiesen, die Vergeblichkeit, im Abstieg in die Vergangenheit jemals auf festen Grund zu stoßen. Dann jedoch kehrt sich die Zeitrichtung um. Der Erzähler tastet sich nun nicht mehr vom Jetzt ausgehend zurück zu dem vermeintlich allerersten Anfang, sondern geht von einem jenseitigen, transzendenten und absoluten Ursprung aus: der «Gestalt des ersten oder des vollkommenen Menschen, des hebräischen adam qadmon, zu fassen als ein Jünglingswesen aus reinem Licht, geschaffen vor Weltbeginn als Urbild und Inbegriff der Menschheit.» Das ist der Roman der Seele, «jener Roman, dessen eigentlicher Held die abenteuernde und im Abenteuer schöpferische Seele des Menschen ist und der, ein voller Mythus in seiner Vereinigung von Ur-Kunde und Prophetie des Letzten, über den wahren Ort des Paradieses und die Geschichte des ‹Falles› klare Auskunft gibt.» Es geht um den Abstieg der Seele aus der göttlichen Lichtwelt in die Niederungen der materiellen Verkörperung. Auch dies ist eine Abwärtsbewegung, das Thema «Tiefe» ist beiden Teilen gemeinsam. Im ersten Teil jedoch geht es um einen chronologischen Abstieg, vom Jetzt zum Einst in illo tempore, im zweiten um einen ontologischen, aus dem Empyreum der Transzendenz in die niedere Welt der Materie.
Trotz dieser Gemeinsamkeit ist aber die Struktur der Gegenbewegung vorherrschend: zuerst aus der Immanenz des Hier und Jetzt heraus und hinein in die nie erreichbare Transzendenz eines absoluten Ursprungs, dann aus der Transzendenz eines absoluten Ursprungs hinein und voraus in die Immanenz der Zeit und Entwicklung. «Es ist kein Zweifel», betont Thomas Mann, «daß hier das letzte ‹Zurück› erreicht, die höchste Vergangenheit des Menschen gewonnen, das Paradies bestimmt und die Geschichte des Sündenfalls, der Erkenntnis und des Todes auf ihre reine Wahrheitsform zurückgeführt ist. Die Urmenschenseele ist das Älteste, genauer ein Ältestes, denn sie war immer, vor der Zeit und den Formen, wie Gott immer war und auch die Materie.» (31/XLIVf.)
Diese Seiten hat Thomas Mann unter intensiver Benutzung eines Aufsatzes des Iranisten und Religionswissenschaftlers Hans Heinrich Schaeder über «Die islamische Lehre vom vollkommenen Menschen, ihre Herkunft und ihre dichterische Gestaltung» (1925) geschrieben. In diesem Aufsatz geht es um den gnostischen Mythos des Urmenschen, wie er in späteren islamischen Quellen verarbeitet wurde, und damit um eine völlig andere Art von Mythos als in den Erzählungen, die Thomas Mann im ersten Teil des Vorspiels behandelt hat. Der erste Teil bezieht sich auf alte Legenden, der zweite auf einen neuen, philosophischen Mythos. Zwischen den Mythen des ersten Teils und dem Mythos des zweiten Teils liegt also eine entscheidende Grenze: die Grenze zwischen dem mythischen Denken des antiken und vorantiken Polytheismus und der theologisch-philosophischen Spekulation der Spätantike, die auf der (platonischen, iranischen, biblischen) Entdeckung der Transzendenz beruht. Der «Roman der Seele» ist von grundsätzlich anderer Art als die Mythen des ersten Teils. Nichtsdestotrotz ist aber auch er ein Mythos und kann daher die Grundlage für Thomas Manns Verfahren bilden, das Prinzip Mythos mit beiden Seiten, der weltimmanent-polytheistischen und der welttranszendent-monotheistischen zu verbinden.
Von dem Roman der Seele, mit dem die Zeitreise in den Brunnen der Vergangenheit an ihr äußerstes Ziel, den absoluten Ursprung aller Dinge, gelangt, greift Thomas Mann dann wieder in die fernste Zukunft aus und entwickelt seinen eigenen Mythos von der Synthese von Seele und Geist, der ein Mythos nicht des Ursprungs, sondern der Zukünftigkeit ist. Steht das Prinzip der «naturverflochtenen Seele» für die Vergangenheit, dann steht das Prinzip des «außerweltlichen Geistes»[7] für die Zukunft. «Das Geheimnis aber und die stille Hoffnung Gottes liegt vielleicht in ihrer Vereinigung, nämlich in dem echten Eingehen des Geistes in die Welt der Seele, in der wechselseitigen Durchdringung der beiden Prinzipien und der Heiligung des einen durch das andere zur Gegenwart eines Menschentums, das gesegnet wäre mit Segen oben vom Himmel herab und mit Segen von der Tiefe, die unten liegt.» (36/LII) In einem Brief an Georg Vollmer, der ihn nach der im Vorspiel vertretenen «Weltanschauung» gefragt hatte, nennt Mann diese Stelle und schreibt: «Dies ist der Humanismus, der, eine Weltanschauung, wenn man will, das ganze Werk durchzieht und hier, wie ein Hauptmotiv einer Oper im Vorspiel zum ersten Mal aufklingt.»[8]
Ironie, Wissenschaft und tiefere Bedeutung
In der Brust des Erzählers, den Thomas Mann in diesem Vorspiel einführt, wohnen zwei Seelen. Er erscheint erstens als ein skeptischer Archäologe, der sich mit den Scheinantworten der Mythen nicht zufrieden gibt und tiefer gräbt, als es die landläufige Uberlieferung wissen will. Er ist ein gelehrter Kommentator, der den biblischen Stoff unablässig auf seine historische Stimmigkeit abklopft und unter dem biblischen Text die noch schwach lesbaren Spuren babylonischer, sumerischer und ägyptischer Textschichten zu entziffern vermag. So stoßen wir zum Beispiel gleich im ersten Satz des ersten Kapitels auf den Ortsnamen Urusalim. In der Tat, so heißt die Stadt Jerusalem in den Amarna-Briefen, der im ägyptischen Tell el-Amarna gefundenen, in babylonischer Sprache abgefaßten diplomatischen Korrespondenz aus dem 14. Jahrhundert v. Chr., dem Jahrhundert, in dem Thomas Mann seinen Roman spielen läßt.[9] Davon weiß die Bibel nichts; hier taucht Jerusalem erst viel später auf, als König David die Stadt von den Jebusitern erobert und zur Hauptstadt seines Königreichs macht. Auch die moderne Stadt Jerusalem weiß von ihrer Vorgeschichte als Urusalim nichts: sie führt sich nur auf David zurück und feierte im Jahre 1996 ihre Dreitausendjahrfeier. Das ist so ein typischer Pseudo-Ursprung, wie ihn der gelehrte Erzähler in diesem Vorspiel aufs Korn nimmt. Die volkstümliche Erinnerung macht sich an Fixpunkten fest, die der Historiker als Konstruktion durchschaut bzw. «dekonstruiert»; das ist die Rolle, in der sich Thomas Manns Erzähler mit sichtlichem Behagen gefällt, aber nicht nur das. Dieser Erzähler ist zweitens auch ein Denker, der seine Beobachtungen und Reflexionen zur Anfangslosigkeit der kulturellen Tiefenzeit zu einer weit gespannten und reich veranschaulichten Phänomenologie und Theorie des kulturellen Gedächtnisses und des mythischen Denkens ausbaut, die sich neben den gleichgerichteten Bemühungen Ernst Cassirers und anderer Theoretiker sehen lassen kann. Wir müssen uns also davor hüten, der berühmten Mannschen Ironie auf den Leim zu gehen: ironisch, humoristisch und pseudowissenschaftlich-spielerisch, wie er selbst immer wieder unterstreicht, ist nur die Rolle als orientalistisch und ägyptologisch ausgebildeter Historiker, also sein Umgang mit Daten und Fakten, zu verstehen. Diese Rolle ist textimmanent und gehört zur Erzählung dazu. Dazu schreibt Thomas Mann in seinem Essay «Joseph und seine Brüder»:
Die erörternde Rede, die schriftstellerische Einschaltung braucht nicht aus der Kunst zu fallen, sie kann ein Bestandteil davon, selber ein Kunstmittel sein. Das Buch weiß das und spricht es aus, indem es auch noch den Kommentar kommentiert. Es sagt von sich selbst, daß die oft erzählte und durch viele Medien gegangene Geschichte hier durch eines gehe, worin sie gleichsam Selbstbesinnung gewinne und sich erörtere, indem sie sich abspiele. Die Erörterung gehört hier zum Spiel, sie ist eigentlich nicht die Rede des Autors, sondern des Werkes selbst, sie ist in seine Sprachsphäre aufgenommen, ist indirekt, eine Stil- und Scherzrede, ein Beitrag zur Schein-Genauigkeit, der Persiflage sehr nahe und jedenfalls der Ironie: denn das Wissenschaftliche, angewandt auf das ganz Unwissenschaftliche und Märchenhafte ist pure Ironie.[10]
Die Ironie bezieht sich also nur auf den skeptischen, erörternden Historiker, aber nicht auf den reflektierenden Denker und seine Ambitionen als philosophisch, religions- und literaturwissenschaftlich gebildeter Intellektueller, und die Einsichten in das Wesen des mythischen Denkens und die Formen und Funktionen des kulturellen Gedächtnisses, an denen diese Romane und ganz besonders der erste so überreich sind, sind nicht nur sehr ernst gemeint, sondern verdienen auch sehr ernst genommen zu werden. Sie sind nicht nur in ihrer erfindungsreichen Anschaulichkeit und ihrem unerschöpflichen Detailreichtum das Schönste, sondern in ihrer geistigen Durchdringung des Gegenstands auch das Klügste, was jemals zur Verankerung des menschlichen Daseins in Vergangenheit und Zukunft, also zum kulturellen Gedächtnis gesagt wurde. Der Erzähler hat seine philosophischen Neigungen so geschickt hinter der ironischen Maske des skeptischen Kommentators versteckt, daß diese Ebene des Werks bisher einigermaßen unterbelichtet geblieben ist. Daher möchte ich den Vorschlag machen, die Josephsromane einmal nicht als sprachliches Kunstwerk, sondern als eine Art «Sachbuch» zu lesen.
Die Lektüre der Josephsromane als «Sachbuch» provoziert einen naheliegenden Einwand. Thomas Mann hat seine Erzählung auf den Ton ironischer Heiterkeit gestimmt und sein Projekt brieflich einmal als einen «Mammut-Spaß» charakterisiert.[11] In einem anderen Brief wehrt er sich dagegen, für einen philosophisch anspruchsvollen Autor gehalten zu werden:
… besonders absurd kommt es mir dann vor, daß man mich manchmal für einen olympisch feierlichen Autor hält, «ponderous» und philosophisch anspruchsvoll, wo ich doch wesentlich ein Humorist bin und all das Meine voll von Späßen und Musik ist.[12]
In seinen brieflichen Äußerungen über das Joseph-Projekt, die Hans Wysling und Marianne Eich-Fischer zu einem «Selbstkommentar» zusammengetragen haben, begegnet das Attribut «humoristisch» auf Schritt und Tritt.[13] Wer die Josephsromane trotzdem als einen wichtigen Beitrag zur historischen Anthropologie und Religionstheorie ernst nimmt, liest sie gegen den Strich und muß sein Unternehmen rechtfertigen. Ohne jeden Zweifel ist ihr Anspruch, die «frommen Historien so [zu] erzählen, wie sie sich wirklich zugetragen haben»,[14] also den Abstand zwischen jeder wissenschaftlichen Rekonstruktion und der niemals unmittelbar wiederzugewinnenden Vergangenheit mit den Mitteln der künstlerischen Imagination im Medium der literarischen Fiktion zu überspringen, spaßhaft, spielerisch und ironisch zu verstehen. Dieser fiktionale Zugriff auf das schlechthin Entzogene läßt sich in einem historischen Roman aber auch ohne jede Ironie und unter vollkommener Ausblendung einer Erzähler-Persona realisieren wie etwa in Flauberts Salammbô. Thomas Mann wählt den umgekehrten Weg und personifiziert diesen Zugriff in der Gestalt eines auktorialen Erzählers, der durch seine unverkennbaren Ironiesignale die fiktional übersprungene Distanz andeutet.[15]