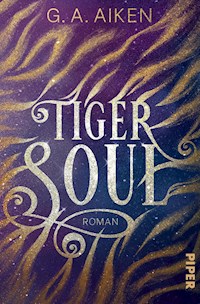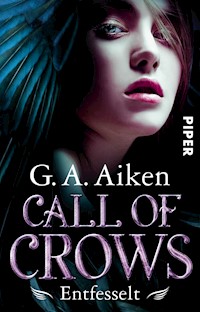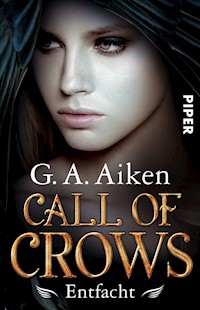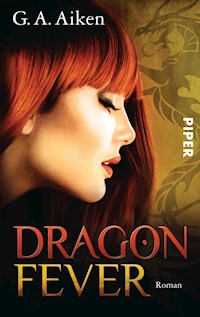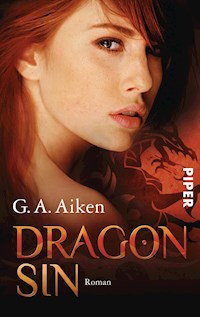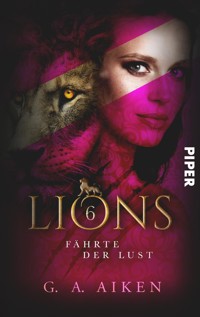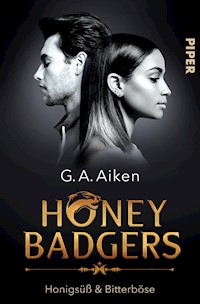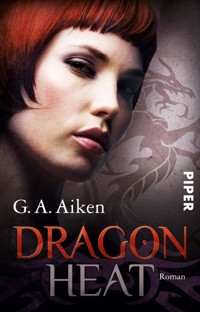9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Shay Malone, Tiger-Gestaltwandler und Partytier, liebt sein Leben und ist immer gut drauf. Seine drei Brüder halten ihn für einen draufgängerischen Faulpelz, der sich nur für das Steak auf seinem Grill oder die nächste Frau in seinem Bett interessiert – aber in Shay steckt viel mehr. Als er und seine Brüder einen großen Plan schmieden, um sich an ihrer kriminellen Großfamilie zu rächen, kann Shay zeigen, was in ihm steckt. Und dann wäre da noch die hübsche Honigdachs-Lady Emily mit ihrem Faible für Sprengstoffe, die ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen will …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Tiger Dreams« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Michaela Link
© Shelly Laurenston 2023
Published by Arrangement with G. A. Aiken
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Born to Be Badger«, Kensington, New York 2023
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Svenja Kopfmann
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: Guter Punkt, Sarah Borchart unter Verwendung von Motiven von iStock/Getty Images Plus
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Kapitel 1
Elf Jahre später …
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Ein paar Tage zuvor …
Jetzt …
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
»Ich bin eine schlechte Mutter.«
Kerrick »Kerry« Jackson sah seine Frau an, während sie sich in ihrer dunklen Küche in aller Ruhe eine spätabendliche Packung Rumrosineneis gönnten. Sie sprachen leise wegen der fünf halbwüchsigen Mädchen, die oben im Zimmer ihrer einzigen Tochter schliefen. Nirgends im Haus brannte Licht, aber im Schein der Mikrowellenleuchte und der Zeitschaltuhr am Elektroherd konnten sie einander trotzdem bestens sehen. Er liebte es, wie das blinkende Licht des Herdes, den seine Frau nie auf die richtige Zeit einstellte, ihr schwarzes Haar – eine Mischung aus Dreads und wilden Locken, die sie oben zu einem unordentlichen Knoten zusammengebunden hatte – hervorhob, vor allem aber den weißen Streifen darin. Und er liebte ihre dunklen Augen, die von weißen Wimpern umrahmt zu ihm herüberspähten. An der Highschool hatten alle gedacht, sie hätte sie sich gefärbt, nur damit sie die »kultige Mom« sein konnte, aber Ayda Lepstein-Jackson hatte nichts gefärbt. Ihr schwarz-weißes Haar war gänzlich naturbelassen, ebenso wie die weiße Augenbraue über ihrem linken Auge.
»Warum sagst du so was?«, fragte er sie.
»Weil wir zu dem Spiel hätten gehen sollen.«
»Das hast du jetzt schon mehrmals gesagt, aber Tock hat sehr deutlich gemacht, dass sie uns nicht dabeihaben wollte.«
»Meinst du?«, fragte Ayda und runzelte die Stirn, sodass sich in der Mitte ein Knubbel bildete – dort, wo sie als Neunjährige angeblich versehentlich gegen einen Telefonmast geknallt war. Der ganze Bereich war damals angeschwollen und die Haut in der Mitte aufgeplatzt. Es gab keine offensichtliche Narbe, aber wenn sie die Stirn runzelte, schob sich die Stelle immer wieder so zusammen wie damals, als sie geschwollen war.
»Natürlich«, erwiderte er. »Sie hat uns in die Augen gesehen und gesagt: ›Ich will euch nicht dabeihaben.‹ Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich noch deutlicher hätte ausdrücken können. Unsere Tochter ist nicht dafür bekannt, sich vage auszudrücken.«
»Unsere Tochter und ihre Mannschaft haben eine nationale Basketball-Meisterschaft gewonnen, und all die anderen Eltern waren in Chicago dabei … Nur wir nicht.«
»Vielleicht haben diese anderen Kinder ihre Eltern dort gebraucht. Aber unsere Tochter braucht uns nicht. Wir mussten nicht für sie oder für ihre Freundinnen da sein.« Den vier Mannschaftskameradinnen, die gerade oben bei ihrer Tochter übernachteten. Ein eingeschworeneres Team hatte er noch nie erlebt. »Nicht mal die Eltern der kleinen Cass waren dort. Ich weiß genau, dass sie in Frankreich sind, um den Louvre zu erkunden.« Er sah seine Frau mit einem wissenden Blick und hochgezogener Braue an, aber sie runzelte nur verwirrt die Stirn.
Kerry machte sich nicht die Mühe, deutlicher zu werden, sondern aß einen weiteren Löffel Eiscreme. »Ich glaube, wir wissen beide, dass die Mädchen noch andere Pläne für die Meisterschaft hatten, als sie zu gewinnen, und sie wollten einfach nicht, dass ihre Familien da sind und ihnen ihr Timing durcheinanderbringen. Du weißt doch, was Zeit und Pünktlichkeit für unsere Tock bedeuten.«
Seine Frau sah ihn an, während sie ihren Löffel ableckte. Langsam ließ sie den Löffel sinken. »Was für andere Pläne?« Sie stieß ein leises Keuchen aus. »Ein Junge?«, fragte sie mit großen Augen. »Oder ein Mann?« Sie keuchte erneut und redete weiter, bevor ihr Mann zu Wort kommen konnte. »Oh mein Gott. Hat sie etwas mit einem erwachsenen Mann? Moment mal … Ist es ein Verbrecher? Hat sie sich mit einem Verbrecher angefreundet?«
»Was?«
»Hat sie ungeschützten Sex mit einem Verbrecher, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist? Und sie nach Chicago gelockt hat, um dort ungeschützten Sex mit unserer minderjährigen Tochter zu haben? Meinst du das?«
Ein paar Sekunden lang konnte Kerry seine Frau nur anglotzen. Er liebte sie. Wirklich. Tat es seit dem Tag, an dem er ihr das erste Mal begegnet war, aber sie war, kurz gesagt, verrückt. Völlig durchgeknallt, wie eine seiner Cousinen sie bezeichnete. Aber tatsächlich liebte er genau das an ihr. Es machte ihr Eheleben … interessant.
»Nein«, antwortete er schließlich und schaute kurz zur Decke, als er etwas hörte, das so klang, als wäre eins der Mädchen aus dem Bett geklettert … oder herausgefallen. »Das habe ich nicht gemeint. Ganz und gar nicht. Ich weiß nicht mal, wie du darauf kommst.«
»Sie ist ein wunderschönes Mädchen. Welcher Verbrecher würde sie nicht wollen?«
Kerry schüttelte den Kopf, um sich das Lachen zu verkneifen, und tauchte seinen Löffel in den Eisbehälter.
»Unsere Tochter«, versicherte er seiner Frau, »ist von niemandem irgendwo hingelockt worden. Noch wird sie jemals von irgendjemandem irgendwo hingelockt werden.«
»Warum wollte sie uns dann nicht mit all den anderen Eltern dort haben?«
»Sind dir nicht die zusätzlichen Reisetaschen aufgefallen, die alle fünf Mädchen von diesem Trip mitgebracht haben?«, fragte Kerry.
Ayda blinzelte. »Was?« Als er nur schwach die Achseln zuckte, schüttelte sie sofort den Kopf. »Nein. Nein, nein, nein. Willst du mir sagen, sie hätten …« Sie senkte die Stimme noch weiter. »… gestohlen?«
»Warum flüsterst du? Du weißt, wer wir sind und was wir sind. Hast du erwartet, unsere Tochter wäre anders?«
»Meine Familie stiehlt nicht, Kerry.«
Er konnte sich ein Schnauben nicht verkneifen. »Machst du Witze? Deine Familie stiehlt vielleicht nur Akten oder Nukleargeheimnisse oder Sprengköpfe, aber es ist trotzdem Diebstahl. Und der liegt unserer Tochter im Blut. Genau wie der weiße Streifen in ihrem Haar und die Tatsache, dass sie Leute auf der Straße anschnauzt, wenn sie das Gefühl hat, sie hätten sich ihr ohne ihre ausdrückliche Erlaubnis auf weniger als zwei Meter fünfzig genähert. Das macht uns zu … uns. Warum erwartest du etwas anderes von unserer Tochter?«
»Einfach so! Ich habe hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass unsere Tochter sich nicht in so was verwickeln lässt. Keine Diebstähle. Keine Lügen. Keine Betrügereien. Und schon gar keine Geopolitik, die ganze Nationen zerstören kann. Das werde ich nicht dulden!«
Kerry ließ seinen Löffel in den Eisbehälter fallen und nahm ihre Hand. »Baby, du kannst nicht leugnen, was unsere Tochter ist.«
»Ich leugne nicht, was wir sind. Ich arbeite bloß daran, dass sie …«
»Ihre Instinkte ignoriert?«
»Nein. Dass sie einen … besseren Weg findet.«
Er atmete tief aus. »Baby, unsere Tochter – Emily ›Tock‹ Lepstein-Jackson – ist und bleibt ein Honigdachs.«
»Nur weil sie ein Honigdachs ist, muss sie nicht …«
»Unhöflich sein? Gemein? Gefährlich labil? Natürlich muss sie das. Weil es uns im Blut liegt, genau wie die hohe Stirn deines Onkels Ishmael und die Tatsache, dass meine Großmutter zu ihrer Zeit Marathons laufen konnte, obwohl eins ihrer Beine kürzer ist als das andere. Unsere Kleine ist, was sie ist. Und das ist eine knurrende, fauchende, siebzehnjährige Diebin, die ein sehr gutes Auge für Schmuck, Kunst und Küchenschränke hat, in denen sie und ihre Dachsfreundinnen die Nacht verbringen können. Daran kannst du nichts ändern.«
»Aber ich habe mich doch auch geändert. Ich bin freundlich …«
»Aber es ist ein Kampf.«
»… Ich stehle nicht …«
»Aber wir wissen alle, dass du es gern tun würdest. Insbesondere, wenn etwas glänzt.«
»… Und ich reiße mir ein Bein aus, um das Richtige zu tun.«
»Das gilt auch für deine Tochter. Deshalb ist sie vor drei Wochen beinahe von der Schule geflogen, weil sie diesen Football-Spieler angegriffen hat, der eine Zehntklässlerin begrapscht hat. Sie kannte das Mädchen nicht mal.«
Ayda schüttelte den Kopf. »Wegen dieser Sache musste ich heftig auf den Schulleiter einreden.«
»Auf ihn einreden oder ein paar ernste Drohungen aussprechen?«
»Eine Kombination aus beidem. Aber sie hatte recht!«, verkündete Ayda plötzlich. »Was der Typ getan hatte, war nicht in Ordnung, und ich unterstütze sie voll und ganz darin, ihre Geschlechtsgenossinnen zu beschützen.« Sie schaute durch die gläsernen Schiebetüren und stieß einen kleinen Seufzer aus. »Aber … trotzdem …«
»Hör auf«, befahl er. »Es ist ihr nichts passiert. Es wird ihr nie etwas passieren. Sie hat wahrscheinlich in irgendeinem Einkaufszentrum einen kleinen Juwelierladen ausgeraubt und sämtliche kitschigen Eheringe und diese billigen Tennisarmbänder gestohlen, die nichtsnutzige Ehemänner ihren Frauen kaufen, für die sie offensichtlich nichts als Verachtung empfinden.«
»Das klingt ein bisschen hart.«
»Ich würde meine Talente niemals darauf verschwenden, dir so was zu besorgen. Du bekommst nur das Beste von dem, was ich auf dem Schwarzmarkt ergattere oder einem guten Juwelier stehlen kann. Genau wie mein Daddy es für meine Mom tut.«
Sie versuchte, ihr Lächeln zu verbergen, aber er sah es trotzdem. Und liebte es.
»Unsere Kleine«, fuhr er fort, »probiert sich nur aus. Wenn sie und ihre kleinen Freundinnen planen, einen Laden im Einkaufszentrum auszurauben, dann sind das nur gesunde Teenager, die ein instinktives Bedürfnis befriedigen.«
Sie zog die Nase kraus, ein Mienenspiel, das er absolut vergötterte. »Das kannst du nicht wirklich glauben.«
»Natürlich glaube ich das. So habe ich auch angefangen. Mit einem dieser Juweliere, die einer Ladenkette angehören und wo die meisten Leute ihre Ringe für zweite und dritte Ehen kaufen. Außerdem, wie süß waren die vorhin denn bitte? Wie sie alle so getan haben, als wären die Taschen nur mit Sachen gefüllt, die sie beim Spiel gekauft haben. Gönn ihnen ihren Triumph. Das wird ihr Selbstbewusstsein stärken.«
Einen Moment lang starrte Ayda ihn mit offenem Mund an. »Glaubst du wirklich, das wäre hilfreich?«, fragte sie dann.
»Das ist hilfreich. Und ich bin hilfreich. Ich helfe dir. Denn eins willst du auf gar keinen Fall: Du willst dich nicht mit unserer Tochter anlegen, und genau darauf arbeitest du hin. Tock kann gemein sein. Meine Tante Lucille spricht nicht mal mehr mit ihr. Sagt, sie sei ein Handlanger des Teufels.«
Ayda entzog ihm ihre Hand und rieb sich die Stirn. »Unsere Tochter ist zu jung, um mit ihren Freundinnen Juweliere auszurauben. Sie weiß nicht, wie gefährlich so was sein kann. Ich könnte wegen dieses einen Raubüberfalls damals, der schiefgegangen ist, ohne Weiteres immer noch in Südafrika im Knast sitzen.«
»Zunächst einmal war es kein Raubüberfall, Baby. Du hast das Kommando über eine Diamantenmine übernommen und eine Militärrebellion angezettelt. Haben sie dich nicht sogar zu ihrer Königin gemacht?«
»Nein!«, fauchte sie zurück. »Sie haben mich zur Göttin des Blutes unserer Feinde gemacht, was eine Ehre war, wie du eigentlich wissen solltest.«
»Und deine Mutter war diejenige, die dich außer Landes gebracht hat, und sie war auch der Grund, warum wir einige meiner Cousins und Cousinen nicht besuchen können.« Er schüttelte den Kopf. »Südafrika will dich nicht wiederhaben, Baby.«
»Dessen bin ich mir bewusst. Und das alles will ich nicht für unsere Tochter.«
Er runzelte die Stirn. »Will sie denn nach Südafrika?« Ayda schlug mit beiden Fäusten auf den Tisch. »Verdammt noch mal, Kerry!«
Ein lauter, dumpfer Schlag draußen vor den Glastüren ließ sie vor Schreck den Streit vergessen, in den sie sich gerade hatten hineinsteigern wollen. Sie schauten hinüber und sahen einen Mann mit dem Gesicht nach unten auf ihrem Rasen liegen.
»Wer zur Hölle ist das?«, wollte Ayda wissen.
»Ich habe keine …«
Noch jemand schlug auf dem Boden auf, gefolgt von zwei weiteren Personen. Einige Sekunden später landeten neben den Männern lautlos Tock und ihre vier Honigdachsfreundinnen aus ihrer Mannschaft, die sich aus dem Fenster am Treppenabsatz im ersten Stock hatten fallen lassen.
»Was um alles in der Welt …?«, ächzte Ayda leise.
Aus verschiedenen Gründen war keins der Mädchen nach Hause gefahren, nachdem der Mannschaftsbus sie an der Schule abgesetzt hatte. Während die vollmenschlichen Teamkameradinnen mit der Mannschaftskapitänin zu einer großen Feier im Haus ihrer Eltern gefahren waren, waren Tock und ihre Freundinnen hierhergekommen, um Steaks und Krabben zu essen – frische, noch krabbelnde Skorpione regionalen Ursprungs, versteht sich.
Nach dem Abendessen und ein paar Stunden vor dem Fernseher waren alle fünf Mädchen zu Bett gegangen. Kerry hatte angenommen, dass das alles sein würde. Dass sie bis zum Morgen nichts mehr von den Mädchen hören würden. Wenn sie sich wie normale Teenager verhielten, würden sie sich vielleicht hinausschleichen, um etwas Gras zu rauchen oder ein paar Bier zu trinken. Mehr hatte er wirklich nicht erwartet.
Aber jetzt wurde ihm klar, dass er es hätte besser wissen müssen. Schließlich waren Tock und ihre Freundinnen nicht wie er und seine Geschwister. Oder wie Ayda und ihre Familie. Sie waren nicht nur Honigdachs-Gestaltwandler. Sie waren Honigdachse. In ihren Herzen. In ihrem Blut. In ihren Seelen. Sie konnten den Honigdachs in sich nicht abschalten, um sich den Menschen anzupassen. Viele andere Gestaltwandler wussten nicht mal, dass es ihresgleichen überhaupt noch gab.
Deren Familien konnten sich ohne Probleme oder Bedenken in jede Versammlung einfügen. Sie konnten jahrelang unter Vollmenschen leben … jahrzehntelang …, ohne sich anmerken zu lassen, dass sie beim sonntäglichen Familienessen gegrillte Wassermokassinschlange in Barbecuesoße und mit Gift versetzte Weine genossen. Aber es gab auch Dachse, die sich nicht anpassten. Sie machten sich nicht die Mühe. Weil es sie nicht interessierte. Jetzt begriff er, dass seine Tochter und ihre Freundinnen so waren … Diese Mädchen waren echte Honigdachse. Gemeine, bösartige, knurrende Honigdachse, an die sich niemand von hinten anschleichen sollte. Oder versuchen sollte, sie zu töten, während sie bei einer Freundin übernachteten.
Kerry war zu verblüfft, um seinem Kind irgendwie zu helfen, und musterte stattdessen die Männer am Boden. Er erkannte Gangster aus Chicago, wenn er welche vor sich hatte. Gangster, die in seinem Haus waren, weil sein Kind nicht etwa irgendwas aus einem Laden in einem Einkaufszentrum gestohlen hatte. Nein, sie hatte einen Raubüberfall auf jemanden ausgeheckt, vorbereitet und durchgeführt, der viel gefährlicher war. Jemand, der seine Schlägertruppe aussandte, um seinen Besitz von kleinen Mädchen zurückzubekommen, selbst wenn sie dafür jeden im Haus umbringen mussten.
Kerry war beeindruckt. Er wettete, dass das Timing des Überfalls perfekt gewesen war. Denn wenn seine Tochter eines konnte, dann war es, das richtige Timing abzupassen.
Was für törichte, törichte Männer das gewesen waren. Sie hatten sich nichts dabei gedacht, in ein Haus in einem Vorort mitten in Wisconsin einzudringen, um die Sachen ihres Chefs zurückzubekommen. Wie schwer konnte das schon sein, hatten sie sich wahrscheinlich gedacht. Kleinen Mädchen Schmuck wieder wegzunehmen.
Aber Tock und ihre Freundinnen … Er musste fast lachen.
Die Mädchen steckten immer noch in ihren Schlafklamotten für die Übernachtungsparty im Lepstein-Jackson-Haus. Tock hatte Kerrys altes Football-Trikot aus dem College an, obwohl sie sich für den Sport gar nicht interessierte. Mads zeigte sich in ihrem Chicago-Bulls-Basketball-Trikot, das so lang war, dass es ihr bis über die Knie fiel. Auf der Rückseite prangte der Name »Jordan«. Die kleine Cass Gonzalez, die von den anderen Mädchen »Streep« genannt wurde, weil sie immer wie auf Knopfdruck losheulen konnte, wenn man sie beschuldigte, etwas aus dem Lehrerzimmer ihrer Highschool gestohlen zu haben, trug ein Hello-Kitty-Nachthemd, Hello-Kitty-Socken und ein Hello-Kitty-Stirnband, das ihr langes braunes Haar zurückhielt. Gong Zhao steckte in etwas, das Kerry nur als ein Seidennegligé mit dazu passendem Morgenmantel bezeichnen konnte, der in der Taille mit einem ebenfalls passenden Seidengürtel zusammengehalten wurde. Es wirkte ein bisschen zu erwachsen für ein kaum siebzehnjähriges Mädchen, aber Gong – deren Spitzname aus irgendeinem Grund Nelle lautete – trug nie typische Teenagerkleidung. Alles in ihrem Schrank war Designermode, einschließlich dessen, was sie gerade anhatte. Und warum eine Siebzehnjährige ein Lacroix-Negligé mit passendem Morgenmantel trug, wusste Kerry wirklich nicht. Max MacKilligan, die wie immer lächelte, hatte Laufshorts an und ein abgeschnittenes T-Shirt mit der Sängerin Pink auf der Vorderseite.
Sie hatten ihre Outfits aber definitiv vor dem Schlafengehen noch ergänzt, wie zum Beispiel einige Ketten aus Gold und Platin mit Diamanten. Oder um Ringe mit Rubinen und Smaragden an ihren Fingern. Um dicke Platinarmbänder an den Handgelenken und – bei den Kleineren unter ihnen – um ihren Bizeps herum. Und mindestens zwei der Mädchen trugen Diademe, von denen er sich fast sicher war, dass sie früher einmal einer europäischen Königsfamilie gehört hatten. Nichts davon hatten sie getragen, als sie nach oben verschwunden waren.
»Ist das eins der Schmuckstücke der holländischen Königsfamilie?«, fragte seine Frau mit ehrfürchtiger Stimme, als sie auf Gongs Hals zeigte.
»Ja, ich glaube schon.« Wo auch immer sie eingebrochen waren, es war wahrscheinlich von außen ein ganz normales Juweliergeschäft gewesen, aber im Keller oder auf einer anderen Etage wurden meistbietend gestohlene Juwelen vertickt. Darauf hatte sein Kind es abgesehen.
Kerry wusste nicht, was ihn mehr verwirrte und beunruhigte. Wie seine Tochter und ihre Freundinnen von diesem Laden in Chicago erfahren hatten. Oder wie die Leute in Chicago den Aufenthaltsort seiner Tochter und ihrer Freundinnen so schnell ermittelt hatten. Niemand, absolut niemand würde vermuten, dass eine Handvoll halbwüchsiger Mädchen einen solchen Laden ausraubte. Ein einfacher Schaufenstereinbruch vielleicht, aber ein durchgeplanter Raub mitten in der Nacht, bei dem keine Alarmanlage losging und keine Cops auftauchten, bis der Manager am nächsten Morgen erschien, um den Laden zu öffnen? Das war ein Job für alte Hasen, die sich seit Jahrzehnten als Juwelendiebe betätigten. Das war ein letzter Job vor dem Ruhestand. Kein Anfängerjob für fünf Mädchen, die noch auf der Highschool waren.
Tock gab den Mädchen ein Zeichen, und sie setzten sich in Bewegung. Kerry konnte nur einen schnellen Blick auf eine gleichermaßen schockierte Ayda werfen. Die Siebzehnjährigen benutzten Handzeichen, um sich lautlos zu verständigen; als wären sie für einen Kampfeinsatz ausgebildet. So was taten sie nicht mal auf dem Spielfeld. Dort brüllten sie einander an, wenn sie bei einem Spiel eine bestimmte Taktik anwenden wollten. Aber wenn sie es mitten in der Nacht mit Leichen zu tun hatten …
Kerry schüttelte kurz den Kopf. Er wusste, dass sein Mädchen etwas Besonderes war, aber verdammt!
Cass packte einen Arm und wollte gerade einen Leichnam fortschleifen, als ihr Blick auf Kerry und Ayda fiel. Sie stieß ein merkwürdiges kleines »Iiiks« aus, das Kerry und Ayda selbst durch die Glastüren gut hören konnten.
»Was ist?«, flüsterte Mads.
Cass deutete nur mit einem Ruck ihres Kinns auf Kerry und Ayda, und alle Mädchen sahen sie an. Starrten sie an. Ihre Augen glitzerten in der Dunkelheit wie die aller anderen nachtsichtigen Tiere.
Einen Moment lang dachte Kerry, dass die Mädchen einfach weglaufen und die Leichen zurücklassen würden. Er würde ihnen keinen Vorwurf daraus machen. Es war eine normale pubertäre Reaktion darauf, mit Leichen erwischt zu werden.
Natürlich rief er sich ins Gedächtnis, dass dies keine »normalen« pubertären Jugendlichen waren. Nicht mal normale pubertäre Honigdachse.
Das wurde deutlich, als die kleine Max MacKilligan einen Arm hob, winkte und ihnen beiden zugrinste. »Hi, Mr und Mrs Jackson! Herrliche Nacht, hmm?«
Darauf fiel Kerry keine Antwort ein. Er war sich nicht mal sicher, ob er antworten sollte. Denn das wäre wirklich merkwürdig gewesen.
Aber er musste von diesem Gedanken ablassen, als er sah, wie seine geliebte Tochter langsam auf die Glastüren zukam. Ihr Gesicht wurde immer finsterer, je näher sie kam.
»O mein Gott«, hörte er seine Frau flüstern, »sie wird uns beide umbringen.«
Als Tock die Tür erreichte und sie beide böse anstarrte, war er sich plötzlich nicht mehr so sicher, ob Ayda wirklich so verrückt war. In dem Moment war Kerry wirklich davon überzeugt, dass seine Tochter mit dem Gedanken spielte, sie beide zu töten. Nicht weil sie es wollte oder weil sie sie hasste, sondern weil sie zu viel gesehen hatten. Eine entsetzliche Entscheidung, aber wenn er ehrlich sein wollte, eine sehr logische. Und seine Tochter handelte immer logisch.
Er hielt den Atem an, als sie langsam ihre Hand hob und unvermittelt einen Finger gegen das Glas stieß.
»Ist das mein Rumrosineneis?«, fragte sie scharf.
Kerry und Ayda sahen beide auf die Eisdose hinab, die sie leer gegessen hatten, dann tauschten sie einen Blick. Sie waren sprachlos, aber Tock wartete auf eine Antwort.
Ayda räusperte sich. »Es ist Rumrosine«, sagte sie dann leise.
»Also ist es mein Rumrosineneis«, zischte seine Tochter ärgerlich. »Alles Rumrosineneis in diesem Haus gehört mir. Das weißt du doch, Ma.«
Seine Frau blinzelte einige Male, bevor sie antwortete: »Ich … ähm … schätze, das stimmt. Du liebst ja dein Rumrosineneis.«
»Wirst du es mir ersetzen?«, wollte sein Kind wissen, das endlich wie ein echter Teenager klang.
»Es gibt noch mehr in der Tiefkühltruhe in der Garage«, teilte Kerry ihr mit.
»Bist du dir sicher?«, hakte Tock nach.
»Ich sorge immer dafür, dass Rumrosineneis im Haus ist, Süße. Ich kenne dich ja«, fügte er hinzu.
»Ich werde wirklich sauer, wenn keins da ist. Ich hatte vor, es zum Frühstück zu essen.«
»Das ist doch kein Frühstück«, entgegnete er.
»Für mich schon. Versuch nicht, mir Vorschriften zu machen, Dad«, meckerte sie.
Dann wandte sie sich ab und wies auf die Leichen.
Ohne ein weiteres Wort bückten sich die Mädchen und schnappten sich Arme oder Beine. Cass und Gong nahmen einen Leichnam, Tock und Max einen anderen. Mads hievte sich einen großen Mann auf die Schulter und packte dann das Bein des letzten. Auch Tock bückte sich und nahm ein Bein, und gemeinsam spazierten die Mädchen mit ihrer Beute davon.
Als sie zwischen den Bäumen hinterm Haus verschwanden, sah Ayda ihn mit einem Gesichtsausdruck an, den man nur als … angespannt bezeichnen konnte.
»Bevor du in Panik gerätst«, begann er und ignorierte dabei ihre hochgezogenen Brauen und weit aufgerissenen Augen, »sie werden diese Leichen ganz sicher auf Hyänenland vergraben. Du weißt schon … Weil wir alle unsere Leichen auf Hyänenland begraben.«
Sie begann, mit den Fingern ihrer linken Hand auf den Holztisch zu trommeln. Kein gutes Zeichen. Seine Frau war viel beängstigender, wenn sie verstummte. Mit der schwatzhaften, hysterischen Ayda konnte man reden. Aber mit der stummen, mit den Fingern trommelnden, zornig dreinblickenden Ayda nicht.
»Okay«, sprach er weiter. »Ich schätze, du machst dir keine Sorgen darüber, wo sie die Leichen vergraben wollen.«
Die Finger trommelten.
»Oder darüber, dass deine Tochter und ihre Freundinnen in unserem Haus still und leise vier bewaffnete Gangster getötet haben, ohne dass wir es mitbekommen haben …«
Die Finger trommelten unaufhörlich weiter.
»Oder woher diese Gangster überhaupt wussten, dass Tock und ihre Freundinnen die Diebe waren.«
Die Finger trommelten immer noch.
»Ich vermute stattdessen, dass du versuchst herauszufinden, wie deine Mutter in all das verwickelt ist.«
Das Trommeln hörte sofort auf, und sie ballte die Finger zur Faust.
Kerry lehnte sich auf dem Stuhl zurück. »Ja«, sagte er mit einem langen Seufzer, »das habe ich mir gedacht.«
Kapitel 1
Elf Jahre später …
Zuerst wurde sie von hinten angerempelt. Dann folgte eine gemurmelte Entschuldigung. Zu guter Letzt wurde ihr ein Stück Papier in die linke Hand gedrückt.
Emily »Tock« Lepstein-Jackson ging weiter durch die Menge, ohne den Mann anzusehen, der sie angerempelt hatte. Stattdessen wartete sie, bis sie an einer Baustellentoilette vorbeikam. Sie ging nicht hinein. Das konnte sie nicht. Sie ging darum herum und blieb zwischen dem Baustellenklo und dem einen Meter achtzig hohen Sicherheitszaun stehen, um sich das Stück Papier in ihrer Hand anzusehen.
So was war schon eine ganze Weile nicht mehr passiert, weil sie für niemanden arbeitete. Nun ja, zumindest für keine Regierung. Für die Gestaltwandler-Nation hingegen schon. Der galt ihre wahre Loyalität. Regierungen waren wandelbare Gebilde. An einem Tag ein demokratisches Paradies, am nächsten ein totalitärer Albtraum. Sie wollte geschichtlich betrachtet nicht auf der falschen Seite landen, also schenkte sie ihre Loyalität der einen Gruppe, die sich seit Tausenden von Jahren nicht verändert hatte. Den Gestaltwandlern. Ihr einziges Ziel bestand darin, für die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Art zu sorgen. Sie wollten keine wissenschaftlichen Experimente sein. Sie wollten nicht, dass man sie jagte und Trophäen aus ihnen machte. Sie wollten keine Sexspielzeuge für jene sein, die sie »exotisch« fanden. Und sie wollten definitiv nicht als Steaks auf dem Teller irgendeines Vollmenschen landen.
Das war ein Glaubenssystem, dem Tock sich verschreiben konnte. Und nicht einem Auftraggeber, der ihr heimlich mitten auf einem Straßenfest zu Ehren der Großmutter ihrer Teamkameradin einen Zettel in die Hand drückte. Sie war mit ihren vier Mannschaftskameradinnen und einigen Raubkatzen in Detroit, um sich zu entspannen. Um leckeres Essen zu essen, ein bisschen Streetball zu spielen und vielleicht ein wenig mit den süßen Typen aus der Gegend zu flirten. Nicht, um Teil einer verdeckten Operation zu werden, die dazu führen konnte, dass sie …
»Scheiße.«
Tock knüllte den Zettel zusammen, holte ein Feuerzeug hervor, das sie nur für solche Sachen benutzte – schließlich rauchte sie nicht –, und steckte das Papier in Brand. Sie hielt es zwischen Daumen und Zeigefinger, bis nur noch ein winziges Fetzchen übrig war. Ihre Finger schmerzten ein wenig von der Flamme, aber sie würden schnell wieder verheilen.
Sie ließ den verbliebenen Fetzen fallen und ging um die Baustellentoilette herum. Dann holte sie ihr Handy hervor und schickte rasch eine Nachricht an ihre Mannschaftskameradinnen: Muss abzischen. Sehen uns dann wieder in Manhattan. Bin pünktlich zum Training zurück.
Die letzte Zeile richtete sich speziell an Mads. Sie wusste, dass das Mads’ erste Frage sein würde. Ihre professionelle Gestaltwandler-Mannschaft war auf dem Weg zum Finale, und ihre Freundin würde nicht zulassen, dass sich irgendwas zwischen ihr Team und einen möglichen Sieg bei der diesjährigen Meisterschaft stellte. Denn wenn es um Basketball ging, war Mads ein wenig … besessen. Doch so war sie schon immer gewesen. Seit dem Tag, an dem Tock ihr das erste Mal begegnet war. Mads liebte Basketball. Was logisch war, wenn Tock genauer darüber nachdachte. Basketball war Mads’ »sicherer Ort«. Ein Ort, an dem ihr niemand etwas anhaben konnte. Buchstäblich. Sie hatte praktisch Flügel an den Füßen. Ganz gleich, wie ätzend sich Mads’ Familie ihr gegenüber benahm – und sie waren schon immer verflucht ätzend gewesen –, konnten sie nichts sagen, was Mads beim Basketball verunsichert hätte. Weil Mads einfach so gut darin war.
Natürlich war auch Tock keine schlechte Spielerin. Sie nahm die Sache nur nicht so ernst wie Mads. Aber sie gewann gern. Und sie war sehr gut darin, zu gewinnen. Sie hatte sogar einen kleinen »Wir-haben-euch-fertiggemacht«-Tanz drauf.
Sie sollte sich wirklich nicht in Gefahr bringen – was bedeutete, möglicherweise die Meisterschaft zu riskieren –, aber sie wusste, dass es Zeiten im Leben gab, in denen man eine Bitte nicht ignorieren konnte. Selbst wenn man es wirklich gern getan hätte.
Abseits des Straßenfestes fand Tock schnell den Wagen, der auf sie wartete. Alle Informationen, die sie brauchte, hatten sich auf diesem Zettel befunden: Der Wagen, mit dem sie zu dem ungefähr eine Stunde entfernten Flugplatz fahren würde, der Privatjet, mit dem sie zurück an die Ostküste fliegen würde, und eine Andeutung dessen, was sie tun würde, wenn sie dort angekommen war.
Sie schob ihre Hand unter den hinteren linken Radkasten des Autos, bis sie den Schlüssel spürte, der am Metall klebte. Als sie ihn herauszog, schloss sie die Tür per Funk auf und ließ den Motor an. Tock ging zur Fahrerseite und öffnete die Tür.
»Wo geht’s denn hin?«
Erschrocken schaute sie zu der Raubkatze auf. Der Mann lehnte an der Beifahrerseite des Wagens, während er aus einer fettigen Papiertüte eine jamaikanische Teigtasche mit Rindfleisch aß.
»Was machst du hier?«, fuhr sie ihn an. »Warum folgst du mir?«
Sie war mindestens eine Meile von dem Straßenfest entfernt. Er musste ihr gefolgt sein!
Er zuckte die Achseln. »War nur neugierig.« Ohne mit dem Essen aufzuhören, hielt er ihr die fettige Papiertüte hin. »Teigtasche? Die sind wirklich gut. Ich hatte schon, hmm, acht.«
»Katzen«, seufzte Tock.
Shay Malone beobachtete den Honigdachs. Sie funkelte ihn an, aber er war sich nicht sicher, warum. Er hatte eigentlich gar nichts getan. Er war einfach nur neugierig, ob sie gerade dieses wirklich schöne Auto stahl. Ein nagelneuer Mercedes-Benz, der locker über hundert Riesen gekostet hatte, war nichts, was sich jemand so einfach als Mietwagen aussuchte. Und wer ließ den Schlüssel im Radkasten?
Leute, die nichts Gutes im Schilde führten. Solche Leute taten das.
Und Honigdachse führten nie etwas Gutes im Schilde, nicht wahr? Zumindest nach dem, was er bis jetzt mitgekriegt hatte.
Tock lehnte sich über das Autodach und knurrte: »Geh. Weg.«
»Klaust du dieses Auto?«, fragte er. »Das ist echt nicht cool.«
»Was? Nein. Ich klaue nicht …«
»Ich weiß, es ist ein Reiche-Leute-Auto, aber das bedeutet nicht, dass du es dir einfach so nehmen kannst. Das ist nicht okay. Stehlen ist nicht okay.«
»Ich stehle gar nichts. Und jetzt verpiss dich.«
»Wenn du nicht stiehlst, was machst du dann?«
»Ich muss mich um was kümmern. Jetzt geh.«
»Okay, ich werde Mads einfach erzählen, dass du mit einem Auto weggefahren bist, das dir nicht gehört, und dass du die ganze Zeit geflüstert hast. Mitten in Detroit.«
Tock kniff die Augen zusammen und schaute dann sofort auf die Uhr an ihrem Handgelenk. Es war eine große Armbanduhr, und sie sah sehr teuer aus. Vielleicht die Uhr ihres Freundes. Er wusste es nicht. Er hatte nie gefragt.
Sie knurrte. »Steig ein. Mach schon.«
Zum Glück war der Wagen eine Limousine, kein kleines zweitüriges Nichts, in das seine Beine kaum hineinpassten, geschweige denn seine Schultern.
Sobald sie im Wagen saßen und Türen und Fenster geschlossen waren, sagte Tock: »Ich muss jemandem helfen. Ich stehle nichts. Das Auto wurde für mich hier abgestellt.«
»Moment mal … Soll ich Mads und die anderen …«
»Nein!« Sie schloss erneut die Augen und stieß einen Seufzer aus. »Ich will sie da nicht mit reinziehen.«
»Warum nicht?«
»Das ist meine Sache. Und jetzt verschwinde.«
Shay dachte einige Sekunden lang nach, bevor er antwortete: »Nö.«
»Nö? Wie meinst du das, ›Nö‹?«
»Ich meine, nö. Ich gehe nirgendwohin. Wenn du schon auf die Unterstützung deiner Freunde verzichtest, solltest du wenigstens mich dabeihaben. Ich kann helfen.«
»Ich brauche deine Hilfe nicht.«
»Entweder fahre ich mit, oder ich hole Mads. Und wenn sie hört, dass du so kurz vor eurem Finale ganz allein irgendwas Gefährliches machst …«
Tock umklammerte das Lenkrad mit beiden Händen und begann, durch die Nase einzuatmen und durch den Mund auszuatmen.
»Was machst du da?«, fragte er.
»Das ist eine Beruhigungstechnik, die mich hoffentlich davon abhält, dich totzuprügeln.«
»Ich versuche nur …«
»Hör auf zu sagen, dass du helfen willst. Du bist einfach eine Nervensäge.«
Shay erwiderte nichts. Er starrte sie nur an, bis sie den Kopf zu ihm drehte.
Ihre Augen weiteten sich. »Fängst du gleich an zu weinen?«, fragte sie scharf.
»Nein.« Und das tat er wirklich nicht. »Aber meine Gefühle sind verletzt.«
»Was? Katzen haben keine Gefühle!«
»Haben wir doch. Und du hast meine verletzt. Aber ich bin eine Verpflichtung eingegangen – ich begleite dich. Trotz deiner grausamen Worte. Die mich so verletzt haben.«
Sie wollte etwas sagen, zeigte mit einem Finger auf sein Gesicht, hielt inne, stieß einen langen Seufzer aus und fuhr schließlich einfach los.
Als sie an einer Ampel stehen blieben, hielt er ihr die Tüte mit den Rindfleisch-Teigtaschen unter die Nase. »Willst du eine?«, fragte er.
Wie sie ihn anfunkelte. So böse anfunkelte. Sie saßen noch da, lange nachdem die Ampel wieder grün geworden war. Erst als die Autofahrer hinter ihnen anfingen, zu hupen und Flüche aus dem Fenster zu schreien, rührten sie sich.
Dieser Blick … Er wusste ehrlich gesagt nicht, ob er lachen oder sich wie ein verwirrtes Kätzchen unter dem Lenkrad verstecken sollte.
Er war erleichtert, dass er sich weder für das eine noch das andere entscheiden musste. Denn schließlich fuhr sie wieder los und hielt ihm ihre rechte Hand hin, damit er ihr eine Teigtasche in die Handfläche legen konnte.
Tracey Rutowski trat schwungvoll aus dem Gucci-Laden auf der Old Bond Street. Es war früh am Morgen, und sie hatte heute den ganzen Tag Termine an der Royal Academy of Arts, in der Hoffnung, den nächsten Michelangelo oder Monet zu finden. Oder besser noch, den nächsten Mapplethorpe oder Basquiat. Aber zuerst wollte sie ein leer stehendes Ladenlokal in der Nähe überprüfen – vielleicht würde es sich ja als ihre neue Galerie eignen.
Sie blieb vor dem schwarzen SUV stehen, der auf sie wartete, und überreichte die Einkaufstasche mit dem Gucci-Logo, in der sich ihre neue schwarze Handtasche befand, dem Typ, der an der Fahrertür stand – eine Raubkatze. Die neue Tasche würde bei all ihren anderen schwarzen Handtaschen, Rucksäcken und Clutches und den schwarzen Jeans, T-Shirts und Pullovern in ihrem Kleiderschrank landen. Das war ihr Markenzeichen. Schwarz.
Die Katze nahm die Tasche entgegen und rümpfte bei deren Anblick kurz die Nase.
»Was?«
»Noch mehr Scheiß, mit dem du nichts anfangen kannst, für den du aber viel Geld ausgibst?«, antwortete er, bevor er die Einkaufstasche unsanft durch die offene Autotür warf.
»Du bist immer so negativ.«
»Ich bin Realist. Und du hamsterst.«
»Ich hamstere nicht.« Sie wandte den Blick ab, bevor sie hinzufügte: »Ich mag einfach hübsche Dinge. Sei lieber froh, dass ich die Tasche gekauft habe, und nicht mit dem Wachpersonal von Gucci hinter mir die Straße entlanggerannt komme.«
»Du meinst, wie beim letzten Mal?«
»Das war nicht Gucci … Das war Harry Winston, und ich habe nur meine Fertigkeiten auf Zack gehalten. Also, bleib hier«, fuhr sie fort. »Ich muss mir nur ein Gebäude etwa eine Straße weiter anschauen. Danach werden wir …«
»Wirklich?«, warf er ein … in diesem Ton. »Das musst du wirklich jetzt tun?«
Neil Jeffers war ihr Leibwächter, Chauffeur, Assistent und Freund, seit sie sich vor vielen Jahren kennengelernt hatten, als sie beide noch viel zu jung gewesen waren, um zu tun, was sie taten. Aber das hatte sie zusammengeschweißt. Wie Kriegskameraden, nur dass Neil immer noch eine Katze war, also ein Arschloch aus Prinzip. Nur, um sie zu ärgern.
»Patrice will, dass ich einen Blick darauf werfe. Das dauert nur fünf Min…«
»Zwanzig. Es wird zwanzig Minuten dauern. Und ich dachte, Patrice wäre im Urlaub.«
»Ist sie auch, aber sie hört nie auf, zu arbeiten. Das wissen wir doch beide. Und sobald ich das erledigt habe, können wir fahren.« Als er die Augen verdrehte, fügte sie hinzu: »Was ist? Was?«
»Nichts. Geh, geh. Lass alle warten, als hätte niemand etwas Besseres zu tun, als auf dich zu warten.«
»Warum der Katzensarkasmus?«
»Das ist kein Sarkasmus. Wir liiieben es doch alle, auf dich zu warten. Es ist der absolute Höhepunkt unseres Tages.«
»Sarkasmus«, beschuldigte sie ihn. Dann wandte sie sich von ihm ab und ging die Straße entlang, bis sie das leer stehende Ladenlokal erreichte, auf das sie ihre Maklerin Patrice angesetzt hatte.
Patrice fand für Tracey häufig die besten Locations für ihre Galerien, ganz gleich, in welchem Land sie waren. Sie arbeiteten seit den Neunzigern zusammen, als Patrice ein ausgebranntes Gebäude in der Bronx für Traceys erste Ausstellung mit jungen Kunstschaffenden aus der Umgebung gefunden hatte. Die meisten von ihnen waren People of Color mit starken politischen Ansichten gewesen, die sie in ihren Werken deutlich zum Ausdruck brachten. Das Event war ein Riesenerfolg gewesen und hatte einige sehr wohlhabende, anspruchsvolle Kunstinteressenten und kritische Stimmen angelockt, neben den Leuten, die Tracey tatsächlich beeindrucken wollte. Aber dann war das NYPD aufgetaucht, und das Ganze hatte sich in einen schrecklichen Aufruhr verwandelt …
Okay, vielleicht hatte sie den Aufruhr ausgelöst, aber die Cops hatten sie sauer gemacht.
Letztendlich hatte dieses kleine Vergehen in ihrem Strafregister ihrer Karriere aber keinen Abbruch getan. In den letzten zwei Jahrzehnten hatte sie sich sogar von einer trendigen und rebellischen zu einer führenden, etablierten Kunsthändlerin entwickelt.
Sie besaß aktuell Galerien in Paris, Rom, Toledo, Manhattan, Los Angeles, São Paulo, Lagos, Johannesburg und Sydney. Auf Anfrage vermittelte sie auch private Kunstkäufe für Milliardäre. Vor ein paar Jahren hätte sie eigentlich eine Galerie in Hongkong eröffnen sollen, aber seit den späten Achtzigern war ihr die Einreise nach China untersagt, also … tja, keine Galerie in Hongkong. Oder in Tokio. Oder, was das betraf, in Seoul. Ostasien hatte sie praktisch verbannt, aber alle paar Jahre versuchte sie trotzdem, sich hineinzuschmuggeln. Es war ja nicht so, dass sie nicht eine Menge Geld mitgebracht hätte. Aber … da stahl man mal ein paar Gegenstände aus der Ming-Dynastie, indem man mit seinen Krallen und seinen Honigdachs-Fähigkeiten ein paar unbekannte Gräber aufbuddelte, und schon waren alle sauer auf einen! Sie war jung gewesen! Ein Teenager! Konnten sie es nicht einfach auf sich beruhen lassen? Vor allem, nachdem sie alles zurückgegeben hatte, was sie mitgenommen hatte?
Und ja, Tracey besaß bereits eine Galerie in London, aber sie hatte ihre Galerie immer in die Old Bond Street verlegen wollen. Eine fast unmögliche Aufgabe für eine Amerikanerin wie sie, es sei denn, man kannte jemanden, der jemanden kannte, der jemanden kannte, der über Beziehungen zum Buckingham-Palast verfügte.
Einem Ort, den zu betreten ihr seit den späten Achtzigern ebenfalls untersagt war.
Ihr Ruf im Parlament war nicht viel besser, aber zumindest hatte man sie nicht so ausgeschlossen wie die Krone. Denn wer wusste schon, wann man sie und ihr sonniges Gemüt brauchte, um dem MI6 noch einmal zu helfen? Nicht dass man um diese Hilfe gebeten hätte, aber sie hatte sie trotzdem freiwillig gegeben. Ob man sie gewollt hatte oder nicht.
Tracey klopfte an die große Holztür. Als niemand reagierte, zog sie an dem hölzernen Griff. Die Tür schwang lautlos auf, und Tracey trat ein.
»Hallo?«, rief sie. »Jemand da?«
Sie schritt weiter hinein und ließ aufmerksam den Blick durch das Gebäude schweifen. Sie würde mehrere Wände einreißen müssen, da hier zuvor ein Bekleidungsgeschäft gewesen war. Aber die hohen Decken waren großartig, und sie liebte das natürliche Licht, das …
Tracey rümpfte kurz die Nase, als sie einen sehr speziellen Geruch wahrnahm … Der ihr in jeder Hinsicht zuwider war.
Hyänen. Verdammte Hyänen.
Sie hasste es, wenn Neil recht behielt. Sie hätte direkt zu ihren Meetings fahren sollen. Und sie hatte noch nicht mal ihre Pistole bei sich. Die hatte sie im Auto gelassen, damit sie problemlos in den Gucci-Laden hatte gehen können. Und bevor sie hergekommen war, hatte sie einfach vergessen, sie einzustecken.
Eigentlich war sie nicht überrascht, dass sie in eine Falle geraten war. Es war nicht das erste Mal, dass man sie in einen Hinterhalt lockte. Oder das zehnte Mal. Wer zählte schon so genau mit? Aber sie war überrascht, dass die Hyäne, die aus dem Schatten auftauchte, kein rumänisches Weibchen mit Muskeln so dick wie Melonen war. Tracey hatte der untalentierten Schlampe einen Matisse direkt vor der Nase weggeschnappt, und sie hatte gewusst, dass das ein Affront war, der nicht ohne Folgen bleiben würde.
Doch das hier … das hier hatte sie nicht kommen sehen.
»Freja?«, fragte sie. Es war Jahre her, seit sie die gemeine Bestie das letzte Mal gesehen hatte. »Freja Galendotter?«
Die Hyäne lächelte. »Hallo, Tracey.«
Weitere Hyänen traten aus den Schatten, die ihr so sehr gefallen hatten, als sie hereingekommen war. Sie umzingelten Tracey, hielten aber Abstand. Denn sie waren alle männlich. Es war keine einzige weibliche Hyäne unter ihnen, außer Freja. Und sie kannte den Grund dafür.
»Stimmt ja.« Sie konnte sich ihr breites Grinsen nicht verkneifen. »Ich habe gehört, dass meine Nichte dir in den Hintern getreten hat. Deinen ganzen Clan mithilfe einiger Löwenmännchen auseinandergenommen hat.« Sie küsste ihre Fingerspitzen wie ein französischer Meisterkoch. »Sensationell.«
Frejas Miene verhärtete sich, und sie starrte Tracey voller Zorn und Hass an. Wobei nichts davon Tracey galt – sie kannten einander kaum, trotz jahrelanger Drohungen –, sondern eher ihrer Tochter. Freja hasste sie, weil sie sich nicht als Superbestie entpuppt hatte. Die Kombination aus Hyäne und Traceys idiotischem Bruder hatte das erzeugt, was meistens bei Kreuzungen mit Dachsen herauskam: einen ganz alltäglichen alten Honigdachs. Genau wie ihr Vater. Honigdachsgene setzten sich bei Gestaltwandlern immer durch. Nicht wie bei diesen Coydogs oder Ligern oder Bärenkatzen. Ganz gleich, was man selbst oder die eigene Familie war, wenn man sich mit einem Honigdachs paarte … bekam man einen Honigdachs. Und die Galendotters ließen ihre arme Nichte das niemals vergessen.
Traceys Mom hatte angeboten, das bedauernswerte Kind in der Familie aufzunehmen, aber Freja war eine derart rachsüchtige Soziopathin, dass sie abgelehnt hatte. Sie hatte das Kind, das sie hasste, behalten, nur um Traceys Bruder unglücklich zu machen. Denn er hatte ihr nicht gegeben, was sie wollte. Einen kleinen Freak, den sie benutzen konnte, um ihre Feinde zu peinigen.
Freja hatte außerdem klargestellt, dass sie Mads höchstpersönlich töten würde, wenn irgendeiner der Rutowskis versuchte, das Kind zu entführen. Dass sie ihr direkt vor deren Augen die Kehle aufschlitzen würde. Damals hatte Tracey diese Drohung geglaubt. Weil Frejas Mutter und die Weibchen ihres Clans tun würden, was immer man ihnen befahl. Und wenn das bedeutete, ein Kind zu töten, würden sie auch das tun. Ohne auch nur eine Frage zu stellen.
Aber das war passiert, bevor Mads sich endlich gewehrt und den Clan ihrer Mutter ausgelöscht hatte. Dieser Angriff heute musste Frejas allerletzter Versuch sein, ihr Schicksal zu wenden. Um wieder zu einem der gefürchtetsten Hyänen-Clans in den Staaten zu werden. Indem sie die Familie ihrer Tochter tötete.
»Lass mich raten«, begann Tracey, »Mads hat deinen Clan vernichtet, und jetzt willst du Rache? Mein Gott!«, platzte sie heraus. »Was hat mein Bruder nur je in dir gesehen? Du bist so langweilig.«
»Ich bin nicht wegen Mads hier. Ich bin deinetwegen hier. Auf deinen Kopf ist so viel Geld ausgesetzt, dass ich damit meinen Clan zurückgewinnen werde. Deshalb bin ich hier.«
»Ich soll glauben, dass das hier nichts mit meiner Nichte zu tun hat?«
»Wegen ihr muss ich gar nichts unternehmen. Sie und ihre Freundinnen und das wertlose Ungeziefer, das ihr alle seid … ihr werdet bekommen, was ihr verdient. Dafür muss ich keinen einzigen Finger rühren.«
Tracey runzelte die Stirn. »Was zur Hölle soll das heißen?«
»Im Moment solltest du dir wirklich Sorgen um dich selbst machen.«
»Wegen dir?« Tracey schnaubte. »Oh, bitte.«
Freja grinste höhnisch. »Ich hätte dich schon vor langer Zeit umbringen sollen.«
»Also bist du jetzt Kopfgeldjägerin?«
»Bei der Summe, die sie für dich anbieten?«
»Ist das Kopfgeld aus Deutschland?«, hakte Tracey nach. Das rumänische Weibchen war nicht mehr in Deutschland.
»Nein.«
»Rom?« Sie senkte die Stimme. »Vom Papst?«
»Was?«, fauchte die Hyäne, die von der Frage offensichtlich überrascht war. »Nein.«
»Sierra Leone?«
»Hör auf damit! Du gehst mir auf die Nerven!«
»Meinem Bruder zufolge ist das nicht schwer.«
Die Hyäne zog eine Pistole aus dem Bund ihrer Jeans und zielte damit direkt auf Traceys Kopf.
»Eine Pistole?«, fragte Tracey lächelnd. »Wie originell.«
»Ich weiß alles über dich. Ich gehe keine Risiken ein.«
»Du? Du weißt über mich Bescheid?«
»Ja. Ich weiß Bescheid. Dachse. Schwer umzubringen.«
»Nein. Ich rede nicht von den Honigdachsen. Ich meine mich. Vielleicht hat mein Bruder dir davon erzählt? Von meiner Vergangenheit.«
»Du warst eine Hure?«, hakte Freja trocken nach.
»Davon abgesehen …« Tracey senkte die Stimme. »Von meinen Verbindungen zu verschiedenen Regierungen? Von dem versehentlichen Militärputsch in Mexiko?« Sie zog eine kleine Grimasse. »Diese bedauerliche Sache mit Margaret Thatcher?« Sie senkte die Stimme noch weiter. »Von Gorbatschow?«
»Was? Wovon redest du? Du klingst wie eine Irre.«
»Also … hat mein Bruder dir nie etwas erzählt. Über mich. Na so was.«
Pete wollte nicht hier sein. Er wollte nicht dieses Stemmeisen in der Hand halten. Er wollte nicht in einem fremden Land sein! Aber er hatte keine andere Wahl. Es war ätzend, eine männliche Hyäne zu sein. Vor allem, wenn man in einen Clan hineingeboren wurde, der von solchen Frauen geführt wurde.
Er war erst sechzehn. Zu jung, um auf eigene Faust loszuziehen. Zumindest hatte seine Mutter das gesagt, bevor sie ihm eröffnet hatte, dass sie und seine Schwestern fortgehen würden, um sich einem anderen Clan anzuschließen, und dass er einfach bei Frejas Clan bleiben könne. Sie hatte ihn wie einen Haufen Müll fallen lassen, und jetzt war er hier. Und gleich würde er zusehen müssen, wie eine Frau in mittleren Jahren erschossen wurde, weil … was? Sie existierte? Und war die Pistole wirklich notwendig? Er war in dem Glauben erzogen worden, dass seinesgleichen keine Waffen brauchte. Sie brauchten nicht zu kämpfen. Aber jetzt war seine Tante kurz davor, eine Frau mittleren Alters mit grauen Ansätzen in ihrem schwarz-weißen Haar und Falten um die Augen herum zu töten. Er wollte ihr nicht wehtun. Er wollte niemandem wehtun! Er wollte einfach gehen. Egal wohin.
Aber bevor er diese Worte herausschreien konnte, hörte er ein Ploppen, und der Onkel, der neben ihm stand, ging schreiend in die Knie. Er konnte gerade noch erkennen, dass das Bein seines Onkels irgendwie nicht richtig aussah, bevor Sekunden später ein Baseballschläger von hinten auf dessen Schultern niedersauste. Er krachte zu Boden und schluchzte vor Schmerz.
Pete sah die Frau an, die jetzt neben ihm stand. Sie war eine relativ kleine Latina mit dichtem braunem Haar, das eine wirre Masse aus Dreadlocks und Locken bildete. Unter dem rechten Auge hatte sie ein winziges Herz-Tattoo und auf ihrer rechten Hand eine größere Tätowierung, irgendwas auf Spanisch. Sie trug eine weite, abgetragene Jeans, die mit Blut bespritzt war … und etwas Farbe, vermutete er, da Blut im Allgemeinen nicht blau, grün oder lila war. Zu den Jeans trug sie ein schwarzes Tanktop mit dem Motörhead-Logo auf der Vorderseite und eine doppelte Silberkette, an der zwei Anhänger baumelten, ein Adler und eine Feder.
Sie würdigte ihn kaum eines Blickes, aber dann hörte er sie fragen: »Wie alt bist du?«
»Se-se-se…« Er schluckte und versuchte es noch einmal. »Sechzehn.«
Mit einer ruckartigen Kopfbewegung wies sie hinter sich. »Geh da rüber«, befahl sie. »Komm niemandem in die Quere. Mach keine Dummheiten.«
»Ja, Ma’am«, murmelte er, bevor er auf die hintere Wand zueilte. Als er sich wieder umdrehte, sah er, wie der Kopf eines seiner Cousins durch den Schwung des Baseballschlägers herumgerissen wurde. Eine andere Frau hatte den Schlag ausgeführt, der seinen Cousin taumeln ließ. Diese hatte kein schwarzes Haar mit weißen Strähnen. Sie war blond, und ihr Haar fiel ihr in einem dicken Zopf über den Rücken. Und sie trug teurer aussehende Kleider als die anderen Frauen. Einen engen schwarzen Rock, eine weiße Seidenbluse und Schuhe mit sehr hohen Absätzen, in denen sie herumwirbelte, ohne auch nur ein einziges Mal auszurutschen oder auf den Hintern zu fallen. Sie duckte sich einfach vor den Schlägen eines anderen Cousins weg, bevor sie ihm die Spitze des Schlägers in den Bauch rammte, dann erneut ausholte und ihn seinem Cousin auf den Kopf krachen ließ. Er ging schwer zu Boden und bewegte sich nicht mehr, atmete aber noch.
Als sie mit ihm fertig war, warf sie den Schläger einer weiteren Frau in mittleren Jahren zu, die ihn mühelos auffing. Sie wirbelte den Schläger einmal in der Hand herum, drehte sich und schlug zu, woraufhin ein Onkel durch den leer stehenden Laden flog. Schlug erneut zu, und ein Cousin krachte gegen einen Pfeiler in der Nähe.
Diese Frau hatte ein weißes, ärmelloses T-Shirt an, eine ärmellose Jeansjacke, graue Jeans und Arbeitsstiefel mit klobigen Absätzen. Ihr Haar war auf einer Seite kinnlang und auf der anderen bis auf den Schädel abrasiert. Die verbliebenen Haare verdeckten gerade noch eine alte Tätowierung, die Pete nicht ganz erkennen konnte.
All diese neu hinzugekommenen Frauen prügelten auf seine Cousins und Onkel ein und rückten dabei immer weiter vor, bis sie die männlichen Mitglieder seiner Familie k. o. geschlagen oder so schwer verletzt hatten, dass keiner von ihnen sich mehr vom Boden erheben konnte.
Schließlich standen die Frauen neben der ersten Frau, auf deren Kopf seine Tante noch immer mit ihrer Pistole zielte. Doch die erste Frau hatte sich nicht bewegt. Sie hatte nicht mal weggeschaut. Sie hatte überhaupt nichts getan, außer dazustehen und seine Tante Freja niederzustarren.
Pete verstand das nicht. Wer waren diese Frauen? Und woher waren sie gekommen? Seine Onkel und Cousins hatten das Gebäude durchsucht, bevor sie sich auf die Lauer gelegt hatten, bis die erste Frau aufgetaucht war. Sie hatten niemanden im Laden gesehen. Hatten niemanden gerochen. Und doch waren sie alle da. Starrten alle seine Tante nieder.
Er wusste, dass alle Frauen Honigdachse sein sollten, aber man hatte ihm, seinen Onkeln und Cousins nur gesagt, sie sollten aufpassen, dass sie keine Waffe oder ein Messer in die Finger bekamen, denn Dachse kämpften nicht fair. Wegen ihrer geringen Größe hielten sie es für ihr gutes Recht, ihre Chancen im Kampf gegen größere Raubtiere möglichst zu erhöhen. Was bedeutete, dass seine Tante Freja es als fair betrachtet hatte, eine Waffe auf diese Dachsfrau zu richten. Scheinbar ging ihr die Gestaltwandler-Ehre am Arsch vorbei. Pete war sich sicher, dass Tante Freja nie damit gerechnet hätte, dass der weibliche Honigdachs Verstärkung bekommen würde oder dass diese zusätzlichen Dachse so verdammt gemein und so geschickt im Umgang mit einem einzigen simplen Baseballschläger waren.
Und es war so einfach für diese Frauen gewesen. Es war kein Kampf, der alle Kämpfe zwischen Honigdachs und Hyäne beenden würde. Eher eine Auslöschung, die weniger als zwei Minuten gedauert hatte und nach der seine Tante nun völlig allein dastand. Ohne Verstärkung. Ohne Schutz. Seine Onkel waren einfach zu lädiert, um sich zu bewegen. Seine Tante mochte ihn auf ihrer Seite wähnen, aber Pete wollte das nicht. Er konnte seine Füße nicht dazu überreden, sich zu bewegen. Nicht mal, um wegzurennen. Er konnte nur gaffen und zittern. Kein hübscher Anblick, wenn man als Raubtier galt, das an der Spitze der Nahrungspyramide stand.
Mit Blick auf seine Tante sagte die erste Frau: »Wenn du denkst, du wärst schnell genug, kannst du den Schuss ab…«
Seine Tante feuerte den Schuss ab. Er hätte der Frau den Kopf wegsprengen müssen. Tat er aber nicht. Weil sie sich bewegte. So schnell, dass Pete es kaum sah. In der einen Sekunde stand sie vor seiner Tante, gute anderthalb Meter entfernt, mit ihren Freundinnen an ihrer Seite. In der nächsten Sekunde hatten ihre Freundinnen sich im Raum verteilt, und die Frau war herumgewirbelt, schaute nun in dieselbe Richtung wie Freja und hielt jetzt deren Hand mit der Pistole fest in ihren beiden Händen.
Ohne Frejas Hand loszulassen, schaffte die Frau es irgendwie, die Pistole auseinanderzunehmen. Sie zerbrach die Waffe nicht in Einzelteile, wie ein Grizzlybär es getan hätte. Noch brach sie Tante Freja die Hand, wie ein Grizzly es definitiv getan hätte. Aber irgendwie nahm sie die Waffe auseinander. Teile davon fielen zu Boden, bis seine Tante nur noch einen Rahmen ohne Munition in der Hand hielt.
Da sie nun keine brauchbare Waffe hatte, griff Freja mit ihrer freien Hand nach dem Hinterkopf der Frau. Die Frau hob einen Arm, beugte ihn, riss ihn zurück und begrub den Ellbogen mitten in Tante Frejas Gesicht. Sie tat das mit solcher Wucht, dass die Nase seiner Tante nicht nur gebrochen wurde. Nein, eine Hälfte davon bohrte sich tief in ihr Gesicht, und Pete war sich nicht sicher, ob sie überhaupt noch durch die Nase atmen konnte.
Als die Frau zurücktrat, rutschte seine Tante zu Boden und schlug sich beide Hände vors Gesicht. Nun stellte die Frau sich zu ihren Freundinnen, und alle vier zogen ihre eigenen Pistolen und zielten damit auf Freja.
Pete wollte aufschreien, in der Hoffnung, sie aufhalten zu können, aber die Frau kam ihm zuvor. »Was zur Hölle macht ihr da?«
Die Blondine schaute zwischen Freja und der Frau hin und her. »Wir töten sie. Oder?« Sie hatte einen starken osteuropäischen Akzent und war hübsch, jetzt, da er sie richtig sehen konnte.
»Nein. Wir töten sie nicht.«
»Nicht?«, wiederholte die Latina. »Warum nicht?«
»Ich habe Mads versprochen, ihre Mutter nicht zu töten.«
»Du meinst, als sie zehn war?«
»Ja! Ich habe ein Versprechen gegeben.«
»Mir hast du ihre Seele versprochen«, knurrte die Blondine.
»O mein Gott.« Die Frau drehte sich zu ihr um. »Geht es schon wieder um deine Vorfahren?«
»Es war das Jahr achthundertsechsundfünfzig …«
»Echt jetzt?«
»… und das Leben in der Rus war hart, aber nicht für Honigdachse. Doch dann überfielen die Galendotters das Dorf meines Volks. Löschten fast all meine Vorfahren aus. Aber wir haben überlebt und Rache geschworen. Und Honigdachse … wir vergessen nie. Wir vergeben nie.«
»Ich werde nicht zulassen, dass du sie wegen eines mehr als tausend Jahre alten Grolls tötest.«
»Was bist du bloß für ein Dachs?«
»Einer, der sein Versprechen gegenüber seiner süßen, sensiblen Nichte hält.«
Die Frau kramte ihr Handy aus der schwarzen Jeans und deutete mit der anderen Hand auf Pete. »Komm her, Schätzchen«, forderte sie ihn freundlich auf.
Da ihm keine anderen Optionen blieben, gelang es ihm endlich, sich in Bewegung zu setzen. In ihre Richtung. Er konnte nicht glauben, dass sie ihn überhaupt wahrgenommen hatte. Er war nicht versessen auf die Idee, neben ihr zu stehen, aber sie tat ihm nicht weh, drohte ihm auch nicht. Legte ihm einfach einen Arm um die Schulter und ging mit ihm zur Tür.
»Ich werde dir eine Telefonnummer geben, die du anrufen solltest«, sagte sie ihm mit aufrichtiger Güte in der Stimme. »Der Mann, der den Anruf entgegennimmt, hilft verwaisten Gestaltwandlern. Er wird dir eine Unterkunft und etwas zu essen besorgen und herausfinden, was du als Nächstes tun willst, damit du nicht zu Frejas Dummheiten zurückkehren musst, wenn du das nicht willst. Okay?«
Er nickte, weil er sich nicht sicher war, was er sonst tun konnte.
»Du hast doch ein Handy, oder?«, fragte sie, als sie draußen waren. Ein schwarzer SUV wartete auf der Straße direkt vor dem leer stehenden Laden. Er spürte, dass der Wagen für sie und ihre Freundinnen bestimmt war.
Pete zog sein Handy hervor, und binnen Sekunden hatte sie ihm die Nummer geschickt. Er betete, dass sie nicht log, aber ihm blieb nichts anderes übrig, als ihr zu vertrauen.
»Also, wenn du da nicht wieder reingehen willst … Und ich an deiner Stelle würde es nicht wollen …«, sie drehte ihn weg von all ihren blutbespritzten Freundinnen, »… solltest du einfach auf die Straße gehen und den Anruf machen. Okay? Mein Freund wird jemand wirklich Nettes schicken, der dich abholt, wenn er selbst das gerade nicht tun kann. Okay?«
Er nickte. »Ja, Ma’am. Vielen Dank.«
»Alles Gute, Schätzchen«, sagte sie.
Er ging und fragte sich, was zur Hölle mit ihm passieren würde, und gleichzeitig war er maßlos erleichtert darüber, von einem Honigdachs eine Art seltsame Erlaubnis erhalten zu haben, nicht in diesen leer stehenden Laden zurückgehen zu müssen, um sich um seine verletzte Familie zu kümmern. Dann hörte er die Dachsfrau etwas in ihr eigenes Handy sagen. Er verlangsamte seinen Schritt, um zu lauschen und sicherzugehen, dass sie nicht jemanden anrief, um ihn zu beseitigen. Aber das tat sie nicht.
»Ich bin’s«, hörte er sie sagen.
Als sie bei dem wartenden SUV ankam, hörte er einen Mann aus dem Innern brüllen: »Ich wusste, dass das passieren würde! Warum hörst du nie auf mich?«
»Meine Nichte steckt in Schwierigkeiten«, sagte die Frau in ihr Handy. »Und wenn meine Nichte in Schwierigkeiten steckt, gilt dasselbe für deine Enkelin.«
Kapitel 2
Sie sprach nicht mit ihm. Nicht während der Fahrt zum Flughafen. Nicht als sie in den Privatjet stiegen, nicht als sie abhoben und … irgendwohin flogen. Sie sagte gar nichts. Aber sie überprüfte immer wieder zwei Dinge: ihr Handy und ihre Armbanduhr. Er verstand nicht, warum sie ihre Armbanduhr überprüfen musste, wenn sie die Uhrzeit mühelos auf ihrem Handy sehen konnte. Andererseits war ihr Spitzname Tock. Nach allem zu schließen, was Mads und die anderen Dachse gesagt hatten, war dieser Frau Zeit sehr wichtig. Vielleicht war es nur eine Angewohnheit, auf ihre Armbanduhr zu schauen. Und es war schwer, Angewohnheiten abzulegen.
Ungefähr eine Stunde nach dem Start verschwand sie im Badezimmer, und als sie zurückkam, trug sie ein enges schwarzes Outfit und dicke schwarze Stiefel. Sie zog eine schwarze Kampfweste an und machte sich daran, mehrere Waffen zu laden. Vier Pistolen mit einer Unmenge an zusätzlichen Magazinen und sechs Messer in verschiedenen Größen. Letztere steckte sie in die Scheiden, die in ihre Kleidung eingenäht waren.
»Das sind aber eine Menge Waffen«, bemerkte er.
»Ach ja?«
»Nun … für mich ist es eine Menge. Ich kenne mich nicht wirklich aus mit Pistolen oder Messern.« Dabei hob er die Hände. »Ich benutze einfach meine Krallen.« Er fuhr besagte Krallen aus und beobachtete, wie seine Finger sich veränderten – wie die kurzen, menschlichen Nägel auf der Stelle verschwanden und die Tigerkrallen aus den Spitzen hervorbrachen. Seine Krallen waren über zehn Zentimeter lang. Länger als die Krallen vollblütiger Amur-Tiger, aber das war typisch für Gestaltwandler-Katzen. Sie neigten dazu, längere Krallen und Reißzähne zu haben als ihre vollblütigen Cousins, und häufig waren sie auch größer als diese und wogen mehr. Was logisch war. Wenn große Gestaltwandler sich mit anderen großen Gestaltwandlern vermehrten, führte das häufig zu noch größeren Jungen und Welpen.
»Siehst du?«, fragte Shay und hielt ihr seine Krallen hin.
Sie schaute auf, runzelte die Stirn und machte sich wieder daran, ihre Waffen zu laden.
Als er begriff, dass sie kein Interesse an einem Gespräch mit ihm hatte, hielt Shay nach einer anderen Beschäftigung Ausschau. Er bemerkte eine lose Fadenschlaufe an dem schicken Ledersitz neben seinem. Neugierig, ob es ihm gelingen würde, die winzige Schlaufe einzufangen, streckte er eine seiner Krallen danach aus …
Als Tock mit dem Laden ihrer Waffen fertig war und sie in die entsprechenden Holster geschoben hatte, sah sie auf ihre Armbanduhr. Die aktuelle Uhrzeit entsprach ihren Schätzungen, was sie immer entspannte, sodass sie sich endlich in ihrem Sitz zurücklehnen und sich einige Minuten Zeit nehmen konnte, um sich geistig vorzubereiten auf …
»Was hast du getan?«, fragte sie scharf und setzte sich aufrecht hin.
Der Tiger sah sie an und blinzelte. Er versuchte nicht, seine Krallen aus den Fäden zu befreien, die er aus dem freien Sitz neben ihm gezogen hatte. Noch versuchte er, die Lederstreifen zu verbergen, die auf den Boden des Jets gefallen waren und die nun einen halb zerfetzten Sitz mitten in dem Privatjet hinterließen, der ihr nicht gehörte.
Nachdem er sein Werk begutachtet hatte, zuckte er die Achseln. »Ich wollte nur sehen, ob …«
»Vergiss, dass ich gefragt habe«, fiel sie ihm ins Wort. Tock war nicht in der Stimmung für Katzenlogik. »Befreie dich einfach aus dem Gewirr und fass nichts mehr an.«
Er zog seine Krallen ein, und das riesige, lose Fadenknäuel fiel auf den Sitz. Aber sobald Shay sich entspannte, beobachtete sie, wie er nach etwas Neuem Ausschau hielt, das er zerreißen konnte. Die Raubkatze war eine Landplage!
Verzweifelt griff sie in ihre Reisetasche und holte eine Zeitschrift heraus.
»Hier«, sagte sie im Befehlston und drückte ihm die Zeitschrift in die Hand. »Lies das!«
»Mechanik?«, las er laut den Titel der Zeitschrift vor. »So was wie Autos?«, fragte er hoffnungsvoll.
»Nein. So was wie Physik.«
Die Hoffnung verschwand aus seinem Gesicht, und er betrachtete das Cover. »Etwas Langweiligeres gibt es nicht.«
»Physik ist nicht langweilig.«
»Doch, irgendwie schon.« Er betrachtete einige Sekunden lang das Cover, bevor er eine Kralle ausfuhr und damit langsam über die makellose Titelseite kratzte. Die Zeitschrift war drei Monate alt, aber sie war immer noch einwandfrei, denn genauso hielt Tock ihre Habseligkeiten. Makellos, sauber, intakt!
Verärgert und verzweifelt beugte sie sich vor und entriss ihm die Zeitschrift. Aber als sie sie genauer betrachtete, sah sie, dass er mit seiner einen Kralle die Hälfte der Seiten aufgeschlitzt hatte.
»Verdammt!«
»Du hättest sie mir nicht wegreißen sollen!«, beschwerte er sich.
»Was ist los mit dir?«, wollte sie wissen.