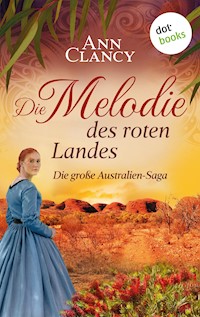4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Es wird das Abenteuer ihres Lebens – Love-and-Landscape-Romantik im australischen Outback England, 1840: Die junge Erbin Georgina Stapleton begibt sich voll freudiger Erwartung auf das prunkvolle Segelschiff nach Australien – ohne zu ahnen, welch grausames Schicksal sie erleiden wird: Vor der Küste Australiens führt ein schrecklicher Sturm zu einem Schiffbruch, den nur Georgina und der mutige Schiffsoffizier Miles Bennett überleben. Auf ihrer abenteuerlichen Reise zurück in die Zivilisation, entwickelt sich zwischen dem ungleichen Paar trotz der rauen Umgebung ein zartes Band aus Gefühlen – , die tiefer gehen, als sich Georgina eingestehen möchte, denn in Adelaide warten Verpflichtungen auf sie. Wird Georgina den Mut aufbringen, ihrem Herzen zu folgen? »Eine wunderbare Autorin!« Channel Nine Die raue Schönheit des roten Landes: Ein romantischer und eindrucksvoller Australienroman für Fans von Di Morissey und Patricia Shaw; jetzt als eBook bei dotbooks.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Ähnliche
Über dieses Buch:
England, 1840: Die junge Erbin Georgina Stapleton begibt sich voll freudiger Erwartung auf das prunkvolle Segelschiff nach Australien – ohne zu ahnen, welch grausames Schicksal sie erleiden wird: Vor der Küste Australiens führt ein schrecklicher Sturm zu einem Schiffbruch, den nur Georgina und der mutige Schiffsoffizier Miles Bennett überleben. Auf ihrer abenteuerlichen Reise zurück in die Zivilisation, entwickelt sich zwischen dem ungleichen Paar trotz der rauen Umgebung ein zartes Band aus Gefühlen – , die tiefer gehen, als sich Georgina eingestehen möchte, denn in Adelaide warten Verpflichtungen auf sie. Wird Georgina den Mut aufbringen, ihrem Herzen zu folgen?
»Eine wunderbare Autorin!« Channel Nine
Über die Autorin:
Ann Clancy ist Australierin mit irischen Wurzeln. In Papua-Neuguinea aufgewachsen, bereiste sie die ganze Welt, bevor sie beschloss, das Schreiben zu ihrem Beruf zu machen. Abenteuerliche Romane über starke, unabhängige Frauen liegen ihr besonders am Herzen. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Adelaide im Süden Australiens.
Ann Clancy veröffentlichte bei dotbooks bereits
»Der Ruf des roten Landes« und »Die Melodie des roten Landes«.
***
eBook-Neuausgabe August 2024
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2013 unter dem Originaltitel »Daughter of the Storm«. Die deutsche Erstausgabe erschien 2013 bei Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Augsburg
Copyright © der englischen Originalausgabe 2013 by Ann Clancy
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2013 by Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/BRONWY GUDGEON, AKV, Kathy SG
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fe)
ISBN 978-3-98952-170-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/egmont-foundation. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tochter der roten Sonne« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Ann Clancy
Tochter der roten Sonne
Die große Australien-Saga
Aus dem Englischen von Marie Henriksen
dotbooks.
Kapitel 1
Plymouth, EnglandFebruar 1840
»Wie aufregend!«, rief Georgina mit einem Blick auf die Treppenstufen, die in die Seite des Schiffs eingelassen waren. »Ich gehe nach dir hinauf, Onkel Hugh!«
Ihre Blicke folgten den Stufen hinauf zu dem Bollwerk des großen Segelschiffs, das sich über ihnen erhob. Daneben sah das kleine Ruderboot, mit dem sie über den Fluss schaukelten, noch winziger aus.
»Kommt überhaupt nicht in Frage«, erwiderte ihre Tante. »Du wartest mit mir, bis wir mit dem Tragstuhl des Bootsmannes hinaufgebracht werden. Der erste Eindruck ist entscheidend. Als Passagiere der Kabinenklasse kommen wir vermutlich zuletzt an Bord, und alle werden an Deck sein und deine Ankunft beobachten. Du willst doch nicht, dass die Leute dich für eine Wilde halten.«
Georgina hob die Füße und ihre langen, dicken Röcke, als die Männer die Ruder ins Boot zogen. Der Stoff in ihren Händen war üppig und weich. Sie schob ihren warmen Mantel zurück und begutachtete den Rock. »In diesem Kleid kann ich doch nur einen guten Eindruck machen, Tante Mary.«
Das Kleid war nach der neuesten Mode geschnitten. Der weite Rock würde im Stehen über den Boden wischen, die Taille war schmal, das Mieder eng geschnitten, mit einer Spitze Richtung Nabel. Es brachte ihre Figur vorteilhaft zur Geltung. Die Ärmel waren modisch weit, und das strahlende Hellblau passte zu ihren Augen. Ihre Haut fühlte sich unter der frischen Brise lebendig an und glühte ein wenig.
Ihre Tante sah sie mit leicht zusammengezogenen Lippen an. »Nun ja, es ist ein schönes Kleid«, gab sie zögernd zu. »Aber die Farbe ... ich finde es ein wenig zu früh, die Trauerkleidung abzulegen. Grau oder lavendel ...«
»Oder irgendeine andere traurige Farbe!«, lachte Georgina.
»Dieses Blau ist jedenfalls viel zu strahlend.«
»Aber, aber, meine Liebe, sie ist doch erst neunzehn! Zu jung, um ihr halbes Leben in Trauer zu verbringen«, unterbrach Onkel Hugh vorsichtig. Er widersprach seiner Frau nur selten.
Sie waren sich in all den Jahren immer ähnlicher geworden – ein wenig mollig, stahlgraues Haar, Doppelkinn und ein wenig pompöses Auftreten. Und sie schienen sich fast immer einig zu sein. Nur jetzt, in Bezug auf Georgina, waren sie unterschiedlicher Meinung.
»Nein, und der liebe Papa hätte das auch gar nicht gewollt«, fügte Georgina hinzu. »Er glaubte an ein Leben in Fülle, er wollte aus jeder Gelegenheit so viel Vergnügen ziehen wie möglich. Er wäre entsetzt, wenn er mich ewig in langweiligen Farben sehen müsste, die mir nicht stehen.«
Das Gespräch wurde unterbrochen, als eine Stimme von oben sie aufforderte, an Bord zu gehen.
»Vorsichtig, haltet euch gut fest«, warnte ihre Tante, aber Georgina hörte nicht zu. Sie zog ihre Handschuhe aus.
Ihre Blicke waren fest auf ihren Onkel geheftet, der jetzt die Treppe hinaufging. Auf beiden Seiten waren dicke Taue als Handlauf gespannt.
Als er oben angekommen war, griff sie nach den Tauen. Sie hatte schon lange kein echtes Abenteuer mehr erlebt, und sie würde den Überlegungen ihrer Tante nicht einen Augenblick folgen.
Der Aufstieg war furchterregend und schwierig genug, um ein wilder Genuss zu sein.
Als sie oben ankam, packte sie jemand fest am Arm. Ein Blick sagte ihr, dass es nicht ihr Onkel war. Es war eine starke, autoritäre Hand und ein muskulöser, sonnengebräunter Unterarm mit vielen feinen goldenen Härchen, die in der blassen Wintersonne funkelten.
Sie blickte auf und sah in ein Paar blaue Augen, allerdings nicht dunkelblau wie die ihren, sondern himmelblau, wie von der Sonne und dem Meer über viele Jahre gebleicht. Ein gutaussehendes Gesicht kam ihr entgegen, das Gesicht eines Mannes, der viel Zeit unter freiem Himmel verbrachte. Die Sonne hatte die hohen Wangenknochen und das feste Kinn goldbraun gefärbt, als würde Wikingerblut in seinen Adern fließen. Das blonde, ebenfalls von der Sonne gebleichte Haar war ein wenig zerzaust und kräuselte sich unter dem Rand der Offiziersmütze.
»Nur weiter, Miss. Klettern Sie auf die Reling, ich helfe Ihnen«, sagte der Mann.
Er hielt ihren Blick fest, als sie seinen Worten folgte. Dann umfassten seine Hände ihre Taille, als sie leichtfüßig aufs Deck sprang.
Sie sah zu ihm auf, heftig atmend vor Aufregung. Sie war größer als die meisten anderen Frauen, aber er überragte sie bei Weitem. Seine Größe und die breiten Schultern verliehen ihm eine entschiedene Autorität, die sie – gemeinsam mit seiner schicken, makellosen Uniform – auf den Gedanken brachten, es müsse sich um den Kapitän handeln.
»Willkommen an Bord, Miss Stapleton«, sagte er.
»Vielen Dank, Herr Kapitän.«
»Miles Bennett, Erster Maat, Madam«, sagte er und lächelte verlegen. »Kapitän werde ich vielleicht auf der nächsten Reise sein, die ich mache, wenn alles gut geht. Der Kapitän kann sie selbst nicht in Empfang nehmen, da er noch an Land ist und letzte Besorgungen macht. Er kommt immer als Letzter an Bord. Ich habe während seiner Abwesenheit den Befehl über das Schiff.«
Er warf einen Blick über die Schulter. »Jimmy Cole!«, rief er einem jungen Kerl auf dem Hauptdeck zu.
Jimmy kam angerannt. »Aye, aye, Sir!« Seine großen grünen Augen funkelten vor Aufregung, und sein Lächeln erstreckte sich von einem Ohr zum anderen und entblößte einige Zahnlücken. Die Ohren selbst standen ab wie die Segel eines Schiffs. Georgina bemühte sich, ernst zu bleiben, während sie sich vorstellte, wie der Wind in seine Ohren griff und ihn übers Deck trieb. Er war jung, begeistert und wollte alles richtig machen.
»Du kannst Miss Stapleton und Mr und Mrs Clendenning den Weg zu ihren Kabinen zeigen, wenn dort alles bereit ist. Sorg dafür, dass sie sich dort gut einrichten.«
»Aye, aye, Sir.«
»Georgina?« Die Stimme ihres Onkels.
Sie riss sich vom Anblick des Ersten Maats los und drehte sich zu ihrem Onkel um, der besorgt über die Reling hinunter zu dem Ruderboot spähte.
»Bleib noch einen Moment hier, solange wir auf deine Tante warten«, sagte er.
Georgina klatschte in die Hände und sah sich um. »Wie aufregend! Ich war noch nie auf einem Schiff. Ich freue mich so auf die Fahrt«, sagte sie zu dem Ersten Maat.
»Ich wünschte, alle unsere Passagiere würden es so sehen. Das würde die Reise für alle Beteiligten viel angenehmer machen«, erwiderte der Maat trocken. »Entschuldigen Sie mich, Madam.« Er entfernte sich und rief den Seeleuten in der Nähe einige Befehle zu.
Georgina, die ihre Tante bei ihrem Onkel in guten Händen wusste, spazierte über das Hüttendeck und beobachtete das geschäftige Treiben. Die Seeleute liefen in alle Richtungen, bereiteten das Schiff aufs Ablegen vor und schimpften leise vor sich hin, wenn die Passagiere sie störten.
Auf dem Hauptdeck zweieinhalb Meter unter ihr waren verschiedene Passagiere aus dem Zwischendeck zu sehen: junge Männer, die in kleinen Gruppen herumlungerten, mit aufgeregten Blicken und immer auf der Suche nach einem Spaß. Verhärmte Frauen mit verschwollenen Augen und mit Säuglingen auf dem Arm, die ihre Kinder beobachteten, die über Taue und Gepäckstücke tollten. Die verheirateten Männer waren ernst und dunkel gekleidet; sie dachten wohl an die fünfmonatige Reise, die vor ihnen lag. Krumme alte Männer und Frauen saßen an windgeschützten Plätzen, so alt, dass sich Georgina fragte, warum sie noch einmal von vorn anfangen wollten. Manche Leute lasen, spielten, schrieben, nähten oder strickten. Einige aßen, rauchten oder saßen einfach da und taten gar nichts. Die Kleidung verriet Menschen aus jeder Schicht und aus jeder Gegend des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, von den mondänen Straßen der Stadt London bis zu den letzten Winkeln Schottlands.
Es herrschte ein unbeschreiblicher Lärm. Befehle wurden gebrüllt, die Seeleute sangen und fluchten, Glocken läuteten, Ketten rasselten, Babys schrien, über ihnen kreischten die Möwen, Schweine quiekten, einige Passagiere tanzten einen Jig zu den kratzigen Tönen einer Fiedel, die Frauen schrien ihren Kindern zu, sie sollten nicht zu nah an die Reling gehen, und eine Gruppe betete laut und klagend um Errettung von den Gefahren der See. Und das Schiff selbst knirschte, stöhnte und knackte im Rhythmus der Wellen.
Georgina rümpfte die Nase. Die Gerüche waren ebenso erstaunlich wie die Geräusche. Teer und Tau, faulendes Holz, Hühnerdung, alter Fisch, ungewaschene Menschen, schmutziges Wasser in den Speigatten, Lebensmittel aller Art, der Geruch von Kochtöpfen über den Herdfeuern und natürlich das schlammige Hafenwasser, in dem das Schiff schwankte.
»Komm, Georgina!«, rief ihr Onkel, und sie ging zurück zu ihm und der Tante, um sich die Kabinen zeigen zu lassen.
Ihre Einzelkabine war nicht schlimmer als erwartet. Sie war etwas weniger als zwei auf zwei Meter groß und hatte ein Bullauge, durch das der kalte Wind blies. Nebenan lag die Kabine ihrer Tante und ihres Onkels. Sie war drei mal zwei Meter groß, die beste Kabine an Bord. Durch das schöne, quadratische Fenster am Bug überblickte man den Hafen.
Jimmy Cole stellte sich als Schiffsjunge und Kabinenboy vor und half dem Steward, ihre Sachen zu verstauen. Der Schrankkoffer wurde mit Klampen sicher am Boden befestigt, und lose Gegenstände wurden mit starken Tauen an den Seitenwänden festgebunden. »Hältst du meinen Koffer für ein wildes Tier, Jimmy?«, lachte Georgina. »Glaubst du, er springt mich an, sobald ich ihm den Rücken zukehre?«
»Na ja, Madam, ich war noch nicht auf See, aber ich mache, was man mir sagt. Und es heißt, es kann schrecklich raue See geben.«
»Wenn du hier fertig bist, habe ich kaum noch Platz, um mich anzuziehen«, sagte sie.
»Dann sollten sie mal ins Zwischendeck gucken, ist ja nur ein paar Zentimeter unter ihnen. Da sind hundertfünfzig Seelen zusammengepfercht wie Tiere. Kein Platz zum Stehen oder Anziehen, kein bisschen Platz für einen selbst, nur ein oder zwei Fuß breit zum Schlafen auf der Pritsche, und die Kinder auch noch dazwischen ...« Er schwieg abrupt, als ihn der Steward mahnend ansah.
»Nun ja, jeder hat wohl sein Schicksal zu tragen.« Georgina zuckte mit den Schultern.
Von oben waren Gesang und das Rattern von Ketten zu hören. Ein Seemannslied.
Sie spürte, dass sich das Schiff anders bewegte, und hörte Jubeln und Gerenne über sich.
»Was ist jetzt los?«
»Ich würde sagen, wir sind unterwegs, Madam.«
»Dann muss ich rauf«, erwiderte Georgina, strich sich das blonde Haar zurück und setzte sich die Haube wieder auf. Sie wartete auf ihren Onkel und ihre Tante, und dann gingen sie durch den Mittelgang, vorbei an den Kabinen des Kapitäns, des Schiffsarztes und der anderen Passagiere und durch die Messe. Der Salon war gut eingerichtet, mit echten Teppichen, damastbezogenen Stühlen und Tischen mit Einlegearbeiten. Sie würden also den gewohnten Komfort nicht vollkommen entbehren müssen.
Die Passagiere standen dicht gedrängt an der Reling. Einige jubelten und winkten, andere weinten oder riefen letzte Abschiedsgrüße hinüber ans Land. Und einige warfen einen ernsten, vielleicht letzten Blick auf das gute alte England.
Georgina konnte ihre Aufregung kaum bezähmen. Endlich ging es los! Nicht mehr lange, dann würde sie ihren Verlobten in die Arme schließen, heiraten, die Trauer hinter sich lassen und die Freuden des Ehelebens genießen. Sie würde frei sein, würde ihren eigenen Hausstand und Dienstboten haben, mit gutaussehenden Männern flirten, wie es nur verheiratete Frauen tun durften, sie würde die angenehmen Zeitvertreibe der oberen Klassen genießen, Bälle, Besuche, Partys, Jagden ... Und das aufregende neue Land! Was für ein Leben!
Jetzt hatte sie Zeit, die anderen Kabinenpassagiere zu beobachten, die auf dem Deck spazieren gingen. Ein junges Paar, beide mit braunen Haaren und sanften, großen braunen Augen – offenbar Bruder und Schwester. Er hielt die Hand seiner Schwester und murmelte ihr tröstende Worte zu. Georgina grüßte lächelnd; Onkel Hugh stellte sich vor.
»Richard Cambray«, erwiderte der junge Mann, schüttelte Onkel Hugh die Hand und verbeugte sich dann respektvoll vor Tante Mary. Dann nahm er Georginas Hand. »Sehr erfreut«, sagte er. Georgina bemerkte, dass er sie eindringlich ansah. Eine neue Eroberung wartete auf sie ...
»Und das ist meine Schwester, Miss Gemma Cambray«, sagte Richard ruhig.
Seine Schwester nickte Georgina kühl zu und zog Richards Arm enger an sich. Es schien Georgina, als wollte sie ihn vor der Bedrohung durch eine attraktive, selbstbewusste Frau beschützen.
Ihre Verwandten tauschten noch ein paar Höflichkeiten aus, während Georgina die anderen Passagiere auf dem Hüttendeck beobachtete. Ihr Blick blieb an einem großen, dunklen Mann hängen, der sich das Haar mit Öl zurückgekämmt hatte. Alles an ihm sah wie geschliffen aus, vom Scheitel bis zur Sohle. Seinen Zylinder hielt er in der Hand. Sein Mantel war von feinster Qualität, und seine breiten Schultern schienen keine Polster nötig zu haben.
Sie hörte, wie sie heftig einatmete. Das war ein Mann, der ihr auf Anhieb gefiel! Er wandte sich ihr zu, als spürte er ihren Blick, und bevor sie die Augen niederschlagen konnte, hatte er fast unmerklich eine Braue hochgezogen, und sie sah ein Funkeln in seinen Augen. Ein Schauer der Vorfreude lief ihr über den Rücken.
Als sie wieder hochsah, erwartete sie, dass er den Blick abgewandt hätte, aber weit gefehlt, er starrte sie immer noch an. Sein voller Mund verzog sich zu einem langsamen, fast zynischen Lächeln. Er wusste, dass sie ihn anziehend fand.
Sie hob ihr Kinn ein wenig und sah weg, als würden sie all die Schiffe und kleinen Fischerboote um sie herum viel mehr interessieren. Bald darauf beeilten sich einige Passagiere, dem Lotsen letzte Briefe zu übergeben, und für eine Weile vergaß sie den Mann. Der Lotse ging von Bord und ruderte mit seinem kleinen Boot davon. Wenig später hatten sie den Kanal hinter sich gelassen. Ein letzter Ton des Nebelhorns, und sie waren allein.
»Volle Kraft voraus!«, brüllte ein Mann mit heftigem schottischem Akzent: der Kapitän, wie Georgina vermutete. Er sah aus wie aus alten Geschichten. Klein, rundlich, mit vielen Falten im Gesicht und einem Schnurrbart. Haare und Bart waren grau; früher war er wohl rothaarig gewesen. Seine tief liegenden Augen wurden von buschigen Brauen überschattet.
»Aye, aye, Sir!«, rief der gutaussehende Maat zurück.
»Segel runter!«
Der Befehl wurde wiederholt, die Seeleute rannten los, dass die weiten Hosen flatterten.
»Die gehorchen aufs Wort!«, murmelte Georgina ihrem Onkel zu.
»Das will ich hoffen. Wenn einer aufmuckt, wird er ohne Pardon ausgepeitscht. Und wenn mehr als einer aufmuckt, ist es eine Meuterei. Wenn sie damit Erfolg haben, ist es Piraterie, und wenn nicht, ist es ihr sicheres Ende. Gehorchen müssen sie, auf einem Schiff gibt es keine Diskussionen.«
»Großsegel hoch!«, befahl der Maat.
Die Masse aus Tuch, Tauen und Blöcken krachte, ratterte und flatterte nach oben, während die Seeleute bei jedem Zug brüllten. Das Schiff drehte sich langsam in den Wind und nahm Fahrt auf.
Die Passagiere stießen drei mächtige Jubelrufe aus, und Georgina spürte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen.
»Romantisch, nicht wahr, Miss Stapleton?«, sagte Richard Cambray zu ihr.
»Unbedingt, Mr Cambray.«
Nur die Seeleute blieben scheinbar ungerührt.
***
»Ein durchaus erträgliches Essen«, erklärte Onkel Hugh.
»Freut mich, dass es Ihnen geschmeckt hat«, erwiderte der Erste Maat.
Die Teller wurden abgeräumt, und man brachte Flaschen mit Portwein und frische Gläser.
Kapitän McGlashan saß am Kopf des Tisches, aber er war ein knorriger alter Kerl und ließ keinen Zweifel daran, dass er die Passagiere – sei es mit oder ohne Kabine – nur an Bord duldete, weil er musste. Der Erste Maat Miles Bennett hatte sie einander vorgestellt und sorgte dafür, dass die Gespräche während des viergängigen Essens geschmeidig dahinflossen.
Georgina hatte das Glück, ihm gegenüber zu sitzen, sodass sie ihn unter ihren dunklen Wimpern beobachten konnte. Er gehörte natürlich nicht zur selben Gesellschaftsschicht wie die Kabinenpassagiere, hatte aber eine natürliche Sicherheit, als hielte er sich für ebenso gut wie sie, unabhängig von seiner Herkunft. Soweit sie sehen konnte, erfüllte er seine Pflichten mühelos. Es war eine Schande, dass er kein Passagier war; es hätte ihr Freude gemacht, ein bisschen mit ihm zu flirten. Er war so selbstgewiss, so voller Selbstvertrauen und so gleichgültig ihr gegenüber, dass er eine schöne Herausforderung gebildet hätte.
Schwer zu sagen, wer besser aussah: der blonde, blauäugige Miles Bennett oder Geoffrey Bressington, der dunkle Mann, den sie an Deck beobachtet hatte. Auch Bressington wäre keine leichte Eroberung, er war viel zu erfahren. Er hatte etwas Gefährliches, Raubtierhaftes an sich, als hätte er schon viele Frauen gehabt. Inzwischen sah man einen dunklen Bartschatten um sein Kinn, eher blau als schwarz, aber ansonsten war er perfekt gepflegt.
»Und was zieht sie in die Kolonien?«, fragte Miles Bennett ihn.
Georgina bemerkte, dass er kurz zur Seite sah, bevor er antwortete und Miles in die Augen blickte. »Geschäftliche Interessen, Mr Bennett. Ich höre, dass es in den Kolonien Möglichkeiten gibt, von denen wir in England kaum etwas wissen.«
Etwas in seiner Antwort klang falsch, aber sie verdrängte den Gedanken sofort wieder, denn Geoffrey wandte sich mit derselben Frage nun ihr zu. »Und Sie, Miss Stapleton? Was führt sie nach Australien?«
»Ein Neuanfang, Mr Bressington. Nach dem Tod meines Vaters vor einigen Monaten bin ich Waise, und meine Tante und mein Onkel waren so freundlich, mich auf ihrer Rückreise nach Südaustralien mitzunehmen ...«
» ... wo sie ihren Verlobten trifft«, ergänzte Tante Mary, als wüsste sie, dass Georgina nur zu gern den Verlobten unterschlagen hätte.
Ein neues Funkeln erschien in Mr Bressingtons Auge. Er wusste ganz genau, was für ein Spiel sie spielte. »Er ist Ihnen also vorausgereist?«
»Ja, wir hatten geplant, dass er sich erst dort einrichten und mich dann nachholen sollte. Aber mein Vater starb unerwartet ...«
»Das tut mir sehr leid.«
»Ja, es war ein Jagdunfall. Und da dachte ich mir, es sei ja sinnlos, dort traurig herumzusitzen. Es hätte ein Jahr dauern können, bis die Briefe hin und her gegangen waren, um alles zu arrangieren. Also beschloss ich, mich auf den Weg zu machen. Und da meine Tante, meine nächste Verwandte, gerade ohnehin abreisen wollte ...«
»Charles ist ein so angenehmer, verlässlicher Bursche. Georgina und er kennen sich schon, seit sie Kinder sind«, bemerkte Tante Mary. »Die Ländereien der Familien grenzen aneinander, sie sind also sozusagen zusammen aufgewachsen. Und wir dachten, je eher sie unter seinem Schutz ist, desto besser. Wir wollten nicht, dass sie ganz allein in England zurückbleibt. Nun können wir nur hoffen, dass ihr Brief vor uns ankommt, sodass Charles rechtzeitig von ihrer Ankunft erfährt.«
»Charles ...«
»Charles Lockyer.«
Mr Bressington nickte. »Ja, der Name ist mir durchaus ein Begriff. Ich habe ihn wohl in einem der Clubs getroffen.«
»Sie reisen also zurück, Mr Clendenning?«, unterbrach Richard Cambray das Gespräch und wandte sich an Onkel Hugh. »Erzählen Sie uns doch ein wenig von den Kolonien. Wir sind dankbar für jedes Stückchen Information. Es ist besser, ein wenig vorbereitet zu sein, bevor man sich ein neues Leben aufbaut.«
»Was haben Sie in den Kolonien vor, Mr Cambray?«, fragte Onkel Hugh.
»Wir wollen uns in der Gegend um Port Philip ansiedeln. Unsere Eltern sind verstorben, wie die von Miss Stapleton, und wir nahmen an, unser Erbe wäre in den Kolonien gut angelegt. Wir denken an Schafzucht.«
»Nun, ich kann Ihnen einiges über Südaustralien und unsere Erfahrungen dort erzählen«, sagte Onkel Hugh. »Ein vielversprechendes Land, gutes Wetter, durchaus ländlich, fruchtbarer Boden. Aber die Regierung hat sich verrechnet. Die Kolonie hat nicht genug Vieh und zu wenig Transportmöglichkeiten, um wirklich zu gedeihen. Deshalb sind wir nach England zurückgekehrt, wir bringen einiges an Tieren mit: Pferde, Kühe und Schafe. Außerdem haben wir einige unserer Landarbeiter und Hausangestellten überreden können, uns zu begleiten, denn es gibt kaum gute Dienstboten in der Kolonie. Unsere Leute sind im Zwischendeck. Das Vieh ist eine gute Investition ...«
Georginas Aufmerksamkeit schweifte ab. Sie interessierte sich nicht besonders für Südaustralien, denn sie würde, wie ein Großteil der Passagiere, nach Portland Bay Weiterreisen, wo Charles jetzt lebte. Jetzt spürte sie, wie sich das Schiff stetig hob und senkte und in eine rollende Bewegung überging. Sie war so sehr in die Unterhaltung vertieft gewesen, dass sie den zunehmenden Wind kaum bemerkt hatte. Die See war rauer geworden.
Sie sah sich am Tisch um. Miss Cambray, das schüchterne, stille kleine Ding, wurde allmählich blass. Ebenso erging es Georginas Tante. Obst und Käse standen unberührt auf dem Tisch. Aber Georgina ging es gut, besser als gut. Sie freute sich regelrecht über die Wellen und nahm sich einen Apfel.
Der Zweite Maat kam in die Messe und sprach ein paar leise Worte mit dem Kapitän, der kurz nickte und sich dann entschuldigte.
Onkel Hugh schwadronierte endlos weiter.
Plötzlich neigte sich das Schiff, und der Erste Maat griff schnell nach der Portweinflasche, die über den Tisch rutschte.
»Wir bekommen etwas Seegang«, sagte er.
»Ist alles in Ordnung, Mr Bennett?« Gemma Cambrays Stimme klang hoch, zittrig und ängstlich. Man hörte sie jetzt fast zum ersten Mal.
»Ja, ja, es ist alles in Ordnung. Das Schiff wird nur etwas unruhiger, wenn wir auf den Ozean hinausfahren«, sagte er.
»Es besteht also keine Gefahr?«, fragte sie weiter, mit angespanntem Gesicht und weit aufgerissenen Augen.
Sie sieht aus wie ein erschrockenes Reh, dachte Georgina und lachte glockenhell. »Ich habe gehört, wir müssen uns keine Sorgen machen, solange der Kapitän nicht zu beten anfängt«, sagte sie.
»Da haben Sie recht.« Mr Bennett sah aus, als müsste auch er lachen. Er wandte sich an Gemma. »Sie können ganz ruhig sein, es besteht keine Gefahr. Die Cataleena kann mit wesentlich schwererer See zurechtkommen«, sagte er freundlich und ernst zu ihr. Dann entschuldigte auch er sich und verließ die Tischgesellschaft.
»Ich glaube, ich ziehe mich auch zurück«, hauchte Gemma, als hätte sie wirklich etwas Dringendes vor. Richard sprang auf, um sie in die Kabine zu bringen.
»Ich würde mich auch gern ein wenig hinlegen«, sagte Tante Mary, eine Hand an die Stirn gelegt.
»Ich begleite dich«, sagte Hugh und nahm sie am Ellbogen.
Georgina stand ebenfalls auf. »Brauchst du mich, Tante?«
»Nein, Liebes, sorg du für dich selbst«, erwiderte Onkel Hugh. »Deine Tante erträgt Seereisen nicht besonders gut. Wenn sie allein in ihrer Kabine ist, geht es ihr besser. Der Steward kann ihr helfen.«
»Dann mache ich noch einen Spaziergang übers Deck, wenn ihr nichts dagegen habt«, sagte Georgina.
»Du solltest hier unten bleiben, das ist sicherer«, protestierte ihre Tante mit einem Schaudern.
»Die frische Luft wird ihr guttun«, sagte Onkel Hugh. »Solange sie sich gut festhält und niemandem im Weg steht, ist es gut. Ich habe schon oft festgestellt, dass frische Luft und ein Blick auf den Horizont wahre Wunder wirken«, bemerkte er zu Georgina. »Aber bleib auf dem Hüttendeck, geh nicht nach unten.«
Georgina ging hinauf. Auf dem Deck pfiff der Wind in der Takelage. Sie blieb stehen, um ihre Haube fester zu binden, aber der Wind zog ihr trotzdem das Haar hervor und wehte es wie ein goldenes Netz übers Gesicht. Sie zog ihre hellblaue Pelerine fester um ihre Schultern und schloss alle Knöpfe.
Ihre Augen brauchten einen Moment, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Hier draußen spendeten nur die Laterne beim Kompass und der Mond etwas Licht. Wolken rasten über den Himmel. Sie hielt sich mit beiden Händen fest, bis sie einen sicheren Platz gefunden hatte, von wo sie das Schiff und das Meer überblicken konnte.
Sie hielt sich am Mast fest, wandte ihr Gesicht dem Wind zu und atmete tief die frische, kalte Salzluft ein. Hier an Deck war es viel besser, weit weg von den fremden, stickigen Gerüchen hinter den Luken. Der üble Gestank des aufgewühlten Bilgenwassers verbreitete sich auf dem ganzen Schiff. Wenn die anderen Passagiere klug wären, würden sie auch hier stehen und das schwindlige Gefühl vom frischen Wind davonblasen lassen, das seit dem Abendessen aufgekommen war.
Sie schloss die Augen und überließ sich ganz dem Gefühl des Segelns. Die Geräusche, Gerüche, die kalte Luft auf ihrer Haut ... Von der Brücke her waren Befehle zu hören, die Stimme des Ersten Maats übertönte den Wind. Die Seeleute brüllten, fluchten und rannten herum, der Wind pfiff und jaulte um das Schiff, und überall klapperte, ratterte und flatterte etwas.
Georgina öffnete die Augen wieder. Das Schiff hob und senkte sich in den haushohen Wellen, Gischt und Wasser machten das Deck nass, und die Seeleute rutschten und stolperten. Hühnerkäfige und alle möglichen Geräte fuhren übers Deck.
Mit wachsendem Staunen beobachtete sie, wie die hartgesottenen Seeleute in die Takelage kletterten. So weit oben sahen sie aus wie Affen in den Baumwipfeln, wo sie sich nur mühsam festhalten konnten. Das Schiff warf sie hoch und tauchte sie dann erbarmungslos wieder ins Wasser. Ein Mann rutschte von dem Seil ab, auf dem er stand, jemand schrie, Georginas Herzschlag setzte kurz aus, als sie sah, wie er verzweifelt mit den Armen ruderte. Kurz hing er in der Luft, dann fand er wieder sicheren Halt.
Sie schüttelte den Kopf und zwang ihren Blick zurück aufs Deck. Lieber nicht hinschauen. Was für Männer waren diese Seeleute? Warum riskierten sie Leben und Gesundheit für die zweifelhaften Freuden der Seefahrt? Sie zuckte mit den Schultern. Sie mussten ja wissen, was sie taten. Sie hatten den Ruf, raue Kerle zu sein, die tranken und fluchten, brutale Wilde, die kaum lesen und schreiben konnten, die vor ihren Pflichten an Land davonliefen, vor ihren Frauen oder vor dem Gesetz ... Sie fragte sich, was einen Mann wie Miles Bennett wohl zur Seefahrt gebracht hatte. Sein Akzent, seine Selbstsicherheit, seine guten Manieren und seine offensichtliche Intelligenz unterschieden ihn deutlich von den Abgründen der Gesellschaft, aus denen der Rest der Mannschaft kam.
Kälte und Feuchtigkeit krochen ihr durch die Kleider, und sie entschloss sich, unter Deck zu gehen. Doch als sie an der Luke ankam, ließ ein Stöhnen sie innehalten. Die Schiffsbalken stöhnten und schwankten, die Wellen schlugen auf das Schiff ein wie ein Vorschlaghammer, aber sie war sicher, dass sie noch etwas anderes gehört hatte.
Da war es wieder – ein unheimliches Stöhnen, ein Schrei tiefsten Elends, einer gequälten Seele. Georginas Herz zog sich zusammen. Die meisten Außenstehenden hielten sie für ein verwöhntes, egoistisches Ding, aber in Wirklichkeit war sie mitfühlend und konnte es kaum ertragen, einen anderen Menschen in Not zu sehen. Und wenn sie jemals einen Menschen in Not gehört hatte, dann jetzt.
Sie ging zurück, um nachzusehen. Vielleicht war es ein Mitreisender, vielleicht war jemand auf dem glitschigen Deck gestürzt und hatte sich verletzt. Jemand hatte Schmerzen. Sie wusste nicht, ob es eine männliche oder weibliche Stimme war, auf jeden Fall kam sie aus der Richtung eines Stapels aufgewickelter Taue und Segel. Vorsichtig trat sie näher heran, beugte sich darüber und spähte in die Dunkelheit.
In diesem Moment hörte sie feste Schritte hinter sich auf dem Deck und drehte sich um. Mr Bennett kam auf sie zu.
»Miss Stapleton! Was tun Sie denn hier oben?«
»Mr Bennett ...« Sie ignorierte seine Frage. »Da muss jemand verletzt sein, und ich wollte nachsehen, was ...« Das schreckliche Stöhnen war wieder zu hören, und sie drehte sich um.
Mr Bennett griff in den Stapel und zog die jämmerliche Gestalt des Schiffsjungen Jimmy Cole hervor. »Aufstehen, Junge, was ist los mit dir?«
Für einen kurzen Moment teilten sich die Wolken und ließen graues Mondlicht auf Jimmys Gesicht scheinen. Die Sommersprossen auf seiner Stupsnase leuchteten grünlich auf seiner blassen Haut. Auch ohne den Gestank des Erbrochenen auf seinem Hemd konnte man deutlich sehen, was ihm fehlte. Georgina trat einen Schritt zurück.
»Seekrank, Sir!«, stöhnte der Junge.
»Reiß dich zusammen! Es gibt keine Entschuldigung für eine Befehlsverweigerung, hast du nicht gehört, dass alle Mann an Deck gerufen wurden?«
»Doch, aber ich kann jetzt nicht klettern, mir ist ganz schwindlig und ich habe weiche Knie, so schlecht ist mir.«
»Du tust, was dir befohlen wird, sonst macht der Kapitän Hackfleisch aus dir«, sagte der Maat streng. »Hier bleiben!«
Er ging weg, und Jimmy ließ sich wieder aufs Deck sinken. Georgina wusste, sie hätte nach unten gehen sollen, aber sie war zu neugierig. Der Erste Maat kam zurück, einen Blechbecher in der Hand. Als die nächste Welle überkam, schöpfte er den Becher voll, dann packte er Jimmy am Arm.
»Trinken!«
»Nein, Sir, das geht nicht!«
»Ich habe gesagt, trinken!«
Er packte den Jungen am Kragen und stieß ihm den Becher an den Mund. Jimmy war zu hilflos, um noch Widerstand zu leisten. Im Mondlicht sah Mr Bennetts Gesicht sehr entschlossen aus, während er dem Jungen das Wasser einflößte.
Georgina war entsetzt. Meerwasser trinken? Was für eine Kur war das denn?
Jimmy hustete, spuckte und wand sich. Georgina trat einen Schritt vor, um den Ersten Maat aufzuhalten, aber sein warnender Blick ließ sie innehalten. Das arme Kind! Endlich war das Salzwasser unten. Der Maat ließ den Jungen los, der aufstand, einen Moment schwankte und sich dann über die Reling beugte, wo er stöhnend hing und sich übergab, als hätten sich seine gesamten Eingeweide losgerissen und kämen nach oben.
»Was tun Sie denn da? Der arme Junge, als ob er nicht schon krank genug wäre!«, flüsterte Georgina. Sie hatte noch nie gesehen, dass man jemanden so schlecht behandelt hätte.
Hart aber gerecht, hatte ihr Vater immer gesagt. Wenn einer seiner Dienstboten krank war, wurde er ins Bett gesteckt. Drückeberger wurden ohne Zeugnis entlassen, aber nicht verfolgt.
»Das geht Sie nichts an, Miss Stapleton.«
»Nein, und es geht mich natürlich auch nichts an, wenn er aus der Takelage stürzt. Dann haben Sie einen Mann über Bord, oder besser gesagt, ein Kind über Bord.«
»Sie haben recht, er ist nicht größer als ein Seemannsknoten«, erwiderte er. »Aber er gehört zur Mannschaft wie jeder andere hier. Und er kann von Glück sagen, dass ich ihn gefunden habe und nicht der Kapitän, denn er hätte ihn wegen Befehlsverweigerung auspeitschen lassen. Ein Schiffsjunge ist nicht viel mehr als ein Sklave, Miss Stapleton, und je eher er das begreift, desto besser.«
Seine hellblauen Augen blitzten wie Eis.
»Aber Salzwasser ... «
»Das beste Heilmittel gegen Seekrankheit. Was hätte ich denn sonst mit ihm tun sollen? Ihn mit einem heißen Tee ins Bett stecken?«
»Genau.«
Der Maat legte den Kopf in den Nacken und lachte. »Etwas Schlimmeres hätte ich ihm gar nicht antun können. Wenn ich ihm eine solche kleine Freundlichkeit erweise, ist er beim Rest der Mannschaft für alle Zeiten unten durch. Sie würden ihn ständig wegen seiner Schwäche hänseln. Ein Junge, der nichts aushält, wird hier in der Luft zerrissen. Ein Seemann braucht ein dickes Fell. Außerdem würden sie es mir als Schwäche auslegen.«
»Es geht Ihnen also nur um Ihre Autorität an Bord?«
»Darum sollte es Ihnen auch gehen, Miss Stapleton.«
Das Schiff hob sich, und sie schwankte, als würde sie im nächsten Moment stürzen. Er griff nach ihrem Arm, fast ein wenig zu fest. »Wenn die Jungs sich auch nur ein einziges Mal weigern, im Sturm in die Rahen zu klettern – und ich meine einen echten Sturm, denn das hier ist ein lindes Lüftchen gegen das, was uns vielleicht noch bevorsteht -, dann kann das ganze Schiff sinken. Sie und ich und alle anderen. Unser Leben hängt davon ab, dass die Matrosen jedem Befehl auf der Stelle gehorchen. Was denken Sie denn?«
Ihr lief ein Schauer über den Rücken. Darüber hatte sie nicht nachgedacht, und sie wünschte, sie hätte nichts von alledem gehört.
»Sie frieren, Miss Stapleton, gehen Sie unter Deck.«
Ja, sie fror, aber seine anmaßende Art war schwer zu ertragen. Niemand würde ihr Befehle erteilen!
»Ich bin nicht einer von Ihren elenden Seeleuten, ich springe nicht, nur weil Sie etwas befehlen.«
Der Griff um ihren Arm wurde fester, und er zog sie nah zu sich heran und sah ihr mit eisigem Blick in die Augen. »Doch, Miss Stapleton, Passagiere müssen den Offizieren dieses Schiffs gehorchen. Das gilt auch für Sie. Es ist mir vollkommen gleichgültig, ob Sie in den Kabinen oder im Zwischendeck logieren. Sie und Ihresgleichen sind nicht dazu geboren, hier das Kommando zu übernehmen. Verwöhnte, lästige Mädchen sind mir genauso viel wert wie seekranke Schiffsjungen. Und ein Becher Salzwasser ist nicht meine einzige Möglichkeit.«
Die Entschlossenheit in seinem Blick schickte einen Schuss Kampflust durch ihre Adern, und seine Hand auf ihrem Arm ließ eine Hitzewelle durch sie hindurchströmen. Sie fragte sich, welche anderen Möglichkeiten er meinte.
Sie riss sich von ihm los und stolperte ein paar Schritte rückwärts, um das Gleichgewicht zu bewahren. Dabei starrte sie ihn wütend an, ohne die richtigen Worte zu finden, um ihre rechtmäßige Autorität wiederherzustellen. So ging man mit einer Stapleton nicht um!
Aus dem Augenwinkel sah sie Jimmy, der sich aufgerichtet hatte, seine Kleider in Ordnung brachte und nach der rauen Behandlung offenbar wesentlich gesünder war.
Also wechselte sie den Ton und senkte den Blick auf die Weise, die den meisten Männern unwiderstehlich erschien. »Der Wind und die Aussicht aufs Meer tun mir gut, so wie das Salzwasser dem jungen Jimmy offenbar gutgetan hat. Ich bin lieber hier oben, als zu stöhnen, schreien und beten wie die anderen da unten.«
Dann hob sie ihr Kinn und sah ihm warnend in die Augen. Um seine Mundwinkel zuckte es, als er nickte, als würde er ihrem Strategiewechsel und ihrer Entscheidung zustimmen. »Gut. Aber wenn das Wetter schlechter wird, müssen Sie unter Deck gehen. Dann werden nämlich die Luken geschlossen.«
»Selbstverständlich«, murmelte sie gehorsam.
Er lachte. »Ich sehe schon, das wird eine lebhafte Reise, Miss Stapleton. Aber machen Sie es nicht zu lebhaft, ja?«
Eine Sekunde später sah sie nur noch seinen Rücken. Er war wirklich anmaßend, und leider hatte er bei dieser ersten Begegnung eindeutig den Sieg davongetragen. Sie konnte ihn nur gegen ihren Willen bewundern.
***
Am nächsten Morgen wachte Georgina früh, aber nach gutem Schlaf sehr erfrischt auf. Das Schiff hob und senkte sich immer noch auf den Wellen, aber sie hatte sich bereits daran gewöhnt. Als es sieben Uhr schlug, ging sie in die Offiziersmesse, doch dort war kein Mensch zu sehen.
Sie setzte sich und wartete, während der Steward eine Kanne mit dampfendem Tee hereinbrachte und vor sie hinstellte.
»Guten Morgen, Miss Stapleton.« Der hochgewachsene, dunkle Gentleman kam herein.
»Guten Morgen, Mr Bressington.«
»So, es scheint also, als wären wir aus härterem Holz geschnitzt als der Rest, nicht wahr?«, sagte er, während ihm der Steward den Stuhl zurechtrückte.
»Wo sind sie denn alle?«
»Ich vermute, sie starren in irgendwelche Schüsseln und Eimer.« Er lachte leise. »Oder sollte ich zartfühlender sein? Ich vermute, sie sind ein wenig indisponiert, weil die See sich so wild gebärdet.«
Georginas Lachen perlte durch den Speiseraum. »So wild nun auch wieder nicht.«
»Nicht für Sie und mich, meine Liebe«, sagte er mit einem geschmeidigen Lächeln. »Sie sind doch wohl allem gewachsen.«
Etwas in der Art, wie er das sagte, ließ Georginas Herz schneller schlagen, als hätten seine Worte eine doppelte Bedeutung.
Mr Cambray betrat die Messe. Er sah blass und müde aus, und sein dichtes Haar, das er gestern aus dem Gesicht gekämmt getragen hatte, fiel ihm heute in die Stirn wie bei einem kleinen Jungen.
»Wie geht es Ihnen heute Morgen?«, fragte Mr Bressington.
»Wie nicht anders zu erwarten; ich denke, ich begnüge mich heute früh mit etwas Tee«, erwiderte er so tapfer und mannhaft wie möglich, aber durchaus auch auf der Suche nach ein wenig Mitleid.
In diesem Augenblick kamen der Maat und der Kapitän herein, begrüßten die Passagiere und setzten sich an den Tisch.
Georgina sah den Maat vorsichtig unter ihren Brauen heran. Sie musste an die Szene am vergangenen Abend denken. Er sah nachdenklich aus, sagte aber nichts.
»Und wie geht es Miss Cambray?«, fragte Georgina den jungen Mann zu ihrer Rechten. »Nicht besonders gut, aber sie ist so wunderbar geduldig in ihrem Leiden wie immer. Sie ist seit jeher von zarter Gesundheit, aber sie trägt es wie ein Engel.«
Georgina sah ihn voller Mitgefühl an, aber ein aufmerksamer Beobachter hätte den Schalk in ihrem Blick bemerkt. »Vielleicht würde ihr ein kleiner Spaziergang an Deck guttun. Ich bin ja sehr für frische Luft. Darf sie an Deck kommen, Mr Bennett?«
Die Mundwinkel des Maats zuckten.
»Ich fürchte, dafür ist sie zu schwach; vielleicht, wenn sie sich ein bisschen besser fühlt«, erwiderte Mr Cambray, bevor der Maat antworten konnte.
»Dann braucht sie vielleicht stärkere Medizin, zum Beispiel einen Becher Meerwasser. Ich habe gehört, das soll Wunder wirken.«
»Um Gottes willen!«
»Ja, ich stimme Ihnen zu, Mr Cambray, das klingt schauderhaft. Man würde sie zum Trinken zwingen müssen, aber ich habe mir sagen lassen, es handelt sich um einen Akt von großer Menschlichkeit.«
»Nur ein Mensch ohne jegliches Gefühl würde eine so grauenhafte Maßnahme vorschlagen«, erwiderte Mr Cambray.
»Ja, das habe ich auch gedacht«, sagte Georgina mit einem Seitenblick auf den Maat. Mr Bressington hatte sich auf seinem Stuhl zurückgelehnt und beobachtete Georgina und den Maat durch zusammengekniffene Augen.
»Nein, sie ist so schwach, ich glaube nicht, dass wir sie in den nächsten Tagen außerhalb ihrer Kabine sehen werden.«
»Oh, wie bedauerlich!« Georgina trug das Mitgefühl dick auf.
»Ja, und die Stewards können sie, so gut sie es meinen, auch nicht trösten«, sagte Cambray mit einem Blick auf den Kapitän. »Ihre lauten Stimmen und groben Manieren verschlimmern ihren Zustand nur noch.«
»Hat sie denn keine Zofe bei sich?«
»Nein, unser bisheriges Mädchen wollte nicht mit uns kommen, und Gemma mag keine Fremden um sich haben. Vielleicht könnten Sie ihr heute Vormittag einen kurzen Besuch abstatten, Miss Stapleton, das würde sie ein wenig aufheitern. Sie sind so beherzt und fröhlich.«
Georgina war ehrlich entsetzt. Miss Cambray war eine bemitleidenswerte Person und überhaupt nicht ihr Geschmack. Und eine Kabine zu betreten, in der es nach Erbrochenem stank ...
Jetzt sah sie der Maat mit sichtlichem Vergnügen an. Er hatte ihre Gedanken sicher gelesen.
»Das würde ich nur zu gern tun, aber aus Erfahrung weiß ich, dass ein Mensch mit guter Laune normalerweise das Letzte ist, was ein Patient braucht. Mein Besuch könnte ihren Zustand eher verschlechtern, verstehen Sie? Ich nehme sie aber gern auf einen Spaziergang mit, sobald sie sich wieder besser fühlt. Ich würde ihr meine eigene Zofe anbieten, aber ich habe auch keine dabei. Bitte richten Sie Ihrer Schwester mein herzliches Mitgefühl aus und sagen Sie ihr, dass ich mich auf einen kleinen Spaziergang mit ihr freue.«
»Sie sind zu freundlich«, erwiderte Mr Cambray.
Sie sah den Maat an, um festzustellen, welche Wirkung ihr Angebot auf ihn hatte. Seine Augen, die am vergangenen Abend so kalt gefunkelt hatten, glühten heute Morgen vor guter Laune.
»Im Übrigen werden wir, die wir aufrecht stehen, Miss Stapletons Gesellschaft noch viel mehr zu schätzen wissen als die Kranken«, sagte Mr Bressington. »Was täten wir ohne eine schöne Frau, die unsere Augen erfreut?«
Etwas in seiner Stimme brachte Georginas Herz zum Flattern.
»Ja, in der Tat«, sagte der jüngere Mann.
Georgina würde die nächsten Tage im Wesentlichen mit Mr Bressington und Mr Cambray verbringen müssen. Der Seegang war stark, aber nicht gefährlich, ihr Onkel war mit der Pflege seiner Frau beschäftigt, und die meisten anderen Passagiere ließen sich kaum einmal blicken.
Mr Bressington war erfahren in der Kunst des Flirts, und Georgina fühlte sich von seiner Aufmerksamkeit geschmeichelt. Er brachte ihr Herz zum Zittern – vielleicht war es seine geschliffene Art, vielleicht auch das Gefühl, dass er ein gefährlicheres Spiel im Sinn hatte als sie. Sie bevorzugte harmlose Geplänkel, während er offenbar bereit war, etwas weiter zu gehen, womöglich sogar viel weiter. Er schien sie ohne Worte oder Berührungen herausfordern zu wollen, als sagte er zu ihr: »Jetzt kannst du noch deinen Spaß haben, in ein paar Monaten bist du verheiratet, dann ist der Spaß vorbei.«
Mr Cambray war ganz anders als er. Er war jungenhaft, begeistert und sehr darauf bedacht, Eindruck auf sie zu machen. Da er an beherzte Frauen nicht gewöhnt war, verunsicherte sie ihn ein wenig. Er sah sie mit wachsender Bewunderung an, und wäre er nicht so ehrenhaft gewesen, dann hätte er sicher versucht, sie zu küssen. Heiße Jungenküsse, vielleicht aus Versehen auf ihre Nase oder den Mundwinkel.
***
Am dritten Abend auf See, als Wind und Wellen sich ein wenig beruhigt hatten, verbrachte Georgina den ganzen Abend an Deck und bemerkte, dass der Blick des Maats oft auf ihr ruhte. Sie wusste nicht genau, warum, denn es hatte seit dem ersten Frühstück an Bord keine weiteren Wortgefechte zwischen ihnen gegeben. Richard Cambray erzählte Geschichten aus seiner Kindheit, und Georgina lachte laut über seine Eskapaden – nicht so sehr über die Geschichte selbst, als vielmehr über die Mühe, die er sich beim Erzählen gab.
Als sie aufblickte, sah sie, dass der Maat sie die ganze Zeit ansah, eindringlich und ernst, ohne dass sie den Grund verstand. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder Richard zu.
Später, als Richard nach unten gegangen war, um nach seiner Schwester zu sehen, blieb sie mit ihren Gedanken allein, und der Maat nahm darin einen großen Raum ein. Sie blickte auf das unruhige Meer und dachte an ihn, an die Mischung aus Wärme und Eis in seinen Augen, die gebräunten Unterarme mit den goldenen Härchen, den großzügigen Mund, der so hart wurde, wenn er sich ärgerte, seine hochgewachsene, schlanke Gestalt und seine Bewegungen, wenn er arbeitete. Sie dachte an Gespräche mit ihm, Wortgefechte, aus denen sie als Siegerin hervorging, Dialoge, in denen er ihr zu verstehen gab, wie sehr sie ihm trotz allem gefiel. Wunderbare Phantasien, zumal sie sich auf verbotenem Gebiet bewegten. Georgina wusste, dass ihre Tante schockiert in Ohnmacht gefallen wäre, wenn sie von den Gedanken ihrer Nichte gewusst hätte.
Sie war ganz und gar absorbiert von dem Blick aufs Meer und von ihren Gedanken, als sie eine glatte, warme Hand auf der ihren spürte. Als sie sich erschrocken umsah, stand Geoffrey Bressington vor ihr.
»Oh, meine Liebe, jetzt habe ich Sie erschreckt.« Seine Stimme war leise und schien zu pulsieren.
»Ich war ganz in Gedanken«, erwiderte sie und konnte nur hoffen, dass man ihr die Art ihrer Gedanken nicht angesehen hatte.
»Wie schön Sie heute Abend sind! Dem Himmel sei Dank, dass die Wolken sich verzogen haben und ich Ihre tiefblauen Augen im Mondlicht sehen kann, in denen sich das Licht der Sterne spiegelt. Auch Ihre Haut glüht, als hätten sich nichts als Vergnügen im Sinn.«
Georgina antwortete nichts, aber ihr Herz schlug schneller bei seinen Worten. Sie fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. Geoffrey warf einen Blick über ihre Schulter. »Kommen Sie, wir gehen ein Stück«, sagte er. »Dieser aufdringliche Bennett lässt Sie ja nicht aus den Augen. Sie sind zu gut für seine niedrigen Blicke.«
Georgina war überrascht, dass er so verächtlich über den Ersten Maat sprach, aber sie erwiderte immer noch nichts. Er zog sie mit sich, hielt ihre Hand und ging mit ihr zum Mast, wo man sie vom Steuerrad nicht sehen konnte.
»Mr Bressington«, murmelte Georgina, wohl wissend, dass sie mit ihm nicht hier sein sollte, vor den Blicken aller anderen verborgen.
»Nennen Sie mich doch nicht Mr Bressington«, bat er. »Mein Name ist Geoffrey.« Er ließ ihre Hand nicht los.
»Geoffrey, ich ...«
»Ich weiß, Sie denken, dass es sich nicht schickt, mit mir hier zu stehen, und das ist sehr ehrenhaft von Ihnen. Sie sind ein wohlerzogenes Mädchen. Aber ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Es könnte der letzte Abend ohne Ihre Verwandten sein; morgen werden sie wieder aufstehen und Sie bewachen wie die Habichte. Selbst die unschuldigsten Freuden werden sie Ihnen missgönnen.«
Er hob die Hand. »Nein, sagen Sie jetzt nichts. Ich verstehe Sie, eine Frau von Ihrem Format, Sie wollen das Leben genießen, wenigstens ein bisschen, bevor sie sich in eine Ehe einsperren lassen. Und wer sollte Ihnen das verdenken? Ein mutterloses Kind, mit neunzehn Jahren verwaist durch den plötzlichen, tragischen Tod des Vaters. Gefangen in den Pflichten der freudlosen Trauerzeit, um nicht respektlos zu erscheinen. Nur zu bald werden wir das neue Land erreichen, werden getrennte Wege gehen, wenn Sie Ihre Pläne weiterverfolgen wollen. Und nie hatten Sie auch nur eine Chance, die Welt ein wenig kennenzulernen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Sie sich für den Rest Ihres Lebens glücklich mit Ihrem Kindheitsfreund niederlassen wollen, wohl wissend, dass Sie geboren wurden, um das Leben in seiner ganzen Fülle zu genießen.«
Seine Hände strichen an ihren Armen entlang, und ein Daumen streifte ihre Brust; vielleicht war es ein Zufall, jedenfalls schickte die Berührung eine Hitzewelle durch ihren ganzen Körper.
Seine Worte erinnerten sie an ihren Vater. Er hatte selbstverständlich von ihr erwartet, dass sie keusch in die Ehe ging, aber er hatte sich auch ein freudvolles Leben für sie gewünscht.
Geoffrey spielte ein gefährliches Spiel mit ihr, und sie wusste, sie hätte nicht allein mit ihm sein dürfen, aber er hatte mit jedem seiner Worte recht. Sie wünschte sich in der Tat mehr vom Leben. Sie dürstete nach Leidenschaft und Abenteuer, sie wollte jedes Vergnügen auskosten, das das Leben ihr schenken konnte. Aber junge Frauen ihres Standes sollten solche Wünsche gar nicht kennen. Warum?
Er zog sie an sich, und seine warmen Lippen fuhren langsam und sinnlich über ihre Schulter und den Nacken. Wie wunderbar sich das anfühlte! Sie legte den Kopf in den Nacken.
Wenn sie genug davon hatte, konnte sie ihm jederzeit Einhalt gebieten, sagte sie sich, während sie immer tiefer in die Welt der sinnlichen Freuden eintauchte. Seine Berührungen waren wie eine Droge, sie wollte mehr davon, sie wollte herausfinden, was als Nächstes kam, wie schnell ihr Herz noch schlagen konnte.
»Du bist wie eine unschuldige junge Blume, reif und bereit, ein Mädchen auf der Schwelle zur Frau«, murmelte er. »Ich kann nicht anders, ich bete dich an, ich lechze danach, dich zu berühren, überall, deine Schönheit zu fühlen.«
Seine Lippen bedeckten die ihren, warm, voll und weich, zuerst nur mit einer sanften Berührung, dann fester. Sie nahm seinen männlichen Duft wahr, ein wenig Zigarrenrauch, Haaröl, seine saubere Haut. Sein Kuss wurde fordernder, seine Zunge teilte ihre Lippen, schmeckte sie, verführte sie.
Leise stöhnte sie auf.
Sie wusste, was sie tat, war verboten. Er hatte die Grenzen der Schicklichkeit längst hinter sich gelassen, küsste sie wie niemand je zuvor. Die schnellen, brennenden Küsse der jungen Männer waren ganz anders gewesen. Sie schwankte, und seine Hände hielten sie fest, strichen über ihren Rücken, während seine Zunge ihren Mund eroberte.
Unwillkürlich schrie sie auf, als seine Hände in ihr Haar fuhren. Er hielt sie fest, küsste sie immer leidenschaftlicher, ließ sie seine Zunge spüren, und sie gab sich immer mehr hin, so sehr genoss sie die Berührungen eines erfahrenen Mannes.
»Oh, Geoffrey«, murmelte sie, fast gewillt, ihm Einhalt zu gebieten. Er zog sich ein wenig zurück und sah ihr in die Augen, als sie hinter ihm eine Bewegung sah oder eher spürte.
Dann hörte sie feste Schritte und zog sich schnell zurück. Diesen festen Schritt hatte sie schon einmal gehört. Und tatsächlich, es war Miles Bennett, der auf dem Weg zum Hauptdeck an ihnen vorbeiging.
Sein kalter, harter Blick verriet ihr, dass er sie gesehen hatte. Für den Bruchteil einer Sekunde zögerte er, als wollte er etwas sagen, aber dann ging er einfach weiter.
»Georgina«, sagte Geoffrey und griff nach ihrem Arm, aber sie zog sich zurück, und er ließ die Hand sofort sinken.
Sie fühlte, wie sie errötete. »Ich glaube, ich sollte mich jetzt zurückziehen.«
»Ich werde Sie begleiten«, sagte er.
»Nein, ich komme gut zurecht.« Sie spürte, wie steif sie klang.
»Georgina«, sagte er leise. »Unschuldige Freuden sind keine Schande ...«
»Nein«, unterbrach sie ihn. »Und es ist auch keine Schande, wenn man beschließt, dass man genug davon hat«, sagte sie kurz. »Gute Nacht.«
Damit ließ sie ihn stehen und ging unter Deck. Gütiger Himmel! In einer so kompromittierenden Situation von Miles Bennett ertappt zu werden! Was würde er jetzt über sie denken? Dann schüttelte sie den Kopf. Was kümmerte es sie, wie er über sie dachte? Wer war er denn, dass er über ihr Verhalten urteilen durfte? Es war doch nur ein unschuldiger Spaß gewesen!
Doch dann erinnerte sie sich an Geoffreys Hand auf ihrer Brust, und sie wünschte sich, sie hätte im Boden ihrer winzigen Kabine versinken können. Sie schloss die Tür ab. Bennett hatte sie auch beobachtet, wie sie mit Richard gelacht und geflirtet hatte. Und er wusste, dass sie verlobt war.
Sie nahm ihren Fächer aus Sandelholz und fächelte sich Luft zu. Ausgerechnet er! Vermutlich hielt er sie jetzt für mannstoll. Dass er sie für verwöhnt und lästig hielt, hatte er ihr ja schon gesagt. Sie ärgerte sich, dass sie es so weit hatte kommen lassen, sie war wütend, weil der Maat sie ertappt hatte, und sie war geradezu rasend vor Zorn, weil sie sich um die Meinung eines Mannes scherte, der ihr doch eigentlich vollkommen gleichgültig sein konnte.
»Ach, soll er doch zum Teufel gehen!«, sagte sie und zerbrach eine Holzstrebe ihres Fächers zwischen ihren Fingern.
Kapitel 2
The Coorong, SüdaustralienFebruar 1840
Die Tenetjeritänzer kamen langsam von den fernen Dünen her, den Abhang hinunter, fünfzehn Krieger, die sich im Takt bewegten wie die dünnen roten Beine der Möwen. Ihre nackten dunklen Füße schlugen einen trommelnden Rhythmus in den Sand. Ein uralter Tanz, der Totemtanz ihres Clans, der Tanz des Tenetjeri, der rotbeinigen Möwe.
Die große, lang gestreckte Bucht von Coorong schimmerte golden im Hintergrund, die Wellen glitzerten in der Sonne. Goldener Sand erstreckte sich zwischen dem Ozean und den Dünen, so weit das Auge reichte. Majestätisch erhoben sich die Sanddünen im rötlichen Abendlicht. Die sommerliche Vegetation war niedrig und trocken, Grashalme mit hell vergoldeten Kanten tanzten im Wind. Die echten rotbeinigen Möwen standen still auf dem Sand, wo auch die Sandregenpfeifer herumliefen. Eine Formation großer, majestätischer Pelikane flog über ihre Köpfe hinweg. Es war ein üppiges Land, das da in der hochsommerlichen Stille lag.
Peeta war glücklich. Am Ende der Gruppe war Thukeri zu sehen, der als junger Krieger hinter den älteren Männern gehen musste. Wäre er nicht so groß und breitschultrig gewesen, man hätte ihn aus der Entfernung kaum erkennen können. Aber sie wusste, dass er es war. Sein Tanz war geschmeidig und kraftvoll, sein Körper jung und männlich. Zu jung, um mit den Älteren mitzuhalten, aber auch zu alt, um mit den noch Jüngeren zu tanzen, die die Rolle der Nemineri, der jungen Möwen übernahmen.
Sie sang mit den anderen, als wäre sie selbst eine Möwe, rief ihn und schlug lauter auf ihre Trommel. Dies war ihr Land. Ihr Paradies. Das geliebte Land ihres Stammes.
Die rituellen Zeichen aus Lehm leuchteten weiß auf der dunklen Haut ihrer Gesichter und bildeten eine Maske, die ihre Züge verdeckte. Einige Tänzer hatten runde Motive aus Punkten im Gesicht, andere trugen Querstriche über Wangen und Nasen. Und alle hatten leichte Schurze aus Tierhäuten um die Hüften.
Als die Tänzer näherkamen, sah sie, dass er es wirklich war. Er hatte noch keinen dichten Bart wie die älteren Männer, die weißen Querstriche auf seinen Wangen betonten seinen feinen Knochenbau und die glatte Gesichtshaut.
Thukeri. Ihr bester Freund und eines Tages, wenn es der große Schöpfer Ngurunderi so wollte, ihr Mann.
Und wenn Peeta die religiösen Vorschriften einhielt, sich vor Zauberei hütete und den magischen Ahnherrn ihres Stammes achtete, Tenetjeri, die Möwe, dann würde das Glück auf ihrer Seite stehen.
Sie und Thukeri waren unzertrennlich, solange sie sich erinnern konnte. Sie waren beide mutig, witzig, voller Spaß und Lachen. Sie stammten beide aus angesehenen Familien des Kandukara-Clans. Tatsächlich wurden beide Familien im ganzen Volk der Ngarrindjeri hochgeachtet, bei allen Stämmen, die dazugehörten, von den Ramindjeri im Nordwesten bis zu den Milipa im Südosten, und bei allen Stämmen an dem großen Fluss, der sich durch das nördliche Hinterland schlängelte. Thukeris Vater Tenetje war der angesehenste Führer der Ngarrindjeri, und er saß im Tendi, dem großen Rat der Ältesten, die über alle wichtigen Angelegenheiten des Volkes bestimmten.
Die Frauen saßen im Schneidersitz im Sand, die Gesichter der sommerlichen Hitze des Sonnenuntergangs zugewandt. Peeta liebte das Gefühl von Sonne auf ihrer Haut, die strahlende Hitze auf ihrem Gesicht und den Brüsten. Sie sah an sich hinunter. Ja, ihre Brüste wuchsen, bald würde sie in den Kreis der Frauen aufgenommen werden. Sie trug schon den Schurz, und in den nächsten Tagen würde sie die Initiationsriten der Mädchen vollenden. Sie hatte schon kleine Brandnarben, bald würden die Schnitte folgen, und dann würden die Frauen ihre Brüste mit Ockerfarbe bemalen.
Ihre Mutter saß neben ihr und sah sie lächelnd an. Ihre Augen leuchteten in der Abendsonne. Peeta erwiderte das Lächeln und drehte sich dann um, um ihre jüngeren Schwestern anzusehen, die hinter ihr saßen. Sie lächelten ebenfalls und lachten. Sie waren zusammen, wie sie es auf jeder Etappe ihrer Reise zu einem Leben als Frau sein würden.
Thukeris Vater Tenetje war der Besitzer des Möwen-Totems; er hatte den Befehl über das Lied. Er ging langsam an der Gruppe vorbei, sang laut mit seiner tiefen Stimme und führte die Tänzer durch die heiligen Worte und Bewegungen. Selbst wenn er die Zeremonie nicht geleitet hätte, hätte man ihn leicht erkennen können. Sein Gesicht trug die Narben der Windpocken, die vor zwanzig Jahren von den Stämmen am Fluss eingeschleppt worden waren und so viele aus seinem Volk das Leben gekostet hatten. Er hatte mit knapper Not überlebt, aber sein Gesicht war für immer entstellt. Die Kraft seines Miwi, seines inneren Seins, hatte ihn vor dem Tod beschützt, der auch vor zehn Jahren die Stämme der Ngarrindjeri heimgesucht hatte. Und dieses Miwi hatte ihn auch zum Anführer seines Clans gemacht.
Peeta legte die Hand auf ihren Bauch, um ihr eigenes Miwi zu stärken, sich vor Zauberei und Krankheit zu schützen und Unglück abzuwenden.
Tenetje führte die Tänzer zum Flutsaum hinunter. In den kleinen Wellen spielte eine Schule Delfine, sie tauchten und sprangen, und glitten unmittelbar vor den Tänzern lautlos zurück ins Wasser.
Tenetje sang den nächsten Teil des Lieds, und die Tänzer verbeugten sich vor dem Wasser, erhoben sich wieder, mit gestrecktem Kinn, wie trinkende Möwen.
Es war wirklich ein perfekter Tag, dachte Peeta. Heiß und trocken, sodass man die Nacht am Strand verbringen und auf dem kühlen, feuchten Sand schlafen konnte. Welten entfernt vom Winter, wenn die kalten Stürme kamen und die Kandukara sich ins Binnenland zurückzogen und sich in ihren Winterhütten verkrochen. Peeta sah die rötlichen Strahlen der Abendsonne hinter den Tänzern, die den Zauber des Tanzes noch verstärkten. Ja, sie war glücklich, sehr glücklich, hier zu sein, Thukeri zu sehen und zu wissen, dass eine wunderbare Zukunft auf sie wartete.
Tenetje veränderte das Lied ein wenig, und die Tänzer schüttelten sich und flatterten, während sie in die Sonne blickten. Peeta setzte sich anders hin und rückte ihren Schurz zurecht, damit er sie richtig bedeckte. Sie war kein kleines Mädchen mehr. Es war wichtig, dass sie sich zurückhaltend gab, jetzt, da sich ihr Körper veränderte.
Tenetjes Lied veränderte sich wieder, der Rhythmus wechselte, die Tänzer liefen in einem großen Kreis herum. Die Frauen schlugen die Trommeln schneller, und die Tänzer sprangen mit großen, geschmeidigen Schritten, als würden sie fliegen, in den Himmel hinauf. Als sie sich streckten, schlugen sie kraftvoll mit den Flügeln. Einer nach dem anderen, streckten sie die Beine, als würden sie im Wind dahingleiten. Und dann ließen sie ihre Rufe hören, mit ausgestreckten Schwingen, kreisten im Aufwind und ließen sich wieder fallen.
Der Refrain erklang wieder, jetzt ein wenig verändert. Die Stimmen der Frauen schwebten über dem Geräusch der Wellen und drängten die Möwen, höher zu fliegen. Peetas Stimme war laut und deutlich zu hören. Sie sang für sich und Thukeri und für ein glückliches Leben.
***
Edith umarmte ihre Mutter und ihren Onkel Ben noch einmal zum Abschied.
»Pass auf dich auf, liebste Tochter«, sagte ihre Mutter und hielt ihren Arm noch einen Moment fest. »Denk immer daran, fleißig zu arbeiten, jeden Abend zu beten und andere so zu behandeln, wie du selbst behandelt werden willst.«
»Sie braucht keine guten Ratschläge in letzter Minute«, lachte ihr Onkel und strich sich mit einer Hand über den Bart. »Sie war immer schon ein braves Mädchen.«
»Das stimmt, aber es kommt ja nicht jeden Tag vor, dass eine Mutter ihre älteste Tochter so ganz allein in die Welt hinausschickt. Da muss ich doch etwas sagen!« Ihre Mutter lachte, aber in ihrer Stimme klang noch ein Rest von Sorge mit. Sie hustete und wandte sich ab.
»Sie kommt schon zurecht. Ihr Herr ist ein Gentleman, einer von den ganz feinen, glaub mir. Er hat mir versichert, dass man gut auf sie aufpassen wird«, sagte der Onkel. »Sie geht auf eines der besten Anwesen im ganzen Bezirk Portland Bay. Und sie ist ja auch schon achtzehn.«
»Ich weiß ja«, lächelte ihre Mutter, aber sie zerdrückte das Taschentuch in ihrer Hand und zog die Tochter noch einmal an sich. »Ich hätte mir nur gewünscht, sie hätte eine Stelle hier bekommen können, in Portland Bay, in meiner Nähe. Lockyer Downs ist fünfzig Meilen weit weg. Ach, wenn es mir doch nur ein bisschen besser ginge, dann könnte ich auch etwas verdienen.«
»Aber das kannst du nicht, Mutter. Du musst dich erholen. Sieh zu, dass du den Husten loswirst und ein bisschen zunimmst. Außerdem gehe ich gern in den Busch. Ich möchte etwas von der Welt sehen und Geld verdienen«, sagte Edith.
»Du bist ein hübsches Mädchen«, bemerkte ihre Mutter mit kritischem Blick, eine Hand an die Wange ihrer Tochter gelegt. »Das kann dich in Schwierigkeiten bringen, so nett und gut erzogen du auch sein magst.«
»Los geht’s, Mädchen«, sagte der Onkel und beendete die Diskussion. Er half ihr auf den Wagen. »Es wird alles gut. Und deine Mutter wird gesund.«
Edith rückte ihre Haube aus Stroh über den braunen Locken zurecht und ordnete die Falten ihres praktischen groben Rocks um ihre Füße. Dann lächelte sie ihrer Mutter noch einmal tröstend zu.
»Abfahrt!«, rief der Kutscher.