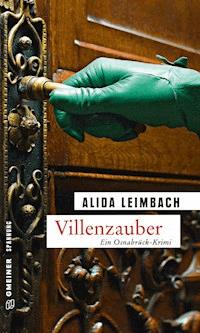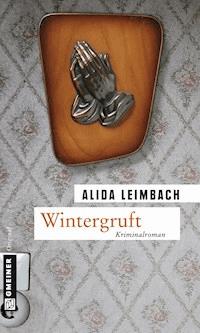Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalkommissar Johann Conradi
- Sprache: Deutsch
Während der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 wird Friseur Rolf Schmalstieg erschossen in seinem Salon aufgefunden. Für Kriminalkommissar Johann Conradi ist es der erste Fall, seit er aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt ist. Alles deutet für ihn auf ein Eifersuchtsdrama hin, denn Schmalstiegs Lebensgefährtin Lieselotte wird von ihrem verschollen geglaubten Ehemann verfolgt. Gemeinsam mit seinem jüngeren Kollegen Fritz Starnke begibt sich Johann Conradi auf Mörderjagd …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alida Leimbach
Tod unterm Nierentisch
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Katja Ernst
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © mauritius images / imageBROKER; Zeitschalter gGmbH / Umspannwerk Recklinghausen – Museum Strom und Leben, Recklinghausen
ISBN 978-3-8392-6804-9
1. Kapitel
Donnerstag, 17.06.1954
Otto Korittke stellte seinen kleinen Koffer neben dem Garderobenständer ab. Er schnupperte die wohlbekannten, aber längst vergessenen Düfte nach Haarspray, Shampoo, Bartwachs und Rasierwasser. Noch ein weiterer Geruch mischte sich hinein, den er aus besseren Zeiten kannte und der ihn an seinen Großvater erinnerte: Es roch würzig-herb und sehr aromatisch nach Zigarre.
Fein war der Salon, eine andere, fremd gewordene Welt. Wie lange mochte es her sein? Jahre? Jahrzehnte? Ihm war der Bezug zu einem normalen Leben völlig abhandengekommen.
»Augenblick, ich bin gleich bei Ihnen«, rief der Friseur aus dem hinteren Teil des Salons.
»Keine Eile«, winkte Korittke ab.
Im Radio lief ein Schlager. »Es liegt was in der Luft«, sangen eine Frau und ein Mann im Duett. Leise summte er mit.
Vor der Kassentheke wies ein Reklame-Aufsteller in verschnörkelter Schrift auf das Angebot des Salons hin:
Schmalstiegs Haarpflege, erstes Spezialgeschäft für moderne Frisuren und Schönheitspflege
Haarschnitt für Damen, Herren und Kinder, elektrische Gesichtsmassage, Kopfmassage gegen Haarausfall und Schuppen, Shampooing, Haartinkturen, elektrische Trockenhaube, Ondulation.Eigene Anfertigung aller vorkommenden Haararbeiten wie Perücken, Toupets, Zöpfe, Locken. Reiche Auswahl in echt und imitiert an Schildpatt-Haarschmuck, Haarbürsten, Zahnbürsten, Parfüm, Seifen, Schminken, Puder und sonstigen Toilettenartikeln.
Hinter der Kasse hing eine gerahmte Fotografie eines schönen, aber kühl wirkenden Mannequins. Eine Weile stand er davor und versuchte, seine Lieselotte in dem Bild wiederzuerkennen.
Er fragte sich, wie Schmalstieg so schnell zu Geld gekommen war, dass er sich einen eigenen Salon leisten konnte. Lange war das mit der Währungsreform noch nicht her. Überhaupt war es erstaunlich, wie viele neue Geschäfte es plötzlich in Osnabrück gab. Sie alle waren prallgefüllt mit Waren. In den Schaufenstern präsentierte sich eine wahre Luxuswunderwelt, als hätte es den Krieg und die mageren Jahre danach nie gegeben.
»Momentchen noch«, rief wieder der Friseur. »Legen Sie schon mal ab und machen Sie es sich bequem!«
Leise pfeifend, um seine Nervosität zu überspielen, sah sich der Kunde nun genauer um. Auf einem nierenförmigen Tisch waren in fächerförmiger Anordnung Illustrierte ausgebreitet. Otto Korittke kannte die Zeitschriften alle nicht. Er kam sich vor wie ein Kind, das die Welt entdeckte.
»Quick« entzifferte er, »Bunte«, »Gong« und »Er – die Zeitschrift für den Herrn«. Das Männermagazin zeigte auf dem Titelblatt eine hübsche Dame, nur mit einem Handtuch bekleidet, die sich in den Dünen eines weißen Sandstrands sonnte. Wie schön müsste es sein, einmal das Meer zu sehen, einen Sonnenuntergang auf der Promenade zu erleben, mit Lieselotte an seiner Seite.
Der Friseur kam auf ihn zu – ein großgewachsener, breitschultriger Mann in einem weißen Kittel. Er sah erstaunlich gut aus, viel besser, als Korittke erwartet hatte.
»Sie wünschen?«, fragte er mit einem professionellen Lächeln, das jedoch sogleich einfror, als er das schmuddelige Erscheinungsbild seines Kunden bemerkte.
Otto Korittke musste wegen des Größenunterschiedes zu ihm aufblicken. »Tja«, begann er zaghaft lächelnd und gab sich Mühe, seine Unsicherheit zu überspielen. »Da bin ich nun also.«
Der Friseur musterte ihn von oben bis unten. »Was kann ich für Sie tun?«, fragte er mit frostiger Stimme. Offensichtlich hielt er ihn für einen Bettler oder Hausierer.
»Ich möchte … ich würde gern …«, stammelte Korittke und drehte seine Kappe in den Händen.
»Nur damit Sie es wissen: Schmalstieg ist mein Name. Ich bin hier der Chef, kann Ihnen aber keinen Rabatt einräumen, sosehr ich es auch bedaure. Hundert Meter weiter, am Ende der Johannisstraße, bekommen Sie einen Haarschnitt zu einem günstigeren Preis. Ich hoffe, Ihnen damit gedient zu haben. Schönen Tag noch, der Herr!«
»Ondulation«, sagte Korittke schnell, »ich hätte gerne eine Ondulation. Wird doch bei Ihnen gemacht?« Er deutete mit dem Kopf zum Reklameaufsteller. »Zumindest steht es da!«
Schmalstiegs Augen verengten sich. »Eine Ondulation ist die chemische Einbringung von Locken ins Haar, auch Dauerwelle genannt, und leider nur für das Frauenhaar vorgesehen.«
Korittke lächelte spröde, nahm auf dem mittleren Stuhl im Männerbereich Platz und angelte sich den Zeitungshalter mit der aktuellen Tagespost. »Bedienen Sie ruhig Ihren Kunden weiter, ich habe Zeit«, sagte er, ohne den Blick vom Blatt zu nehmen. »Viel zu viel Zeit, um genau zu sein, aber das interessiert Sie sicher nicht.«
Der Friseur seufzte übertrieben. »Es kommt gleich jemand.« Im Stechschritt durchquerte er den Damensalon und verschwand hinter einem dicken grünen Vorhang. Dort läutete er mit einer Glocke und rief: »Kundschaft!«
Korittke schlug die Zeitung auf. Das Bild der deutschen Fußballmannschaft, die am Abend spielen sollte, fiel ihm ins Auge. Er hatte die Jungs vorhin schon in einem Schaufenster gesehen. Ein Radiogeschäft warb mit Fernsehgeräten. Sie kosteten ein Vermögen, aber vielleicht wäre es ihm ja möglich, darauf zu sparen. Erst einmal musste er Arbeit finden. Lange hatte er davorgestanden, bis sein Mund trocken wurde und er beschloss, in ein Wirtshaus zu gehen. Dort hatte er sich mit Bier und Korn etwas Mut angetrunken und von seinem Begrüßungsgeld ein kleines Schnitzel bestellt. Nach wenigen Bissen war er satt gewesen, sein Magen war so klein geworden.
Als er einen Schatten vor sich bemerkte, blickte er auf.
»Hoffentlich mussten Sie nicht so lange warten!«, sagte eine nette Frauenstimme.
Vor ihm stand eine Angestellte, etwa 20 Jahre alt. Ihr Gesicht kam ihm bekannt vor, auch ihre Stimme hatte einen seltsam vertrauten Klang. Ob das etwa Bettine …? Er traute sich nicht, sie darauf anzusprechen, so heruntergekommen, wie er war.
»Wieso dauerte das so lange?«, herrschte Rolf Schmalstieg die junge Frau an. »Wo bleibst du denn, Tine?«
»Entschuldige, ich musste oben helfen, Salate vorbereiten, Schnittchen schmieren und Eier dekorieren. Bald beginnt das Spiel gegen die Türkei. Wir sind aber fast fertig.« Zu dem Kunden im Wartebereich, der gerade die Zeitung am Holzstiel weghängte, sagte sie: »Sie dürfen dann, mein Herr.« Auch sie musterte ihn kritisch. Otto Korittke wusste, dass ihr sein Aussehen missfiel. Seine Kleidung war abgetragen und schlotterte um seinen mageren Körper, die Schuhe dreckig, der Koffer abgestoßen. Er kam direkt vom Bahnhof, hätte sich gerne vorher frisch gemacht, wusste aber nicht, wo. Nach jahrelanger russischer Gefangenschaft hatte er kein Zuhause mehr.
»Liebes Fräulein, ich würde gerne Frau Korittke sprechen«, sagte er, »Frau Lieselotte Korittke.«
Rolf Schmalstieg unterbrach sein Gespräch mit dem Kunden. »Um was handelt es sich?«
»Diese Adresse wurde mir genannt. Hier soll ich sie finden. Stimmt das nicht?«
Der Friseur hob sein Kinn und starrte ihn düster an. »Was wollen Sie von ihr? Sie schneidet keine Haare!«
»Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig.« Mit beiden Händen hielt Korittke seine Kappe fest. Den Koffer hatte er zwischen seine Beine geklemmt.
»Meine Tochter Bettine wird Sie bedienen.« Der Friseur verteilte Rasierwasser in seinen Händen und klopfte es energisch gegen die glatt rasierten Wangen des Kunden. Klatschende Geräusche waren zu hören, als würde er Backpfeifen verteilen. Der Kunde gab einen missfallenden Brummton von sich. »Genießen Sie es, Herr Schulte! Leichte Schläge fördern die Durchblutung!«
»Ihre Tochter?«, fragte Otto Korittke und wurde blass.
*
»Das Rührei bitte mit Kräutern und etwas Speck, kross gebraten, dazu zwei Scheiben Toast, nur mäßig braun«, wies Möbelfabrikant Walter Kettler das Hausmädchen Katharina an. Er war gerade aus der Fabrik gekommen und nahm nur eine leichte Mahlzeit ein, weil er Magendrücken hatte. Schon vor dem Krieg hatten sie eine Gründerzeitvilla am Westerberg bezogen, die sie vornehm eingerichtet hatten, mit schweren orientalischen Teppichen, Seidentapeten und Ölgemälden in Jugendstil- und Barockrahmen. Sie saßen im Salon, einem großen Zimmer mit einer Flügeltür zum Garten hin und einer weißen Blumenbank, auf der Giselas Kakteensammlung aufgereiht war. Der Salon, der Wintergarten und das angrenzende Speisezimmer waren noch mit schweren Vorkriegsmöbeln ausgestattet. Gisela drängte längst auf moderne leichte Möbel, aber für sein gemütliches Heim wollte er nicht auf die gewohnte Eichenvollholzqualität verzichten. Nur bei der Sitzgruppe hatte er sich auf einen Kompromiss eingelassen und beschwingt wirkende Sofas und Sessel in Bonbonfarben fertigen lassen. Das Kaminfeuer knisterte – es war ein kühler und regnerischer Tag – und im Radio lief Swingmusik.
»Ach, und, Katharina, bitte denken Sie daran, dass wir nachher eine kleine Gesellschaft erwarten. Das Spiel beginnt um 18 Uhr. Spätestens zur Halbzeit sollte für acht Personen alles gerichtet sein.«
»Sehr wohl«, gab Katharina mit einem Knicks zurück. Ihr Blick verriet, dass sie für den Abend eigentlich etwas anderes vorgehabt hatte. Mit verschlossener Miene verließ das Mädchen den Raum.
»Musste das sein, Walter?« Gisela verzog das Gesicht. »Wir haben sie in dieser Woche schon zweimal abends beansprucht. Wenn sie kündigt, müssen wir wieder mühsam jemanden einarbeiten. Dazu habe ich keine Lust.«
»Natürlich musste das sein.« Walter straffte seine Zeitung und verschaffte sich einen Überblick über die Artikel. Die Osnabrücker Rundschau war an diesem Tag voll mit Berichten über die Fußballweltmeisterschaft. »Sie wird nicht kündigen, Liebes, sie weiß genau, was sie hier hat. Ein hübsches Zimmer mit einem eigenen Bad en Suite findet sie so schnell nicht wieder. Dazu gute Speisen und ein Gehalt, von dem sie sogar zu Hause etwas abgeben kann.«
»Das ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Sogar unsere Arbeiter und Fabrikangestellten verdienen besser. Ihr bleiben nach Abzug von Kost und Logis nur 100 Mark.«
»100 Mark sind mehr als genug.« Er vertiefte sich in einen Sportartikel.
Gisela nestelte am silbernen Zigarettenetui, nahm eine Eckstein heraus und ließ sich von ihrem Mann Feuer geben. »Du bist mir noch eine Antwort schuldig, Walter. Wie war es gestern beim Friseur? Was sagt er zu der Sache? Mich würde interessieren, wie er die schockierende Nachricht aufgefasst hat.«
Der Fabrikant ließ die Zeitung sinken. »Er wirkte nicht sonderlich überrascht, eher so, als störe ihn der Umstand überhaupt nicht, dass sein minderjähriges Töchterchen ein Kind von einem Mann erwartet, mit dem sie nicht verheiratet ist und der in keiner Weise ihrem Stand entspricht.«
»Jetzt spann mich nicht auf die Folter. Was hat er gesagt?« Sie nahm einen tiefen Zug.
»Natürlich erwartet er, dass Edmund sie heiratet. Das war abzusehen.«
»Vernünftig von ihm, oder? Ich denke, das Kind gehört in eine richtige Familie. Edmund ist alt genug, und Bettine … Nun ja, sie wird es lernen, Mutter zu sein und einen Haushalt zu führen.« Sie stockte. »Was ist? Warum schaust du so? Deinem Stirnrunzeln entnehme ich, dass du nicht damit einverstanden bist. Aber warum nicht, Walter?«
»Edmund wird es nicht tun, er wird sie nicht ehelichen, er darf es nicht. Das ist er seinem guten Namen schuldig. Wir müssen ihn auf jeden Fall davon überzeugen, dass er einen Fehler macht, wenn er nicht auf uns hört. Edmund ist jung, erst 21 Jahre alt. Da bleibt genug Zeit, die Richtige zu finden. Ich habe auch das Gefühl, er liebt diese Bettine nicht wirklich. Unser Sohn hat eine bessere Partie verdient.«
»Das können wir nicht beurteilen, Walter.«
Der Fabrikant wiegte den Kopf. »Die Richtige wird kommen. Edmund braucht eine Frau aus gutem Hause, die etwas mitbringt, die Möbel Kettler voranbringt und nicht umgekehrt schröpft.«
Gisela fröstelte beim Anblick der Kondenstropfen, die sich am Glas bildeten. »Legst du bitte Holz nach, Darling? Es ist nur noch wenig Glut im Kamin. Und es regnet ununterbrochen.«
Verständnislos zuckte er mit den Schultern. »Wir haben Sommer, kalendarisch seit zwei Tagen schon. Ich finde, es ist warm genug im Raum, aber wenn du meinst …« Seufzend begab er sich zum Holzlagerfach, nahm einige Scheite heraus und warf sie ins Feuer. Mit dem Schürhaken stocherte er nach.
»Die Konkurrenz ist groß und nimmt beständig zu«, fuhr er fort, während er ächzend Platz nahm. Er hatte seit der Währungsreform fast 20 Kilo zugenommen. Die Schneiderin hatte unentwegt zu tun, die zu eng gewordene Kleidung zu ändern. Seine Frau versuchte es bereits mit Diäten, aber er hielt nichts davon, war froh, dass es wieder genug zu essen gab, und genoss die reiche Auswahl auf dem Tisch. »Wir brauchen Mittel, um zu investieren. Die Maschinen sind nicht die modernsten und genügen den heutigen Ansprüchen in keiner Weise. Die Kunden verlangen Kunststoffmöbel, kein Echtholz mehr. Sie wollen Farben, die aussehen wie Bonbons oder Eissorten. Das schaffen wir mit unseren Maschinen nicht. Kurz gesagt, wenn schon eine Schwiegertochter, dann eine aus gutem Hause.«
Walter Kettler lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor dem Wohlstandsbauch. Es war noch gar nicht lange her, nicht einmal zwölf Jahre, da hatte er mit leeren Händen vor seinem zerstörten Betrieb gestanden. Eine Bombe hatte das Zentrallager in Bramsche getroffen. Nichts war ihm geblieben. Und heute besaß er eine florierende Firma, die munter auf der Wirtschaftswunderwelle mitschwamm. All das hatte er selbst fertiggebracht, mit Weitsicht, Fleiß, Klugheit und einer gewissen Portion Egoismus. Sicher, die Zeit war ihm zu Hilfe gekommen, die große Nachfrage der Kunden, die Tatsache, dass er auf das richtige Pferd gesetzt und in Möbel investiert hatte. Aber vor allem hatte er es seiner Tüchtigkeit zu verdanken, dass es seiner Familie heute so gut ging. Walter Kettler hatte das richtige Gespür für die Zeichen der Zeit. Die Leute waren wie wild auf neue Möbel, Teppiche und Stoffe, um ihre Wohnungen geschmackvoll und modern einzurichten. Sie hatten auch keine Scheu mehr wie früher, auf Pump zu leben. Im Gegenteil, Ratenkauf war sehr beliebt. Deshalb würde es sich lohnen, in Werbung zu investieren. Sein Eintrag im Branchenbuch der Stadt Osnabrück war 16 Jahre alt und wirkte mittlerweile bieder und antiquiert:
Kettler, Walter, Möbelfabrik. Vornehme, geschmackvolle Wohnungseinrichtungen von einfachster bis reichster Art in gleicher, erstklassiger Ausführung unter Verwendung nur besten Materials. Die Herstellung geschieht in eigener Fabrik, wodurch jeder persönliche Wunsch berücksichtigt werden kann. Einrichtung ganzer Häuser sowie einzelner Zimmer mit Vertäfelungen, Holzdecken und so weiter. Eigenes künstlerisches Atelier. Ständige Ausstellung von zahlreichen fertig eingerichteten Musterzimmern, in Holz und in Kunststoff, Gemälden, Radierungen, großes Stoff- und Teppichlager, Maschstraße.
Zufrieden war er damit nicht. Er wusste, dass die Nachfrage nach Holzvertäfelungen, Holzdecken und Vollholzmöbeln stetig zurückging. Zigarettenrauch waberte durch den Salon und überdeckte Giselas Tosca-Parfüm.
Er war auf dem Weg, ein reicher Osnabrücker Bürger zu werden. Seit bald 20 Jahren besaßen sie diese prächtige Villa am Westerberg aus der Gründerzeit. Inzwischen würde Gisela lieber einen schicken komfortablen Neubau mit Zentralheizung beziehen. Aber Walter Kettler war ein Mann mit konservativen Ansichten, der Wert auf Gediegenheit und Qualität legte. Er fuhr einen großen Wagen, seine Frau ein Cabriolet, der Junge hatte zu Weihnachten einen Volkswagen bekommen, bevorzugte allerdings immer noch das Moped, mit dem er sich verwegener fühlte, wie er stets betonte. Undankbar war die Jugend.
»Du unterstellst Bettine etwas, ohne sie richtig zu kennen. Hast du dich mal längere Zeit mit ihr unterhalten als in den 20 Minuten, in denen sie dir die Haare schneidet?«
»Die 20 Minuten reichen mir bereits, um mir ein Bild zu machen.«
»Und? Welches Bild hast du dir gemacht?«
Kurz ging er in sich. »Sie ist ein Fräulein aus einfachem Hause, hübsch, aber liederlich und flatterhaft und zudem völlig unvermögend. Der Vater ein vermisster Koch, die Mutter eine ehemalige Friseuse, nun Hausfrau. Mit einem Haufen Kindern und der Großmutter hausen sie in beengten Verhältnissen. Ich möchte nicht wissen, wie die hygienischen Bedingungen bei denen aussehen. Es heißt, wo mehr als sechs Köpfe unter einem Dach leben, sind Läuse und Krätze nicht weit. Und jetzt kommt’s: Einige Geschwister sind älter als Bettine, andere jünger. Viel jünger, um nicht zu sagen: richtig klein. Ein Windelmatz ist auch darunter. Und nun sag mir bitte, von wem sind die wohl? Vom verschwundenen Ehemann der Mutter gewiss nicht, der soll noch irgendwo in Russland sein!«
Gisela Kettler griff nach ihrer geblümten Kaffeetasse mit Goldrand, streckte ihren kleinen Finger aus, was Walter nicht leiden konnte. »Und wenn es so wäre, Walter? Dinge dieser Art passieren nun einmal, sie geschehen öfter in unruhigen Zeiten. Wer wartet denn schon zehn Jahre auf seinen Ehemann? Das kann man nicht von einer Frau verlangen. Niemand hält das aus. Allein ist es schwer, besonders mit Kindern. Irgendjemand muss doch das Brot verdienen. Es sei ihr gegönnt, dass sie wieder einen Mann an ihrer Seite hat.«
»Es sind uneheliche Kinder, Gisela. Mann und Frau leben in wilder Ehe zusammen, in ungeordneten Verhältnissen. Was sind das für Zustände? Das geht doch nicht! Die Kirche hat eine Onkelehe nicht gewollt und heißt sie nicht gut. Auch die Gesellschaft duldet so etwas nicht. Welcher Ruf geht diesen Leuten voraus! Es wird ein schlechtes Licht auf uns werfen, wenn Edmund sich weiter mit diesem Mädchen abgibt.« Je länger er darüber nachsann, was ihm und seiner Familie bevorstand, desto nervöser wurde er. Mit dem Fuß stupste er die Siamkatze weg, die sich gerade auf seinem Schoß niederlassen wollte. Stattdessen suchte sie nun mit beleidigtem Blick Giselas Nähe, sprang zu ihr aufs Sofa und ließ sich das weiche Fell kraulen.
Ärgerlich betrachtete er das innige Bild, das sich ihm bot. Gisela lag mit angezogenen Beinen auf der Couch. Sie trug ein grünes, tiefdekolletiertes Abendkleid, dazu eine Perlenkette und auffälligen Ohrschmuck, der bei ihrer kurzen Lockenfrisur gut zur Geltung kam. Eine vornehme und äußerst gepflegte Frau war sie, zu der ihre Siamkatze Miranda gut passte. Seine Frau war vollauf mit sich selbst beschäftigt, vor allem damit, immer jung zu wirken. Ihr Tag spielte sich hauptsächlich in Kosmetik- und Frisiersalons ab, in teuren Modeateliers, bei Modenschauen und bei Cocktailpartys. Gisela war eine attraktive, elegante Frau, aber sie berührte ihn nicht mehr. Er fühlte keine Liebe mehr für sie. An manchen Tagen konnte er sie nicht einmal ertragen. Mittlerweile verstand er sogar Männer, die ein heimliches Techtelmechtel mit ihrer Sekretärin hatten. Schon lange träumte auch er von einer Geliebten, hatte es in der Firma zwei-, dreimal bei den Schreibfräuleins versucht, leider ohne Erfolg. Die Damen trugen ihre Nasen heutzutage höher als ihre Brüste.
»Du kannst nicht ernsthaft wollen«, sagte er, »dass unser Sohn in so eine Familie einheiratet. Wie stünden wir da? Reden würden die Leute, verspotten würden sie uns! Die Kunden kaufen dann bei der Konkurrenz. Willst du das? Möchtest du anderen Möbelhäusern in die Hände spielen und unser Familienglück riskieren, nur um ein kleines Enkelkind im Arm zu halten? Lass nicht immer dein Herz sprechen, Gisela, das war noch nie der richtige Weg. Romantische Gefühle sind unsinnige Gefühle, sie haben keinen Bestand. Was allein zählt, ist der Erfolg. Vergiss nie: Bei allem, was du tust, bei jedem Schritt, den du gehst, überlege, ob es im Sinne unserer Firma ist.«
Ihr Gesicht verdüsterte sich.
»Na siehst du«, interpretierte er ihre nachdenkliche Stimmung, »ich wusste, dass du nicht naiv bist. Rede mit Edmund. Überzeug ihn davon, dass sein Weg nicht der richtige ist. Auf dich wird er eher hören als auf mich. Eines Tages wird er uns dankbar sein.«
»Wie hast du es eigentlich erfahren?«, wollte Gisela Kettler wissen und rauchte nervös.
»Was denn, Liebling?«
»Na, die Nachricht von ihrer Schwangerschaft.«
Er räusperte sich. »Beim Haareschneiden war das. Sie hat wortwörtlich gesagt: ›Guten Tag, Herr Kettler, wissen Sie, dass Sie bald Großvater werden? Und sehr wahrscheinlich sogar mein Schwiegervater?‹ Da hat es mir förmlich die Sprache verschlagen. Demnächst werde ich mir Herrn Schmalstieg persönlich vorknöpfen. Ich werde ihm ein Angebot unterbreiten, das er nicht ausschlagen kann.«
Es klopfte. Katharina brachte auf einem Silbertablett die warme Zwischenmahlzeit. »Ich hoffe, es ist recht so«, sagte sie mit verkniffenem Mund und stellte das Tablett auf einer Anrichte ab. »Vielen Dank, Katharina.«
Mit gesenktem Kopf entfernte sie sich, blieb aber in der Tür stehen.
»Was ist denn noch?«, fragte der Möbelfabrikant mit einem Anflug von Ungeduld.
»Ich hätte da eine Frage, verzeihen Sie bitte.«
»Nanu?« Er zog die Augenbrauen hoch.
Das Dienstmädchen machte einen Knicks und lüftete die weiße gestärkte Spitzenschürze. »Ich hoffe, es ist nicht allzu aufdringlich, aber ich wollte fragen, ob alles recht ist.«
Walter Kettler lachte leise. »Natürlich ist es das, vielen Dank.«
»Wer spielt eigentlich heute?«
»Wir gegen die Türkei«, sagte er. »Ein wichtiges Spiel. Es wird zeigen, ob wir überhaupt eine Chance haben. Ich rechne mit nichts. Wir müssen uns gewaltig ins Zeug legen, um mit den anderen Mannschaften mitzuhalten. Wenn wir das nicht tun, sind wir schneller wieder draußen, als wir denken können.«
Katharina bedankte sich, trat aber immer noch nicht den Rückzug an.
»Noch etwas?«
Sie räusperte sich, knickste noch einmal. »Ich wollte einfach nur mal fragen, ob ich vielleicht, einmal, ein einziges Mal, bitte verzeihen Sie meine Aufdringlichkeit … Das Spiel würde mich sehr interessieren! Es wäre so schön, wenn ich dabei sein dürfte, Herr Kettler! Ich habe doch in der Kellerküche kein Radio.«
Er schmunzelte. »Das lassen wir mal schön sein. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber wenn Sie uns nett bedienen, richtig nett, bekommen Sie eventuell das eine oder andere Tor mit!«
2. Kapitel
Otto Korittke stützte seinen müden Kopf auf. Hunger hatte er nicht. Das Wiedersehen mit seiner Lotte schlug ihm auf den Magen. Minutenlang konnte er nichts sagen, bis seine Frau, ja, das war sie immer noch, damit begann, die Platten wegzuräumen und den Tisch zu decken.
»Das ist das Teeservice, das ich dir zur Hochzeit geschenkt habe«, bemerkte Otto mit rauer Stimme und sah zu, wie sie ein Sahnekännchen dazustellte. Er fühlte sich vernichtet. Verraten und verkauft. Er hatte gehofft, dass sich alles als Irrtum herausstellen würde. Nie hätte er damit gerechnet, dass sie nicht auf ihn warten würde! Wie auch? Schließlich hatte er sie nicht freiwillig verlassen, sondern war gezwungen worden, sich bei der Wehrmacht zu melden. Er hatte ihr versprochen, so schnell wie möglich gesund zurückzukommen. Sie hatte ihn bei ihrem letzten Abschied nach einem Heimaturlaub lange in den Arm genommen und geweint. Wie hätte er damit rechnen sollen, dass sie es nicht ernst meinte, sondern sich den Nächstbesten schnappte, der an ihr vorbeilief, um heimlich mit ihm erst ein Techtelmechtel zu haben und dann ein neues Leben zu beginnen?
»Ich weiß«, sagte Lieselotte. »Ich halte es in Ehren.«
»Das tust du nicht«, platzte es aus ihm heraus. »Du benutzt es mit einem anderen Mann, diesem Friseur. Er trinkt aus meinen Tassen und isst von meinen Tellern. Was ist mit deinem Ehering? Du hast ihn abgenommen?«
Sie blickte auf ihre Hände, als suche sie ihn dort. »Willst du ihn wiederhaben?«
Bekümmert schüttelte er den Kopf. »Behalte ihn ruhig. Bewahre ihn für Bettine auf. Ich habe keine Verwendung dafür.«
»Ach, Otto.«
»Es ist, wie es ist. Du brauchst mich nicht zu bemitleiden.«
Eine Weile saßen sie sich schweigend gegenüber und tranken Tee. Als das Essen fertig war, gab sie ihm eine ordentliche Portion direkt aus der Pfanne und sah zu, wie er aß. Beim Anblick der fettigen Bratkartoffeln hatte er doch Appetit bekommen. Sie bot ihm einen Nachschlag an, aber er lehnte ab.
»Wie soll es jetzt weitergehen?« Er legte das Besteck quer auf den Teller und schob ihn ein Stück zur Seite. »Ich habe mich so auf unser Wiedersehen gefreut!«
»Ich mich doch auch, Otto, das musst du mir glauben! Lange habe ich davon geträumt, dass du zurückkehrst. Ich habe mich an der Hoffnung festgehalten, dass alles gut werden wird. Ich habe mir vorgestellt, wie es sein würde, wenn wir uns in die Arme fallen, wie du dich anfühlst, wie deine Haut riecht. Aber irgendwann … Hörst du, es war nicht leicht für mich. Hinter uns liegen schwere Zeiten. Ich musste doch an unsere Kinder denken. Der Hungerwinter 1947 war furchtbar, wir waren alle krank und bekamen keine Medizin. Ich weiß nicht, wie wir diese Zeit überhaupt überlebt haben.« Sie machte eine kurze Pause, sah ihn an. »Gerd ist tot, weißt du das überhaupt?«
Entsetzt hob er den Blick. »Nein, das wusste ich nicht. Mein erstgeborener Sohn tot? Was ist geschehen? Ist er gefallen?«
Sie nickte. »Ich will jetzt nicht darüber sprechen, sonst muss ich wieder weinen, und das will ich nicht.«
Verlegen kratzte er sich am Nacken. »Ich könnte die Wut kriegen, wenn ich noch die Kraft dafür hätte. Er war ein Kind, unerfahren, übermütig, gutgläubig. Am Ende haben sie auch die ganz Jungen geholt.«
»Gerd fehlt mir so sehr«, sagte sie. »Es gibt Momente, in denen ich besonders an ihn denke. Dann zerreißt es mich jedes Mal aufs Neue. Aber es geht vielen so. Man darf nicht ständig jammern.«
»Ich verstehe dich. Wir müssen nach vorne schauen, Lieselotte.« Seine Lippen bebten. »Was ist mit den anderen? Was macht Karl?«
Ihre Miene erhellte sich. »Eva studiert. In Hamburg«, sagte sie stolz. »Sie will Lehrerin werden!«
»Das ist ja großartig. Wie hat sie das denn geschafft? Sie war immer schon ehrgeizig, eine gute Schülerin, aber dass sie studiert? So ein Studium kostet doch eine Unmenge Geld!«
»Ihr Lehrer unterstützt sie. Er hat dafür gesorgt, dass sie ein Stipendium bekommt. So müssen wir das Hörergeld nicht bezahlen, zumindest für die ersten vier Semester. Die Miete für ihr Zimmer bezahlt Rolf. Das geht schon. Die 25 Mark kann er erübrigen.«
»Rolf. Ja«, sagte Otto. »Rolf hat genug, ich sehe schon. Dein Rolf scheint richtig im Geld zu schwimmen. Da kann ein ehemaliger Hotelkoch wie ich nicht mithalten. Und Karl? Wie geht es Karl?« Röte schoss ihm ins Gesicht. Er wollte keine Hiobsbotschaft mehr hören. Es war genug.
Sie zögerte, sah an ihm vorbei. »Karl ist im Moment in einer etwas schwierigen Phase. Er ist laut und frech. Nun ja, er ist 19, kein einfaches Alter. Oft eckt er bei Rolf an. Die zwei sind wie Hund und Katz. Aber er hat Glück gehabt«, fuhr sie munterer fort. »Das Hotel Hohenzollern hat ihn genommen, nachdem er vom Elektriker, vom Herrenschneider und vom Buchbinder wegen Unpünktlichkeit und Aufsässigkeit gefeuert worden ist. Er tritt in deine Fußstapfen, Otto, macht eine Lehre als Koch, ist im zweiten Lehrjahr, verdient schon 60 Mark. Die Hälfte davon gibt er uns als Kostgeld ab. Rolf wollte ihm nur 10 Mark lassen, das sei genug Taschengeld, meint er, aber das konnte ich verhindern, denn Karl spart auf einen Motorroller. Es gefällt ihm im Hotel, darüber bin ich sehr froh. Ich bete jeden Tag, dass er endlich bleiben kann. Schon länger habe ich keine Klagen mehr gehört. Vielleicht ist das seine Berufung!«
»Das ist schön«, sagte Otto lächelnd. »Ich wusste, dass er eines Tages meinen Weg einschlägt und im Hotel arbeitet. Als Kind wollte er immer Kellner sein, weißt du noch? Das war sein Lieblingsspiel.«
Sie schmunzelte bei der Erinnerung daran.
»Verkaufstüchtig war er immer schon. Wie geht es deiner Mutter?«
»Ausgezeichnet. Sie ist froh, wieder eine Aufgabe zu haben.«
»Eine Aufgabe? Was meinst du damit?« Sein Gesicht wurde ernst.
Sie schluckte hörbar. »Wo warst du überhaupt?«, fragte sie schnell. Sie rieb ihre Fingerknöchel, bis sie weiß wurden. »All die Jahre, ohne etwas von dir hören zu lassen. In Russland?«
Otto griff nach seiner Teetasse und nickte. »Fast zehn Jahre Gefangenschaft. Ich habe dir geschrieben, sehr oft sogar. Hast du meine Briefe nicht bekommen?«
»Anfangs ja. Ich habe zurückgeschrieben, aber irgendwann hast du nicht mehr geantwortet. Was ist passiert, Otto?«
»Ich möchte nicht darüber reden.«
Sie rührte die Kandisbrocken in ihrer Teetasse um, immer wieder, bis sie sich langsam auflösten. Eine Weile war nur das knisternde Geräusch zu hören, das der Löffel beim Umrühren der Zuckerstücke in ihrer Tasse verursachte. »Ich muss dir etwas sagen«, sagte sie und atmete tief durch. »Du würdest es ja doch erfahren.« Kurz sah sie zu ihm hin, es fiel ihr sichtlich schwer zu sprechen, aber es half nichts. »Ich habe zwei weitere Kinder bekommen. Sie sind noch sehr klein, Karin und Peter, sechs Jahre alt und fast drei. Sie geht schon zur Schule, ist Ostern eingeschult worden. Ihr Mund steht den ganzen Tag nicht still. Der Kleine hat erst spät angefangen zu laufen, ist noch etwas unsicher auf den Beinen. Meine Mutter ist mit ihnen unterwegs. Ich rechne jede Minute damit, dass sie zurückkommen.«
Er erstarrte. »Mit ihm? Mit diesem Friseur?« Er deutete mit dem Daumen in Richtung Küchentür. Pure Verzweiflung stand ihm ins Gesicht geschrieben, als erfasse er erst jetzt das Ausmaß der Katastrophe. »Es ist also vorbei mit uns?«
Sie nickte traurig. »Ja, Otto. So ist es. Rolf und ich sind ein Paar, wir leben zusammen wie Mann und Frau. Endlich ist es raus. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als dich damit abzufinden.«
»Du kommst nicht zurück zu mir? Ist das endgültig?«
»Ja, Otto.«
»Seid ihr verheiratet?«, presste er atemlos hervor.
»Noch nicht. Aber wir werden es wohl bald sein.«
»Und wir? Was ist mit uns?« Seine Stimme brach. Seine Augen wurden rot und schienen vor Erschöpfung zufallen zu wollen.
»Es tut mir so leid. Ich dachte, du würdest nie wiederkommen, und deshalb habe ich mir ein neues Leben aufgebaut. Zusammen mit Rolf.« Draußen ratterte die Straßenbahn vorbei. Sie wartete, bis es ruhiger wurde. »Was hätte ich denn tun sollen? Mit den Kindern allein bleiben? Wie hätte ich sie ernähren sollen? Die Kinder brauchen einen Vater und ich brauche einen Mann! Ich bin nicht geschaffen für ein Leben als alleinstehende Frau. Das wollte ich nicht, Otto.«
»Und in diesem Leben habe ich keinen Platz«, schlussfolgerte er. »Darin habe ich nichts mehr zu suchen.« Er streifte seinen Ehering ab und legte ihn auf den Küchentisch. »Den brauche ich wohl nicht mehr. Er passte sowieso nicht so gut wie am Anfang, war mir zu weit geworden.«
»Bitte versteh doch und verzeih! Wenn ich wenigstens gewusst hätte, dass du noch lebst! Ich kann es nicht ändern, Otto, auch wenn ich wollte! Es ist zu spät! Ich habe mit Rolf zusammen eine neue Familie. Mach es uns nicht schwerer, als es ist!«
»Dann werde ich jetzt gehen«, sagte er traurig und nahm seine Kappe. »Ich habe hier nichts mehr verloren.« Er trank den Tee aus, nahm sein Gepäck und ging, ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen.
»Komm bitte nicht wieder, hörst du? Glaub mir, es ist am besten so. Du wirst eine andere Frau finden und mit ihr glücklich werden, bist ja noch jung genug«, rief Lieselotte ihm hinterher, aber er antwortete nicht.
Auf der Stiege begegnete er seiner Noch-Schwiegermutter Wilma, die ein Kleinkind auf dem Arm trug. Schnell zog er seine Kappe tiefer ins Gesicht und murmelte einen Gruß. Hinter ihr tauchte ein Mädchen mit hellem Bubikopf auf. Sie sang mit ihrer hellen Kinderstimme ein Lied, das er gut kannte, denn seine Schwiegermutter hatte es auch mit den älteren Enkeln oft gesungen: »Im Frühtau zu Berge wir ziehn, fallera«. Das Mädchen stoppte sofort, als sie ihn erblickte. »Oma, wer ist dieser fremde Mann?«, fragte sie und schaute ihn mit großen Augen an.
»Ich weiß es nicht«, sagte Wilma, erwiderte aber kurz seinen Gruß.
Unten angekommen, drehte Otto Korittke sich um und sah der kleinen Gruppe hinterher. Wilmas Haare waren weiß geworden, und die der Kleinen waren blond, nicht braun wie die der anderen vier Kinder. Mit hängenden Schultern durchquerte er den Salon. Hinten öffnete sich eine Tür, und heraus kam Karl. Er erkannte ihn sofort. »Karl«, rief er, »Karl!« Kurz standen sie sich gegenüber. Karl war inzwischen ein paar Zentimeter größer als er. Er hatte eine aufgeplatzte Augenbraue, eine rote Wange und einen frischen Erguss unter einem Auge. Otto zuckte erschrocken zurück. »Was ist los?« Er wollte ihn am Arm festhalten, aber Karl schien nicht zu wissen, wer er war, machte sich los und ging, ohne ein Wort zu sagen, an ihm vorbei in Richtung Privatwohnung.
3. Kapitel
Johann Conradi war froh, dass der Tag endlich seinem Ende zuging. Lang und kräftezehrend war er gewesen, Probleme mit seinem Chef, Vorwürfe, er würde seine Arbeit nicht genau genug nehmen, habe sich nicht gründlich genug eingearbeitet – dabei war er schon seit mehr als vier Wochen auf seiner neuen Dienststelle in Osnabrück. Auch sei er mit seinen Gedanken oft woanders. In diesem Punkt musste der Kriminalkommissar seinem Vorgesetzten leider recht geben. Er dachte oft an Frederike, seine Frau, und vermisste sie schmerzlich. Noch nie in seinem Leben hatte er einen Menschen so sehr vermisst wie sie.
Frau Westermann, bei der er zur Untermiete wohnte, hatte ihn im Treppenhaus abgefangen und zum Essen eingeladen. Sie habe ein paar Bratkartoffeln mit Bohnen und Speck übrig. Aber er hatte dankend abgelehnt, weil ihm nicht nach Gesellschaft war. Inzwischen bereute er seine Entscheidung. Das bisschen, was er in seinem Regalfach von gestern Abend übrig hatte – etwas Brot, Gewürzgurken und eine Büchse Ölsardinen –, würde nicht reichen. Aber nun hatte er sich entschieden, und dabei blieb es auch. Der Kriminalkommissar suchte im Radio nach einem Klassiksender. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch, nahm einen Schreibblock zur Hand und tauchte seinen Füllfederhalter ins Tintenfass.
Liebe Frederike,
ich sitze am Fenster, höre Radio und denke an dich. Stell dir vor, ich wohne wieder in der Lotter Straße. Es war ein großer Zufall. Aus alter Gewohnheit habe ich bei Feinkost Remme ein Heringsbrötchen gekauft und mitbekommen, dass eine ältere Dame einen Untermieter für ein möbliertes Zimmer suchte. Wie du dir denken kannst, habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und sie angesprochen. Ich muss wohl einen guten Eindruck hinterlassen haben, denn sie hat mich sofort mitgenommen.
Die Miete von 20 Mark im Monat ist nicht zu viel verlangt, finde ich. Es ist ein hübsches Zimmer mit Dachschrägen, zwar ohne fließendes Wasser, aber für den Anfang geht es. Es hat eine Rosentapete und Vorhänge mit Rosenmuster. Das ganze Jahr grünt und blüht es hier. Manchmal scheint es mir, als könne ich die Rosen sogar riechen. Was du wohl dazu sagen würdest? Über meinem Bett hängen weiße Tauben in einem Blumenbouquet und daneben starrt mich ein röhrender Hirsch im Herbstblätterwald an. Beide Bilder stecken in vergoldeten Rahmen, solche verschnörkelten, du weißt schon. Ich weiß, du hättest die Tiere abgehängt, aber ich bringe es nicht übers Herz.
Was dir ebenfalls nicht gefallen würde: Es gibt kein Badezimmer wie bei uns früher. Weißt du, was Frau Westermann mir zur Antwort gab, als ich sie danach fragte? »Mit der Linie eins kommen Sie bequem zum Badehaus am Pottgraben. Dort gibt es Duschen und Wannenbäder für zwei Groschen!« Ich habe mir ein Lachen verkniffen, denn ich wollte sie nicht beleidigen. Vielleicht finde ich bald eine Unterkunft mit fließend warmem Wasser, das wäre komfortabler. Zwar bin ich Luxus nicht mehr gewohnt, aber kaum lebe ich wieder zivilisiert, möchte ich am liebsten sofort an unser früheres Leben anknüpfen und es behaglich und schön haben.
Ich versuche mal, dir meine Vermieterin zu beschreiben. Sie ist eine gute Seele mit Küchenschürze und Brille auf der spitzen Nase, verwitwet und mindestens 70 Jahre alt. Ihre Haare sind silberweiß und zu einem dünnen Dutt gezwirbelt. Energisch ist sie und pingelig, was Geräusche anbelangt, denn du weißt ja, dass ich gerne Opern höre, und das am liebsten ziemlich laut.
Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, denn ich habe alles, was ich brauche. Besonders schätze ich den gemütlichen Ohrensessel vor dem Fenster, in dem ich nach der Arbeit lese und Musik höre, wie jetzt gerade. Das Grundig-Radio, das auf dem Schreibtisch steht, habe ich letzte Woche bei Wischott gekauft, es war im Sonderangebot, hat einen prima Empfang, viel besser als unser altes Gerät. Kein Rauschen mehr, kein Verwackeln der Sender. Der Ton der Musik ist so brillant, als würde ich mich in einem Konzertsaal befinden, und die Stimme des Sportmoderators klingt glasklar, als wäre er direkt nebenan. Die Fußballweltmeisterschaft ist nämlich im Gange, eine wunderbare Abwechslung vom schnöden Alltag. Spannende Spiele, auf die ich mich freue. Heute spielte Deutschland gegen die Türkei und hat tatsächlich 4:1 gewonnen. Das hätte ich nie für möglich gehalten! Du hättest dich vermutlich währenddessen mit deinen Freundinnen ins nächste Café verdrückt, Fußball hat dich ja nie wirklich interessiert.
Inzwischen ist es fast neun am Abend. Eben habe ich eine Pause gemacht, um Abendbrot zu essen. Frau Westermann besteht darauf, morgen für mich zu kochen. Es gibt eine kräftige Rinderbouillon und zum Nachtisch eingelegte Pflaumen. Dank ihrer guten Pflege habe ich schon acht Pfund zugenommen. Es könnte mittlerweile auch mehr sein, denn eine Waage gibt es nur im Pottgrabenbad, und da war ich seit einer Woche nicht mehr, ich Schweinchen. Ich sehe dich den Kopf schütteln und mit mir schimpfen. Beruhige dich, Fredi, morgen gehe ich wieder und bleibe so lange in der Wanne, bis ich schrumpelig werde. Vorübergehend leistet die Waschschüssel gute Dienste, und dank Eau de Cologne hat sich noch niemand im Büro beschwert. Frau Westermann denkt, dass ein Kriegsheimkehrer wie ich viel Nachholbedarf hat, dabei war ich ja nicht mal in Russland, aber die Unterschiede sagen ihr nichts. Sie will sogar zu meinem Geburtstag am nächsten Mittwoch eine Buttercremetorte für mich backen. Ich freue mich, weiß aber auch, dass ich danach Magendrücken haben werde.
Du, ich habe Angst vor meinem Geburtstag. Ein weiterer Geburtstag ohne dich. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, wie du zur Tür hereinkommst, mir einen Kuss gibst, dich auf meinen Schoß setzt und deine Arme um meinen Hals schlingst. Ich höre deine Stimme, sehe deine lachenden Augen, deine Grübchen und die zarte Röte deiner Wangen. Ich fühle deinen Kopf in meiner Halsbeuge, deine braunen verwuschelten Haare, die weichen Rundungen deines Körpers. Ich erinnere mich noch an deinen Duft. Den vergesse ich nie, ein wenig nach Mandeln, Vanille und Honig. An meinem Geburtstag werde ich besonders an dich denken, voller Sehnsucht, mein Engel. Ich werde mich nach dir verzehren, wenn ich mit vollgeschlagenem Bauch auf dem Bett liege und die Rosen an der Tapete zähle. Ach, du, Fredi, wenn du wüsstest, wie sehr du noch immer in meinem Herzen bist! Hätte ich einen Wunsch frei, dann würde ich mir wünschen, dich noch einmal in den Arm zu nehmen und ganz lange festzuhalten, nein, für ewig festzuhalten und niemals mehr freizugeben.
In ewiger Liebe
Dein Johann
4. Kapitel
Mittwoch, 23.06.1954
Die Ladenglocke bimmelte, als der Mann die Tür aufstieß. Im Salon befanden sich nur zwei Personen, Friseur Rolf Schmalstieg und ein männlicher Kunde.
»Augenblick, ich komme gleich!«, rief Schmalstieg, ohne von seiner Arbeit aufzusehen.
»Keine Eile«, sagte der Mann und blieb hinter dem Garderobenständer stehen.
Der Kunde rauchte. Strenger Zigarrendunst waberte durch den Salon und überdeckte die parfümierten Düfte.
»Jetzt noch Kundschaft?« Die Stimme des Rauchers war etwas heiser. Er räusperte sich. »So kurz vor dem Spiel?«
Der Mann hinter dem Garderobenständer zuckte zusammen. Er kannte diese Stimme. Er kannte sie gut.
»Einen Haarschnitt werde ich noch schaffen«, sagte Schmalstieg. »Die Spiele sind im Moment so langweilig, dass ich nicht unbedingt von Anfang an dabei sein muss. Meine Frau wird mir davon erzählen. Ich hoffe nur, dass nicht gleich in den ersten paar Minuten ein Tor fällt. Dann würde ich mich vielleicht ein klein wenig ärgern.«
Der Kunde ließ ein beifälliges Grunzen ertönen.
Der Mann konnte keinen klaren Gedanken fassen. Am Garderobenhaken hingen mehrere Jacken, Mützen und Hüte, darüber ein Hinweisschild, man möge bitte auf seine Garderobe achten. Anscheinend hatten einige Kunden das so wenig getan, dass sie ihre Sachen dort vergessen hatten. Es gab alles wieder im Überfluss. Wirtschaftswunder, sie waren mittendrin. Niemand musste mehr Löwenzahn und Brennnesseln sammeln für die Suppe am Abend, Kartoffeln vom Feld organisieren oder Beeren pflücken, um Kompott daraus zu machen.
Draußen rumpelte ein Lastwagen vorbei. Eine Frau schrie mit gellender Stimme hinter einem Kind her. Es schien noch einmal gut gegangen zu sein, denn auf ihren Schrei folgten wüstes Geschimpfe und daraufhin das durchdringende Brüllen eines Kleinkindes.
»Sie wollten mir noch etwas sagen«, stellte der Raucher fest, nachdem sich die Situation draußen beruhigt hatte.
Der Mann hinter dem Garderobenständer hielt den Atem an.
»Lieber ein anderes Mal, wir sind nicht allein.« Der Friseur räusperte sich und dämpfte seine Stimme. »Vielleicht morgen früh in meinem Büro. Um 8 Uhr, da ist noch keine Kundschaft da. Wird nicht lange dauern.«
»Bitte verschonen Sie mich mit einer weiteren Hiobsbotschaft.«
»Na ja … Stellen Sie sich darauf ein, dass es kein gemütlicher Kaffeeklatsch wird.«
Für ein, zwei Minuten war nur das Schaben des Rasiermessers zu vernehmen, dann folgten trappelnde Schritte und die helle Stimme eines Kindes. »Dauert’s noch lange? Mutti will das wissen. Oben ist alles fertig. Das Spiel fängt gleich an.«
»Sag ihr, ich brauche noch etwas Zeit. Einen Herren bediene ich noch, dann mache ich zu.«
»Gut, aber wirklich bald kommen«, sagte das Kind und ging wieder.
Der Mann hinter dem Garderobenständer ballte seine Hände zu Fäusten, die sich plötzlich eiskalt und taub anfühlten, als gehörten sie nicht zu ihm. Kalt wurde sein ganzer Körper, während sein Herz hart in seiner Brust schlug. »Mutti will das wissen … Das Spiel fängt gleich an«, dröhnte es in seinen Ohren. Es ging nicht anders. Er musste es tun. Die Zeit drängte. Es gab kein Zurück mehr.
*
Lieselotte Korittke blickte betrübt aus dem Fenster. Vom Sommer keine Spur. Es war kühl, regnerisch und windig. Jagende Wolken bedeckten den Himmel, der dunkel und schwer über der Stadt lag. Nachdenklich zog sie die Gardine zu und staubte den niedrigen Nussbaumschrank ab. Äußerlich wirkte er wie eine hübsche, etwas größere Kommode, aber sein Innenleben war eine Überraschung, mit der niemand rechnete: ein nagelneuer Telefunken befand sich darin, außerdem Radio und Schallplattenspieler! Es war eine Sünde, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten. Sie und Rolf lebten über ihre Verhältnisse. Was hatten sie sich allein in den letzten zwei Jahren alles gegönnt! Allem voran den Salon, sie hatten ihn eigenhändig modernisiert und viel Arbeit hineingesteckt. Rolf hatte den Führerschein gemacht und sich den Traum von einem fabrikneuen Volkswagen erfüllt. Die Miete für den Salon und die dazugehörige Wohnung war teuer, denn die Wohnung verfügte sogar über eine Zentralheizung und ein Badezimmer mit Badewanne und Fliesen.
Lieselottes größter Wunsch war eine moderne Einbauküche mit Kühlschrank und Elektroherd gewesen. Auch hier hatte Rolf sich großzügig gezeigt. Die neue Küche war wunderbar, denn nun hatte sie alles Wichtige auf engstem Raum zusammen und musste nicht mehr ständig hin und her laufen, um zu kochen und zu spülen. Für jeden Handgriff brauchte sie sich nur umzudrehen, eine großartige Zeitersparnis! Leichtsinnigerweise hatte sie überdies bei Neckermann eine vollautomatische Waschmaschine bestellt, die drei Wochen später, kurz vor Weihnachten, geliefert wurde. Sie hätte sich ein wenig länger gedulden sollen, weil der Schuldenberg immer größer wurde, aber ihre Nachbarin hatte schon eine gehabt und in den höchsten Tönen geschwärmt! Bei jedem Zusammentreffen mit ihr hatte sie damit angegeben. Außerdem bot Neckermann einen Ratenkauf mit niedrigen Zinsen. Wenn Lieselotte ehrlich war, war dies ihre größte Errungenschaft, noch wertvoller als die Einbauküche! Hätte sie vorher gewusst, wie viel Zeit sie damit einsparte, hätte sie alle anderen Dinge aufgeschoben, nur nicht die Waschmaschine. Keine schwieligen, roten, runzligen Hände mehr, keine Rückenschmerzen vom vielen Bücken, keine hässlichen Haare vom Dunst in der Waschküche. Lieselotte wusch nun die Kleidung der Familie öfter und regelmäßiger und schimpfte nicht mehr so viel mit den Kleinen, wenn sie ihre Sachen dreckig machten.
Auf den Fernseher hatten sie eigentlich noch zwei oder drei Jahre warten wollen, bis sie einen Großteil der Schulden abbezahlt hätten. Aber Rolf hielt sich nicht daran. Die Fußballweltmeisterschaft war sein Antrieb. Er wollte unbedingt das Endspiel sehen, nicht nur hören. Vor zwei Tagen war er zu Radio Wischott gegangen und hatte den teuersten Fernsehschrank für sage und schreibe 748 Mark gekauft. Lieselotte war außer sich, dass er sich über ihre Bedenken hinweggesetzt und sogar ihre Mutter angepumpt hatte. Die schenkte ihm trotz ihrer mageren Rente 100 Mark dafür. Das war ihr erster großer Streit gewesen. Rolf sagte, dass er ein Leben lang der Dumme gewesen sei, der nichts besessen hatte, außer einer winzigen ungeheizten Wohnung ohne Badezimmer. Die Kunden würden nun sehen, dass er es weit gebracht hatte und sich viel mehr leisten konnte als die Konkurrenz, einfach, weil er erfolgreicher war. Er freute sich auf das triumphale Gefühl, von Fernsehsendungen zu erzählen, die seine Kunden nur vom Hörensagen kannten, wenn überhaupt. Es war schön, endlich etwas zu haben, mit dem er angeben konnte.
Dieses Argument leuchtete ihr schließlich ein. Lieselotte musste zugeben, dass der Fernsehschrank auch in geschlossenem Zustand überaus apart war und sich hübsch dekorieren ließ. Nach der Politur stellte sie eine Blumenvase mit drei weißen Nelken darauf und goss den Gummibaum, dessen große Blätter ein wenig Staub angesetzt hatten. Morgen würde sie sie mit Schmierseife bearbeiten.
Bettine, die 19-jährige Tochter, und Großmutter Wilma brachten Teller und Platten mit belegten Schnittchen, russischen Eiern und Frikadellen herein und stellten Bowle- und Biergläser bereit. Aus dem Kinderzimmer am Ende des Flurs, nur durch einen dicken Vorhang vom Schlafzimmer abgetrennt, drangen helles Lachen, Quietschen und Juchzen, weil die Kleinen sich gerade ihre Schlafanzüge anzogen und vor lauter Freude darüber, dass sie ausnahmsweise einmal länger aufbleiben durften, auf den Betten herumsprangen.
Im Vogelkäfig, der an einer Stange vor dem Wohnzimmerschrank hing, zwitscherte Coco, der blaue Wellensittich. An Weihnachten war er eingezogen und forderte seitdem sein abendliches Beschäftigungsprogramm ein. Bettine gab ihm ein Salatblatt von der Garnitur ab und kraulte durch die Gitterstäbe hindurch sein Köpfchen. »Coco brav, Coco brav?«, gurrte sie und pfiff ihm etwas vor. Der Vogel antwortete mit lautem Zwitschern. Ein bisschen klang es, als wolle er die menschliche Stimme nachahmen.
»Händewaschen nicht vergessen«, mahnte Lieselotte, während sie rasch noch etwas Ordnung im Wohnzimmer machte, die »Hörzu« weglegte und die Kissen auf der Couch mit einem ordentlichen Knick in der Mitte versah.
Plötzlich hielt sie inne und fragte nach Rolf. Die sechsjährige Karin, die gerade das Zimmer betrat, zog rasch ihr Schlafanzug-Oberteil auf die richtige Seite, bevor ihre Mutter sie dafür tadelte und möglicherweise sogar ins Bett schickte. Man konnte nie wissen.
»Papa hat noch einen Kunden«, sagte die Kleine. »Ich war eben unten und wollte ihn holen. Ich soll euch sagen, es dauert noch ein bisschen.«
Lieselotte warf seufzend einen Blick auf die Wanduhr. Es war kurz vor sechs, eigentlich wollten sie längst alle zusammen auf der Couch sitzen und es sich gemütlich machen. »Einen Kunden? Er hat versprochen, pünktlich Feierabend zu machen. Und nun will er lieber arbeiten, ach, du liebe Zeit!«, sagte sie zu ihrer Mutter. »Ich verstehe ihn nicht. Willst du nicht mal nachsehen, Bettine, wie weit er ist? Karin hat schon ihren Schlafanzug an und kann sich unten so nicht zeigen.«
»Warum nicht?«, fragte die Sechsjährige, bekam aber keine Antwort.
»Gleich«, sagte Bettine, rollte die Augen und ging in die Küche, um Knabbergebäck in Schälchen zu füllen.
Lieselotte klappte den Fernsehschrank auf und drehte den oberen Knopf nach rechts, bis das erwartete Knacken ertönte. Gespannt blieb sie vor dem Apparat stehen, ob sie auch alles richtig gemacht hatte. Das schwarz-weiße Testbild wackelte und war grobkörnig. Sie zog den Apparat ein paar Zentimeter hervor und richtete die Antenne aus, stellte sie immer wieder um. Das Bild wurde klarer. Dabei blieb es aber. »Gleich sehen wir Fußball in echt«, sagte sie.
Bettine hatte an der Schwelle mitgehört. »Das glaubst auch nur du. Ich habe gehört, dass wir nicht alle Spiele sehen können, wahrscheinlich sogar nur das Endspiel. Die deutschen Spiele werden nicht gezeigt. Man kann sie nur am Radio verfolgen und später in der Wochenschau.«
Lieselotte fuhr herum. »Das kann doch nicht sein! Dann hätte Vati nicht so viel Geld ausgegeben!«
Bettine zuckte mit den Schultern und drehte sich auf dem Absatz um. »Nur am Radio, du wirst schon sehen. Und beim Endspiel sind wir sowieso nicht mehr mit dabei! Wir werden viel früher ausscheiden. Das Geld hätte er sich sparen können.«
»Freches Gör«, schimpfte Lieselotte und richtete erneut die Antenne aus.
Als Bettine mit zwei weiteren Schalen aus der Küche kam, schaltete Lieselotte gerade das Radio ein. Es kamen die 18-Uhr-Nachrichten.
Dann war es so weit. Der Sprecher Herbert Zimmermann stellte die deutsche Mannschaft vor, mit den besonderen Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler. Auch die gegnerische Mannschaft wurde genau unter die Lupe genommen. Wortreich legte er Chancen, Risiken und Fallstricke dar. Lieselotte setzte sich kerzengerade auf einen der beiden neuen Cocktailsessel und vergaß fast zu atmen. Noch immer hoffte sie darauf, dass Herbert Zimmermann auch auf dem Bildschirm erscheinen würde, aber das war nicht der Fall. Außer dem Testbild war nichts zu sehen. Enttäuscht drehte sie den Apparat schließlich aus.
»Und?«, fragte Bettine provozierend. »Wer von uns beiden hatte nun recht?«
Lieselotte winkte ab. Herbert Zimmermann war viel interessanter, wenn auch im Radio. Leider sah es nicht gut aus: Die Deutschen würden es gegen die Türken nicht leicht haben. Sie mussten sich gewaltig ins Zeug legen, um das desaströse Spiel gegen Ungarn vom Sonntag wieder wettzumachen.
Großmutter Wilma kam zur Tür herein, nachdem sie mehrmals zwischen Küche und Wohnstube hin- und hergelaufen war. »Was sagt er? Wie sieht’s aus heute?«
»Zimmermann meint, dass eine Chance besteht, weil Sepp Herberger die wichtigsten Spieler noch geschont hätte.«
»Denn man tau«, murmelte Wilma Müller, während sie ihrer Tochter ein Glas Bowle mit frischen Erdbeeren reichte.
Dann verteilten sich alle auf die Sofas und Sessel. Die beiden Kleinen quetschten sich dazwischen und wurden regelmäßig ermahnt, still zu sein.
»Peter, noch einmal, und es geht in die Klappe!«, sagte Großmutter Wilma streng.
*
Schwungvoll stieß der Mann die Ladentür auf. Ihn konnte nichts mehr aufhalten. Mit wenigen Schritten war er bei der Verkaufstheke, hinter der Rolf Schmalstieg gerade Geld zählte. Die Scheine knisterten in seinen Händen. Es musste ein guter Tag gewesen sein. Die Blicke der beiden Männer begegneten sich.
»Geschlossen!«, sagte Schmalstieg mit frostiger Miene. »Wir haben geschlossen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, abzusperren.«
»Das macht nichts«, sagte der Besucher. Seine Stimme klang selbst in seinen Ohren fremd. Er war vorhin schon mal da gewesen, nur wenige Minuten war das her. Er musste sich zwischendurch ein wenig frische Luft verschaffen. Nun war er sich sicher. Nicht mehr denken, nur noch handeln. Keine Gefühle mehr. Er war eine Maschine. Und die hatte zu funktionieren. Schnell und reibungslos.
Mit einer langsamen Bewegung tauchte er seine Hand in die Jackentasche und fühlte den geriffelten Griff der Pistole. Sein Herz klopfte. Es hatte nicht zu klopfen.
»Ich bitte Sie, zu gehen!«, sagte Rolf Schmalstieg eisig. »Und kommen Sie nicht wieder! Ich will Sie hier nicht noch einmal sehen.«
Jetzt. Na los. Es wird nicht lange dauern. Nur wenige Sekunden, dann wäre alles vorbei.
Zwei Schritte nach vorne, die Finger am Abzug.
Der Friseur öffnete seinen Mund, schwieg aber.
Die Finger fest am Metall. Die Hand, die die Pistole aus der Tasche zog. Schwer war sie. Und gefühllos, wie der ganze Mensch in diesem Augenblick. Nur das Herz klopfte. Es klopfte, als hätte es etwas zu sagen. Kurzer Wechsel in die andere Hand.
Ein Auge zu, das rechte fixierte das Ziel.
Dann fiel ein Schuss. Es gab einen dumpfen Schlag, als der leblose Körper gegen die nierenförmige Theke sackte. Sonst kein Geräusch, kein Schrei, kein Klagelaut, nichts.
Ein blutiges Rinnsal. Er konnte nicht hinsehen.
*
Lieselotte Korittke nahm eine Zigarette aus dem fächerförmigen Spender und zündete sie an. Sie trug noch immer ihre schwarzen spitzen Pumps mit den Bleistiftabsätzen und den Satinschleifen, obwohl ihre Füße schmerzten. Aber Hausschuhe tolerierte sie nur, solange sie noch im Morgenmantel war. Rolf mochte es nicht, wenn sie sich gehen ließ. Ihm gefiel es, wenn Frauen mit ihren Reizen spielten, wenn sie sich Mühe gaben mit ihrem Erscheinungsbild, wenn sie zeigten, wie wichtig ihnen der Mann war. Heute trug sie ein flaschengrünes, weit ausgeschnittenes Kleid mit auffälliger Brosche am Revers. Der Ansatz ihrer Brüste war sichtbar. Rolf gefiel das.
Inzwischen war sie beim zweiten Glas Erdbeerbowle angelangt. Die Kinder tranken auch Erdbeerbowle, allerdings ohne Alkohol.
»Langsam werde ich unruhig«, sagte sie. »Mein Gefühl sagt mir, dass etwas nicht stimmt. Wo bleibt nur Rolf? Wir haben uns solche Mühe gegeben, all die feinen Sachen hier vorbereitet.« Ihr Blick fiel auf die Teller und Schüsseln, aus denen sich vor allen Dingen die Kinder bedienten. Sie nahm einen tiefen Zug von der Zigarette und blies den Rauch langsam aus. »Ich habe dich schon vor einer halben Stunde gebeten, nach ihm zu sehen«, sagte sie und warf ihrer Tochter Bettine einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Wenn ihn das Spiel interessieren würde, wäre er längst da, oder? Wahrscheinlich hat er Wichtigeres zu tun, Abrechnung oder so. Ich möchte nichts verpassen. Rolf ist schließlich kein kleines Kind, dem man hinterherrennen muss. Wenn er keine Lust auf das Spiel hat, ist das seine Sache.«
»Sei nicht so frech! Du bist bald wie Karl, mit dem gibt es auch nur Ärger! Und sag gefälligst Vater oder Vati und nicht Rolf, hast du verstanden? Ich bin die Einzige, die ihn beim Vornamen nennen darf!«
»Er ist nicht mein Vater.«
»Er ist es, zum Donnerwetter! Wenn du ihn ablehnst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn er die Kleinen bevorzugt.«
»Also gut, dann sage ich dir klipp und klar, dass es mir egal ist, ob Rolf da ist oder nicht!«
Lieselotte hob die Hand, nahm bereits Schwung zum Ausholen, senkte sie aber wieder, als sie Wilmas strengen Blick wahrnahm.
»Komm, Kind, rede dich nicht um Kopf und Kragen«, sagte die Großmutter ruhig zu Bettine, »geh doch einfach runter und sieh nach, was er macht. Ärgere deine Mutter nicht.« Wilma saß in ihrer angestammten Sofaecke und hatte wie immer Strickzeug in den Händen. So wie es aussah, sollte es ein Pullover für Peter werden, den Jüngsten. Er wuchs so schnell und wollte die kratzigen Sachen nicht anziehen, die sein großer Bruder Karl in dem Alter getragen hatte.
Bettine trollte sich beleidigt.
Der Friseursalon lag im Erdgeschoss, sie musste nur die steile Treppe hinuntergehen, die von einer winzigen Funzel ausgeleuchtet wurde. Kühl und feucht war es an dieser Stelle des Hauses, auch im Sommer, da niemals ein Sonnenstrahl ins Treppenhaus drang. Unten angekommen, schob sie den dicken grünen Samtvorhang beiseite, der den privaten von dem öffentlichen Bereich trennte.
Schon beim Betreten des Geschäftes hatte sie das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Der Salon war hell erleuchtet, wirkte aber wie ausgestorben. Es war vollkommen still, auch von oben drangen keine Geräusche hinunter. Selbst von der Straße, auf der es tagsüber oft dröhnte und rumorte, wenn ein Lastwagen oder ein Pferdefuhrwerk über das Kopfsteinpflaster rumpelte, hörte sie keinen Ton. Die Weltmeisterschaft fegte ganz Osnabrück leer. Jeder sah zu, die Spiele entweder im heimischen Wohnzimmer oder in einer Wirtschaft zu verfolgen.
Es roch seltsam. In die üblichen Düfte des Salons nach Seife und Haarspray mischte sich ein unangenehmer Geruch, metallisch, ekelerregend, nach Blut oder Urin oder beidem. Übelkeit stieg in ihr hoch. Als sie sich dem Kassenbereich näherte, sah sie etwas Rotes, das unter der Theke hervorquoll. Sie schlug beide Hände vor den Mund und war sekundenlang wie erstarrt.
5. Kapitel
»Ich muss mit Ihnen reden«, sagte Drescher, »setzen Sie sich bitte. Wir müssen uns kurz über Ihre Situation unterhalten.« Drescher war Mitte 30 und in den Rängen der Polizei rasch aufgestiegen. Er war nicht sehr groß und viel zu zierlich für einen Mann.
Mit einem mulmigen Gefühl nahm Conradi Platz. Was wollte der Chef von ihm? Beim Hinsetzen warf er einen verschämten Blick auf seine Uhr. Er ärgerte sich, dass er aufgehalten wurde. Ihn zog es nach Hause, so schnell wie möglich, zu seinem abgewetzten Ohrensessel am Fenster und dem neuen Radio mit dem erstklassigen Empfang. Zwei Flaschen Bier hatte er in seiner Waschschale bereits kaltgestellt. Wenn er die Straßenbahn in 20 Minuten erwischte, wäre er noch rechtzeitig vor dem Spiel zu Hause. Aber im Moment sah es nicht danach aus. Albert Drescher fing an und hörte nicht mehr auf. Er redete und redete. Johann Conradi hörte kaum zu. Er beobachtete, dankbar für jede Ablenkung, einen Marienkäfer, der sich am Rand der Schreibtischplatte von seinem Flug erholte. Gerade hob der Winzling seine Beinchen und putzte die rotgepunkteten Flügel.
»Es geht um Sie, Herr Inspektor Conradi«, stellte Albert Drescher klar, nahm seine Brille ab und polierte sie mit einem karierten Taschentuch. »Ihre Zukunft als Polizist steht auf dem Spiel. Ich habe Sie gerade gefragt, und das nicht zum ersten Mal, warum Sie oft so gleichgültig wirken und unkonzentriert. Ich lese in Ihrem Gesicht, dass es Sie keinen Funken interessiert, was ich Ihnen erzähle.« Mit einer fahrigen Handbewegung setzte er die Brille wieder auf. Die Gläser wirkten nun verschmierter als zuvor. Sein Gesicht hatte bereits die schlaffen Züge eines älteren Mannes.
»Verzeihung«, sagte Conradi räuspernd. Er versuchte sich nicht anmerken zu lassen, was er von dem zwölf Jahre jüngeren Chef hielt, der seine rasche Beförderung Gerüchten zufolge einem Onkel zu verdanken hatte. Jeder auf der Etage beneidete ihn um sein repräsentatives Büro, ein helles Eckzimmer mit Radierungen von Franz Hecker an den Wänden und gediegenen Möbeln aus glänzendem Mahagoni.
Albert Drescher ließ den Deckel seiner bunten Zigarrenkiste aufschnappen. »Schauen Sie sich ruhig um, Herr Conradi, hier kann man es weit bringen, wenn man fleißig, diszipliniert und ehrgeizig ist.«
Johann Conradi atmete tief durch und betrachtete seine Hände auf der Stuhllehne. Am Morgen, nach dem Aufstehen, hatte er endlich, nach langem Zögern, seinen Ehering abgenommen. Wo er gesessen hatte, war nun ein heller Abdruck zu sehen.
Seit einem Monat war er zurück in Osnabrück. Von Anfang an hatte es Spannungen zwischen ihm und Drescher gegeben. Vielleicht war es tatsächlich besser, er beendete die Probezeit von sich aus und ging woandershin. Die Polizeiarbeit war überall gleich, und Osnabrück erkannte er sowieso kaum wieder. Die Silhouette der Stadt hatte sich völlig verändert. Überall Ruinen und Schuttberge, wo mal prächtige Villen und Geschäftshäuser gestanden hatten. Dafür gab es jetzt einstöckige Behelfsbauten, schnell gebaut und zweckdienlich. Am Nikolaiort und im Schlossgarten waren Siedlungen mit Nissenhütten aus Wellblech entstanden. Viele Familien und Flüchtlinge lebten dort, die ihr Zuhause verloren hatten. Besonders der Neumarkt war nicht wiederzuerkennen. Die Plätze waren durch die Bombardierung so verändert, dass sie nicht mehr zu Osnabrück passten und sich auch in einer anderen Stadt hätten befinden können.
Aus dem Nichts entstanden in den Randbezirken Neubaugebiete mit grauen gesichtslosen Mehrfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern. Sie waren praktisch gebaut und zweifellos modern, aber längst nicht so schön wie die Gebäude, die er aus seiner Kindheit und Jugend kannte. Alles war anders. Selbst die Menschen waren ihm fremd geworden. Osnabrück war nicht länger seine Stadt, war keine Heimat mehr. Sogar das Heimweh, das ihn in den Jahren der Kriegsgefangenschaft geplagt hatte und auch noch danach, war auf einmal nicht mehr wahr. Es musste ein Irrtum gewesen sein oder ein Traum. Johann Conradi fragte sich, wonach er sich verzehrt hatte. Die Menschen, die er geliebt hatte, waren tot. Das, was jetzt war, hätte er sich niemals ersehnt. Danach konnte man kein Heimweh haben.
»Sie sind zur Probe eingestellt worden und von meinem Wohlwollen abhängig. Ob Sie bleiben dürfen, entscheide ich, vergessen Sie das nicht!« Albert Drescher nahm eine Zigarre aus der Kiste, schnitt die Spitze ab und zündete sie an, ohne Conradi eine anzubieten. »Menschenskinder, Conradi, was soll ich nur von Ihnen halten. Es fällt mir schwer, meine Enttäuschung zu verbergen. Was habe ich mich auf Sie gefreut! Ein erstklassiger Polizist seien Sie, wurde mir gesagt, jung, sportlich, ambitioniert.« Er rauchte manieriert mit gespreizten Fingern und blies eine Wolke gen Zimmerdecke. Seine großen leicht abstehenden Ohren wackelten dabei. Conradi fand, dass er Ähnlichkeit mit einer Spitzmaus hatte. Dazu passten auch sein schmaler Kopf, die leicht hervorstehenden Augen hinter den dicken Brillengläsern und die fusseligen Haare.
»Gewissenhaft, rechtstreu, fleißig, einer der Besten, die die Polizei zu bieten hätte«, fuhr der Chef mit verkniffenem Mund fort und stieß ein heiseres Lachen aus.
Das Büro lag bereits im blauen Dunst. Conradi mochte den Geruch nur, wenn er selbst rauchte.
»Jaja, und dann diese Enttäuschung. Himmel, hätte ich auch nur geahnt, wen sie mir da schicken, hätte ich gewiss eine andere Entscheidung getroffen.«
Conradi fühlte sich, als hätte ihm jemand einen Schlag in die Magengrube verpasst. »Es tut mir leid, dass Sie so unzufrieden mit mir sind«, sagte er geistesabwesend. Er wollte nichts mehr hören. Nur noch eine Dreiviertelstunde bis zum Spiel Deutschland gegen die Türkei. Er wollte, dass dieses unangenehme Gespräch endlich ein Ende fand, er wollte nichts als nach Hause.