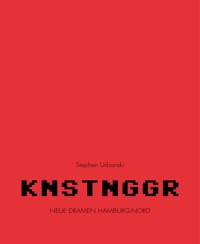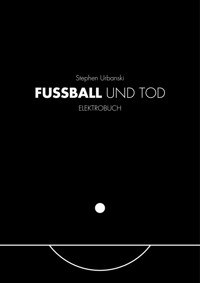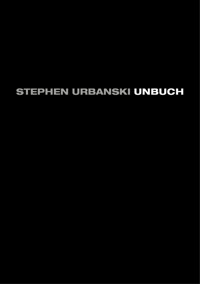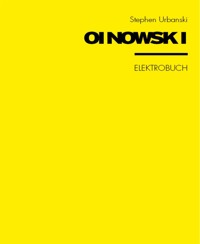14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stephen Urbanski: TODE$$CHLAGER – Die Charts der Neuen Armut. Erfunden wahre Geschichten über ein Leben mit der HHure und der Schere. Ein Hamburger Elektrobuch, nur für Erwachsene. (Nach Diktat vereist.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
TODE$$CHLAGER
Die Charts der Neuen Armut
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenUrbanski / TODE$$CHLAGER
DREI BÜCHER ARMUT – (Kleine Dramen Hamburg-Nord):
TAUBENHHEIM / HHAU / HHÄRTZCHEN IN DER GRUBE
ABSCHAUMDÖRFER – Viertes Buch Armut
Letztes Buch Armut: DER GESTANK DER GROSSEN WIESE
Fünftes Buch Blei. Armut killt.
(HH? HH.)
Kam hier neulich rein und spielte mir seine Version von Heinrich Heines „Die Weber“ vor, nur er auf seiner akustischen Taylor. Nur er und seine Stimme, soft, aber eindringlich; dazu dieser charmante Akzent, der sofort Atmosphäre zu schaffen versteht. „Deutschland, wir weben dein Leichentuch / Wir weben hinein den dreifachen Fluch.“ So weit, so alt, so - deutsch. Wäre da nicht die Tatsache, dass es sich beim Sänger um einen reinen US-Amerikaner handelt. Zwar Professor für Germanistik an einer kalifornischen Universität, zwar Sohn einer deutschen Mutter, dennoch. Ein absoluter Native. Mir standen die Haare zu Berge. Die Art, wie er den Song shuffelte, synkopisch, sonnig, sinnlich, lässig. Gänsehaut aufgrund des Textes, seit Dekaden nicht vernommen, Zeilen, die selbstverständlich zum Deutschunterricht eines jeden humanistischen Gymnasiums gehörten, so auch in meinem, einige Quartiere westlich von Winterhude. Heinrich Heine, „Die Weber“ - aktueller denn je, HH. Und dann noch mit diesem Akzent intoniert, awesome.
Dean meinte, er hätte den Track vor einigen Tagen hier in Hamburg aufgenommen, live. Ich sagte, toll. Er hätte ein, zwei Fehler gemacht, ich sagte, toll, wahre Kunst macht Fehler, sonst wäre sie keine. Live eingespielt bei Freund Frederik Planter. Ich sagte, toll, da warst du in besten Händen. Der Mann versteht was von Räumen. Der Mann versteht was von Schwingungen. Der Mann versteht was von Pflanzen. Mein Mann, sagte ich. Wir grinsten. Man kennt sich halt. Alte Hippies Hamburg-Nord. Plus Gästeliste Sacramento, California, USA.
Heute schreiben wir den 4. September 2013. Zweiundzwanzig Grad, Niederschlag null, Luftfeuchte achtzig Prozent. Wind flaut mit drei Stundenkilometern Geschwindigkeit von irgendwoher. Irgendwohin. Heute Vormittag haben tatsächlich die Vögel gesungen. Korrigiere: Heute Vormittag haben tatsächlich einige Vögel gesungen, die wenigen, die noch da sind. Dachten wohl, es sei Frühling. Mitnichten. Es ist Spätsommer. Es ist Frühherbst, je nach Lesart. Je nach Befindlichkeit. Je nach Schweregrad individueller Depression. Heute Vormittag gab’s tatsächlich Sirenengeheul. Klang nach Hafengegend. Kann auch Barmbek gewesen sein, man weiß es nicht. Vielleicht ein Probelauf. Vielleicht wurden wir auch wieder angegriffen, punktuell. Man weiß es nicht.
Ansonsten Normalzustand: Bulgaren, die als selbstständige Sub-Sub-Subunternehmer unsere Häuser wärmedämmen, unseren historischen Klinker verpappen. Kitakinder, die in Reihe geschaltet durchdrehen. Irgendwelche Fridas und Florians, unter Aufsicht irgendwelcher Vollzeitaugen. Irgendwelche Asen, die Sondermüll im Hausmüll verklappen. Irgendwelche technischen Geräte. Geigerzähler. N$$A-Apps. Und die NPD verteilt Kondome an Ausländer. Asozial war wer noch mal?
Es war ein weiter Weg bis hierher. Eintrag Sonnabend, 7. Januar 2012: „Dummes Geld“. Daraus ist TAUBENHHEIM entstanden, das „Erste Buch Armut“. Daraus der Block DREI BÜCHER ARMUT (3BA). Danach ABSCHAUMDÖRFER(4BA). Als fünfter und damit letzter Zacken meines Pentagramms DER GESTANK DER GROSSEN WIESE. Zwanzig Monate später nun TODE$$CHLAGER: alle fünf Bücher in der Zusammenfassung. Erfunden wahrer harter Stoff. Verbündete gesucht, Genossen gefunden. Gespräche, Telefonate, Mails – hallo, N$$A. Treffen, Impressionen, Sichtungen, Wege, Meilen. Ein langer Weg. Ich bin einigen Leuten zu Dank verpflichtet. Allen voran Freund und Supporter Jason B. Saiks, der immer dran geglaubt hat, an den Prozess, an das Produkt, an mich, dessen Finger zig Male auf Löschen zeigte. Auf Delete. Auf Erase. Der immer gesagt hat, ich möge doch noch eine Schippe Geduld drauflegen. Der immer gesagt hat, es will, es wird freigelassen werden. Danke, Jason, ohne Dich und Deine Begleitung hätte es dies alles kaum gegeben. Danke John-R. Sauerland, der Du die ersten drei Bücher gegengelesen, mir bei TAUBENHHEIM den entscheidenden dramaturgischen Kick verpasst hast. Danke für Know-how, Deine Distanz. Danke Alain Danser für den sorgfältigen Gegencheck ABSCHAUMDÖRFER. Danke für den „Scheinwerfer“, Du weißt schon. Danke Ramses Hofmeister, ohne Dich, mein Freund, hätte ich Hamburg so nie (be)schreiben können. „Immer wieder gern“, oder? Dank an Götz Göpfert von Artdirectors Alliance für die Gestaltung des Titels, danke Israel Hands, Kate Basch, Andreas Stadt; Merci auch all den anderen, die nicht namentlich aufgeführt sind. „Für meine Musen und Menschen, für meinen schönen schwarzen Mond, für meine kaltgepressten Abgestürzten“, jeweils in den Impressen 3BA und 4BA – Euch gewidmet. Was wäre ich ohne meine Menschen? Umarmung, Küsschen.
„Die Sonne hat noch Kraft“, sagt Muttern.
Urbanski / DREI BÜCHER ARMUT
(Kleine Dramen Hamburg-Nord)
Impressum
Urbanski
DREI BÜCHER ARMUT
(Kleine Dramen Hamburg-Nord)
TAUBENHHEIM / HHAU / HHÄRTZCHEN IN DER GRUBE
Redaktion: John-R. Sauerland
Support: Jason B. Saiks
Best Boy: 5 Cent
© Urbi et Urbanski Hamburg 2012
urbi-et-urbanski.tumblr.com
3BA für meine Musen und Menschen.
3BA für meinen schönen schwarzen Mond.
Vorsänger
TAUBENHHEIM geschrieben, rau, roh, rasend.
HHAU geschrieben, eine sommerlich miese Meditation.
HHÄRTZCHEN IN DER GRUBE geschrieben, letzte lumpige Seelenlieder.
Die Wohnung sah aus. Kein Wunder, wenn man ein ganzes Jahr wenig mehr tat, als betendes Blei in die Tastatur zu gießen, kleine Dramen über ein Leben mit der HHure und der Schere zu erzählen. Beine breit, geschnitten. Die Laken sahen aus.
Urbanski / TAUBENHHEIM
Erstes Buch Armut.
Sentenz
„Was dem Schein ein Recht gibt, gibt uns das Recht, uns auszuruhen“
Holger Hiller: „Liebe Beamtinnen und Beamte“
(Ein Bündel Fäulnis in der Grube, 1984)
Urbi et Urbanski
Ein Firmenwagen parkt vor der Tür, und ich weiß nicht so recht, ob man sich als Gewerbetreibender unbedingt „Heil Kfz-Teile“ nennen sollte. Auch, wenn man Heil heißen mag. Nicht nach der deutschen Vergangenheit mit diesem Unwort.
Ein Fluch, alles lesen, alles sehen, alles wahrnehmen zu müssen. So fallen mir in letzter Zeit vermehrt Kennzeichen mit HH-HH auf. Als Kind dachte ich, HH stünde für Hamburg-Hamm. Dabei steht HH für Hamburg-Harburg. HH-HH gibt’s inzwischen sogar als Buchtitel, wenn auch in anderer Schreibweise: „HHhH – Himmlers Hirn heißt Heydrich“. Darin uns ein französischer Autor namens Laurent Binet in der ersten Person an seinen Überlegungen teilnehmen lässt, wie man es anstellt, einen Roman über Nazis und deren Widersacher zu schreiben. Und zwar, indem er munter drauflos erzählt und sich während des Schreibens fragt, ob er formal alles richtig macht, es tatsächlich zum Roman reicht, was er da so zu Papier bringt.
Es stellt sich generell die Frage, ob die Ich-Form, die Ich-Erzählung den Kriterien eines klassischen Romans genügt. Was bei Kritikern nicht ganz unumstritten ist. Zwar darf sie den Nimbus der Unmittelbarkeit, Authentizität, wenn nicht sogar der größtmöglichen Aufrichtigkeit in Fällen durchaus für sich in Anspruch nehmen, gleichzeitig tappt die Ich-Erzählung aber dadurch oft in ihre eigene Falle. Denn sie muss sich dem Vorwurf aussetzen, es mangele ihr punktuell an Abstand. Was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Manch Kritiker geht sogar so weit, dieser Literaturform, diesem Stil eine gewisse Faulheit des Schreibers oder der Schreiberin vorzuwerfen; mithin an der Grenze zur Stillosigkeit, zum Trivialen, Billigen. Ähnlich dürftig, als ginge jemand hin und camouflierte seine Verbitterung über den misslungenen Lauf eines selbst gewählten Lebens hinter Buchstaben und Bildern, die vor gehässigen Anspielungen nur so triefen. Womöglich deklariert der Verfasser seine Abhandlungen noch als zeitgeistkritische Realsatire, die er vordergründig als militant polemische Betrachtung gesamtgesellschaftlicher Zustände daherkommen lässt, als Sozialgrotesken gar, welche ihm aber vielfach nur als ein willkommenes Mittel zum Zweck zu dienen scheinen, um Menschen, die kaum oder keinerlei Schuld an seiner Misere tragen, aus niederen Motiven unbarmherzig vorzuführen. Als wollte sich jemand in Zeilen abreagieren. Und auch, wenn dem verwüsteten Ego das eine oder andere wunderliche Wortspiel gelingen mag, manch tragischer Sach- oder Menschverhalt allemal trefflich vorgetragen, selbst die geliebte HHeimstatt dieser oder jener grimmigen Betrachtung unterzogen wird, so ist ein solches Unterfangen, nämlich die Facetten individueller Verzweiflung an den Umständen zur Literatur zu erklären, von vornherein ob der in Teilen überbordend kapriziösen, narzisstischen Selbstbespiegelung des Autoren, seiner fehlenden Distanz sich selbst und den Dingen gegenüber zum Scheitern verurteilt.
Armut, du Arschloch.
-SKI
Erstes Kapitel.
TaubenHHeim
Sing mit ihr, dem garstig grauen Täubchen:
HHool HHool,
HHool,
HHool HHool.
HHool HHool,
HHool,
HHool HHool.
HHool HHool,
HHool,
HHool HHool.
HHool?
Der abgeschossene Roman
„Ich wär gern wieder reich.“
Einer: „Was würdest du dafür tun?“
Einer: „Weich?“
Ja, abgeschossen
„Bin nicht gern arm.“
Einer: „Wer ist das schon…“
Einer: „Wieso, worum geht’s denn?“
Fünfundzwanzig hübsche Antworten auf die Klagen eines Armen über seine Armut
1 / „Wieso, worum geht’s denn?“
Abwimmelnde Genervtheit. Man hat zu tun. Und du nicht.
2 / „Wieso, du hast doch Zeit genug.“
Endlich mal lebenslänglich ausschlafen. Zur Not auf Parkbänken. Bis der Ordnungsdienst kommt. Irgendwer nervt immer.
3 / „Wieso, du hast doch alles.“
Tisch, Bett, Stuhl und Dach. Damit gehörst du zu den Privilegierten. Solange die Bank mitspielt. Andere leben auf der Straße. Wenn du Pech hast und die Bank nicht mehr mitspielt, lernst du die Parkbänke deiner Stadt kennen. Die gibt es auch mit Widmung: „Gestiftet von der Haspa.“ Oder von der Commerzbank, „Gemeinsam mehr erreichen“.
4 / „Wieso, ist nun mal so.“
Auf Augenhöhe mit „Häng dein Herz nicht an Dinge“. Oder „Geld allein macht nicht glücklich“. Was nicht stimmt. Nichts macht glücklicher als Geld. Beide Seiten wissen das. Mit dem Unterschied, dass einer hat, der andere nicht. Ende der Augenhöhe.
5 / „Pech.“
Unstern, ein hübsches Wort für Unglück, oder? Es gibt noch so viel zu entdecken. Nicht wahr, mein Lieber? Tja, mein Lieber.
6 / „Mein Lieber.“
Gönnerhaft von Mann zu Mann. Teile und herrsche. Das Auto.
7 / „Mein Bester.“
In Fällen krankhafter Armut empfehlen wir: Reichtum. Wohlstand als Gegenmittel. Und schon geht’s wieder. Ganz leicht, ganz einfach. Stellt euch man nicht so an.
8 / „Kann ich dich zurückrufen?“
Denn ich habe die Flatrate. Und du nicht. Kann also dauern. Auch schön: SMS schicken, die mit einer Frage enden. Dass der Empfänger genötigt ist, zu antworten. Was ihm schwerfällt, ohne Flatrate. Was ihn ärgert, denn jede SMS kostet.
9 / „Geh arbeiten.“
Taxi fahren. Oder lass dich zum Busfahrer ausbilden. Das Arbeitslosenamt zahlt sogar die Umschulung. Nennt sich Qualifikation. Nennt sich Maßnahme. Weitere Maßnahmen: Geh doch ins Callcenter. Du hast doch eine schöne Stimme.
Oder in die Altenpflege. Dekubitus, das Wundliegegeschwür. Inkontinenz. Rollator. Stabile Seitenlage. Guck mal, da, das Auto: „Pflegen mit Respekt.“ Gut, womit auch sonst? Dennoch, das Thema hat Zukunft. Deine Zukunft, mein Bester.
10 / „Ihr wollt doch gar nicht arbeiten.“
Mach doch mal was. Geh doch wenigstens Flaschen sammeln. Die tun jedenfalls was, die Flaschensammler. Plus: in der Ansprache vom Singular in den Plural wechseln. Um das Spiel in die Breite zu ziehen.
11 / „Ihr wolltet ja nicht hören.“
Mütterplural. Folgt seiner ganz eigenen Logik.
12 / „Du hättest alles werden können.“
Muttersingular.
13 / „Das ändern wir jetzt auch nicht mehr.“
Mehrheitsmütter aus der Kriegsgeneration. Haben gelernt, sich zu ergeben.
14 / „Okay!?“
Verstanden. Beziehungsweise nicht verstanden. Kleine Pause machen. Und dann: Morgen fliegen wir nach Havanna. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Und sonst?
15 / „Das tut mir sehr Leid.“
Und sonst?
16 / „Das Wichtigste ist doch die Gesundheit.“
Und selbst?
17 / „Jedes Häuschen hat sein Kreuzchen.“
Mengenlehre: Der Mond ist aus grünem Käse.
18 / „Schreib das alles auf.“
Dann sind wir dich erst mal los. Guter Tipp auch bei Liebeskummer. Will man ebenso wenig von wissen.
19 / „Armut macht frei.“
Schau an, das Zyndikat, die gute alte Nazischule: Eigentlich sollte man euch Leuten den gelben Stern mit römisch IV drauf verpassen. Hat doch schon mal funktioniert. Und dann ab ins KZ, stehen doch noch alle. Wir hatten hier nämlich mal sechs Millionen Juden. Worüber noch zu reden sein wird.
20 / „Jedem das Seine.“
Schau an, die neue kalte FDP-Schule, angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Der Markt hat immer recht. Jeder an seinen Platz. Insofern kümmere dich doch um deinesgleichen. Mach doch ein Ehrenamt. Zum Beispiel bei der „Hamburger Tafel“. Dort kannst du das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, der Mensch muss ja auch essen. Außerdem hilfst du so der Lebensmittelindustrie, Entsorgungsgebühren zu sparen. Und zwar so was von reichlich. Oder ist das jetzt auch wieder falsch?
21 / „Weiße Rosen aus Athen.“
Auswandern. Der neue Trend. Muss ja nicht Griechenland sein. Somalia hat auch schöne Strände.
22 / „Das muss man auch mal aushalten können.“
Klassisches Akademiker-Argument. Unangreifbar, weil ganz hohe Schule.
23 / „So schlimm?“
Blödmann-Oberwasser.
24 / „Wat geiht mi dat an?“
Plattmacher.
25 / „Aber das wolltest du doch.“
(Nach Diktat vereist.)
Tausend Geld
Die Dinge.
Bargeld: 35,74 Euren. Wir schreiben den 17. Februar 2012. Noch elf Tage Monat. Blöd, dass wir ein Schaltjahr haben. Also einen weiteren Tag als Zugabe. Auf der anderen Seite werden Minirente und aufstockende Sozialhilfe bereits am 29. auf dem Konto sein. In die Tasche gelogen bedeutet das: zwei Tage früher als sonst. Oder zumindest einen Tag, wenn man vom Mittel ausgeht, dass nämlich ein Monat dreißig Tage zählt. Der kommende März wiederum hat einunddreißig Tage. Also eigentlich dreiunddreißig, wenn man den 29. Februar als Stichtag für Kontoeingänge hinzuzählt. Heißt nichts anderes, als dass mir der Kalender dieses Jahr zwei zusätzliche Tage aufbürdet; auch ohne sie hätte ich nicht gewusst, wie ich den Monat bestreiten soll. Das ist kaum zu schaffen. Da sollte man sich kein X für ein U vormachen. Da muss man auch mal Ross und Reiter nennen. Wo kriege ich zügig eine Magnum samt Munition für 35,74 Euren her? Jetzt. Nicht morgen, nicht irgendwann. Ich brauche nur eine Kugel.
Die Dinge.
Kontostand: Miete ist runter, Gott sei Dank. Wasser ist runter, dito. „Alice“ geht noch runter, meine sexy kleine Festnetz-Flatrate. Klarmobil: unklar. Habe vor Monden eine Rechnung moniert. Seitdem nie wieder was gehört. Seitdem wurde nichts mehr abgebucht. Handy funktioniert trotzdem. Mir recht. Mir doch egal. Vattenfall müsste gestern gezogen haben, 32,20 Euren Nachzahlung Verbrauchstrom, die Endabrechnung, denn ich habe den Versorger gewechselt. Die Nachzahlung muss ich aus dem sogenannten Regelsatz begleichen, wird vom Sozialamt nicht übernommen. Vattenfall zieht noch die monatliche Pauschale von 91 Euren Nachtstrom, und zwar am 20., nächste Woche. Vattenfall hat das Monopol auf Nachtstrom, da kommt man nicht raus, da kann man nicht wechseln. Hamburg Energie, mein neuer Grundversorger für Morgenstrom, Vormittagstrom, Mittagstrom, Nachmittagstrom, Frühabendstrom, Spätprogrammstrom, Nachtschlafstrom zieht seinen ersten Abschlag von 35 Euren, und zwar am 28., einen Tag vor Monatsende. Also am eigentlichen Monatsende, hätten wir dieses verdammte Schaltjahr nicht. Ich bin komplett überfordert, all diese Daten, all die tausend kleinen Terminchen, mit knallharten Deadlines versehen, hinter denen tausend Türme johlend empor wachsen, Salden an den Wolken kratzen, mir meinen Himmel verpatzen, sich die Hände reiben, grinsend die Hand nach tausend Geld aufhalten, all dies verwirrt mich, belustigt mich sogar ein wenig, weil es so idiotisch ist, so verklemmt, kleinkariert und spießig, sich wegen solcher Sümmchen verrückt zu machen, bis diese ein Ausmaß, eine Dimension, eine Größe erreichen, die ihnen gar nicht zusteht, bis sie zubeißen, die Kleindeutschenängste, anerzogen, antrainiert, diese Furcht vor den Fälligkeiten läppischer Beträge, die irgendwelche Institutionen fordern, damit fremde Räume die meinen bleiben, warm bleiben, bewässert werden, Muscheln besprochen werden können. Denn falls tausend Geld bei tausend Türmen nicht rechtzeitig eingeht, weil Schalter die Zahlungen verweigern, dann schlagen aus den Zeitfenstern der nächsten elf Tage schneidend blaue Flammen. Wo bleibt der Deinhardt?
Die Dinge.
Dinge kosten Geld. Geld hat mich nie interessiert, solange es nur da war. Genug davon, um Dinge zu bezahlen. Notwendige, schöne, besondere Dinge. Rechnungen in Restaurants, Pullover von Omen, Mustangs von Ford. Leckere, schöne, schnelle Dinge. Notwendige Dinge wie Miete, Tabak, Kaffeebohnen. Mittlerweile wird es selbst damit eng, stecke ich knietief im Dispo, eingesperrt im Schuldturm, lege in Ketten kümmerliche Versprechen auf Besserung ab, beide Seiten wissen, Gläubiger und Schuldner, sie sind so viel wert wie unsichtbare Tinte unter irgendwelchen Verschreibungen. Zweitausendfünfhundert eilige Euren zum Ausgleich auf plus minus null wären gut, um zunächst mal die Bank ruhig zu stellen. Und dann noch zehn Mal tausend Geld, um private Gläubiger glücklich zu machen. Der nächste Sechser im Lotto könnte helfen. Um mal wieder Luft zu holen. Eine Atempause. Keine Angst mehr. Vor heute. Vor heute Nacht. Vor morgen. Vor morgen Nacht. Vor den Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, die noch kommen mögen. Hoffentlich lässt mich die Bank nicht hängen. Dann ist alles vorbei. Dann geht es schnell. Dienstags kommt die Müllabfuhr. Und freitags. Heute ist Freitag. Vielleicht sollte ich mich zum Abfall legen.
Die Dinge.
Kleidung: Socken satt. T-Shirts toll. Boxer-Shorts bombig. Jeans: zwei Paar Levis 501, schön in dunklem Blau, von geschenktem Geld vergangenes Jahr erstanden. Reichen eine Weile, um auszusehen. Einigermaßen gestylt auszugehen. Meinen Oberkörper ziert die Jacke eines Toten, eine schwarze von The North Face. Damit schlüpfe ich überall als lieber Hamburger durch, denn liebe Hamburger tragen Jacken dieser Marke. Und liebe Marken machen dich zum besseren Menschen, gut gelaunt, kaufkräftig, konsumwillig. Diese schicke, multifunktionelle Rüstung für den urbanen Überlebenskampf am Geldautomaten hat mir ein Bekannter vermacht; jemand in seinem Umfeld war verstorben, recht jung, mit neununddreißig. Tragisch, aber toll. Tragisch für ihn, toll für mich. Ich habe einen schicken Kurzmantel gesehen, in funky Feldgrau. Im Army-Shop, Holstenstraße. Den hätte ich gern. Für den Übergang. Kostet neunundsiebzig Euren. Warum nicht 35,74? Schuhe: Die Chucks haben sich verlaufen. Die Hacken der Nikes sind schief. Ich hasse schiefe Hacken. Niemand soll sehen, dass ich arm bin. Ich brauche dringend neue Schuhe. Für den Übergang. Für den Sommer. Ich lebte gern mal wieder auf fröhlichem Fuß.
Die Dinge.
Haushaltsgeräte: Nichts darf kaputtgehen. Wehe, die Waschmaschine gibt auf. Wehe, der Kühlschrank. Die Kaffeemühle. Der Fernseher. Der Hifi-Verstärker ist schon kaputt, die Endstufe ist hin. War mal ein richtig guter, warm klingender NAD. Der, von dem ich ihn vor Zeiten für tausend Geld kaufte, hat versprochen, sich zu kümmern. Das war vor bald einem Jahr. Seitdem nichts mehr gehört von ihm.
Die Dinge.
Elektrik: Transformator der Niedervoltanlage im Schlafzimmer ist kaputt. Keine Ahnung, wieso, keine Ahnung, was so was kostet. Ich könnte es kugeln. Doch wozu? Ich brauche kein Licht im Schlafzimmer. Ich weiß, wo was ist. Ich weiß, wie ich nackt aussehe. Ich weiß auch ohne Licht, wie nackt ich mich fühle.
Die Dinge.
Wände: Letzte Renovierung war vor zehn Jahren. Frische Farben müssten her. Frische Farben kosten tausend Geld. Vergiss es. Vergiss frische Farben. Die Neue Armut wohnt vergilbt.
Und sonst? Neue Bürsten für die elektrische Braun „3D Pulsating Toothbrush“ wären vonnöten. Man zeigt der Welt die Zähne weiß, klinisch rein; braun geht gar nicht. Zahnpasta, -seide und Mundwasser sind noch ausreichend vorhanden. Duschgel und Haarwasch dito. Bodylotion: Die Buddel ist halbvoll, welch Sinnbild. Düfte: diverse. Von Armani, Calvin Klein und Paco Rabbanne. Die Neue Armut stinkt nicht. Waschpulver reicht noch für einige Gänge. Insektenspray ist genug da. Klopapier auch. Küchenrollen: noch zwei. Und sonst? Klingen? Kaffeefilter? Kotzbeutel? Müllbeutel? Müsli? Milch? Mütter?
Mütter. Mütter? Wieso Mütter? Wieso Insektenspray?
Ausblick: Das Wochenende steht vor der Tür. Mal Ausgabezeiten der Tafeln checken. „Chic & satt“, Elim Christengemeinde, Bostelreihe, „für mehr Himmel auf Erden“. Der Himmel unter meinesgleichen hinter dem Parkhaus des €inkaufs-KZ Mundsburg. Vielleicht sollte ich ein Ehrenamt machen? Hin zur Hamburger Tafel. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, denn der Mensch muss ja auch essen. Und der Lebensmittelindustrie helfen, Entsorgungsgebühren zu sparen. Und zwar so was von reichlich. Oder ist das jetzt auch wieder falsch? Das Telefon klingelt. Keine Ahnung, wer dran ist. Mir egal, wer dran ist, und zwar so was von. Ich nehme ab und brülle hinein: „Mann!!! Geh mir nicht auf den Sack!!! Ich weiß nicht, was du für mich zahlen kannst!!!“
HHoolen HHorst
Sing mit mir zum Schlag der Tauben:
Geld Geld,
Geld,
Geld Geld.
Geld Geld,
Geld,
Geld Geld.
Geld Geld,
Geld,
Geld Geld.
Glück?
WINTERHU.DE
Zweites Kapitel.
Zyndikat
Tag beginnt mittags. Wozu früher aufstehen? Wozu vormittags, wenn man nichts vorhat? Alles wegschlafen, ignorieren, was von außen kommt. Hahahuuu-Hündchen zwei Stockwerke tiefer, das raus will zum Arschficken. Kläng-däng die Müllabfuhr. „Stopp, stopp, stoppo!“ – Kitatante treibt den Kleinwuchs an der Straße zusammen. Alles wegschlafen, ignorieren, was von innen kommt. Die Angst und ihre Bilder. Die Schuld und Scham, versagt zu haben. Die Scham, Schuld und Schulden womöglich nie mehr begleichen zu können. Die Gelder, die ich nach und nach von Bekannten lieh, mir leihen musste, um zumindest die private Insolenz abzuwenden. Damals noch in der irrigen Annahme, mich nach Zusammenbruch meines Geschäftes bald wieder als ganz normaler Angestellter einer Werbeagentur verdingen zu dürfen. Und somit die Kohle zeitnah zurückzuschaufeln. Doch der Ofen war aus.
Die Panikattacken kamen über Jahre. Seit sie vorüber sind, geht schlafen wieder einigermaßen. Eine Panik, die mich nachts ansprang wie eine wilde Bestie, mich alle Fenster aufreißen ließ. Mal versucht, leise zu schreien? Ist nicht ganz leicht. Mal versucht, wegzulaufen? Ist nicht möglich. Wohin auch?
Mittags gibt’s hier massenhaft Parkplätze. Die Ameisen und fleißigen Bienen haben längst ihre Waben verlassen und tun woanders wichtige Dinge. Ich stehe mit heißem Milchkaffee und erstem Joint an Fenstern und sehe: Nornen, die mit bösem Blick Hundescheißebeutel aus roten Behältern picken, auf denen „Hummel Hummel Müll Müll“ steht. Sehe: Rentner beim Einsteigen in automobile Altenteile, Mercedes-Elch-Klasse, blau-metallic. Willst du vorne sitzen? Klapp, Tür zu. Oder komm doch nach hinten. Tür wieder auf, klapp, Tür wieder zu. Haben wir alles? Klapp, Kofferraum zu. Oder warte. Wieder auf. Mutti muss noch mal ins Haus. Opa wartet. Mutti kommt zurück. Tasche in den Kofferraum. Klapp, Tür zu. Mutti nach vorne. Klapp, Tür zu. Opa steigt ein, klapp. Opa startet. Hochtourig aus der Parklücke. Hochtourig los. Es dauert eine Ewigkeit, bis in den dritten Gang geschaltet wird. Ra, Ra, Rachengold.
Sehe: die Neuen Mütter samt den Früchten ihrer Leiber. Bitte komm her. Nein, das bitte nicht, das ist A-A. Bitte lass das liegen, das ist ein Blindgänger einer britischen 500-Pfund-Bombe. Bitte tu dies nicht, tu das nicht. Statt dem kleinen Scheißer mal eine reinzuhauen, wie zu Zeiten meiner Kindheit üblich. Hat immer funktioniert. Und aus mir ist ja auch was geworden. Schließlich liege ich nicht wie ein Blindgänger in der Gegend rum, auf öffentlichem Grund. Sondern gebe mich im Gefängnis meiner Wände gemeingefährlichen Gedanken hin.
Bofrost liefert. DHL liefert. Hermes liefert. Trab, trab, trab, schnell, schnell, schnell. Empfänger nicht zu Hause. Es klingelt. Ich gehe nicht hin. Wir nehmen hier nichts an der Tür. Außerdem riecht die ganze Wohnung nach Gras. Ich nehme einen tiefen Zug vom Joint. Meine neue Lebensaufgabe heißt Versenkung. Ich bin in den Anblick der gegenüberliegenden Zeile versunken, von links nach rechts: eine podologische Praxis, ein privater Altenpflegedienst, eine Praxis für Naturheilkunde. Übersetzt von links nach rechts: Putzerfische, die den Grind abknabbern. Daneben dienstbare Geister, die faulend Fleisch abwischen. Und einer gibt die Globuli dazu. Der Inhaber des Altenpflegedienstes fährt einen Polski-Fiat. Allein das. Und dann noch mit dem Kennzeichen HH-HB 831. Was denn jetzt? HH? Oder HB? HHier ist HH. HB wollen wir HHier nicht. Und Brema Bischöfe, die mal vor einigen Jahrhunderten unseren frühmittelalterlichen Stadtkern okkupiert hielten, wollen wir nicht erwähnt wissen, weder als Ziffern auf Nummernschildern noch sonst wo, sonst wie, sonst noch was?
Oh ja, und zwar dies hier: Eine Ladenzeile, in der es nichts zu essen gibt, kann keine gute Zeile sein. Wo bleibt „Griechisch minus Winterhu.de“? Wo bleibt „My Thai“? Wo bleibt „Doris ihre Futterkiste“? So sieht’s hier mittags aus, nichts zu essen, stattdessen massenhaft freie Stellplätze. Näpfe und Bleche scheinen einen Nichtabstellpakt geschlossen zu haben, eine diskrete Allianz eingegangen zu sein, die mich mit knurrendem Magen und übersäuerter Seele am Fenster stehen lässt. Ich habe nichts vor an diesem Tag. Auch am nächsten nicht. Eigentlich nie. Mehr. Wenn das so weitergeht, und es sieht ganz danach aus. Mir fällt nichts ein. Ich habe zu nichts Lust. Ich könnte Staub saugen. Staub wischen. Zu Staub werden. Ich könnte online gehen, kugeln, taggen, posten, mailen. Keine Lust, keine Likes. Ich könnte fassfrische Nachrichten und artige Artikel lesen. Keine Lust, Kunst kann nichts. Ich könnte chatten, Volten tauschen, irgendjemanden anrufen. Doch wen? Ich bin inzwischen high vom Gras, doch tatsächlich habe ich nicht mal mehr Lust auf dieses hysterische Kribbeln, das mich früher schnell machte, meine Wahrnehmungen verdoppelte. Früher war ich Freiberufler mit Ideen, ohne Zeit. Heute bin ich Freigänger ohne Ideen, aber mit viel Zeit, viel zu viel Zeit. Zeit, an der Zeit zu verzweifeln. Zeit, die war. Zeit, die ist. Zeit, die noch kommt. Viel zu viel Zeit, um unfreundlichen Gedanken nachzuhängen. Ich denke mir was aus, ein Spiel. Teilnehmen dürfen nur ehrliche Steuerzahler. Das Spiel heißt „Arme klatschen“. Arme kriegen den Hartz-IV-Stern und sind damit als Asoziale leicht auszumachen. Jeder darf mal. Reinhauen, draufhauen, reintreten, nachtreten. Wenn man genügend blutige Masse beisammen hat, kehrt man sie auf der Moorweide zusammen und verbringt sie in die Lager. Da kriegt dieses Gesocks dann den Rest. Hat doch schon mal funktioniert. Fahrtkosten gehen natürlich zu Lasten der Gäste, wird vom Hartz-IV-Regelsatz abgezogen, hat doch schon mal funktioniert, als die gelben Sternchen für ihre Deportationen sogar noch zahlen, der „Deutschen Reichsbahn“ einen Obolus für den jeweiligen Stehplatz im Viehwaggon entrichten mussten.
Wie steht’s damit, Hamburg, Deutschland? Nein, das ist krank und billig, das ist ekelhaft. Das ist menschenfeindlich. Was ist bloß los? Früher wirkten Gräser anders. Da stellten wir Gongs in die Landschaft und tanzten Ausdruck an den Ufern von Seen. Ach, früher.
Vielleicht die abgespeckte Variante? Nennen wir sie „Arme versenken“. Es wird doch wohl noch irgendwo irgendwelche Seen geben? Oder zur Not auch Meere.
Es gibt hier massenhaft Parkplätze. Allein vom Wert der momentan hier abgestellten Autos könnte ich monatelang essen gehen lassen. Ja, lassen. Vielleicht lege ich mich wieder hin und mache Sonnen zu Monden. Bis die Nornen zum nächtlichen Gongschlag tanzen.
iHartz
Was kommt nach alten Männern, die wie mumifiziert den ganzen Tag in wenig mehr als ehedem weißer Schiesser-Unterwäsche am Fenster stehen und rüberglotzen? Gibt es eine spezielle Heizungs-Flatrate für einbalsamierte Untote? Wenn ja, wo?
Was kommt nach mir in meinem sanften Mittelalter, der ich, einen Bol frischen Milchkaffee in der Hand, ungewaschen, unrasiert, graue, abgewetzte Nike-Joggingklamotte, Sohlen in milbig schwarzen Socken vom Vortage, Hacken in beigen Chucks, die zwar völlig runter sein mögen, aber immer noch einen fröhlichen Fuß machen, unentwegt unfreundlich zurückglotze?
Ist dies Stillleben in Einklang zu bringen mit der sozialen Unterhaltungsverordnung?
Was macht uns so traurig? Was lässt uns derart verwahrlosen?
Warum werden wir alt? Und warum ich?
Facialbook
Was kommt nach Milf? Milf für Mothers I'd love to fuck.
Die Mirf? Mirf für Mothers I'd refuse to fuck?
Dann bitte auch das andere Geschlecht: Dirf. Daddies I'd refuse to fuck. Wäre nur gerecht.
Dazu das pure Gegenteil: Dilf. Daddies I'd love to fuck. Hallo, Nachbar gegenüber.
Sex fehlt, Haut fehlt, Wärme fehlt.
Die Dinger
Was kommt nach Uggs, diesen Lammfellstiefeln australischer Provenienz mit dem Charme schnell schief getretener Hacken?
Was kommt nach diesen taillierten Kurzdaunenjacken mit Kunstfellbesatz am Kragen, von deren weltweiter Produktion die Hälfte beim Hamburger Fachhandel gelandet zu sein scheint? Und was kommt nach großen Taschen von Longchamp?
Was kommt da rein? Was mag da drin sein? Smartphones in Strassoptik? Oder in Pink mit Häschen drauf? Apple oder BlackBerry? Große weiße Kopfhörer von Sony? Große weiße Kondome von London? Gibt es London überhaupt noch?
Was kommt nach blonden, gebügelten Strähnchen unter grauen Strickmützen von H&M? Was kommt nach Strickmützen von Le Petit Chou?
Und seit wann bindet man Schals wie Krawatten?
Allstarvergnügen (und die einzig mögliche Replik in Klammern)
Ich habe diese Breitband-Wahrnehmung. Mehr Fluch als Segen. Ich muss alles sehen, lesen, wahrnehmen. Das war nie anders. Alles sehen, lesen, wahrnehmen. Alles. Fing an, als ich klein war. Begann mit Nummernschildern. Als ich klein war, dachte ich, HH stünde für Hamburg-Harvestehude. Dabei steht HH für Hamburg-Hausbruch.
Alles sehen. Ich muss regelmäßig Hamburg 1 „Aktuell“ schauen. Das erste Alstervergnügen seit Jahren ist im Gange, Buden säumen die Ufer, Rettungskräfte stehen bereit, eine kleine Großstadt tummelt sich auf der zugefrorenen Außenalster zwischen Kennedybrücke und Krugkoppel, Anleger Rabenstraße und „Käpt'n Prüsse“. Ein HH1-Reporter steht in der Menge und berichtet live. Es sei ja ziemlich glatt. Der eine oder andere wäre bereits ausgerutscht und hätte sich die Schulter gebrochen.
Allein das.
Die Schulter.
Nicht das Bein.
Oder einen Arm.
Oder mal gar nichts.
Nein, gleich die Schulter. Exklusiv für Hamburg 1.
Es ist also glatt auf der zugefrorenen Alster.
Mal sehen, was die Polizei dazu sagt.
Schwenk auf Beamten. Es sei ja so glatt, meint der Reporter. Wie kommt das?
Der Beamte der Hamburger Polizei lächelt und schnarrt:
„Uns fehlt der Schneestrich.“
Das ist so maschinengeschrieben dämliches Behördendeutsch, das schreit nach einer Antwort. Doch wir bleiben höflich und flüstern sie in Klammern:
(„Deiner Mutter fehlt der Schneestrich.“)
Elegante Jüdin
Heute Nachmittag läuft auf Arte eine Dokumentation mit dem Titel „Kiss me, I´m Jewish“. Über das Lebensgefühl der „jungen Juden Europas“, wie es im Videotext heißt. Muss ich sehen, weil auch meine Einstellung zum Leben „laut, bunt, geistreich und intensiv“ ist. Und um dies zu unterstreichen, werde ich bei nächster Gelegenheit ein Shirt mit „Junge Juden Hamburg-Nord“ beflocken lassen. Einfach so. Als Statement. Oder falls mal was ist.
Denn irgendwas ist immer. Ein Bekannter berichtete von einer S/M-Kontaktanzeige in der Wiener „Kronen Zeitung“, die ihm unlängst untergekommen war. Mit nur zwei prägnanten Wörtern: „Elegante Jüdin“. Stellt sich die Frage, was man diesen Leuten eigentlich noch antun muss. Tut uns – Leid? Tut, tut, tut? Das Diktat der Dummheit scheint kein Ende finden zu wollen. Neulich wurde ich Zeuge einer Begebenheit mitten in Barmbek. Vor mir im Bus saß eine Frau, Typ Kettenraucherin mit flachen Haaren frisch aus dem Bett, Typ schlichtes Mittelalter in KiK-Klamotte. Vor dieser Person flegelten sich zwei Jungs mit Migrationshintergrund, oder, wie eine Polizistin in einem Beitrag auf Hamburg 1 neulich so schön blond formulierte, „mit Migrantenhintergund“. Digger und Doof mit den obligatorischen Kanisterfrisuren, in den für sie üblichen weißen, mit sinnfreien Ornamenten im Arschgeweih-Stil bedruckten Textilien. Die es einem leicht machen, sie nicht zu mögen. Sie mögen sich ja selbst nicht. Wenn sie Worte speien wie „Digger, hassu mein Schwester gelacht?“. Wenn sie Worte rotzen wie „Digger, dein Muddha kannisch blasen, ey“. Digger und Doof, unruhig, breitbeinig, auf Stress gegelt. Bereit, zu demütigen. Saglinkerso: „Digger, bald sind wir mehr als diese scheiß Kartoffeln.“ Mit scheiß Kartoffeln sind wir gemeint, die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Sagrechterso: „Was, Digger?“ Sagersterso: „Wir sind jetzt schon eine Million, Digger. Und dann hauen wir sie weg, Digger.“ Die Achse des Blöden. Warum nicht mal irgendeine Zahl in die Diskussion werfen? Warum nicht einfach mal was behaupten, warum nicht einfach mal einen kleinen Dschihad anzetteln, ganz entspannt unter Vertrauten in der Linie 172, mitten in Barmbek? Was der Frau hinter ihnen wenig zu imponieren schien. Die beugte sich nach vorn, tippte dem Wortführer auf die Schulter und sagte laut: „Entschuldigung, wir hatten hier auch mal sechs Millionen Juden.“ Todescool. Danach war erst mal Ruhe. Und Ruhe ist bekanntermaßen die erste Bürgerpflicht. Über dem Portal eines alten Hauses in der Langen Reihe steht geschrieben: „Eintracht im Haus – Friede dem Reich“.
Reich mir mal die Jüdin rüber.
Kur.de
Die Drogeriekette Schlecker, ehemals „modern und preisberühmt“, wirbt seit einiger Zeit mit einem Claim, der an Doofheit nicht zu überbieten ist: „For You. Vor Ort.“
Tatsächlich stammt dieser Schwachsinn von den Inhabern selbst. So was muss man erst mal kreieren: „For You. Vor Ort.“
Das Unternehmen steht kurz vor der Pleite, wie man der Presse entnehmen kann. Doch man steuert gegen. Momentan mit einem Aushang in den Schaufenstern, der suggeriert, die Mitarbeiter liebten ihren Laden und würden alles für ihn tun und neue Sortimente wären unterwegs und „For You. Vor Ort.“.
Gestalterisch hat man ganz tief in den Schriftenkoffer gegriffen und eine Typo ausgegraben, die an eine antike Schönschreibschrift erinnern soll. Unglückliche Wahl allerdings, denn die Anrede liest sich, wenn man nicht genau hinsieht, wie „liebe Kurdinnen, liebe Kurden“. Auch, weil man das Papier hat beidseitig bedrucken lassen, sodass der Text bei rückseitigem Gegenlicht kaum noch zu entziffern ist. Weil man doof ist oder geizig oder beides. Zu doof, zu geizig, um sich professionelle Plakate gestalten zu lassen. Ich höre die Verantwortlichen sagen, wieso, die Rückseite ist doch noch gut. So wie Großmütter früher gebrauchtes Weihnachtspapier aufgebügelt in den Schrank legten. Falls mal was ist. Falls noch mal irgendwo Weihnachten ist.
„For You. Vor Ort.“ Steht da und keiner tut was. Niemand unternimmt was dagegen. Heutzutage darf jeder alles. Jeder darf mal. Geld darf alles. Diese Erkenntnis übermannt mich, lässt mich zu Boden gehen. Gleißendes Neonlicht leuchtet meinen Geist aus, und ich verkrieche mich unter endlosen Regalmetern von gebrauchtem Geschenkpapier, gelutschten Lutschmitteln, vermüllten Müllbeuteln und Insektenspray.
Croque-Nigger
Eine Bekannte hat sich eine Thrombose zugezogen, als Spätfolge zweier schwerer Operationen. Sie erhält Medikamente. Blutverdünner. Sie spritzt sie sich selbst. Bauchfleisch hoch und rein damit. Was mich schon wieder hungrig macht.
Was mich endlich mal wieder auf eine Idee bringt. Eine echte, denn eine Idee ist mehr als ein Einfall. Hab ich mal gelernt. Ich starte noch mal eine Karriere. Als Fixer. Ich werde Crack-Nigger. Frische Farben, Farben fein.
Der Vorteil: mal wieder was vorhaben. Ein Vorhaben haben. Haben, haben, haben. Worum geht’s denn? Darum geht’s doch, oder?
Der Vorteil: Neue, interessante Menschen treten in mein Leben.
Der Vorteil: klare Ziele. Und dazu noch in HHauptbahnhof-Nähe.
Nicht weit weg von diesem schönen alten Haus in der Langen Reihe kurz vor der Ecke Schmilinskystraße, vom HHauptbahnhof kommend auf der rechten Seite gelegen. Auf dem geschrieben steht: „Eintracht im Haus – Friede dem Reich“.
Reich mir mal das Bauchfleisch rüber.
Ich wäre gern wieder ein geachteter Bürger dieser meiner Stadt. In unmittelbarer Nähe unseres schönen HHauptbahnhofes. Mit seinen schönen Croque-Läden. Und das Wort „Croque“ bringt mich auf eine noch bessere Idee:
Ich werde als Croque-Nigger Karriere machen.
Der schwarze Mann als solcher soll ja über ein Geflecht recht dicker, pulsierend dunkelblauer Venen auf dem Schaft verfügen, die verbrauchtes Blut arbeitsteilig in Sekundenschnelle zum Herzen zurücktransportieren. Und das Konzept dicker dunkelblauer Venen imponiert mir, steht es doch sinnbildlich für Saft und Kraft im Mehrweg$$ystem, farblich für ein noch effektiveres Bio-Recycling.
Bleibt nur noch, das Konzept mit Leben zu füllen. Und ich weiß auch schon wie und wo. Ich werde mich vor dem HHauptbahnhof aufhalten und den Passanten meine Flöte „Schinken-Banane“ zeigen. Asozial zum Anbeißen.
Appendorf
„Was wollen Sie regulär wissen?“
Antwort einer Mitarbeiterin eines Technikkaufhauses auf meine Frage, wo denn bitte die Ersatzaufsteckbürsten für die Braun „3D Pulsating Toothbrush“ zu finden seien.
„Was wollen Sie regulär wissen?“
Wunderbar.
Gibt’s euch Leute auch als App?
Kann man euch irgendwo günstig runterladen?
Rein regulär?
MUNITIONIERUNG
Drittes Kapitel.
ScheiternHHaufen
Fünfzehn Jahre Popkultur: V-2 Schneider, die Band. „Sex Dwarf“, das Fanzine. „Poser“, die Szene-Magazine. Zehn Jahre Werbung: Wyatt, die Agentur, Pleite gegangen 2004. Alles weg. Alles. Inklusive Billardtisch. Inklusive der Kühlschränke mit den Softdrinks. Inklusive der Kühlschränke mit den Säften. Inklusive Wasserspender. Indikatoren eines über lange Zeit gut bis sehr laufenden Unternehmens verschwanden nach und nach.
Ich kannte mich nicht aus. Ich wollte da nicht hin. Einer sagte, du musst. Du musst dich arbeitslos melden. Ich sagte, keine Zeit. Ich muss die Agentur abwickeln, die Finger heben, mit Banken reden, mit Gläubigern. Außerdem bin ich nicht arbeitslos, sondern pleite. Einer sagte, richtig, verstanden, aber wovon willst du die Miete bezahlen? Vom Rest ganz zu schweigen.
Dezember 2004, Dienstag vor Weihnachten, Arbeitslosenamt Langenhorn. Auf dem letzten Drücker mit dem Taxi hin. Ich kannte mich nicht aus. Ich hatte im Vorwege noch nie mit diesem Milieu zu tun gehabt. Ich mochte das Gebäude nicht, Zweckbau, Architektur wie ein Steuerbescheid. Kalt. Überall Kippen auf dem Gelände. Man sei nicht zuständig, es hätte eine Strukturreform gegeben, man kümmere sich nur noch um die regulären Arbeitslosen. Ich sei keiner. Stimmt, hätte ich regulär wissen können. Ich war ja selbstständig gewesen. War. Gewesen.
War. Gewesen: 1994 hatte ich genug von Ex- und Popkultur. Mit Beginn der Punkbewegung Ende der Siebziger stand in Anzügen und kurzen, zornigen Haaren auf Bühnen und sang mit den Jungs und Deerns von V-2 Schneider kurze, zornige Songs zu kurzen, zornigen Elektrobeats. Schrieb in den Achtzigern für Fanzines wie „Sex Dwarf“. Lernte Leute aus der etablierten Journaille kennen, wusste durch Esprit und Ideen, die mehr als nur erste Einfälle waren, zu überzeugen und wurde 1990 Verlagsleiter im Verbund von „Poser“, einem Szenemagazin, dem ich nach vier Jahren wieder adieu sagte. Ich wollte in die Werbung. Ich war geil auf geile Produkte und geile, schnelle Statements wie in den Lucky-Strike-Kampagnen. Auf blutige Hemden wie bei Benetton. Ich war geil auf mein eigenes Ding. Nichts hatte mehr Sex als Werbung. Nicht mal Sex.
1994 wurde Wyatt Werbeagentur GmbH gegründet. Wyatt Earp, der coole, korrupte Revolverheld aus dem Wilden Westen stand Pate bei der Namensfindung. Korrupt und cool wie wir, angetreten, um sich mit schlechter Kreation zu duellieren. Wyatt bestand anfänglich aus einem Comiczeichner, der zudem noch ein begnadeter Typograph war, logische Logos entwerfen konnte. Einem konzeptionellen Grafiker, der Ideen hatte. Einem Kontakter, der Leute kannte. Und meiner Wenigkeit als Texter und Wortspieler. In den ersten beiden Jahren machten wir das, was große Agenturen nicht machen konnten oder wollten, kleinere Sachen, Promotions für Kartoffelchips, Zigaretten, Biere, Telefonie, Testmärkte für Tiefkühlkost und Versicherungsprodukte. Das waren intensive, irre, großartige Zeiten, obwohl wir von der Hand in den Mund lebten. Unsere Autos verkauften, um Mieten zahlen zu können, Druckerpatronen, Klopapier, Insektenspray. Großartige Zeiten; gern erinnere ich mich an unsere Kampagne für den Testmarkt einer Lebensmittelkette mit Sitz in Köln, bei der es galt, direkt am Point of Sale für den schnelleren Abverkauf tiefgekühlter Hähnchen zu sorgen, durch Slogans wie „Mir ist kalt, hol mich hier raus“ oder „Ich bin dein Huhn, mach mich heiß“, die als Deckenhänger über den Truhen hingen, oder als Fußspuren mit klugen Sätzen wie „Dein Weg zum Huhn“ dorthin führten.
Wir banden Windsorknoten bei besonderen Anlässen. Wir kamen immer besser ins Geschäft. März 1996 gewannen wir einen ansehnlichen Medienetat, Kunde war ein großes Verlagshaus. Für das wir ausschließlich Business to Business arbeiteten, Zielgruppenkampagnen entwarfen, Marktpotenziale ermittelten, Marktforschungen durchführen ließen. Wir hatten gut zu tun, waren in der Weltgeschichte unterwegs, machten gute Jobs, verdienten gutes Geld; bei Wyatt standen zu besten Zeiten ein gutes Dutzend guter Leute in festem Lohn und Brot. Nach den Anschlägen des 11. September dünnten Markenartikler und Medienkonzerne jedoch massiv die Anzahl ihrer Kreativdienstleister aus. Weltweite Netzwerke traf es, große Agenturen hierzulande auch, aber ganz besonders die kleineren Kreativboutiquen waren davon betroffen. So wie Wyatt. Mitte 2003 verlängerte unser Großkunde die Verträge nicht. Wir mussten Leute entlassen. Weitere, kleinere Projekte brachen weg. Neue Aufträge kamen kaum noch rein. Nach und nach stiegen meine Partner aus. Zuletzt blieb ich als Einziger übrig, holte für die wenigen, hastig akquirierten Jobs freie Mitarbeiter nach Bedarf dazu. Jobs, aus dem Stellenteil des „Hamburger Abendblatt“ akquiriert, denn wer dort Leute sucht, will wachsen, was bewegen, das war die Idee. Somit bei den Inserenten angerufen, Termine vereinbart, hingefahren und vorgestellt, geredet, verhandelt, Briefings abgeholt, kleine Jobs für mittelständische Dienstleister aus Industrie und Zwischenhandel gemacht, nüchtern, unaufgeladen, unaufgeregt, dabei aufwendig, anstrengend, eher schlecht als recht bezahlt. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Das war kein Pop, verfügte über keinerlei Strahlkraft, keinerlei Glamour, nichts dergleichen. Und mein Team gab es auch nicht mehr, mein Team fehlte vorn und hinten, der Austausch, die Reibung, die Inspiration genau dadurch.
V-2 Schneider war pure gegenseitige Befeuerung gewesen, „Sex Dwarf“ breites Grinsen, wenn wir in Glossen über Frisuren von Popstars wie Annie Lennox von den Eurythmics herzogen und im Anschluss blutrot gefärbte Perücken vor der hiesigen Dependance ihrer Plattenfirma in Brand setzten. Als Gegeninstallation, als Statement gegen den gefällig gefönten Ausverkauf des Pop. Selbst „Poser“ gaben dann und wann noch Headlines wie „House dir rein“ über Techno her. Schlagzeilen, die wir ausgelassen auf Goa-Partys in der Heide zelebrierten. Oder auf der „Love Parade“ in Berlin auslebten. Hingegen für Klitschen zu arbeiten, die „Begasung von Containern und Lagern“ kommunizierten, war sprachlich höchst bedenklich und hatte wenig mit Sex, Sinnlichkeit und Lebensart zu tun. Wenig bis nichts.
Gewesen: Oktober 2004 war Schluss mit Wildwest, waren sämtliche Patronen verschossen. Zehn Jahre am Stück durchgearbeitet, so gut wie ohne Urlaub, am Ende dazu verdammt, mich und meine Talente permanent weit unter Wert zu verkaufen statt schicke Themen mit hinreißenden Ideen aufladen zu dürfen; dieses Leben lutschte und musste irgendwann seinen Tribut fordern. Im späten Herbst 2004 lautete die Bilanz wie folgt: Ich war komplett gescheitert, seelisch ausgebrannt, tagsüber besorgt, besoffen nach Feierabend, um mir den Kick zu holen, doch noch irgendwie weitermachen zu können. Kick in Restaurants, Kick zu Hause unterm Kopfhörer, allein mit meinen Tönen, allein mit meinen Sehnsüchten nach einem anderen Leben. Einem Leben zurück in der Popkultur, jung, hell, wach, gierig nach aufregenden Menschen, faszinierenden Ereignissen, nach der Unsterblichkeit des einen kathartisch kostbaren Momentes, wie es früher einmal war, nicht wahr? Nicht wahr, war. Es war vorbei. Aus und vorbei, Wyatt und meine Wenigkeit waren durch miteinander. Blieb nur noch, die Agentur abzuwickeln, zwischendurch noch einige freie Tage zu fangen irgendwo in der Pampa, in frühwinterlicher Askese alles mal sacken zu lassen und dann clean, erfrischt und erholt zurück in den Job, irgendwo bei irgendeinem Player, einem Netzwerk im Ausland vielleicht, das hätte mich noch mal gereizt. Irgendwo, irgendwie, irgendwer. Dachte, es würde sich so regeln lassen.
Doch es sollte anders kommen. Dezember 2004, Donnerstag vor Weihnachten, mit dem Taxi kurz vor dem Ende der Öffnungszeiten beim Bezirksamt Hamburg-Nord aufgeschlagen. Gerade noch rechtzeitig zum Inkrafttreten der Hartz-Gesetze im darauf folgenden Januar schlug ich unterzuckert, pleite und ausgebrannt bei der damals neu ins Leben gerufenen Arge auf, Arge für Arbeitsgemeinschaft SGB II, zuständig für die Belange jener Langzeitarbeitslosen, die als noch arbeitsfähig eingestuft worden waren, nach staatlicher Selektion an der Resterampe, wenn die Transporte eintrafen und das Gammelfleisch ausspuckten, das mit dem Hartz-IV-Stern, frisch stigmatisiert von den Nazikommunisten mit dem Parteibuch der Asozialdemokraten, deren Gefolgschaft aus dem Lager der Blut-und-Boden-Grünen, den antichristdemokratischen und marktradikalen Claqueuren aus Opposition und Wirtschaft plus dergleichen Lobbyisten. Langzeitarbeitslos? War ich nicht. Kannte ich mich nicht mit aus. Ämter? Kannte ich. Meldeämter kannte ich. Postämter kannte ich. Finanzämter kannte ich. Doch die Arge war neu, die Arge war mir fremd, sollte es auch bleiben. Ich mochte den Geruch in den Fluren nicht, gebohnert, abgestanden, abweisend. Ich mochte die Bilder an den Wänden nicht, billige Drucke irgendwelcher Landschaften, wohl sinnbildlich für Sehnsuchtsorte, die Drucke irgendwelcher Blumen, sollten wohl für Wachstum, Schönheit, Ruhe, Reinheit stehen. Ich mochte die Plakate nicht, die Prospekte und Druckerzeugnisse, lieblos dahin gestaltet und von Problemen kündend, von solchen mit Süchten, Armut und Gewalt. Mochte ich nicht. Waren nicht meine Probleme.
Ich mochte den Gang dorthin nicht, meinen Gang nach Canossa, als Fleisch gewordener ScheiternHHaufen. Zwei, drei Monate als Überbrückung schwebten mir vor. Höchstens. Leute mit komischen Namen nahmen meine Daten auf. Alle. Namen, Wohnort, Wohnung, Banken, Verbindungen, Vermögen, die Datenrampe. Der Staat, die Selektion, die Helfer. Ich wollte nur mein Überbrückungsgeld. Sonst nichts. Ich hatte mit ganz anderen Dingen alle Hände voll zu tun. Ich war alles andere als arbeitslos. Eine Frau Paßvogel meinte, ich müsse mich bewerben. Ach was, meinte ich, tatsächlich? Frau Paßvogel meinte, die Zeit dränge. Würde ich beizeiten keine Ergebnisse zeitigen, kämen ihre „Angebote“ zum Tragen. Jede „zumutbare Arbeit“ sei anzunehmen. Jede. Die Drohung. Die Ahnung.
Fünfzehn Jahre Popkultur, zehn Jahre Werbung. Ich aktivierte jeden und alles. Einer meinte, man müsse sich mal treffen, mal essen gehen. Einer meinte, mal könne ja mal ein Bier trinken gehen. Einer bot mir ein Praktikum an. In seiner Werbeagentur. Das ging monatelang so. Nichts zu machen, kein Zugriff, kein Glück. Ich begann, zu zweifeln. An meinen Fähigkeiten, meinem Werdegang, meiner Person. Nach einem Jahr schwante mir, dass ich abstürzen würde, runter in die Langzeitfalle, runter in die Armutsfalle, so nicht bald ein Wunder geschähe. Denn Paßvögel trieben mich zur Verzweiflung. Hunnisch Ferngesteuerte, kommunal angetreten, um Deutschlands Asozialreform umzusetzen, durchzusetzen, hunnisch Ferngesteuerte, dort gelandet, wo von ihresgleichen keinerlei eigene Leistung, eigenes Engagement oder so etwas wie geistige Beweglichkeit gefordert wird, im Gegenteil. Im Gegenteil, „fördern und fordern“, unter diesem aberwitzigen Label wird rigoros „eingeladen“, „qualifiziert“, sanktioniert. Werden Bescheide in abenteuerlichem Maschinendeutsch verfasst, Bedarfsberechnungen fern jeglicher Vernunft und Realität erstellt. Und dergleichen Wahnsinn einer aggressiven, menschenfeindlichen Parallelgesellschaft mehr. Hartz IV ist in berüchtigt deutscher Nazimanier organisierte Armutsindustrie, gemünzt auf Menschen, die nach Bezug des Arbeitslosengeldes I abgestiegen, in der Zweiten Klasse sitzen geblieben sind, abgestempelt, abgerutscht, vermengt mit jenen bedauernswerten Randfiguren, die noch nie was gerissen haben, ehemalige Sozialhilfeempfänger und dergleichen arme Schweine. Was hatte ich mit diesen Leuten zu tun? Nichts. Und doch plötzlich alles. Aus mir war eine nackte Gleichung geworden; Hartz IV ist kalte Arithmetik, kalte VWL, kaltes Rechnen mit menschlichen Brüchen, ein gigantisches Spiel mit Statistiken, an denen viele Türme sehr viel verdienen. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Vor Marx sind alle Menschen gleich. Vor Hartz sind alle Menschen gleicher. Hartz IV ist Asozialismus in perfekter Peinkultur.
Die Arge trieb mich unablässig vor sich her. „Jobangebote“ kamen auf grausig grauem Briefpapier, in unverschämt drohendem, unbotmäßig einschüchterndem Tonfall, mehrmals die Woche, durch die Bank dräuten Callcenterjobs, Verkäuferjobs, Fahrerjobs. Was hatte ich mit Telefonverkäufern zu tun? Was mit Ungelernten? Was mit Niedriglöhnern? Was mit unqualifizierten Aushilfsjobs, die weder meiner Person noch meiner Vita entsprachen? Fünfzehn Jahre Popkultur, zehn Jahre Werbung. Zum Pop fand ich kaum noch Zugang, die Werbewirtschaft und meine Person wollten oder konnten nicht mehr miteinander. Ich rannte gegen Wände, zerbrach mir den Kopf über Lösungsmöglichkeiten, Alternativen, überlegte, noch mal an die Uni zu gehen, jüngere deutsche Geschichte zu studieren. Ins Ausland zu gehen, nach Schottland, um Dudelsack spielen zu lernen. In mich zu gehen, nie wieder aufzutauchen. Bis der nächste Drecksjob ins Haus flatterte. Ich beklagte mich bei Ortsterminen, doch Paßvögel pflegten sich hinter Schreibtischen zu verschanzen, starrten mich unbeeindruckt an. Ich erinnere, wie mich eine bei Gelegenheit anfuhr, nach flüchtigem, eher gelangweiltem Blick auf die Liste meiner Aktivitäten, gefälligst auch bei Reinigungsfirmen vorstellig zu werden. Als was denn?, fragte ich. Als Marketingleiter? Sollen wir jetzt alle Pizzafahrer werden?, lachte ich und schrie dabei fast. Ohne Worte. Doch die Frau meinte es ernst. Ich habe sie ausgelacht, schrie dabei fast. Erklärte, ich sei nach wie vor auf der Jagd nach einer lukrativen Festanstellung im Umfeld meiner Branche, was denn sonst, wo denn sonst? Ich hing immer noch der Illusion nach, mich über Senior Texter langsam an die Position eines Creative Directors ranrobben zu können, um mich zumindest finanziell zu sanieren, mental neu aufzubauen. Schließlich war ich mal ein Meister im Lesen von Marktforschungsergebnissen, Clustering, Consumer Insights gewesen. War Chef im Ring der Meetings und Spendings, im Screening, Monitoring, Campaigning. Best Boy im Klopapiering, Insektenspraying. Bis mir jemand aus der Szene steckte, dass niemand auf ein Ex-Langzeitselbständiges Alphatier Anfang fünfzig warten würde. Das Alter. Das Auftreten. Einer, der sich womöglich noch mit den Kunden seines neuen Arbeitgebers verselbständigte. Der Futterneid, die Konkurrenzangst, der Platzhirschenalarm.
Ich improvisierte, wurde bei Theatern vorstellig. Bei Museen, Galerien, Kunsthändlern. Fernsehanstalten. Produktionsfirmen. Synchronstudios. Nichts. Nur Absagen. Wenn überhaupt, ließen meine Söhne und Töchter, die an meiner Statt nun im Job waren, ausrichten, dass „bei meiner Qualifikation sicherlich bald“ et cetera. Sicherlich. Bald. Ein Bekannter riet zum Radio. Ich hätte doch so eine schöne Stimme. Und so viel Ahnung von Musik. Radio, ausgerechnet. Ich habe diese 16:9-Wahrnehmung. Alles sehen, alles hören. Alles. Ein falscher Ton versaut mir den Tag. Neulich erscholl aus einem Auto die Stimme einer aufgesetzt fröhlichen Moderatorin, gefolgt von Whitney Houstons „I will Always love You“. Der Loop. Ich brachte Bazookas in Stellung und legte auf die Kiste an. Half nichts. Ich legte „Pornography“ von Cure ein. Der Gegenloop. Die Gegeninstallation. Half nichts. Tag war versaut.
Im Januar 2008 wechselte meine Ansprechpartnerin. Ihre Vorgängerin hatte noch dafür gesorgt, dass nicht der volle Satz für meine Wohnungskosten gezahlt wurde. Der „Änderungsbescheid“. Der Tonfall. Die Anmaßung. Die Einschüchterung. Die Erpressung. Die Wohnung sei zu groß. Ich solle gefälligst ausziehen. Ich sagte, sechzig Quadratmeter, zwei Zimmer Altbau, vergleichsweise günstig. Mit Balkon. Zur Lagerung von Bazookas. Mit Boden. Zur Lagerung von Drohbriefen. Mit Keller. Als Schutzraum bei Luftangriffen. Der Widerspruch. Ich weigerte mich, verwies auf Hamburgs prekäre Wohnungssituation. Und auf meine eigene. Half nichts, die Leistungen blieben um fünfzig Euren gekürzt. Fünfzig Euren von nichts. Ich möge kreativ bleiben, riet sie mir zum Abschied. Seitdem kann ich das Wort nicht mehr hören. „Kreativ“ steht seither in einer Reihe mit „authentisch“, „nachhaltig“, „emotional“. Mit „spannender Herausforderung“, Herausforderungen aller Art. Die Neue hieß Frau Schenkhuhn und drohte mit einer „Qualifikation“ zum Gabelstaplerfahrer. Beim TÜV in Norderstedt. Ich weigerte mich. Alternativ hätte sie noch Ein-Euro-Jobs im „Angebot“, entweder oder, irgendwas müsste ich annehmen. Und hielt mir eine, Achtung: „Wiedereingliederungsvereinbarung“ vor die Nase. Der Begriff erinnerte mich an Knast, als hätte ich was verbrochen und bekäme nun die Chance, mich auf Freigang zu rehabilitieren. Entweder Ein-Euro, Qualifikation beim TÜV oder indem ich über einen zu definierenden Zeitraum eine zu vereinbarende Anzahl von Bewerbungen vorlegte. Ich fragte hilflos, wo denn noch bewerben? Frau Schenkhuhn sagte, seien Sie kreativ. Ich dachte, das war ich mein Leben lang. Jetzt nicht mehr.
Ich wollte nichts mehr. Ich wollte mit nichts und niemandem mehr zu tun haben. Nicht mal mit mir selbst. Nimm einem gestanden Mann seine Selbstachtung, und der finale Wunsch nach Erlösung wird irgendwann aufkommen wie ein Sturm. Nimm einem gestanden Mann seine Perspektiven, seine Selbstachtung, seine Würde, seine Freiheit, behandle ihn wie ein Tier, dann wird er zu einem solchen, irgendwann.
Ich wollte nichts mehr. Keinen Sex mehr mit Maschinendeutsch. Keinen Sex mehr mit Änderungsbescheiden. Keinen Sex mehr mit Bedarfsberechnungen. Keinen Sex mehr mit Paßvögeln, Schenkhühnern. Schluss mit allen ScheiternHHaufen, Start Eigenwuttherapie. Der Sprung. Die Tiefe. Das schwarze Loch Nass. Ich kratzte tausend Geld zusammen und bestellte ein Taxi zum Köhlbrand, wollte oben auf dem Scheitelpunkt der Brücke auf mein Schiff warten. Überlegte es mir anders und fuhr stattdessen zum Arzt. Der attestierte ein über Jahre verschlepptes Burnout-Syndrom und schrieb mich krank, erklärte mich für dauerhaft arbeitsunfähig. Ich solle mal mit jemandem reden, meinte er. Einer Professionellen, meinte er. Dringend, meinte er. Ich sei in Gefahr, meinte er.
D-Punkt
Ich nenne sie nicht beim Namen. Ich kürze sie ab. Nicht mal die Dachdeckerin durfte das D-Wort aussprechen, ohne mich ausrasten zu sehen. Ich bin nicht krank. Ich bin nur böse.
Dachdecker ist Knastsprache für Seelenklempner. Seelenklempner meint umgangssprachlich Psychotherapeuten. Meine Therapeutin war eine Psychiaterin. Wenn, dann richtig, meinte mein Arzt. Mal ganz tief rein, meinte mein Arzt. Mal Traumata explorieren, meinte mein Arzt. Professionell ausleuchten. Wecken? Heilen? Abwarten, meinte mein Arzt. Eineinhalb Jahre saß ich dann einer Professionellen gegenüber. Ein Mal pro Woche. Jour fixe. Reden. Reden. Reden. Ich habe es gehasst. Wozu reden, wenn der nächste Sechser im Lotto alle Probleme beseitigen würde, auch die psychischen, die der Mangel generiert. Nichts macht glücklicher als Geld. Alles andere ist nachrangig, ist dummes Zeug, sentimentaler Quatsch. Reden. Reden. Reden. Ich habe es gehasst. Als Sparring aufgefasst. Was nicht funktioniert hat. Als Machtkampf. Was albern war. Als ernsthaften, therapeutischen Ansatz zu nehmen, was mir schwerfiel. Dazu hätte ich diese ominöse Krankheit als eine wirkliche annehmen müssen. Was mir nicht gelang, denn Psychos machen mir Angst, egal, auf welcher Seite sie sitzen. Dennoch, erfahren habe ich einiges. Muttersprüche wie „Du hättest alles werden können“ als das einzuschätzen, was sie sind, Ausdruck einer lebenslangen Überhöhung. Eines mittlerweile erwachsenen Mannes, der sich mit Schuld und Scham herum plagte, Schuld und Scham, auf ganzer Linie versagt zu haben. Und der durch solch unreflektierte Äußerungen noch mehr unter Druck geriet als ohnehin schon. Ich habe gelernt, dummerhafte Bemerkungen aus Bekanntenkreisen wie „Du hast doch alles“ oder „Werd doch Busfahrer“ als Zeichen purer Hilflosigkeit, wenn nicht als Beweis drastischen Empathiedefizits zu werten. Und sie damit bei denen zu lassen, die sie aussprechen. Den Idioten dieser blöden, breiten Welt. Die Hölle sind immer die anderen, hat mich die Dachdeckerin gelehrt.
Wenn ich mal wieder zum Rundumschlag ausholte. HH-HH: Hitlers Hirn-Heißt Hartz. Wenn ich über die KZ-Schergen vom Amt herzog. Über Erfüllungsgehilfen mit Machtbefugnissen, deren Asozial$$ystem ein Millionenheer von Hartztoten alimentiert, um der nächst höheren Kaste, all den Niedriglöhnern, Teilzeitabhängigen, aber auch reaktionären Kleindeutschen und sonstigen schlichten Geistern ein Instrument der Abscheu und der Angst an die Hand zu geben, schrie ich. Damit sie voller ekliger Unterstellungen runtergucken können, sich abarbeiten an jenen, um die es noch schlechter bestellt ist. Denn es könnte ja auch sie selbst betreffen, ganz schnell. Alle die, die noch „Arbeit haben" – auch so ein beschissener Kleindeutschenausdruck, schrie ich. Ich muss hier weg, schrie ich. Dieses Land macht mich fertig, schrie ich. Seien Sie froh, dass Sie nicht in Somalia leben müssen, meinte die Dachdeckerin. Ach was, schrie ich. Scheiß auf Somalia, schrie ich. Der wahre Feind sitzt ganz woanders, sitzt hier, schrie ich. Teilen und herrschen, schrie ich. Friede den Hütten, Krieg den Palästen, schrie ich. Dies ist ein Aufruf zur Gewalt, schrie ich. Haut den wahren Feinden der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf die Fresse. Bringt sie alle um. Killt dieses $$ystem, schrie ich. Zu dem haben Sie auch mal gehört, meinte die Dachdeckerin. Nie, schrie ich. Doch, meinte sie. Und Sie haben ganz ordentlich profitiert. Ich war immer Punk, bin mir stets treu geblieben, schrie ich. Mag sein, meinte sie, doch diese Kultur trägt Sie nicht mehr, meinte sie und malte dabei „Kultur“ in Tüddelchen. Punks sind immer die anderen, dachte ich.
Ich machte meiner Wut Luft, wenn ich über die Medien als Instrument der $$ystem stabilisierenden Angstmache schlechthin herzog. Schön schlechte Nachrichten kolportieren, damit alle schön Angst haben, schrie ich. Immobilienpreise steigen unentwegt, also haben sie Angst. Der neue Mietenspiegel ist raus, also haben sie Angst, denn der könnte sie die Wohnung kosten. Also brav zum Job, den sie hassen. Und abends zurück mit ihrem Sklavenarsch in die Wohnung, solange sie diese noch haben, schrie ich. Angst fressen, Angst sehen. Angst denken. Schlafen mit der Angst, und morgen zurück ins Rattenrennen. Immer noch besser als nichts, und genau davor haben sie Angst, haben wir alle Angst. Also TV an und die Leere gefüllt. Mit Wildwest 2.0, Talkshows, Kochshows, Wettershows, Politshows. Mit dem Kriminaltango. Mit HHeimatfilmen, mit fröhlichen Menschen in Zeitlupe in den Pausen, wo wir mal müssen dürfen. Und Harald Schmidt zur guten Nacht. Zyndikat, Prekariat, Rattenrat. Leerzeichen. Ausschneiden. Hinzufügen. Speichern und schließen. Die Hölle sind immer die anderen. Ich schrie. Ich tobte. Ich rastete aus. Interessant, meinte die Dachdeckerin.
Die Hölle, die anderen. Wenn ich an meinen Bekannten verzweifelte, weil sie mir auf den Sack gingen. Wenn sie was für mich zahlen wollten und ich partout nicht wusste, was. Wenn sie mich irgendwohin fahren wollten und ich partout nicht wusste, wohin. Wenn sie mich einladen wollten und ich partout nicht wusste, wozu. Ich möge die Menschen nicht schneiden, meinte die Dachdeckerin. Gerade Freunde und Familie wären in meiner Situation wichtig, Menschen, die es gut meinen, das Beste, was mir passieren könne.
Die Dachdeckerin meinte es gut, wollte mit mir über 400-Euro-Jobs sprechen. Ich sagte, kein Interesse. Nicht mal einen solchen würde ich mehr durchstehen. Keine komischen Leute mit komischen Namen. Keine Urlaubsfotos. Keine Kinoerlebnisse. Keine Max-Bahr-Prospekte. Keinen Wettbewerb. Keinen Druck. Kein Interesse. Keine solche Jobs, keine solche Menschen. Keine Menschen mehr. Sie wollte mit mir über Ehrenämter sprechen. Ich sagte, ich lasse mich nicht ausbeuten, arbeite nicht umsonst, täte sie ja auch nicht. Scheiß auf die Ehre. Scheiß auf die Ehre, wenn man am Zwölften des Monats nicht mehr weiß, wie den Rest rumkriegen. Wenn man vor Beginn des folgenden Monats schon weiß, dass man ihn knietief im Dispo starten wird. Solange man überhaupt noch einen hat. Die Hölle. Ich schrie. Ich tobte. Ich rastete aus. Ich ging in den Stadtpark. Und kam in einer Suizid-Ambulanz wieder zu mir. D-Punkt für Drama. D-Punkt für Desaster. D-Punkt für Dachdeckerin. Die tat das einzig Richtige und überwies mich in eine Fachklinik zur „Aussteuerung“, letzter Baustein einer geschmierten Armutsmaschinerie. Ich wollte wissen, ob es dort eine Sauna gäbe. Zum Au$$chwitzen.
D-Punkt für Dachdeckerin. Ich habe dieser Therapeutin viel zu verdanken. Als die Nachricht meiner Berentung in 2011 kam, habe ich sie ihr gezeigt und bin danach nie wieder erschienen. Die Rente war ihre Idee. Die Beantragung geschah auf ihr Zutun. Und war das Beste, was mir unter den gegebenen Umständen passieren konnte. Diese Person war das Beste, was mir unter den gegebenen Umständen passieren konnte. Ich beziehe eine minimale Erwerbslosenrente. Ich bin Asozialhilferentner. Mittelaltersarm mit fünfundfünfzig. Ich bin weder tot noch lebendig, weder alt noch jung. Ich bin schleichend verwesendes Weder-noch. Zwölf Tage reich, achtzehn Tage nicht.
D-Punkt für Dekompression. D-Punkt für Depression. Seelenkrebs. Robert Enke, Torwart unseres niedersächsischen Ligakonkurrenten, hat sich im November 2009 vor einen Zug geworfen. Er war krank, ich bin es nicht. Ich bin nur böse.
$$ystem
Warum? Sind Millionen von uns darin gefangen? Lassen sich davon klein machen. Lassen zu, dass einst volle dreißig Tage zu deren zwölf im Monat dahinschmelzen. Warum? Warum fühlen wir uns auch noch schuldig? Warum fühlen wir uns schlecht? Warum lassen wir uns das gefallen? Warum gehen wir nicht hin und richten? Warum gehen wir nicht raus und schichten, irgendwas arbeiten, egal was, irgendwas.
Irgendwas ist immer.
SING MIT MIR
Viertes Kapitel.
Volkswirtschaftslehre
Ich verstehe das Gejammer über die angebliche „Armut per Gesetz“ schon aus konzeptionellen Gründen nicht.
Ich hätte Hartz IV von vornherein wie Bafög angelegt, also als Kredit.
Wollen doch mal sehen, wie lange dieses Pack dann noch gedenkt, seelenruhig bis Mittag im Bett zu bleiben. Wenn es staatliche Leistungen, wenn auch unverzinst, zurückzahlen muss, und zwar zackig, zügig, zeitnah. Klammer auf wieso eigentlich unverzinst Fragezeichen Klammer zu.
Von dieser glatten Eins in Volkswirtschaftslehre bin ich soeben aufgewacht. Wer ausschläft hat immer recht.
Es ist eins.
Schala-LAN
Hartz IV heißt, jedes zumutbare Spiel annehmen zu müssen. So auch jenes im Sommer letzten Jahres, ein Testkick meiner Mannschaft gegen eine „Polizeiauswahl Hamburg Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern“. Auf dem Platz unserer U23 in Norderstedt. Im Zuge der Saisonvorbereitung. Das unsexy Wortungetüm „Polizeiauswahl Hamburg Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern“ nahmen wir als Steilvorlage zur Umdichtung klassischer Fangesänge, Kurven-Standards, die Begriffe wie HSV, Hamburger Sport-Verein oder schlicht Hamburg beinhalten. Aufgerufen, das Unsingbare zu intonieren, entstanden Tage vor dem Match Parodien von beinah surrealen Ausmaßen. Singt mit uns:
„Auf geht’s Polizeiauswahl Hamburg Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern kämpfen und siegen!“
„Ohne Polizeiauswahl Hamburg Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern wär hier gar nichts los!“
„Und hier! Regiert! Die Polizeiauswahl Hamburg Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern!“
„Wer? Wird Deutscher Meister? Polizeiauswahl Hamburg Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern!“
„Steh auf für die Polizeiauswahl Hamburg Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern!“