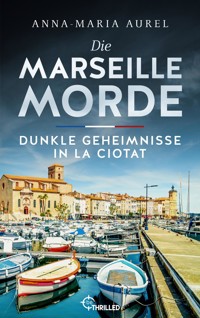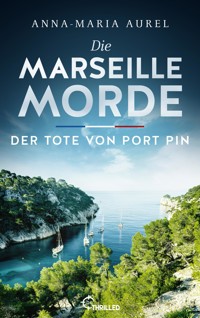5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: between pages by Piper
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Fluss in der malerischen Provence, mit dem tragische Schicksale verbunden sind Für alle Krimiliebhaber:innen und Leser:innnen von Frankreichkrimis à la Martin Walker, Jean-Luc Bannalec und Sophie Bonnet »Gedankenverloren sah er auf das dunkle Wasser der Sorgue. Dieser Fluss war ein Segen für die Region. Doch er hatte nicht allen Glück gebracht.« Die Leiche des Grundschuldirektors Pierre Pinet wird gefesselt in der Sorgue-Quelle von Fontaine de Vaucluse gefunden. Die regionale Kriminalpolizei beginnt unter der Leitung des jungen Capitaine Mathieu Dubois zu ermitteln. Der Direktor war ein allseits geschätzter, sehr sozial eingestellter Mann. Sein Vater, ein steinreicher Bauer, ist in der Gegend jedoch alles andere als beliebt und hat bereits mehrere Jahre im Gefängnis verbracht. Sehr bald findet der Capitaine heraus, dass der vermeintliche Modellbürger ein schmutziges Geheimnis hatte und vom Vater bei der Vertuschung seiner Schandtaten unterstützt wurde ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Tödliches Verhängnis an der Sorgue« an empfehlungen@piper.de, und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Franz Leipold
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Giessel Design
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Die Karstquelle
Die Leiche
Der Capitaine
Der Fall Christian Lantier
Martha
Die Ermittler aus Marseille
Fontaine-de-Vaucluse
Die Brigade Isle-sur-la-Sorgue
Ermittlungsarbeit
Amélies Gedanken
Der Adjutant
Die Lebensgefährtin des Opfers
Pauls Lüge
Das Venedig des Vaucluse
Claude Lantiers Gedanken
Das Reich des Trüffelkönigs
Aus Sylvies Sicht
Ein Abend in der Stadt
Carines Geheimnis
In Marseille
Im Évêché
Montagmorgen
Pauls Geständnis
Der verschwundene Hund
Ein Durchbruch
Die Familie Lagoc
Ein romantischer Abend
Ein Einbruch
Der Staatsanwalt
Die schreckliche Wahrheit
Mittagspause
Lagebesprechung
Pauls Rehabilitierung
Vernehmung des Trüffelkönigs
Heimfahrt aus Avignon
Die verschwundene Waffe
Martins Spaziergang
Der Tote im Trüffelwald
Der Tatort
Ein Abend zu zweit
Amélies Fragen
Sonntag
Die Familie Pinet
Das Begräbnis
Besuch von Carine
Die Einbrecherin
Nachforschungen über die Gendarmen
Neue Verdächtige
Der Angriff
Konfrontation
Der Abendspaziergang
Das Ertrinkungsopfer
Der unangenehme Besuch
Der Tag danach
Ende der Ermittlung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Die Karstquelle
Es war ein sonniger Sonntagmorgen Ende September. Im Tal herrschte eine erfrischend kühle, feuchte, für den frühen Herbst typische Atmosphäre. Die Ruhe war angenehm. Die kleinen Stände, die am Weg zur Quelle Eis, Postkarten und allen möglichen Ramsch verkauften, hatten noch nicht geöffnet, und nur wenige Leute spazierten Richtung Talenge.
»Ich komme am Morgen gerne hierher«, bemerkte Francis Valet und hob den Kopf, um die ungefähr zweihundert Meter hohen Kalkwände zu betrachten, die das enge Tal säumten und die von Karsthöhlen durchbohrt waren.
Seine Frau Elise nickte. »Jetzt ist es noch schön ruhig«, meinte sie.
Sie gingen an den uralten Platanen, hinter denen das Wasser grün schimmerte, vorbei Richtung Quelle, wo sich der über dreihundert Meter tiefe Gouffre befand, der Abgrund, in dem die Sorgue entsprang. Es handelte sich um eine der tiefsten Karstquellen Europas, und der Fluss, der aus ihr geboren wurde, barg unzählige Geheimnisse. Allein die leuchtend grüne Farbe der Sorgue, die auf eine spezielle Algenart zurückzuführen ist, verwunderte den Betrachter. Das besonders klare Wasser war außerdem seit jeher für industrielle Zwecke verwendet worden. Entlang des Ufers sah man immer wieder alte Wasserräder, die früher Papiermühlen angetrieben oder andere Fabriken mit Energie versorgt hatten, heutzutage jedoch als Dekor dienten.
Der Weg war nun nicht mehr asphaltiert, stieg ein wenig an und führte am Fluss entlang zur Quelle. Das Rauschen konnte man einige Minuten später nicht mehr hören, denn zu dieser Jahreszeit war nicht genug Wasser vorhanden. Die Quelle war nicht ganz voll, das Wasser floss an dieser Stelle unterirdisch Richtung Dorf, wo es einige hundert Meter weiter unten aus den Felsen sprudelte. Im Frühjahr jedoch, wenn in den Alpen die Schneeschmelze einsetzte und die Quelle voll war, schäumte der Fluss auch im hinteren Tal über die Steine.
Elise keuchte hinter Francis her. Sie waren beide schon 65 Jahre alt und vom guten Essen und vom Wein füllig geworden. Francis dachte mit Wehmut an die Zeit zehn Jahre zuvor, als er noch sehr viel gewandert war und eine hervorragende Kondition besessen hatte.
Als sie am Ende des Tales ankamen, konnten sie das Wasser nicht sehen. Trotz der relativ ergiebigen Regenfälle der vergangenen Woche war der Wasserstand nicht besonders hoch. Sie stiegen über den Zaun, der die Quelle begrenzte. Nach ein paar Schritten Richtung Abgrund erblickten sie das Loch, in dem das Wasser im Licht der Septembersonne, die hinter der Felswand hervorlugte, türkisblau leuchtete.
»Schön«, seufzte Elise, »und wir sind ganz allein.«
Sie gingen über das helle Kalkgestein ein wenig nach unten bis zum Rand der Quelle, wo der eigentliche Abgrund begann. Einige Meter unter ihnen befand sich der Quellteich, dessen Durchmesser ungefähr acht Meter betrug.
»Weißt du noch, diesen Winter«, bemerkte Francis, »da war hier, wo wir jetzt stehen, Wasser. Gleich hinter dem Zaun hat der See begonnen.«
In diesem Moment stieß seine Frau einen Schrei aus. Francis fuhr herum. Er befürchtete, dass Elise, die sich unmittelbar hinter ihm befand, auf dem steinigen Hang umgeknickt sei.
Doch Elise stand wie erstarrt da. Mit einem zitternden Finger zeigte sie auf den Quellteich. Francis folgte ihrem Blick und zuckte zusammen.
Im leuchtenden Türkisblau, ganz hinten, wo der Felsvorsprung seinen Schatten auf das Wasser warf, trieb etwas Großes, Schwarzes.
»Was … Was ist das?«, stotterte Elise.
Ein eisiger Schauer lief über Francis’ Rücken.
»Es sieht aus wie ein riesiges Tier. Ein Hund oder ein Wildschwein. Oder es könnte sogar ein Mensch in dunkler Kleidung sein.«
Mit Missbehagen bemerkte er, dass er seine Stimme nicht mehr im Griff hatte.
Hinter ihnen tauchten zwei junge Männer auf.
»Haben Sie ein Problem?«, fragte einer der beiden und warf Francis einen besorgten Blick zu. Er trug sein hellblondes Haar kurz geschnitten und wirkte sehr sportlich.
Francis brachte kein Wort heraus, deshalb wies er lediglich auf die Stelle, wo die seltsame dunkle Form im Wasser trieb, einige Meter unter ihnen.
Die beiden jungen Männer starrten auf die gegenüberliegende Seite des Quellteiches hinunter.
»Merde!«, rief der zweite, der eher klein und stämmig war und etwas längeres dunkles Haar hatte. »Das ist ein toter Mensch, der dort mit dem Gesicht nach unten im Wasser treibt! Und … er ist gefesselt!«
Das Gesicht des jungen Mannes war leichenblass. Elise schrie von Neuem auf.
»Putain …«, fluchte der Blonde stammelnd und zog sein Handy aus seiner Hosentasche.
Francis’ Beine versagten, und er musste sich auf den Boden setzen. Es gelang ihm nicht, den Blick vom Quellteich abzuwenden. Nun konnte auch er die nackten Arme und Beine des Toten erkennen, der in einer seltsam verrenkten Pose im Wasser lag.
Die Leiche
Sylvie Montillet seufzte. Sie arbeitete nicht gern am Sonntag. Vor allem, wenn das Wetter so schön war wie an diesem Septembermorgen. Wie viel lieber wäre sie auf dem Wochenmarkt von Isle-sur-la-Sorgue herumgebummelt oder hätte ganz einfach nur auf ihrer Terrasse ausgespannt! Am Vorabend hatte sie ihre Familie in Orange besucht, und es war später geworden als geplant. Sie war erst um eins wieder zu Hause gewesen und musste bereits um sechs ihren Dienst antreten. Nun fühlte sie sich dementsprechend müde. Außerdem hatten in der Nacht mehrere unliebsame Ereignisse stattgefunden. Ein Unfall mit Fahrerflucht war gemeldet worden. Sylvie hatte soeben die Anzeige aufgenommen. Obwohl nur Sachschaden entstanden war, mussten sie und ihre Kollegin Carine Ferrières an diesem Morgen trotzdem versuchen, den Unfallverursacher aufzuspüren.
Noch dazu war in einem Gut im Nachbardorf Pernes-les-Fontaines während der Nacht eingebrochen worden; zwei Kollegen waren bereits dorthin gefahren.
Eine alleinstehende Frau, die ziemlich einsam auf dem Land lebte, hatte nicht weit von der kleinen Ortschaft Saumane entfernt in der Nacht die Gendarmerie gerufen, weil Jugendliche versucht hatten, in ihr Haus einzudringen. Die Gendarmen hatten die Bande zwar in die Flucht geschlagen, doch auch dieser Sache musste nachgegangen werden.
Sylvie wusste ganz genau, dass sie an diesem Sonntag keine ruhige Minute haben würde. Zu allem Überfluss schien ihre Kollegin und Partnerin Carine nicht besonders in Form zu sein. Sie war am Vorabend ausgegangen und hatte wohl zu viel getrunken.
Carine kam aus der Toilette, wo sie sich das Gesicht mit kaltem Wasser gewaschen hatte. Immer noch war sie weiß wie ein Laken und ihre türkisblauen Augen wirkten in ihrem Gesicht riesig, aber Sylvie musste zugeben, dass Carine trotz allem umwerfend aussah.
Carine war nicht nur hübsch, sie war mit ihren langen dunkelbraunen Haaren und ihrem fein geschnittenen Gesicht eine ausgesprochene Schönheit. Niemand hatte Augen wie sie, und wo immer Carine hinging, zog sie jede Menge Blicke auf sich.
Sylvie war das genaue Gegenteil ihrer Kollegin und Freundin: klobig, stämmig, mit einem breiten Gesicht. Trotz ihrer langen Haare wirkte sie relativ männlich. Kein Mann beachtete sie. Sylvie litt darunter, doch sie hoffte trotzdem darauf, eines Tages zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie würde denjenigen finden, der sie so mochte, wie sie war.
Sylvie erhob sich von ihrem Schreibtisch und wandte sich an ihre Kollegin. »Carine, ich befürchte, wir müssen raus!«
Leidend verzog die Freundin das Gesicht.
»Was hast du denn gestern getrunken?«, fragte Sylvie.
»Nicht besonders viel, aber viel Verschiedenes«, seufzte Carine. »Einen Aperol Spritz, eine Sangria, ein Glas Rotwein und dann einen Whiskey.«
Sylvie stöhnte auf. »Wie konntest du nur? Kein Wunder, dass dir heute schlecht ist!«
Carine zuckte mit den Schultern. »Es war ein Scheißabend.«
»Ach … und Kevin?«
»Eben. Genau deshalb war es beschissen. Er ist langweilig und nicht besonders intelligent.«
Sylvie nahm diese Aussage schweigend zur Kenntnis.
Der besagte Kevin kam aus Nordfrankreich und arbeitete in einer Obst- und Gemüsefirma in Cavaillon. Carine hatte ihn eine Woche zuvor durch eine gemeinsame Freundin kennengelernt, und Kevin hatte sich verständlicherweise unsterblich in sie verliebt. Natürlich hatte er sich erhofft, dass er und Carine an diesem Samstagabend ein Paar würden, doch das war anscheinend nicht geschehen.
»Ich bin dann um halb zwölf gegangen, er wollte mich unbedingt begleiten, doch ich habe abgelehnt. Ich empfinde nichts für ihn. Bei mir muss es sofort funken, sonst wird das nichts.«
»Aha!« Mehr hatte Sylvie dazu nicht zu sagen.
Sie wusste wirklich nicht, auf welche Art von Typen Carine stand. Kein junger Mann schien in ihren Augen Gnade zu finden. Sylvie seufzte tief. Als sie nach dem Autoschlüssel griff, stürzte ihr Kollege Michel Bouvet in ihr Büro.
»Alarm in Fontaine-de-Vaucluse!«, rief er atemlos. »Im Quellteich treibt eine Leiche!«
»Eine … was?« Entsetzt wandte sich Sylvie dem Kollegen zu.
»Ja. Du hast richtig gehört. Eine Leiche. Ein gefesselter toter Mensch! Sieht nach Mord aus.«
Carine sah Michel einige Sekunden lang wie erstarrt an, dann stürzte sie in die Toilette, wo sie sich übergab.
Michel verzog das Gesicht. »Was hat sie denn? Ist doch nicht die erste Leiche, über die wir sprechen!«
»Nein, ihr war schon vorher übel«, meinte Sylvie. »Was sollen wir jetzt machen?«
»Ich habe den Kommandanten angerufen, obwohl er frei hat. Er ist bereits nach Fontaine-de-Vaucluse unterwegs und hat die Spurensicherung kontaktiert. Lass Carine hier, sie soll sich ums Telefon kümmern! Wir beide brechen gleich auf.«
»Carine, ich fahre mit Michel nach Fontaine-de-Vaucluse. Du bleibst hier!«, rief Sylvie in Richtung Toilette.
Sie hörte Carine schwach protestieren, reagierte aber nicht darauf, sondern lief sofort hinaus. Sie wollte es der Kollegin in ihrem Zustand nicht zumuten, den Anblick einer Wasserleiche ertragen zu müssen.
Michel Bouvet und Sylvie Montillet sprangen ins Auto und rasten mit Blaulicht durch die geschäftige Stadt, in der wie jeden Sonntag der Markt und der Antiquitätenmarkt boomten, Richtung Fontaine-de-Vaucluse.
Dort angekommen, schien alles noch relativ ruhig.
»Ich glaube, wir müssen unten parken«, meinte Sylvie. »Wenn wir nach oben fahren, ist für die Spurensicherung und die Feuerwehr kein Platz mehr.«
Sie war sich ziemlich sicher, dass der Kommandant bereits die Feuerwehr kontaktiert hatte, um die Leiche aus dem Quellteich zu bergen.
Michel stellte den Wagen hinter dem Rathaus auf dem öffentlichen Platz ab. Der Parkwächter meinte, sie sollten das Gendarmerie-Auto links vom Eingang des Parkplatzes stehen lassen.
»Was ist eigentlich los?«, fragte er verwundert. »Vorhin ist gerade ein Gendarmerie-Auto mit Blaulicht hinauf zur Papiermühle gefahren!«
Sylvie senkte die Stimme. »Anscheinend wurde in der Quelle eine Leiche entdeckt. Aber sagen Sie im Moment niemandem etwas davon!«
»Puuuutain!« Der junge Mann hielt sich die Hand vor den Mund. »Eine Leiche … Hier bei uns in Fontaine! Das ist doch nicht möglich!«
»Anscheinend schon!« Michel grinste schief.
Dann eilten Sylvie und er Richtung Quelle. Die meisten Geschäfte und Verkaufsstände öffneten gerade, und die Geschäftsleute sahen ihnen verwundert hinterher. In diesem winzigen Ort fielen zwei Gendarmen in Uniform so früh am Sonntagmorgen natürlich auf. Einige Minuten später kamen sie am Ende des Tales an.
Vor dem Zaun, der die Quelle begrenzte, standen schon einige Leute, die lautstark miteinander diskutierten. Sylvies Kollegen Simon Bellando und Dominique Monnier befanden sich mit vier weiteren Personen auf der anderen Seite des Zaunes. Kommandant Jean Calcin telefonierte einige Meter von ihnen hektisch und trat dabei von einem Fuß auf den anderen. Er beendete das Gespräch und kam auf Sylvie und Michel zu. Die beiden anderen Kollegen folgten ihm. »Gut, dass ihr da seid. Du bleibst hier bei mir, Sylvie.«
Dann wandte sich Calcin an die drei männlichen Gendarmen: »Schickt alle Leute nach unten. Sperrt unten beim Restaurant am Wasser den Weg, damit die Feuerwehr und die Spurensicherung bei ihrer Arbeit nicht behindert werden!«
Die vier Personen, die die Leiche entdeckt hatten – zwei junge Männer um die dreißig und ein älteres Ehepaar –, wollten den Weisungen der Gendarmen nicht gehorchen. Sie bestanden darauf, zu bleiben und zuzusehen, wenn der Tote aus dem Wasser gezogen wurde. Jean Calcin ging zu ihnen und begann, auf sie einzureden. Schließlich einigte man sich darauf, dass die vier sich ein wenig weiter oben hinstellen und der Arbeit der Feuerwehr und der Spurensicherung von Weitem zusehen durften. Doch alle anderen Leute mussten zum Restaurant hinuntergehen. Die Ausländer, die vor Ort waren, akzeptierten die Anordnungen der Gendarmerie ohne Murren, die paar anwesenden Franzosen verliehen jedoch ihrem Unmut lautstark Ausdruck. Eine Touristenattraktion so einfach zu sperren, nur weil ein Gegenstand in der Quelle trieb, das war in ihren Augen unerhört! Sylvies Kollegen hatten den Besuchern anscheinend den Blick auf die Quelle verwehrt und ihnen nicht mitgeteilt, um welche Art von Gegenstand es sich handelte.
Sylvie stieg zum Rand des Abgrunds hinunter und konnte bald erkennen, was dort einige Meter von ihr, direkt am Fuß des überhängenden Kalkfelsens, an der Wasseroberfläche trieb. Es bestand kein Zweifel, dass es sich um einen gefesselten Menschen handelte. Die junge Gendarmin fröstelte. Wer war dieser Tote, der einem so makabren Verbrechen zum Opfer gefallen war?
Die Kollegen von der Spurensicherung, zwei Männer und zwei Frauen, waren angekommen, begrüßten den Kommandanten und Sylvie, machten Fotos von der Quelle, ihrer Umgebung und dem im Wasser treibenden Körper und meinten dann, dass die Feuerwehr die Leiche nun bergen könnte.
Daraufhin kamen vier Feuerwehrmänner mit ihrer Ausrüstung, darunter Seile, Pickel und ein Schlauchboot, den Weg heraufgeeilt.
Sylvie kannte zwei von ihnen vom Sehen. Sie waren ungefähr in ihrem Alter, knapp dreißig, und gehörten zu den sportlichsten Burschen der Stadt. Sie nickten dem Kommandanten und Sylvie zu und machten sich sofort ans Werk.
Es ging relativ schnell. Das Schlauchboot wurde ins Wasser hinuntergelassen, zwei Männer seilten sich an der Felswand ab und stiegen direkt ins Boot.
Der jüngste Techniker, der relativ sportlich wirkte, begleitete sie. Sylvie sah ihm an, dass ihm beim Abseilen ziemlich mulmig zumute war. Die beiden Feuerwehrmänner, die ihn von oben sicherten, grinsten einander voller Genugtuung an. So durchtrainiert und furchtlos wie sie waren die Gendarmen natürlich nicht!
Sobald die drei Männer im Boot saßen, paddelten sie die paar Meter auf die Leiche zu. Bald waren sie unter dem Felsvorsprung angekommen, und der Techniker schoss einige Minuten lang Fotos.
Sylvie spürte, wie ihr Herz schneller zu schlagen begann, als die beiden Feuerwehrmänner schließlich ins Wasser griffen und die Leiche umdrehten. Zum Vorschein kam ein bläulich-weißes Gesicht. Sie hielt den Atem an.
Jean Calcin starrte in den Abgrund und sah zu, wie die drei Männer die Leiche ins Boot hievten. Wieder fotografierte der Techniker. Am Ufer begannen die beiden anderen Feuerwehrmänner bereits, Vorbereitungen zu treffen, um den Toten nach oben zu ziehen. Sylvie fiel auf, dass es sich bei der Leiche um einen relativ schmächtigen, braunhaarigen Mann in dunkler Sportkleidung – kurze Hose und T-Shirt – handelte, dessen Arme und Beine aneinandergefesselt waren. Gekrümmt wie ein Embryo lag er im Schlauchboot. Irgendwann, nach vielem Manövrieren und Herumschreien, hatten sie den Leichnam endlich nach oben gebracht. Sogar die Feuerwehrmänner, die doch an einiges gewöhnt waren, schienen von seinem Anblick schockiert zu sein.
»Wir lassen ihn hier liegen«, sagte der Einsatzleiter zu Calcin und den Technikern, und Sylvie hörte, dass seine Stimme zitterte. »Wir rühren ihn nicht mehr an.«
Die Leiche befand sich in einem fürchterlichen Zustand. Sylvies Magen verkrampfte sich, und sie spürte, wie ihr die Galle hochkam. Dominique, der gerade eben von der Absperrung zur Quelle zurückgekommen war, würgte einige Meter hinter ihr ebenfalls, und die Hände des Kommandanten zitterten wie Espenlaub.
»Er ist es!« Jeans Stimme war kaum hörbar.
»Wer … er?«, fragte Sylvie bange. Das Gesicht sagte ihr nichts. Allerdings war es sehr entstellt, vollkommen aufgeschwemmt und halb verwest. In den kurzen braunen Haaren hingen grasgrüne Algen. Sie musste den Blick abwenden.
»Der Sohn des Trüffelkönigs, der im Juni verschwunden ist. Den wir tagelang gesucht haben. Der Schuldirektor. Der Cousin von Luis.«
Sylvies Hand fuhr an ihren Mund. Sie unterdrückte einen Schrei.
Der verschwundene Grundschuldirektor Pierre Pinet, den sie ab Ende Mai überall gesucht hatten! Tot. Ertränkt. Gefesselt. In einer der tiefsten Karstquellen Europas. Aber warum?
»Und nun?«, fragte Sylvie ihren Vorgesetzten. »Nun ermitteln wir?«
Er schüttelte den Kopf.
»Nein. Wir geben den Fall ab. An die PJ.«
»An wen?«
»Die Police Judiciaire, die regionale Kriminalpolizei aus Marseille. Ich kann den Fall nicht übernehmen. Das Opfer ist der Cousin meines wichtigsten Mitarbeiters. Und der Sohn eines Mannes, mit dem wir schon genügend Probleme hatten. Wir haben gute Chancen, den Fall loszuwerden. Der Staatsanwalt kommt in wenigen Minuten und wird eine Entscheidung treffen.«
»Ach …« Sylvie war ernüchtert. Obwohl der Tod dieses Mannes sie erschütterte und die fürchterliche, nur ein paar Meter von ihnen liegende entstellte und aufgeschwemmte Leiche sie abstieß, hatte sie dennoch gehofft, wieder einmal einen interessanten Fall bearbeiten zu dürfen.
Ihr Vorgesetzter schien ihre Enttäuschung zu bemerken.
»Dass wir ihn abgeben, heißt noch lange nicht, dass wir gar nicht mehr daran arbeiten. Die PJ schickt uns einen oder mehrere Ermittler. Wahrscheinlich werden sie unsere Hilfe trotzdem brauchen.«
Sylvie fand es reichlich seltsam, dass nun Leute aus Marseille ermitteln sollten, die mit den Verhältnissen vor Ort nicht vertraut waren und weder die Gegend noch ihre Einwohner kannten. Andererseits war es vielleicht besser, dass jemand an dem Fall arbeitete, der mit Pierre Pinets Vater Charles, dem berühmt-berüchtigten Trüffelkönig, bisher nichts zu tun hatte.
Bald verabschiedeten sich die Feuerwehrmänner, und die vier Leute von der Spurensicherung fuhren mit ihrer Arbeit fort.
Der Kommandant sprach vor sich hin in sein Smartphone. Er nahm seine eigenen Kommentare auf, um alle Details und Eindrücke in Erinnerung zu behalten.
»Dunkle kurze Sportkleidung, Adidas-Socken, schwarze Adidas-Joggingschuhe, eine Sportuhr am Arm …«
Sylvie erinnerte sich. Der Mann war eines Abends Ende Mai beim Joggen verschwunden. Er war in Isle-sur-la-Sorgue als Schulleiter ziemlich bekannt gewesen, und die Gendarmerie hatte zusammen mit unzähligen freiwilligen Helfern damals zwei Wochen lang nach ihm gesucht. Fast alle Gendarmen hatten ihn gekannt. Carine war als Kind in die Schule gegangen, in der er unterrichtet hatte. Dominiques Kinder besuchten dieselbe Schule, in der Pinet zehn Jahre zuvor Direktor geworden war, und er war auch bei mehreren Vereinen im Ort Mitglied gewesen. Pierre Pinet war geschieden gewesen, hatte jedoch zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer Lehrerin seiner Schule zusammengelebt.
Er galt als ein Mann, über den man nichts Negatives sagen konnte. Ganz im Gegensatz zu seinem Vater. Der Trüffelkönig, der einige Kilometer von Isle-sur-la-Sorgue im Regionalpark Luberon lebte, war umso berüchtigter. Er war steinreich aufgrund seines Landbesitzes, der Trüffelwälder, der Lavendelfelder, der Weingärten und er zählte zu den wichtigsten und einflussreichsten Bauern der Gegend. Allerdings hatte er bereits im Gefängnis gesessen, weil er zwanzig Jahre zuvor einen jungen Mann erschossen hatte, der in der Nacht in einem seiner Wälder Trüffeln ausgegraben hatte.
Im Luberon war Pinet alles andere als beliebt, häufig hatte er Probleme mit seinen Nachbarn. Er galt als streitlustig, aufbrausend und korrupt. Sylvie überlegte: Konnte der Tod des Sohnes auf die Machenschaften des Vaters zurückführen sein?
Der Capitaine
Mathieu Dubois saß in seinem Büro im Kommissariat von Marseille und kämpfte sich seufzend durch einen Stapel Papiere. Er kümmerte sich nicht gern um administrativen Kram, aber ihm blieb keine Wahl. Es war in dieser Woche etwas ruhiger, und der Capitaine widmete sich all den Aufgaben, die er nicht erledigen konnte, wenn er sich mitten in einer Ermittlung befand. Er war sich sicher, dass er bald wieder in irgendeine Vorstadt aufbrechen musste, deshalb wollte er einiges wegschaffen, bevor der nächste Dealer erschossen wurde. Und tatsächlich kam eine Viertelstunde später sein Vorgesetzter, Kommissar Léautier, durch die Tür seines Büros und setzte sich Mathieu gegenüber auf den Sessel.
»Du hast seit zwei Tagen nichts zu tun«, begann der Kommissar.
Mathieu zuckte mit den Schultern. Diese Art, das Gespräch zu eröffnen, behagte ihm nicht besonders. Wahrscheinlich wollte sein Vorgesetzter ihm wieder eine komplexe Aufgabe übertragen.
»Ich habe einen recht interessanten Fall für dich. Es geht darum, außerhalb von Marseille eine Mordermittlung durchzuführen. Eher eine Seltenheit, weil wir normalerweise hier so eingespannt sind. André und Damien können dich begleiten und falls nötig, kriegst du weitere Unterstützung. Aber ich will, dass du dich ab sofort in dem besagten Ort niederlässt und dich in den Fall gut einarbeitest.«
Christophe Léautier fiel selten mit der Tür ins Haus, meistens schwafelte er eine Weile, bevor er mit den Details herausrückte. Diesmal schien er es ziemlich eilig zu haben, weil er relativ schnell zur Sache kam. Er reichte Mathieu ein Foto. Der Capitaine zuckte zurück. Dieu, das sah ja grausam aus! Ein gefesselter Körper mit einem weißlich-bläulichen, zur Unkenntlichkeit aufgedunsenen Gesicht, der zusammengekrümmt auf einem Kalkfelsen lag. Der Mann trug dunkle Sportkleidung, Hände und Füße waren mit einer starken Schnur aneinandergebunden.
»Nicht schön, hä?«, meinte der Kommissar.
Mathieu sah ihn fragend an.
Christophe Léautier schmatzte ein paarmal. Er machte es gern spannend, wenn er einem seiner Ermittler einen neuen Fall übertrug.
»Ein braver Bürger. Ein Grundschuldirektor aus Isle-sur-la-Sorgue. Wurde aus der Karstquelle von Fontaine-de-Vaucluse geborgen. Er war seit Ende Mai verschwunden. Vermutlich hat ihn jemand beim Joggen überfallen, gefesselt und in der Quelle versenkt. Die Rechtsmedizin hat herausgefunden, dass er ertrunken ist. Er war also noch nicht tot, als er ins Wasser geworfen wurde.«
»Ist die Quelle … tief?«, wagte Mathieu zu fragen.
Kommissar Leautier sah ihn durchdringend an und senkte die Stimme, wahrscheinlich, um seiner Erklärung noch mehr Spannung zu verleihen.
»Die Quelle wird der Abgrund genannt. Sie ist ein dreihundert Meter tiefes Loch. Eine der tiefsten Karstquellen Europas.«
»Was …?«
»Ja, doch sie hat viele Vorsprünge und Hohlräume. Die Leiche lag wahrscheinlich nicht in dreihundert Metern Tiefe. Auf jeden Fall wurde der Mann gefesselt in die Quelle geworfen und lag dort mehrere Monate. Und dann … du weißt ja selbst, die Verwesungsgase im Körper müssen die Leiche an die Oberfläche getrieben haben. Vor drei Tagen wurde sie dann von Spaziergängern entdeckt, wie sie direkt unter der Wasseroberfläche geschwommen ist. Jemand muss den Mann sehr gehasst haben, um ihm so einen Tod zu bescheren.«
»Allerdings.«
Der Fall war interessant. Außerdem fand die Ermittlung im ländlichen Milieu statt, was Mathieu, der zumeist in gefährlichen Vorstädten unterwegs war, sehr schätzte.
Die Frage war nun, warum die regionale Kriminalpolizei eine Ermittlung leiten sollte, die normalerweise die örtliche Gendarmerie übernahm.
Der Kommissar schien die Gedanken seines Capitaines zu lesen.
»Die Situation ist schwierig dort in der Kleinstadt Isle-sur-la-Sorgue«, erklärte er. »Der Tote war ein angesehener Bürger, ein Schuldirektor, sehr aktiv im Vereinsleben der Kleinstadt, allgemein sehr beliebt. Doch er stammt aus einer berühmt-berüchtigten Familie im Luberon, nicht weit von der Kleinstadt entfernt. Sein Vater ist einer der reichsten Bauern der Gegend. Trüffel, Lavendel, Wein, alles, was Geld bringt. Großgrundbesitzer. Man nennt ihn den Trüffelkönig. Und dieser Mann hatte bereits Probleme mit der Justiz. Er hat vor zwanzig Jahren einen jungen Mann erschossen, weil dieser ihm Trüffeln stehlen wollte. Er hat vier Jahre im Gefängnis gesessen, die Familie des Jungen hat Rache geschworen. Und der Trüffelkönig ist in der Gegend kein beliebter Mann. Er hatte Streitigkeiten mit Nachbarn, führte Prozesse mit anderen Bauern, der Aufenthalt im Gefängnis hat ihn äußerst streitlustig gemacht.«
»Aber warum sollte deshalb jemand seinen Sohn töten?«, unterbrach Mathieu seinen Vorgesetzten. »Es wäre doch viel logischer, sich an ihm selbst zu vergreifen.«
»Da bin ich nicht deiner Meinung«, widersprach Léautier. »Das Schlimmste für einen Menschen ist, sein Kind zu verlieren. Dieser Mann war der jüngste Sohn des Trüffelkönigs und der Einzige, der nicht mit ihm arbeitete. Der ältere Sohn und die Tochter managen den landwirtschaftlichen Betrieb zusammen mit dem Vater. Doch der jüngere befand sich weit vom Anwesen entfernt – geografisch und idealistisch gesehen. Er wollte mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Und vielleicht hat jemand dem unbeliebten Kapitalisten beweisen wollen, dass Geld keine Garantie für Sicherheit ist?«
Mathieu zuckte mit den Schultern und sah seinen Vorgesetzten zweifelnd an.
»Nun ja, das ist lediglich eine Theorie«, meinte dieser. »Es kann auch etwas ganz anderes dahinterstecken.« Er schwieg einen Moment lang, ehe er fortfuhr: »Und das Wichtigste habe ich dir noch nicht gesagt. Im Prinzip ist es die Brigade von Isle-sur-la-Sorgue, die diese Ermittlung durchführen sollte, doch der Kommandant hat darum gebeten, sie abgeben zu dürfen. An uns.«
»Ach so?«, fragte Mathieu erstaunt.
Es kam sehr selten vor, dass die Gendarmerie einen Kriminalfall freiwillig an die PJ abgab. Manchmal wurde eine Ermittlung den Gendarmen weggenommen, weil sich die Lösung eines Falls hinauszögerte und die Bevölkerung unruhig wurde. Doch die Gendarmen hielten an ihrer Kompetenz als Ermittler in Kriminalfällen im ländlichen Bereich eifersüchtig fest. Deshalb war es äußerst ungewöhnlich, dass dieser Kommandant den Fall loshaben wollte und ihn nicht an eine andere Brigade, sondern an die PJ abgab.
»Der Cousin des Opfers arbeitet in der Brigade von Isle-sur-la-Sorgue und ist nach dem Kommandanten einer der wichtigsten Gendarmen dort. Ein Adjutant. Dem Kommandanten ist das alles viel zu verfänglich mit dem Trüffelkönig, dessen krimineller Vergangenheit und dessen Neffen. Daher will er jemanden von außen, der die Ermittlung leiten soll. Doch die Gendarmen sind bereit, dir zu helfen. Wichtig ist, dass du dich reinkniest. Dass du dort Präsenz zeigst. Ich bezahle dir ein Zimmer oder eine Ferienwohnung. Du brichst ab morgen nach Isle-sur-la-Sorgue auf!« Christophe Léautier erhob sich. »Du kannst André und Damien haben. Gérald bleibt hier bei uns.«
Nachdem der Kommissar Mathieus Büro verlassen hatte, wusste der Capitaine nicht, ob er sich über die unverhoffte Ermittlung auf dem Land freuen sollte oder ob es eher angebracht war, besorgt zu sein. Er sah sich im Internet Fotos der Fontaine-de-Vaucluse – der besagten Karstquelle – und des Städtchens Isle-sur-la-Sorgue an und musste zugeben, dass es sich um eine wahre Bilderbuchlandschaft handelte. Keine Luftverschmutzung, keine schmutzigen Straßen, keine dicht besiedelten Vorstädte, keine Staus. Dafür schöne Natur, zahlreiche Obstgärten, schmucke Dörfchen, viel Grün und viel Wasser.
Doch andererseits begab sich Mathieu nun in ein Gebiet, das ihm komplett fremd war. Er kannte die Leute, die Gepflogenheiten und die Dörfer nicht, und auch die Landschaft war ihm ziemlich fremd. Er war noch nie in Isle-sur-la-Sorgue oder Fontaine-de-Vaucluse gewesen und erst einmal im Regionalpark Luberon in der Stadt Apt.
Isle-sur-la-Sorgue befand sich gerade mal 90 Kilometer von Marseille entfernt im Hinterland der Mittelmeerküste, vom Kommissariat in einer guten Stunde Fahrt zu erreichen. Mathieu hätte jeden Tag hin- und herpendeln können. Doch der Kommissar hatte seinen Wunsch nur allzu deutlich gemacht, dass Mathieu vor Ort bleiben sollte.
Mathieu dachte an Martha und seufzte tief. Er lebte nun seit dreieinhalb Jahren mit seiner Freundin zusammen; vorher hatten sie in Paris gewohnt, sich jedoch beide zwei Jahre zuvor nach Marseille versetzen lassen. Martha Rainier war Lehrerin, hatte sehr geregelte Arbeitszeiten und konnte sich ihre Vorbereitung für den Unterricht so einteilen, wie sie es wollte. Mathieus Arbeit war eine ständige Konfliktquelle in ihrer Paarbeziehung. Martha warf Mathieu vor, zu viel zu arbeiten. Dabei war er schon Polizist gewesen, als sie einander kennengelernt hatten; außerdem hatte er in Paris nicht weniger gearbeitet als in Marseille.
Doch nun war diese Situation seit einem halben Jahr zu einem Problem geworden. Mathieu fand, dass Martha sich sehr verändert hatte. Aus dem fröhlichen jungen Mädchen war eine berechnende, etwas verbitterte Frau geworden. Sie verhielt sich ihm gegenüber besitzergreifend und war eifersüchtig. Er fragte sich oft, ob nicht er selbst an dieser Situation schuld war. Vielleicht schenkte er Martha zu wenig Beachtung und Zuwendung, sodass sie sich seiner Liebe nicht mehr sicher war? Sie hatten es bereits erwogen, eine Familie zu gründen. Und Martha behauptete, dass sie darauf hinarbeiten mussten, die idealen Bedingungen zu schaffen, um Kinder großzuziehen. Mathieus Arbeit war familienfeindlich, das wiederholte Martha ständig. Sie schlug ihm immer wieder vor, den Job zu wechseln. Doch das war für Mathieu keine Option. Er liebte seine Arbeit bei der Polizei, er hatte die Aufnahmeprüfung zum Lieutenant geschafft, hatte seit einigen Monaten den Dienstgrad Capitaine und wollte Karriere machen. Sein Ziel war, in einigen Jahren die interne Prüfung zum Kommissar zu absolvieren. Er wusste, dass er ein guter Ermittler war und dass er auch eine gewisse Begabung dafür besaß, seine Mitarbeiter anzuleiten und zu koordinieren. Im Moment verzichtete er lieber auf eine Familie als auf seine Arbeit. Und so, wie sich die Situation in den letzten Monaten entwickelt hatte, wollte Mathieu mit Martha ohnehin keine Familie mehr gründen. Viel eher fasste er eine Trennung ins Auge.
Auch Martha sprach häufig davon, ihn zu verlassen.
»Dann gehe ich!«, war bei ihr zu einem geflügelten Wort geworden, und Mathieu hatte in letzter Zeit zumeist geantwortet: »Ja, dann geh eben! Dann meckert wenigstens niemand mehr, wenn sich mein Dienstplan wieder einmal ändert oder wenn ich eine intensive Ermittlung zugeteilt bekomme.«
Mathieu arbeitete wie seine Kollegen, die anderen Lieutenants und Capitaines, weitaus mehr als die in Frankreich für Angestellte üblichen 35 Wochenstunden. Seine Arbeitszeiten waren unregelmäßig, und wenn er ermittelte, zählte er die Stunden nicht. Das war es, was Martha so unendlich grämte. Dass ihm die Arbeit wichtiger war als ihre Beziehung. Mathieu ertappte sich dabei, sich davor zu fürchten, Martha erklären zu müssen, dass er sich einige Tage – oder Wochen? – in Isle-sur-la-Sorgue niederlassen müsste und nur hin und wieder zu Hause vorbeischauen könnte.
Doch dann musste er zugeben, dass die Perspektive, eine Woche oder länger ohne seine Lebensgefährtin verbringen zu können, ihn Erleichterung spüren ließ. Er schüttelte unwillig den Kopf. Was war nur aus ihrer damaligen Verliebtheit geworden?
Mathieu zwang sich, seine Gedanken wieder auf die Arbeit zu lenken, und stand auf, um seine Kollegen Damien Falquier und André Fleuret über die neue Ermittlung zu informieren und sich weitere Informationen zu dem Fall von seinem Vorgesetzten zu holen.
Der Fall Christian Lantier
Claude Lantier ließ die Zeitung sinken und sah seine Frau an. »Er ist nicht freiwillig verschwunden, wie die meisten es vermuteten, er wurde ermordet!«
Sie nickte langsam. »Der arme Mann. Kann ja gar nichts dafür. Da wollte sich gewiss jemand an seinem Vater rächen. Pierre Pinet war immer schon ganz anders als der Rest der Familie. Nicht geldgierig wie sie alle, viel sozialer, für andere da. Warum ausgerechnet er?«
Claude brummte unwillig. Es war ihm im Prinzip vollkommen egal, dass es das einzige Mitglied der Familie getroffen hatte, das nicht so war wie der Rest. Doch es verschaffte ihm Genugtuung, dass derjenige, der ihm und seiner Familie so schlimmes Leid zugefügt hatte, nun genau dieselben Schmerzen zu spüren bekam wie er selbst. Auch sein Sohn war ermordet worden. Der einzige Unterschied war, dass Claude Lantier den Mörder seines Sohnes kannte, während Charles Pinet keine Ahnung hatte, von wem Pierre umgebracht worden war.
Claude war sich bewusst, dass er und seine beiden anderen Söhne verdächtig waren. Gewiss würde der Besuch der Gendarmen nicht lange auf sich warten lassen. Eigentlich wunderte er sich, dass sie ihn noch nicht befragt hatten. Die Motivation, den Mörder zu finden, musste doch in der Brigade von Isle-sur-la-Sorgue sicher groß sein. Der Adjutant Luis Gache war der Cousin des Opfers, gewiss raste er schon durch den ganzen Luberon, um den Fall aufzuklären. Umso seltsamer war es, dass er und seine Familie bisher von seinem Besuch verschont geblieben waren.
Claudes Leben war ziemlich genau vor zwanzig Jahren aus den Fugen geraten, als Charles Pinet Claudes jüngsten Sohn Christian erschossen hatte, der in einem seiner Eichenwälder in der Nacht nach Trüffeln gegraben hatte. Was Christian gemacht hatte, war Diebstahl gewesen. Die Bauern setzten die Trüffeln an und warteten mehr als zehn Jahre, bis diese unterirdischen Pilze endlich groß genug waren, um geerntet zu werden. Trüffeln wurden zu horrenden Preisen gehandelt. Und Charles Pinet, der aufgebrachte Eigentümer, hatte geschossen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Er hatte Christian tödlich getroffen, dessen Komplize hatte es geschafft zu flüchten.
Christian war kein einfacher Junge gewesen. Er war ein fauler und aufmüpfiger Schüler, hatte sich in schlechter Gesellschaft befunden, war auf Abwege geraten und hatte begonnen, krumme Dinge zu drehen. Nach seiner Pflichtschulzeit hatte er kaum gearbeitet. Obwohl er in einer Zeitarbeitsfirma eingeschrieben war, die ihm lediglich einige schlecht bezahlte Jobs vermittelte, hatte er immer Geld gehabt. Mit verschiedenen Kollegen hatte er gedealt, gestohlen und Einbrüche verübt. Seine Eltern hatten gewusst, was er so getrieben hatte, ohne es ihm konkret nachweisen zu können. Heute machte Claude sich selbst schlimme Vorwürfe. Er hätte der Höllenfahrt seines Sohnes ein Ende bereiten und hart durchgreifen sollen! Dann wäre Christian noch am Leben. Er hätte ihn zwingen sollen, eine Ausbildung zu machen, anstatt bei dieser Zeitarbeitsfirma herumzuhängen.
Doch Christian war damals schon neunzehn gewesen, und Claude hatte keinen Einfluss mehr auf ihn gehabt. Christian wäre ausgezogen, wenn er ihn unter Druck gesetzt hätte – mit dem Ergebnis, dass Claude das letzte bisschen Kontrolle über seinen Jüngsten auch noch verloren hätte.
Und dann war die fatale Nacht gekommen. Gegen zwei Uhr morgens hatte es bei Claude und Anne-Marie Lantier geläutet. Schlaftrunken war Claude aus dem Bett getaumelt und hatte Christian verflucht, der gewiss wieder einmal seinen Schlüssel vergessen oder verloren hatte. Claude konnte die Szene jederzeit mit allen ihren Details vor seinem inneren Auge abrufen und wie einen Film abspielen. Er erlebte sie regelmäßig von Neuem in seiner Erinnerung.
Vor der Tür standen zwei Gendarmen, die ihn schweigend ansahen.
»Monsieur Lantier, dürfen wir kurz hereinkommen?«, fragte der ältere der beiden schließlich.
Claude nickte nur wie erstarrt. Hinter ihm war seine Frau aufgetaucht, sie hatte ein Wollkleid über das Nachthemd gezogen. »Ist es wegen Christian?«, fragte sie die Beamten mit schwacher Stimme. »Was hat er diesmal angestellt?«
»Bitte lassen Sie uns in die Küche gehen«, sagte der Gendarm bestimmt, »wir werden es Ihnen erklären.«
Claude sah das Entsetzen in den Augen seiner Frau, und auch er spürte Beklemmung. Die beiden Gendarmen warteten, bis sich die Eheleute hingesetzt hatten, dann begann der eine mit belegter Stimme zu sprechen.
»Es tut uns leid, aber … Ihr Sohn Christian ist erschossen worden. Bei einem Diebstahl.«
Anne-Marie schrie auf. Claude war wie erstarrt. Das konnte nicht wahr sein! Er befand sich mitten in einem Albtraum. Und zugleich sagte er sich, dass er so etwas schon seit Langem befürchtet hatte. Christian war kriminell und hatte nun dafür bezahlt.
»Er hat vor zwei Stunden in einem Trüffelwald herumgegraben. Der Eigentümer ist gekommen und hat geschossen. Es war nicht das erste Mal, dass bei ihm Trüffeln gestohlen wurden. Die Diebe haben jedes Mal seinen Wald verwüstet, einfach aufs Geratewohl im Dunkeln gegraben. Der Mann ist wohl durchgedreht. Wir haben ihn umgehend verhaftet.«
Claude konnte sich noch immer nicht bewegen. Er sah sich selbst am Küchentisch sitzen, neben seiner Frau und den beiden Gendarmen. Er war wie gelähmt. Wie aus weiter Ferne hörte er einen lauten, lang gezogenen Schluchzer. Anne-Marie.
»Ich rufe einen Arzt«, meinte der Gendarm entschlossen, und Claude fragte sich, wo er mitten in der Nacht auf dem Land einen Arzt herbekommen wollte.
»Wer …? Wo …?«, gelang es Claude, schließlich zu stammeln.
Der Gendarm schwieg einen Moment lang. Dann sagte er: »Charles Pinet im Luberon.«
Es war noch schlimmer als gedacht. Der steinreiche Trüffelkönig, der Einbrecher ganz einfach über den Haufen schoss, wie ein Krimineller? Und Claude begann zu brüllen. Es tat gut, aus dieser Erstarrung zu erwachen. »Dieser elende Kapitalist! Dieser steinreiche Schweinehund! Elendiger Mörder! Wegen ein paar Trüffeln!« Er wusste, dass er sich nicht mehr unter Kontrolle hatte, heulte und schrie. Die beiden Gendarmen versuchten vergeblich, ihn zu beruhigen, bis irgendwann der Notarzt kam und ihm eine Beruhigungsspritze verabreichte.
Damit hatte die Zeit des Nebels begonnen – ein grauer, grausamer Dunst, der sich auf sein Gemüt gelegt hatte. Erst bei Charles Pinets Prozess war Claude wiedererwacht. Er hatte sich einen Rechtsanwalt genommen. Dieser hatte für ihn einen hohen Schadenersatz ausgehandelt und in Zusammenarbeit mit dem Staatsanwalt für Pinet sechs Jahre Gefängnis erreicht. Doch Claude wollte kein Geld. Er wollte keinen Schadenersatz. Das Leben seines Sohnes konnte man nicht in Euro bemessen. Das Einzige, was er wollte, war, Pinet lebenslänglich im Gefängnis zu wissen. Sechs Jahre waren eine lächerlich geringe Strafe gewesen! Zumal sie wegen guter Führung auf knappe vier reduziert worden waren.
Monsieur Pinet würde seine Schuld niemals bezahlen. Hatte Claude gedacht. Doch irgendjemand hatte Christian gerächt. Claude lief ein Schauer über den Rücken, wenn er an seine beiden anderen Söhne dachte. Sie hatten mit den Eltern gelitten, ihr Hass auf den alten Pinet war unermesslich. Und wenn nun einer von ihnen beiden in die Sache verwickelt war?
Martha
Wie vorhergesehen, tobte Martha, als sie von Mathieus Ermittlung in Isle-sur-la-Sorgue erfuhr.
»Was? Du willst die ganze Woche dortbleiben?« Ihre Augen waren zu winzigen Schlitzen geworden. »Und wie lange soll diese Ermittlung dauern?«
Mathieu zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Bis wir den Mörder dieses Lehrers gefunden haben.«
»Wie kannst du mich nur so bald nach Schulbeginn allein lassen?«
Mathieu seufzte. Martha war ein wenig weltfremd. Er war nur einer von Tausenden jungen Leuten, die viel arbeiteten. Außerdem hatten Martha und er noch keine Kinder, daher fand er ihr Gejammer nicht wirklich angebracht.
»Du bist erwachsen«, meinte er trocken, »und kannst selbst auf dich aufpassen. Ich habe keine Wahl. Mein Boss schickt mich dorthin.«
»Ach so«, fauchte sie, »so siehst du also unsere Beziehung. Wir sehen einander kaum, und du arbeitest nur. Wahrscheinlich betrügst du mich auch bei der Arbeit!«
»Du bist vollkommen durchgeknallt. Wir sind fast nur Männer. Und ich habe wirklich keine Zeit, dich zu betrügen. Und noch weniger Lust dazu.«
Sie sah ihn mit Tränen in den Augen an.
Mathieu versuchte, seine Stimme sanfter klingen zu lassen.
»Was ist eigentlich los, Martha? Du weißt doch, dass ich dir treu bin. Aber seit einem halben Jahr gibst du immer solche Bemerkungen von dir, ich würde dich betrügen.«
»Du bist … so oft nicht da … du arbeitest … so viel … wir haben so wenig Zeit miteinander«, schluchzte sie.
Mathieu seufzte wieder. »Chérie, das Leben ist so. Die meisten jungen Leute arbeiten viel. Auch Frauen. Du hast einen Job, bei dem du dir die Arbeit größtenteils selbst einteilen kannst, du hast auch lange Ferien. Aber dir muss bewusst sein, dass nur wenige erwerbstätige Leute so viel Freizeit genießen wie du.«
Er verkniff sich hinzuzufügen, dass Martha eine Arbeit gewählt hatte, bei der sie nicht besonders viel verdiente und nie viel verdienen würde. Hätte er das getan, dann würde sie ihm wieder einmal vorrechnen, dass er weit unter dem Mindestlohn arbeitete bei seinem mittelmäßigen Gehalt und den unzähligen Stunden, die er für seine Arbeit aufbrachte.
»Ich möchte, dass du dir auch so eine Arbeit suchst. Ich will Kinder mit dir. Aber nicht, wenn du ständig unterwegs bist und dich in Gefahr begibst.«
»Chérie, du hast immer schon gewusst, dass ich Polizist bin und bleiben werde. Ich habe die Aufnahmeprüfung zum Capitaine geschafft, die nicht einfach ist. Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Ich werde meinen Job nicht wechseln. In ein paar Jahren werde ich versuchen, zum Kommissar aufzusteigen; mein Gehalt wird sich fast verdoppeln, aber dann werde ich auch nicht weniger arbeiten. Aber du weißt, dass wir die Zeit, die uns bleibt, sinnvoll miteinander verbringen. Und vor allem weißt du, dass ich dir treu bleibe.«
»Und die Familie? Wie sollen wir da Kinder haben, wenn du nie da bist? Dann wäre ich ja sozusagen Alleinerzieherin.«
»Martha, Tausende haben in dieser Situation Kinder und schaffen es trotzdem.«
Sie sah ihn langsam an. »Ehrlich gesagt, Mathieu, ich will keine solche Situation. Ich brauche nicht viel Geld zum Leben. Ich will keine Reisen um die Welt, ich brauche keine Markenkleidung und kein großes Haus. Aber ich wünsche mir Lebensqualität. Und dazu gehört auch, dass der Vater meiner Kinder anwesend ist.«
In der Tat war Martha sehr genügsam. Schon als Studentin war sie mit wenig Geld erstaunlich gut zurechtgekommen. Sie hatte keine teuren Vorlieben. Auch für Mathieu war nicht sein Verdienst das Wichtigste. Doch er liebte seine Arbeit, trotz der schlimmen Erfahrungen, die er häufig machte, und der Gefahr, der er zuweilen ausgesetzt war. Seine Arbeit als Ermittler war sein Leben, seine Leidenschaft, die ihm niemand nehmen konnte. Wahrscheinlich passten ihre jeweiligen Lebensmuster nicht zusammen – und nun, wo es darum ging, den nächsten Schritt zu machen und eine Familie zu gründen, mussten sie eine Entscheidung treffen?
Martha sprach das aus, was Mathieu dachte: »Wahrscheinlich müssen wir überlegen, ob wir unter diesen Umständen noch zusammenbleiben wollen. Wir sind jetzt beide dreißig, in dem Alter, in dem man jemanden finden soll, der im Hinblick auf Arbeit und Beziehung dieselbe Einstellung hat.«
Mathieu nickte. »Du hast recht. Diese Zeit, in der wir getrennt sind, sollten wir dazu nutzen, das zu überdenken.«
Wenn Martha über seine Äußerung überrascht war, dann ließ sie sich nichts anmerken. Mathieu war nicht klar, ob sie ihn mit ihren Drohungen, sich von ihm zu trennen, nur unter Druck setzen wollte oder ob sie wirklich daran dachte ihn zu verlassen. Ihm selbst war auf jeden Fall klar, dass es mit ihrer Beziehung nicht so weitergehen konnte. Entweder Martha akzeptierte seine Arbeit und die damit verbundenen Schwierigkeiten, oder er lebte lieber allein. Und trotzdem überfiel ihn eine gewisse Trauer, als er seine Sachen packte, um nach Isle-sur-la-Sorgue aufzubrechen. Martha war nicht die Richtige für ihn und er spürte Sorge. Gab es bei seiner Arbeit überhaupt eine richtige Frau? Oder war die Arbeit bei der Polizei so familienfeindlich, dass alle Beziehungen zum Scheitern verurteilt waren?
Die Ermittler aus Marseille
»In einer Stunde kommen die drei Leute aus Marseille«, verkündete der Kommandant. »Wir machen ein gemeinsames Briefing und stehen ihnen für Fragen zur Verfügung. Wenn sie uns brauchen, dann helfen wir ihnen. Ist das klar?«
»Natürlich«, wagte Sylvie zu erwidern. »Aber ich dachte, wir sollten den Fall komplett abgeben? Ich verstehe unsere Rolle nicht ganz.«
Jean Calcin bedachte sie mit diesem für ihn gewohnt väterlich-strengen Blick, den er immer dann aufsetzte, wenn Sylvie mit dem Haarspalten begann.
»Nun«, meinte der Kommandant, »die PJ braucht alle Informationen, die wir ihnen geben können. Und sie benötigen gewiss auch Ratschläge. Wir haben natürlich die Kompetenzen, um den Fall zu lösen, aber wir sind befangen. Luis’ Cousin wurde ermordet, Luis’ Onkel hatte schon mit der Justiz Probleme und bereitet immer wieder Schwierigkeiten in der Gegend. Deshalb ist es besser, wenn jemand anderes die Verantwortung für all das übernimmt, was in nächster Zeit aufgedeckt werden wird. Es ist der Capitaine …« er sah auf seine Papiere, » … Dubois, der in der Kriminalabteilung von Kommissar Léautier bei der PJ Marseille arbeitet. Wir alle wollen den Fall so schnell wie möglichst lösen, und ich brauche Hilfe von außen. Was sagst du dazu, Luis?« Er wandte sich an seinen Adjutanten, der keine Gefühlsregung zeigte.
Zu Sylvies Erstaunen nickte Luis jedoch nach ein paar Sekunden und meinte: »Du hast recht, Jean. Ich will in diesem Fall nicht ermitteln. Ich möchte mich gern aus den Ermittlungen raushalten. Ihr müsst kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich weiß, wie mein Onkel ist, und ich will beruflich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Soll der Capitaine aus Marseille sich mit ihm die Hände schmutzig machen. Übrigens, ihr wisst es vielleicht nicht, er ist nicht mein richtiger Onkel. Meine Mutter ist nur seine Halbschwester. Und die beiden haben keinen Kontakt. Sie hat ihr Erbteil damals vor über dreißig Jahren an ihn verkauft und sich aus seinen Machenschaften komplett herausgehalten. Was mich betrifft, ihr wisst, dass ich erst vor zwei Jahren hierher versetzt wurde. Also habe ich mit diesem Teil der Familie nicht viel zu tun. Und ich wünsche es auch nicht, mich um sie zu kümmern oder mit ihnen in Verbindung gebracht zu werden.«
Sylvie bemerkte, dass Luis sich nervös über die Nase strich. Das war bei ihm ein Tick, immer dann, wenn er sich nicht wohlfühlte. Sie kannte den Adjutanten nun schon seit zwei Jahren, und es wunderte sie nicht, dass er mit dem zweifelhaften Onkel, der schon wegen Totschlags im Gefängnis gesessen hatte und der Gendarmerie auch aufgrund anderer Dinge negativ aufgefallen war, nicht viel zu tun haben wollte.
Jean räusperte sich. »Ich kann das verstehen. Schließlich ist Charles Pinet ja kein einfacher Mann. Ich werde versuchen, dich aus dieser Ermittlung rauszuhalten. Ich bitte dich nur, etwaige Fragen über deine Familie und andere Leute aus der Gegend genau zu beantworten, wenn das nötig ist. Die Damen und Simon sollen sich um die drei Kollegen von der PJ kümmern, falls sie Hilfe brauchen. Ist das in Ordnung für euch?«
Die fünf anwesenden Gendarmen nickten. Dominique schien etwas enttäuscht, nicht bei der Mordermittlung dabei zu sein, denn er hatte den Direktor der Schule seiner Kinder sehr geschätzt. Außerdem war er dabei gewesen, als man die Leiche des Direktors geborgen hatte.
»Du kannst sicher auch manchmal helfen«, flüsterte Sylvie ihrem Kollegen beschwichtigend zu.
»Und noch etwas«, meinte Jean. »Wir drängen uns nicht auf. Wir bieten Capitaine Dubois unsere Mitarbeit an und geben ihm alle für ihn nötigen Informationen. Falls er jedoch lieber allein mit seinen beiden Kollegen weitermachen will, dann darf er das. Und unsere sonstige Arbeit hat natürlich Vorrang. Wenn wir Zeit haben, helfen wir der PJ, ansonsten muss der Capitaine warten. Gibt es noch Fragen?« Nachdem sich niemand meldete, verließen alle den Raum.
»Na, da bin ich ja mal neugierig«, raunte Sylvie Carine zu, als die beiden in ihr Büro gingen.
Carine zuckte mit den Schultern. »Ich glaube, am besten ist es, ihnen alle relevanten Informationen zu geben und sie dann ermitteln zu lassen. Aber ich denke wie Luis. Ich will mit dem Ganzen gar so nicht viel zu tun haben. Luis und ich sind von hier, wir kennen alle. Der Mord an Pierre Pinet reißt bestimmt uralte Wunden auf.«
»Ja«, meinte Sylvie, »und andererseits ist es gut für uns, euch dabei zu haben. Ihr erinnert euch vielleicht an das eine oder das andere.«
»Ich war damals, als das mit Christian Lantier geschehen ist, ein Kind, und Luis arbeitete in Martinique. Aber natürlich kennen die Leute uns und unsere Familien. Was manchmal von Vorteil ist, aber nicht immer.«
Carine verzog das Gesicht, und Sylvie musste an das Schicksal ihrer Freundin denken. Carine hatte keine Familie mehr. Ihr Vater hatte seine Frau und die Kinder verlassen, als Carine noch sehr klein gewesen war. Ihr älterer Bruder hatte sich umgebracht, als sie vierzehn gewesen war. Ihre Mutter war daraufhin zur Alkoholikerin geworden und wenige Jahre später an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben. Carine hatte nur mehr eine Tante, der sie sehr nahestand, und deren elfjährige Tochter Amélie, die für Carine wie eine kleine Schwester war.
Carine und Sylvie waren eng befreundet. Sie arbeiteten miteinander, wohnten auch nebeneinander, gezwungenermaßen, weil alle Gendarmen in Dienstwohnungen, sogenannten Kasernen, untergebracht waren. Deshalb kannte jeder Gendarm auch die Familien seiner Kollegen. Sylvie lebte gern in der Dienstwohnung, sie erkannte vor allem den bedeutenden finanziellen Vorteil. Eine so große und gepflegte Wohnung hätte sie sich in der Gegend niemals leisten können!
Carine und Sylvie begannen, sich um die verschiedenen Stapel der Anzeigen zu kümmern, die sich auf ihren Schreibtischen türmten. Sylvie ordnete die zu bearbeitenden nach Dringlichkeit, Carine gab die abgeschlossenen in Archivschachteln.
Es war ruhig an diesem Morgen. Am Vortag und in der Nacht war so gut wie nichts geschehen. Keine Unfälle, keine Drogengeschichten, keine Einbrüche. Das war selten.
Zwanzig Minuten später betrat Kommandant Calcin mit drei jungen Männern das geräumige Büro, in dem ein Teil seiner Gendarmen saß.
»Ich stelle euch Capitaine Mathieu Dubois und die Agenten André Fleuret und Damien Falquier vor.«
Er nannte den Polizisten auch die Namen aller seiner Mitarbeiter.
Die drei jungen Männer schüttelten den Gendarmen die Hand. Sylvie war überrascht. Capitaine Dubois schien sehr jung, er war ungefähr in ihrem Alter. Die Männer waren alle drei gut aussehend, schlank, muskulös und sportlich. Sie erinnerten an die Titelhelden aus manchen Fernsehkrimis. Sie waren in enge Jeans, dunkle T-Shirts, Jeansjacken und Turnschuhe gekleidet. Bei der PJ hatten sie das Privileg, keine Uniformen tragen zu müssen. Die beiden Agenten hatten Carine erspäht und konnten den Blick nicht mehr von ihr wenden. Ihr Vorgesetzter, der Capitaine, benahm sich sehr professionell, bedankte sich beim gesamten Team für den Empfang und meinte, er hoffe, den Anforderungen der Ermittlung gerecht zu werden.
Der Kommandant befahl ihnen allen, sich in den Besprechungsraum zu begeben. Jean, die drei Polizisten aus Marseille, Luis, Sylvie, Carine, Dominique und Simon setzten sich um den großen Tisch, dann brachte Marc Follet, der jüngste Gendarm der Brigade, der noch im Training war, ihnen Kaffee und Croissants.
Jean Calcin wandte sich an den Capitaine. »Haben Sie die nötigen Unterlagen von Ihrem Vorgesetzten bekommen und sich in den Fall eingelesen?«
Dieser nickte. »Ja, danke, ich bin schon recht gut informiert.«
»Und welchen Eindruck macht der Fall auf Sie?«, fragte der Kommandant.
Der Capitaine grinste schief. »Grausam. Wie der Mann gefesselt in dieser tiefen Quelle versenkt wurde. Sehr kreativ, muss ich sagen. Der Mord hat für mich etwas Symbolisches. Es geht um einen Abgrund. Und um Wasser. Und ich frage mich, was der Mörder diesem Mann vorzuwerfen hatte. Ich habe auch gehört, dass es sich um eine Rache am Vater handeln könnte. Aber sich aus diesem Grund auf diese Weise an seinem Sohn, einem beliebten Lehrer, zu vergreifen, das scheint mir nun doch etwas abwegig. Ich persönlich frage mich, ob dieser Vorzeigebürger nicht irgendetwas Schlimmes zu verbergen hatte.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: