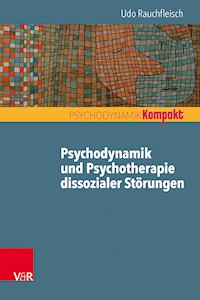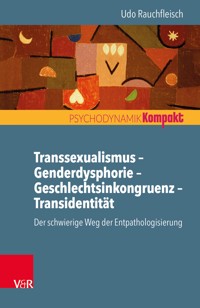Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Udo Rauchfleisch plädiert seit vielen Jahren für eine Entpathologisierung von »Transsexualität«, die für ihn von jeher keine psychische Krankheit war. Aus diesem Grund verwendet er in dieser 6., umfassend überarbeiteten Auflage die Begriffe »Transidentität« und »Transgender«. Rauchfleisch erklärt, wie Transitionsprozesse fachlich begleitet und zusammen mit den trans* Personen im privaten wie im beruflichen Bereich gestaltet werden können. Er widmet sich außerdem der Frage, worauf es in der therapeutischen Begleitung von Transgendern ankommt, sowie aktuellen Themen wie Nichtbinarität, Transition von Kindern und Jugendlichen, Detransition. Zwei Beiträge transidenter Menschen geben Einblick aus ihrer Perspektive. Das Buch richtet sich an Fachpersonen wie Psycholog:innen, Psychotherapeut:innen, Sozialarbeiter:innen, Ärzt:innen und Psychiater:innen, aber auch an Transgender selbst und ihre Angehörigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Udo Rauchfleisch
Transidentität – Transgender
Transitionsprozesse begleiten und gestalten
6., komplett überarbeitete Auflage
VANDENHOECK & RUPRECHT
Für Bruno Schmucki
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2024, 2016, 2006, Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill BV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill BV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Otto Freundlich, Composition (ca. 1930)/ Private Collection/Photo © Christie’s Images/Bridgeman Images/
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Griesheim
BALTO print, Vilnius
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99302-7
Inhalt
Vorworte
Vorwort zur 1. Auflage
Vorwort zur 6. Auflage
Von der Krankheit Transsexualität zur nichtpathologischen Transidentität/Transgender
Begriffsklärung
Historischer Überblick
Exkurs: Das »Problem« der Nichtbinarität
Der Ablauf der Diagnostik und Begleitung von Transidenten/Transgendern
Diagnostik
Der »Alltagstest«
Die Hormonbehandlung
Die chirurgischen Maßnahmen zur Angleichung an das empfundene Geschlecht
Personenstandsänderung
Nachbetreuung
Die Begutachtung und Begleitung von Transidenten/Transgendern
Eigene Erfahrungen aus Begutachtungen und Behandlungen von Transidenten/Transgendern
Meine ersten Begegnungen mit trans* Personen
Diagnostische Überlegungen
Die den Transitionsprozess begleitende Psychotherapie
Zur speziellen Situation von trans* Flüchtlingen
Planung und Begleitung im Coming-out-Prozess
Klärung der familiären Beziehungen
Zur speziellen Situation von trans* Kindern und Jugendlichen
Worauf kommt es in der therapeutischen Begleitung von Transgendern an?
Mit welchen Fragen und Problemen sind Transgender konfrontiert?
Welche Hilfe können die Professionellen Transgendern bieten?
Angebote der Psychiatrie und der Klinischen Psychologie
Angebote der somatischen Fächer
Juristische Beratung
Weitere Beratungs- und Behandlungsangebote
Evaluation der therapeutischen Angebote
Detransition
Was können Transgender selbst tun?
Rückblicke von Annette Güldenring
Vorab
1970er Jahre
Kontroversen um Geschlecht
Behandlungsnihilismus
Free Gender von Jacqueline Born
Gendertheoretische Aspekte der Transidentität
Auf den Punkt gebracht
Literatur
Vorworte
Vorwort zur 1. Auflage
Das Thema Transsexualität beschäftigt mich seit 35 Jahren. 1971 haben wir in der Psychiatrischen Universitätspoliklinik Basel, damals unter der Leitung von Prof. Dr. Raymond Battegay, zunächst zögernd begonnen, transsexuelle Frauen und Männer psychiatrisch-psychologisch zu begutachten zwecks Abklärung der Indikation zu hormonellen und chirurgischen Maßnahmen auf dem von diesen Menschen angestrebten Weg einer Angleichung an das Gegengeschlecht. Seither habe ich etwa hundert Transsexuelle anlässlich solcher Begutachtungen, später dann auch in der therapeutischen Vorbereitung auf die Operation sowie bei Kriseninterventionen, Abklärungen und nachfolgenden Psychotherapien gesehen. Dabei habe ich festgestellt, dass es »die transsexuelle Persönlichkeit« nicht gibt. Mehr und mehr habe ich gerade in den letzten zehn Jahren die Erfahrung gemacht, dass sich hinter dem Etikett »Transsexualität« eine große Zahl völlig unterschiedlicher Persönlichkeiten mit weitgehend voneinander abweichenden Entwicklungen verbirgt. Die Gemeinsamkeit stellt lediglich die durch nichts zu verändernde Überzeugung dar, dem Gegengeschlecht anzugehören und eine hormonelle und operative Angleichung an das Gegengeschlecht anzustreben.
Während in den 1970er und 1980er Jahren die Diagnose »Transsexualität« fast immer eine andere Diagnose – vor allem die der Borderline-Persönlichkeitsstörung – nach sich gezogen hat, ist mir dieses Vorgehen im Verlauf der Jahre zunehmend fragwürdiger geworden. Immer wieder bin ich nämlich mit transsexuellen Frauen und Männern zusammengetroffen, die außer der Überzeugung, dem Gegengeschlecht anzugehören (dies allein bedeutete früher schon, ihnen eine klinische Krankheitsdiagnose zu geben), keinerlei psychopathologische Zeichen erkennen ließen und – im Gegenteil – eine große psychische Stabilität aufwiesen. Allfällig auftretende Depressionen, Angstentwicklungen und andere Störungen erwiesen sich häufig als Folgen der schwierigen Lebensumstände, in denen sich transsexuelle Menschen auch heute noch oft befinden. Etliche von ihnen verfügten aber über eine große Belastungsfähigkeit, die es ihnen ermöglichte, ihre zum Teil schwierigen Lebensumstände (z. B. Verheiratete mit Kindern oder schwierige Verhältnisse im beruflichen Bereich) »mit Bravour« zu meistern, eine Leistung, der ich meine ungeteilte Hochachtung zolle.
Selbstverständlich traf ich daneben auch mit transsexuellen Menschen zusammen, die – mitunter sogar schwere – psychische Störungen aufwiesen, die sich nicht als unmittelbare Folge ihrer Transsexualität, etwa als Folge von sozialen Belastungen, interpretieren ließen. Gerade diese Frauen und Männer bestärkten mich aber in der Auffassung, dass der Transsexualismus das ganze Spektrum von psychischer Gesundheit bis zur (schweren) Krankheit umfasst, ohne dass eine kausale Beziehung zwischen der Transsexualität und der psychischen Gesundheit respektive Krankheit besteht.
Ich werde in diesem Buch den Weg meiner eigenen Entwicklung nachzeichnen, weil ich denke, dass viele Leserinnen und Leser, aber auch transsexuelle Menschen selbst, sich irgendwo auf diesem Weg befinden. Dabei erscheint es mir wichtig, dass wir uns vom Pathologiekonzept des Transsexualismus distanzieren und ihn als Normvariante ansehen. Nur so kann es gelingen, echten Zugang zu transsexuellen Frauen und Männern zu finden. Auch sie selbst müssen zur Stärkung ihres Selbstverständnisses und ihres Selbstwertgefühls diesen Schritt tun, wobei ihnen die Änderung der »Experten«-Ansicht eine große Hilfe sein könnte, indem sie von den Fachleuten nicht mehr als »selbstverständlich krank«, sondern als Menschen wie alle anderen auch betrachtet würden, deren psychische Gesundheit oder Krankheit in keinen ursächlichen Zusammenhang mit ihrer Transsexualität gebracht wird. Schließlich eröffnen sich durch das Abrücken vom Pathologiekonzept des Transsexualismus interessante Perspektiven für den Genderdiskurs in der Gesamtgesellschaft.
Dies sind die Gründe, die mich bewogen haben, dieses Buch zu schreiben. Es ist meine Hoffnung, dass meine Ausführungen Fachleute und an dieser Thematik Interessierte und Angehörige ebenso wie Transsexuelle selbst dazu anregen, sich kritisch und unvoreingenommen mit dem Phänomen »Transsexualität« auseinanderzusetzen und die Herausforderung anzunehmen, die für unsere Gesellschaft darin liegt.
Bei einem solchen Projekt hätte ich ein ungutes Gefühl gehabt, wenn nicht auch transsexuelle Menschen selbst zu Wort gekommen wären. Ein Problem dabei ist allerdings, dass die Leserinnen und Leser bei autobiografischen Berichten leicht den Eindruck bekommen könnten, diese seien »typisch« für transsexuelle Menschen. Aufgrund meiner Erfahrung bin ich hingegen der Ansicht, dass es den typischen transsexuellen Menschen nicht gibt. Abgesehen von der Tatsache, dass sich Transsexuelle durch das Gefühl auszeichnen, dem Gegengeschlecht anzugehören, weisen sie ein unendlich breites Spektrum an Persönlichkeitsformen und Lebensschicksalen auf. Obschon biografische Berichte das, was ich in diesem Buch schildere, vielleicht veranschaulichen würden, könnten sie ungewollt dazu führen, dass sie fälschlicherweise als charakteristisch für transsexuelle Frauen und Männer schlechthin betrachtet würden. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, zwar nicht ganz auf einen autobiografischen Beitrag zu verzichten, habe dazu aber bewusst kein »typisches« Beispiel gewählt, sondern eine eher ungewöhnliche Form, mit dem Phänomen Transsexualismus umzugehen, wie Jacqueline Born sie im Beitrag »Free Gender« schildern wird.
Ohne die intensiven Erfahrungen, die ich im Rahmen von Abklärungen, Begutachtungen und insbesondere in zum Teil etliche Jahre dauernden Psychotherapien sammeln konnte, hätte dieses Buch nicht entstehen können. Deshalb gilt mein ganz besonderer Dank meinen Gesprächspartnerinnen und -partnern (bewusst vermeide ich den in diesem Zusammenhang sonst gebräuchlichen »Patienten«-Begriff, um von vornherein die Verbindung Transsexualität – psychische Krankheit zu vermeiden). Sie haben mich durch ihre Schilderungen an ihrem Leben teilnehmen lassen, haben mir Einblicke in ihre Hoffnungen, Ängste und Fantasien gegeben und haben mich – zumindest aus »zweiter Hand« – ihre oft schwierige soziale Situation erspüren lassen. Sie haben mir über meine anfängliche Irritation hinweggeholfen. Denn wen irritierte es nicht, erstmals mit einem Menschen konfrontiert zu sein, der sich nicht nur wie das Gegengeschlecht kleidet, sondern sich auch so empfindet?
Sie waren und sind es schließlich auch, die mich zum Nachdenken gezwungen haben und mich zu einer gegenüber den 1970er Jahren weitgehend veränderten Einstellung geführt haben. Dafür bin ich ihnen dankbar.
Udo Rauchfleisch
Vorwort zur 6. Auflage
Nachdem acht Jahre seit der letzten Auflage dieses Buches vergangen waren, wurde klar, dass es nur zwei Möglichkeiten gäbe: entweder das Buch, für das der Verlag inzwischen nur noch wenige Exemplare hatte, ganz aus dem Handel zu nehmen oder es grundlegend zu überarbeiten. In Absprache mit Ulrike Rastin von Vandenhoeck & Ruprecht habe ich mich entschlossen, die nötigen, in Anbetracht der vielen Veränderungen im medizinischen und psychologischen, sozialen und rechtlichen Bereich umfangreichen Änderungen vorzunehmen.
Dies begann bereits beim Titel dieses Buches. Der Begriff »Transsexualität« ist nicht nur veraltet und wird mit dem Inkrafttreten der ICD-11 total verschwinden, sondern er erschien mir auch wegen der daran gebundenen Pathologisierung der Transidentität obsolet. Da in der 5. Auflage der Begriff »Transidentität« bereits im Titel enthalten war, erschien er mir passend auch für diese Neuauflage. Ich habe ihn mit dem Begriff »Transgender« ergänzt, da im öffentlichen wie im fachlichen Diskurs heute vielfach der Begriff Transgender verwendet wird. So kam es zum Haupttitel »Transidentität – Transgender«.
Auch der Untertitel (ehemals »Begutachtung, Begleitung, Therapie«) bedurfte der Veränderung, da die Ziele der Neuauflage sich verändert haben. Im Zentrum steht heute für mich die Begleitung und Gestaltung von Transitionsprozessen. Dies ist nun auch der Untertitel dieser 6. Auflage.
Mir war von Anfang an klar, dass die Überarbeitung eine große Herausforderung sein würde. Ich hatte jedoch unterschätzt, wie viel Arbeit die Aktualisierung mit sich bringen würde. Dies betraf ganz verschiedene Bereiche und Themen und reichte von der verwendeten Terminologie und der von mir benutzten Schreibweise bis zu einer Fülle von inhaltlichen Fragen. So mussten beispielsweise größere Passagen zu längst nicht mehr aktuellen Themen (z. B. über den »Alltagstest«) gestrichen werden und anstelle dessen mussten neue Themen (wie Nichtbinarität sowie die Frage der Transition von Kindern und Jugendlichen und die bei ihnen verwendeten Pubertätsblockaden) aufgenommen werden. Außerdem habe ich einige völlig neue Kapitel hinzugefügt, wie »Worauf kommt es in der therapeutischen Begleitung von Transgendern an?«, »Evaluation« und »Detransition«.
Während Jacqueline Born ihren Beitrag lediglich hinsichtlich der aktuellen Scheibweise und in Bezug auf ein paar inhaltliche Formulierungen verändert hat, hat Annette Güldenring einen weitgehend neuen Beitrag verfasst.
Ich freue mich und bin Frau Ulrike Rastin dankbar, dass ich dieses Buch nun in 6., grundlegend überarbeiteter Form publizieren kann. Auf diese Weise war es mir möglich, die Diskussion über Transgender und ihre Transition auf den aktuellen Stand zu bringen und meine inzwischen 54-jährige Erfahrung aus einer großen Zahl von Transitionsbegleitungen darzustellen.
Möge das Buch Kolleg:innen aus den verschiedenen mit trans* Personen befassten Fächern eine Hilfe sein. Möge es aber auch Transidenten selbst zur Klärung ihrer inneren und äußeren Situation dienen und die Diskussion zwischen Fachleuten, Transorganisationen sowie Transgendern und ihren Angehörigen anregen.
Udo Rauchfleisch
Von der Krankheit Transsexualität zur nichtpathologischen Transidentität/Transgender
Begriffsklärung
Da es beim Thema Transidentität und Transgender viel begriffliche Verwirrung gibt, möchte ich am Anfang dieses Kapitels zunächst die Begriffe klären, die ich im Folgenden verwenden werde.
Häufig wird in öffentlichen Diskussionen, aber auch noch im wissenschaftlichen Bereich von Transsexualismus bzw. »Transsexualität« gesprochen (bis die neue ICD-11 in deutscher Sprache vorliegt, wird die Diagnose »Transsexualismus« allerdings noch verwendet). Diese Bezeichnung trifft jedoch nicht das Wesen dieser Menschen, da es bei ihnen nicht um die sexuelle Ausrichtung oder die Art, wie sie ihre Sexualität leben, geht, sondern um ihre Identität. Aus diesem Grund werden heute, auch unter Fachleuten, eher die Begriffe »Transidentität« und »Transgender« verwendet. Nichttransidente werden als »cis« Personen bezeichnet (Sigusch, 1995).
»Transgender« ist ein Oberbegriff, der zur Bezeichnung all der Menschen verwendet wird, die sich nicht mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht identifizieren können bzw. sich dadurch nicht richtig beschrieben fühlen. Dazu gehören sehr unterschiedliche Personen, die im Hinblick auf ihre Identität aber alle in irgendeiner Weise von der Mehrheitsgesellschaft abweichen. Der Vorteil des Begriffs Transgender ist – und deshalb verwende ich ihn in dieser Neuauflage meines Buches –, dass er ein weites Spektrum von Menschen mit den unterschiedlichsten Identitäten beschreibt.
Mit dem Begriff »Transidentität« werden die gleichen Personen bezeichnet. Auch dies ist ein Oberbegriff, der keinerlei pathologische Konnotation hat und zudem darauf hinweist, dass es bei diesen Personen um die Identität geht.
Bei der Beschreibung von Transgendern wird in psychologischen und psychiatrischen Berichten häufig von »Frau-zu-Mann«- bzw. »Mann-zu-Frau«-Transidenten gesprochen. Durch »Mann-zu- Frau« soll ausgedrückt werden, dass eine dem männlichen Geschlecht zugewiesene Person sich als Frau wahrnimmt – und unter Umständen eine Angleichung an den weiblichen Körper wünscht. »Frau-zu-Mann« dient der Beschreibung dessen, dass eine dem weiblichen Geschlecht zugewiesene Person sich als Mann empfindet – und unter Umständen eine Angleichung an den männlichen Körper sucht. Im Grunde widersprechen die Bezeichnungen »Frau-zu Mann« und »Mann-zu Frau« jedoch dem Erleben transidenter Menschen. Aus ihrer Sicht machen sie nämlich keine Veränderung von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann durch, sondern sind von jeher im Inneren Frau bzw. Mann gewesen und möchten ihrem empfundenen Geschlecht entsprechend leben und wahrgenommen werden. Unter Umständen, jedoch nicht in jedem Fall, wollen sie den Körper an die empfundene Identität anpassen lassen und in der dieser Identität entsprechenden Rolle leben.
Transidente selbst bezeichnen sich häufig als »trans* Person« und unterscheiden zwischen »trans* Mann« (dem weiblichen Geschlecht zugewiesen, aber mit männlicher Identität) und »trans* Frau« (dem männlichen Geschlecht zugewiesen, aber mit weiblicher Identität). Ich werde im Folgenden bei meiner Darstellung diese Begriffe verwenden, da sie durch die Charakterisierung trans* Mann bzw. trans* Frau die Selbstdefinition und die soziale Rolle als Frau bzw. als Mann in den Vordergrund stellen und so dem Erleben von trans* Personen am besten entsprechen.
In Abweichung von dem in den früheren Auflagen dieses Buches verwendeten Begriff »biologisches« Geschlecht spreche ich in dieser Neuauflage vom »zugewiesenen« Geschlecht, da keine Aussagen über die geschlechtliche Identität eines Menschen anhand der sichtbaren körperlichen Merkmale getroffen werden können. Ob es sich um eine trans* oder cis Person handelt, kann nur sie selbst anhand ihres »empfundenen« Geschlechts beurteilen.
Dies hat zur Folge, dass die »Diagnose« Transgender bzw. Transident immer eine Selbstdiagnose ist, die sich auf keine Weise von außen validieren lässt. Im diagnostischen Prozess (s. S. 35 ff. und S. 51 ff.) können wir uns als Fachpersonen lediglich den Ratsuchenden als Dialogpartner:innen zur Verfügung stellen und ihnen dabei behilflich sein, sich ihrer Situation bewusst zu werden. Die letzte Entscheidung über die Diagnose liegt aber bei den trans* Personen selbst.
Auf die Differenzierung zwischen binären und nichtbinären trans* Personen werde ich später (Kapitel Exkurs: Das »Problem« der Nichtbinarität) ausführlich eingehen.
An dieser Stelle seien noch ein paar Hinweise zur Schreibweise gegeben, die ich in diesem Buch verwende. Die Frage, ob ich mich für den »Gender_Gap« (_), das »Trans-Sternchen« (*) oder den Doppelpunkt (:) entscheide, hat mir ziemlich viel Mühe bereitet. Nachfragen bei Kolleg:innen, die sowohl im Fachbereich als auch als trans* Aktivist:innen viel Erfahrung haben, und die Konsultation beispielsweise der Empfehlungen vom Transgender Network Switzerland (TGNS) haben mich mehr oder weniger ratlos zurückgelassen. Es gab keine übereinstimmenden Empfehlungen. Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, folgendermaßen vorzugehen – und bin mir klar darüber, dass ich mich damit in etliche Fettnäpfchen setzen werde, aber das ist bei dem Thema dieses Buches ohnehin nicht zu vermeiden:
Ich werde »trans*« als Adjektiv mit Sternchen schreiben, wobei das Sternchen als Platzhalter für die Fülle von möglichen Transselbstzuschreibungen fungiert. Transgender, Transidentität, Transnegativität usw. werde ich als feststehende Begriffe ohne Sternchen oder Doppelpunkt schreiben. Bei Worten wie Klient:innen, Therapeut:innen, Endokrinolog:innen u. ä. verwende ich den Doppelpunkt, um damit einen Raum für alle Geschlechter, jenseits von weiblich und männlich, zu öffnen.
Historischer Überblick
Als in den Jahren 1952/53 in Dänemark bei Christine Jörgensen (Hamburger, Stürup u. Dahl-Iversen, 1953) die erste operative Angleichung eines Mannes an das weibliche Geschlecht erfolgte (Sigusch, 1995, weist allerdings darauf hin, dass plastisch-chirurgische Operationen am Genitale und an den sekundären Geschlechtsmerkmalen von der Medizin spätestens seit 1761 vorgenommen worden seien), begann eine neue Ära in der Geschichte des »Transsexualismus«. Es war auch damals kein neues Phänomen, und Transsexualismus beschränkt sich auch keineswegs auf den mitteleuropäischen und angloamerikanischen Bereich. Wir kennen andere Kulturen, in denen der Wechsel der Geschlechterrolle sogar recht weit verbreitet ist und einen festen Platz im kulturellen und religiösen Leben einnimmt: so die Fakaleiti, Männer auf Tonga (Ozeanien), die sich in ihrem Auftreten und ihrer Kleidung dem weiblichen Geschlecht angleichen, die Kathoey Thailands, die Hijra in Indien und die »Two-Spirit People« in indigenen Gruppen Nordamerikas (Tietz, 2013), um nur ein paar prominente Beispiele zu erwähnen. In ihrer Analyse der weltweiten Geschlechtervielfalt kommt Baltes-Löhr (2023) auf 112 verschiedene Ausprägungen von Geschlecht. Die Two-Spirit People haben in der indigenen Gesellschaft eine anerkannte soziale Stellung und werden zum Teil hochverehrt. Ihr Two-Spirit-Wesen erklären sich die Mitglieder dieser Gruppe durch eine Berufung durch höhere Mächte und schreiben diesen Menschen deshalb auch übernatürliche Kräfte zu. Bei diesen Lebensformen aus anderen Kulturen bleibt aber offen, inwieweit sie den Personen entsprechen, die wir als Transgender bezeichnen.
Neu aber waren 1952 die Benennung des Empfindens, dem »anderen« Geschlecht anzugehören, mit dem Begriff »Transsexualismus« (Benjamin, 1966) und die operative Angleichung an das »Gegengeschlecht« (außer Harry Benjamin sind als Pioniere der Behandlung von Transgendern John Money und Anke A. Ehrhardt, 1970, vom Johns Hopkins Hospital in Baltimore, und Janice Raymond, 1979, zu nennen). Ich habe die Begriffe »anderes« Geschlecht und »Gegengeschlecht« hier in Anführungszeichen gesetzt, weil diese Formulierungen einer heute nicht mehr aktuellen, einseitig binären Sicht entsprechen. In der Folge sind bis in die Gegenwart in den verschiedensten Ländern tausende solcher Operationen durchgeführt worden.
Bezüglich der Häufigkeit des »transsexuellen Syndroms« bestehen nur vage Schätzungen, weil längst nicht alle Menschen, die sich mit dem ihnen zugewiesenen Geschlecht nicht richtig beschrieben fühlen, fachlichen Rat oder gar eine hormonelle und chirurgische Behandlung suchen. Sigusch (1995) schätzte die Zahl von trans* Personen in Deutschland auf 3.000 bis 6.000 Personen. Hirschauer (1999) vermutete eine ähnliche Häufigkeit, die meines Erachtens jedoch weit unterschätzt ist. Andere Schätzungen (American Psychiatric Association, 1994; van-Kesteren, Gooren u. Megens, 1996; Weitze u. Osburg, 1996) sprechen von Inzidenzraten bei trans* Frauen von 1:11.900 bis 45.000 und bei trans* Männern von 1:30.000 bis 100.000. Aufgrund ihrer jahrzehntelangen Arbeit in der Amsterdamer Gender Clinic und einer Neuberechnung früher publizierter Zahlen kommen Olyslager und Conway (2008) sogar auf Werte von 1:1.000 (bei den trans* Frauen) und 1:2.000 (bei den trans* Männern). Diese Angaben der Häufigkeiten zeigen, dass trans* Personen in unserer Gesellschaft offensichtlich eine zahlenmäßig keineswegs kleine Gruppe darstellen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass längst nicht alle Transgender eine chirurgische Angleichung an das empfundene Geschlecht suchen, sondern lediglich 43 Prozent bzw. 50 Prozent (Green u. Blanchard, 2000) und zwischen 77 Prozent und 80 Prozent derer, die Gender-Identity-Zentren aufsuchen, eine hormonelle und chirurgische Behandlung erhalten (van-Kesteren et al., 1996).
Während in der Anfangszeit lediglich einige wenige Zentren bestanden, in denen diese Operationen von einem hochspezialisierten Team durchgeführt wurden (am bekanntesten ist wohl das Johns Hopkins Hospital in Baltimore, das aber heute nicht mehr auf diesem Gebiet tätig ist), gibt es heute in vielen Universitätskliniken – zumeist interdisziplinäre – Teams mit Vertreter:innen von Psychiatrie, Psychologie, Endokrinologie, Urologie, Gynäkologie und plastischer Chirurgie, die sich um die Begutachtung und Behandlung von trans* Personen kümmern.
Daneben finden wir eine Fülle von Privatkliniken, in denen solche Operationen durchgeführt werden. Diese Kliniken sind von unterschiedlicher Qualität. Etliche führen qualifizierte Operationen durch (zu allerdings im Allgemeinen sehr hohen Preisen, die die Krankenkassen nur bedingt übernehmen).
Auch die Methoden und die Qualität der chirurgischen Maßnahmen variieren von Klinik zu Klinik und selbstverständlich auch die Honorare. Eine der weltweit bekanntesten Kliniken mit sehr großer Erfahrung ist die von Dr. Suporn Watanyusakul in Chonbury/Thailand. Dabei ist interessant, dass die Operationskosten hier wesentlich niedriger sind als in den europäischen Ländern. Aus diesem Grund haben sich einzelne Schweizer Krankenkassen in den letzten Jahren bereit erklärt, die Kosten der Operation in Thailand zu übernehmen.
Angesichts dieser Situation können wir heute sagen, dass sich die Situation von trans* Personen gegenüber der ersten Operation im Jahr 1952 erheblich verbessert hat. Wir besitzen heute wesentlich umfangreichere Kenntnisse über die psychologische Befindlichkeit und die soziale Situation von trans* Personen. Die rechtlichen Möglichkeiten (Vornamens- und Personenstandsänderung) und die medizinische Behandlung (hormoneller und chirurgischer Art) sind erheblich verbessert worden. Und gesamtgesellschaftlich ist die Toleranz ihnen gegenüber – weniger aber wohl echte Akzeptanz – gewachsen. Nach und nach werden in der Öffentlichkeit mehr trans* Frauen und trans* Männer sichtbar und bestimmen damit wenigstens ein Stück weit die Wahrnehmung der breiteren Öffentlichkeit.
In einer Hinsicht allerdings hat sich die Situation über die nunmehr 70 Jahre, die seit der ersten Operation vergangen sind, kaum verändert: Dies ist die Tatsache, dass »Transsexualismus« gemäß der ICD-10 (Störung der Geschlechtsidentität) immer noch als eine Krankheit betrachtet wird. Dies wird sich ändern, wenn vermutlich bald die seit dem 1. Januar 2022 gültige, aber im deutschsprachigen Bereich noch nicht verwendete ICD-11 in Kraft tritt, die das Phänomen Trans* als Geschlechtsinkongruenz der Kategorie »Probleme/Zustände im Bereich der sexuellen Gesundheit« zuordnet.
Die ICD-10 ordnet den Transsexualismus hingegen der Gruppe »Störungen der Geschlechtsidentität« (F64) zu und definiert den Transsexualismus als den »Wunsch, als Angehöriger des anderen anatomischen Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden. Dieser geht meist mit dem Gefühl des Unbehagens oder der Nichtzugehörigkeit zum eigenen Geschlecht einher. Es besteht der Wunsch nach hormoneller und chirurgischer Behandlung, um den eigenen Körper dem bevorzugten Geschlecht soweit wie möglich anzugleichen« (F64.0). Als diagnostische Leitlinie wird gefordert: »Die transsexuelle Identität muss mindestens zwei Jahre durchgehend bestanden haben und darf nicht Symptom einer anderen psychischen Störung, wie z. B. einer Schizophrenie, sein. Ein Zusammenhang mit intersexuellen, genetischen oder geschlechtschromosomalen Anomalien muss ausgeschlossen sein.« Die neue ICD-11 wird die unter den »Störungen der Geschlechtsidentität« subsumierte Diagnose »Transsexualismus« nicht mehr enthalten.
Das DSM-IV ordnete den Transsexualismus der Kategorie »Sexuelle und Geschlechtsidentitätsstörungen« zu. Der Begriff des Transsexualismus wurde im DSM-IV aufgegeben zugunsten des Begriffs der »Geschlechtsidentitätsstörung«. Dahinter stand die Überlegung, dass die Diagnose »Transsexualismus«, wie ihn die ICD definiert, zu eng an die Operationsindikation gebunden sei. Der Kern der Diagnose einer Geschlechtsidentitätsstörung war die Verbindung einer gegengeschlechtlichen Identifikation mit einem Unbehagen mit dem eigenen Geschlecht.
Das 2013 veröffentlichte DSM-5 verwendet für trans* Personen nicht mehr den Begriff der »Geschlechtsidentitätsstörung«, sondern spricht von einer »Gender Dysphoria« (Geschlechtsdysphorie; American Psychiatric Association, 2013; Falkai u. Wittchen, 2018). Damit ist ein wichtiger Schritt der Entpathologisierung der Transidentität gemacht, da nicht mehr die Identität selbst als »psychische Störung« deklariert wird (obwohl auch die Geschlechtsdysphorie immer noch im Katalog von psychischen Störungen figuriert). Mit der Diagnose »Geschlechtsdysphorie« wird vielmehr das Leiden an der Geschlechtsinkongruenz bezeichnet.
Eine Geschlechtsdysphorie wird gemäß DSM-5 diagnostiziert, »wenn (Kriterium A) eine deutliche Nichtübereinstimmung zwischen der erlebten und zum Ausdruck gebrachten Geschlechtsidentität und dem zugewiesenen Geschlecht von mindestens 6 Monaten Dauer besteht. Die Nichtübereinstimmung ist durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet: deutliche Nichtübereinstimmung zwischen der erlebten und zum Ausdruck gebrachten Geschlechtsidentität und den primären und/oder sekundären Geschlechtsmerkmalen (oder im Fall von Jugendlichen: den vorweggenommenen Auswirkungen von sekundären Geschlechtsmerkmalen), den starken Wunsch, sich der sekundären Geschlechtsmerkmale zu entledigen (bei Jugendlichen: die Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale zu verhindern), den starken Wunsch, die primären und/oder sekundären Geschlechtsmerkmale des anderen Geschlechts zu besitzen, den starken Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören, den starken Wunsch, als Angehöriger des anderen Geschlechts behandelt zu werden, und die starke Überzeugung, gemäß den für das erlebte Geschlecht typischen Gefühlen zu empfinden und entsprechende Reaktionen zu zeigen.«
Das Kriterium B verweist darauf, dass der Zustand mit einem klinisch relevanten Leiden oder einer Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen verknüpft ist oder der Zustand mit einer deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit verbunden ist, ein solches Leiden bzw. eine solche erhöhte Beeinträchtigung hervorzurufen.
Wie die diagnostischen Leitlinien der ICD und des DSM zeigen, stehen im Zentrum dieser »Störung« die nicht korrigierbare, über lange Zeit hin bestehende Überzeugung der betreffenden Menschen, nicht dem zugewiesenen Geschlecht anzugehören, und ihr Drängen auf hormonelle und chirurgische Maßnahmen, mit deren Hilfe eine Angleichung an das empfundene Geschlecht vorgenommen werden soll. Eine spezielle Gruppe, die allerdings nur eine gewisse Ähnlichkeit mit dem »Transsexualismus« aufweist, stellen Männer mit einer »Autogynephilie« (Blanchard, 1991; Lawrence, 2004) dar. Sie zeichnen sich durch die Neigung aus, durch die Vorstellung oder das Bild von sich selbst als Frau sexuell erregt zu werden. In Bezug auf den Verlauf der Transentwicklung finden sich sehr unterschiedliche Wege.
Transentwicklungen können sehr früh beginnen, was zur Erinnerung der Betreffenden führt, sie seien »schon immer« transident gewesen. Andere Transgender werden sich ihrer Situation erst später im Leben, im dritten oder vierten Lebensjahrzehnt, oder sogar noch wesentlich später, bewusst.
Ob sich Transgender bereits in Kindheit und Jugend ihres Transseins bewusst werden und dies auch ihrer Umgebung kommunizieren, ist stark von der Einstellung der Umgebung bestimmt. Da vor 50 oder 60 Jahren viele Menschen das Phänomen Transidentität nicht kannten, fiel es Transgendern selbst sehr schwer, sich als »Trans*« zu definieren und dies ihrer Umgebung mitzuteilen. Heute hingegen bestehen in der Bevölkerung zumindest vage Vorstellungen davon, was Transidentität ist. Aus diesem Grund eröffnen heute deutlich mehr Kinder und Jugendliche ihren Eltern, dass sie »trans*« sind (vgl. S. 102 ff.).
Bei den früh beginnenden und stabil bleibenden Verlaufsformen wird in Anlehnung an Person und Ovesey (1974a, 1974b) mitunter von einer »primären Transsexualität« gesprochen, häufig mit der (fälschlichen!) Implikation, damit die »echte Transsexualität« zu kennzeichnen. Die erst im späteren Leben sich manifestierende »Transsexualität« wurde von den erwähnten Autoren hingegen als »sekundäre Transsexualität« bezeichnet. Aufgrund meiner Erfahrungen stimme ich indes Reiche (1984) und Senf (1996) voll zu, dass die »sekundäre« Transidentität nicht weniger »echt« ist als die »primäre« und es hier nicht um zwei unterschiedliche Formen der Transidentität geht, sondern lediglich um ein »Früher oder Später in der Organisation dessen, was dann als transsexuelles Phänomen manifest wird« (Reiche, 1984, S. 61).
Werden die primäre und die sekundäre Form der Transidentität in diesem Sinne verstanden, so kann eine solche Unterscheidung indes sinnvoll sein in Bezug auf das therapeutische Vorgehen. In seiner Stichprobe von 271 trans* Personen (81 Prozent trans* Frauen und 19 Prozent trans* Männer) fand Seil (2004) 29 Prozent mit »primärem Transsexualismus« und 71 Prozent mit »sekundärem Transsexualismus«. Interessant ist, dass unter den trans* Frauen 60 Prozent der Gruppe des »sekundären Transsexualismus« angehörten. Ich stimme der Interpretation des Autors zu, der meint, dass dieser hohe Prozentsatz der sekundären Form darauf zurückzuführen ist, dass sich bei männlichen Kindern die transidente Ausrichtung nicht schon von früher Kindheit an ungehindert entwickeln konnte, sondern vom Umfeld vielfach unterdrückt wurde, sodass sich die Transidentität erst im späteren Leben manifestieren konnte. Für die psychotherapeutische Begleitung resultiert daraus, dass die trans* Personen mit einem frühen Beginn und ich-syntoner Ausrichtung (»primäre« Form) vor allem Unterstützung und Klärung in der Auseinandersetzung mit ihren Familien und im beruflichen Bereich benötigen, während diejenigen mit einem späten Beginn und ich-dystoner Ausrichtung (»sekundäre« Form) zunächst Hilfe bei der Lösung ihres innerseelischen Konflikts brauchen, damit sie ihre Transidentität akzeptieren können und diejenigen unter ihnen, die sich sozial isoliert haben, ein soziales Netz aufbauen können.
Auch hinsichtlich der Ziele, die Transgender verfolgen, und hinsichtlich ihrer letztendlichen Entscheidung, ob sie eine Angleichung an das empfundene Geschlecht anstreben und durchführen lassen, ob sie sich in einem Zwischenbereich zwischen den Geschlechterrollen dauerhaft einrichten oder ob sie den Wunsch nach hormonellen und/oder operativen Angleichungen an das empfundene Geschlecht aufgeben, besteht eine große Bandbreite. Ich stimme in dieser Hinsicht Pfäfflin (1996a) zu, dass diese drei unterschiedlichen Wünsche und Verläufe von den Fachleuten (und meiner Ansicht nach auch von Transgendern selbst) nicht wertend gegeneinander ausgespielt werden dürfen und keine der genannten drei Hauptlösungen einen Primat (»echte Transsexualität« zu sein) beanspruchen kann (s. hierzu auch die Ausführungen von Lindemann, 1993).
So zeigt denn auch eine Sichtung der internationalen Literatur zum Thema »Transsexualität« (White u. Ettner, 2004), dass sich längst nicht der größte Teil von trans* Personen hormonell und chirurgisch behandeln lässt, sondern zwischen 43 Prozent und 50 Prozent von ihnen eine Lösung ihres Problems ohne Operation suchen.
Während in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren die trans* Personen, die mit den medizinischen Diensten in Kontakt kamen, den ganzen Prozess der körperlichen Angleichung durchlaufen haben – und dazu von den Fachleuten auch gedrängt wurden –, gehen viele Transidente heute in Bezug auf die körperliche Angleichung schritt- weise vor.
Wenn in den diagnostischen Leitlinien der ICD-10 die Rede ist von der unkorrigierbaren Überzeugung, dem »anderen« Geschlecht anzugehören, könnte man, wie Krafft-Ebing (1886), Anhänger der Lacan-Schule (s. Runte, 1985), Socarides (1970) und Volkan (2004) von einem »Wahn« sprechen, ist doch auch dieser dadurch gekennzeichnet, dass die betreffende Person an einer durch nichts zu korrigierenden Vorstellung festhält, die nicht der äußeren Realität entspricht. Denn von wenigen, eher zweifelhaften Berichten abgesehen, ließen sich trans* Personen nicht von ihrer Überzeugung und von ihrem Wunsch nach einer Angleichung an das empfundene Geschlecht abbringen. Der Ansicht, der Transsexualismus sei Ausdruck eines »infantilen psychotischen Selbst« (Volkan, 2004) widerspricht allerdings die Tatsache, dass wir bei trans* Personen im Allgemeinen – wie bei cis Personen – keine anderen Zeichen einer psychotischen Erkrankung finden.
Etwas weniger pathologisierend war die Ansicht (wie es das DSM-IV formulierte), wir hätten es bei der Transidentität mit einer – allerdings schwerwiegenden, therapeutisch nicht beeinflussbaren – Störung der Geschlechtsidentität zu tun. Dieser Auffassung gemäß liegt bei der Transidentität eine Störung in der Entwicklung der Kerngeschlechtsidentität vor, dem in den ersten zwei Lebensjahren sich ausbildenden Grundbaustein der Geschlechtsidentität (die beiden anderen »Bausteine« sind die Geschlechtsrolle und die Geschlechtspartner:innen-Orientierung).
Unter der Kerngeschlechtsidentität verstehen wir mit Mertens (1992, S. 24) »das primordiale, bewusste und unbewusste Erleben […], entweder ein Junge oder ein Mädchen bezüglich seines biologischen Geschlechts (im Englischen ›sex‹ im Unterschied zu ›gender‹) zu sein. Sie entwickelt sich aufgrund des komplexen Zusammenwirkens von biologischen und psychischen Einflüssen ab der Geburt eines Kindes, wenn die Eltern mit ihrer Geschlechtszuweisung zumeist geschlechtsrollenstereotyp auf ihre Kinder als Junge oder Mädchen reagieren, und ist gegen Ende des zweiten Lebensjahres als (relativ) konfliktfreie Gewissheit etabliert.«
Wenn wir die Transidentität als Störung in diesem Bereich verstehen, haben wir sie zwar phänomenologisch mehr oder weniger zutreffend beschrieben. Aber auch bei diesen Überlegungen bleibt völlig offen, wodurch es zu dieser Entwicklung gekommen sein könnte. Und letztlich würden wir die Transidentität bei der Verwendung dieses Konzepts ebenfalls als pathologische Erscheinung charakterisieren. Kritisch müssen wir auch die Frage stellen, warum die Kerngeschlechtsidentität in diesem Konzept binär konzipiert wird. Sie umfasst sicher nicht nur zwei Dimensionen (s. Rauchfleisch u. Baeriswyl, 2011; Rauchfleisch, 2024a). Hier zeigt sich deutlich, in welch starkem Maße auch unsere psychologischen Konzepte von den unsere Kultur prägenden Binaritätsvorstellungen beeinflusst sind.
Einen noch weiteren Schritt in der Entpathologisierung der Transidentität geht, wie bereits erwähnt, das DSM-5, das nicht von »Transsexualität« oder von einer »Störung der Geschlechtsidentität«, sondern von »Geschlechtsdysphorie« spricht (American Psychiatric Association, 2013; Falkai u. Wittchen, 2018). Gemäß dieser Auffassung besteht bei trans* Personen ein Leidensdruck, der sich aus der Diskrepanz zwischen dem zugewiesenen und dem empfundenen Geschlecht ergibt und als krankheitswertige Störung betrachtet wird. Nicht die Transidentität selbst ist pathologisch, sondern das Leiden entsteht durch die Geschlechtsinkongruenz, die aus dem Auseinanderklaffen von der empfundenen Geschlechtsidentität und dem zugewiesenen Geschlecht resultiert. Mit dieser Formulierung des DSM-5 ist ein entscheidender Schritt der Entpathologisierung der Transidentität getan (Rauchfleisch, 2019), ohne dass zu befürchten wäre, dass die Krankenkassen keine Leistungen mehr erbringen würden, wenn die Transidentität selbst keine »Krankheit« mehr ist. Das aus der Geschlechtsdysphorie resultierende Leiden ist eindeutig behandlungsbedürftig und damit Pflichtleistung der Krankenkassen.
Obwohl sich in der Fachliteratur verschiedene psychodynamische Überlegungen dazu finden, auf welche Weise eine Störung der Kerngeschlechtsidentität entstanden sein könnte, sind diese bei einzelnen trans* Personen gesammelten Beobachtungen äußerst hypothetisch und finden sich durchaus auch in Familien von cis Personen. Als psychodynamische Ursachen sind unter anderem genannt worden: der Wunsch der Eltern, ein Kind des anderen Geschlechts zu haben; das eher »weibliche« Aussehen und Verhalten der späteren trans* Frau und das eher »männliche« Aussehen und Verhalten des späteren trans* Mannes; die (unbewusste) Tendenz eines Elternteils, das Kind dem anderen Geschlecht zuzuweisen, um damit den anderen Elternteil zu verletzen; das Fehlen oder die stark negative Besetzung des gleichgeschlechtlichen Elternteils, wodurch das Kind zur Identifikation mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil gedrängt werde; der »Transsexualismus« stelle eine Form der verdrängten, als verpönt erlebten, nicht akzeptierten eigenen Homosexualität dar (beispielhaft für diese Hypothesen sind Person u. Ovesey, 1974a, 1974b; Stoller, 1975; Volkan, 2004; Kamermans, 1995). Dass die Hypothese einer nicht akzeptierten Homosexualität nicht haltbar ist, ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass eine recht große Zahl von Transgendern nach der Transition in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften lebt.
Von somatischer Seite sind als Ursachen der Transidentität postuliert worden: eine hormonelle Beeinflussung des Fötus mit gegengeschlechtlichen Hormonen in der intrauterinen Entwicklung; Störungen in nicht genauer identifizierbaren Arealen des Gehirns und eine Zeitlang vor allem das Y-chromosomal kodierte Genprodukt Histokompatibilitätsantigen Y (H-Y-Antigen), ein Zellmembranglykoprotein (Eicher et al., 1979; Engel, Pfäfflin, Klemme u. Ebrecht, 1981). In den letzten Jahren hat Diamond (2006, 2010; s. auch Haupt, 2011, 2012) aus der Sicht der Neurowissenschaften postuliert, die Transidentität als eine Form hirngeschlechtlicher Intersexualität zu verstehen. In jüngster Zeit ist die Berichterstattung in den Medien dafür verantwortlich gemacht worden, dass vor allem Jugendliche es als »Hype« empfänden, »trans*« zu sein.
Fasst man die genannten ätiologischen Überlegungen psychologischer und somatischer Art zusammen, so muss man sagen, dass sie das Phänomen »Transidentität« nicht schlüssig erklären. Entweder sind sie viel zu unspezifisch, wie die psychodynamischen Hypothesen, oder mehr oder weniger unbewiesen, wie viele somatische Erklärungsversuche. Wieder andere Theorien (wie die Wirksamkeit des H-Y-Antigens) mussten schon bald wieder fallengelassen werden, da sich die anfänglich Euphorie auslösenden Befunde (»wir haben endlich die somatische Ursache der Transidentität gefunden«) nicht replizieren ließen und als unzutreffend erwiesen.
Bezüglich der mitunter zutreffend erscheinenden psychodynamischen Hypothese, dass Eltern, vor allem Mütter als die Primärversorgenden, das Kind in die Rolle des »anderen« (binär gedachten) Geschlechts gedrängt hätten, hat sich meine Sicht in den letzten Jahren verändert: Aufgrund meiner Beobachtungen gehe ich heute davon aus, dass die Mütter oft die subtilen Signale ihrer ihr Transsein spürenden Kinder wahrgenommen und darauf reagiert haben. Die Transentwicklung wurde nicht von den Müttern initiiert, sondern sie reagierten in einfühlsamer Weise auf die Signale der Kinder.
Wir stehen heute an einem Punkt, an dem wir sagen müssen, dass die Ursachen der Transidentität nach wie vor im Dunkeln liegen. Es ist die gleiche Situation, in der wir uns angesichts der Frage nach der Entstehung der sexuellen Orientierungen befinden. Auch hier sehen wir uns trotz verschiedener Hypothesen einem großen
Fragezeichen gegenüber, wenn wir zu ergründen versuchen, wie hetero-, bi-, homo-, pan- und asexuelle Orientierungen entstehen. Auf Zusammenhänge zwischen Transidentität und den verschiedenen sexuellen Orientierungen werde ich im Kapitel »Die den Transitionsprozess begleitende Psychotherapie« noch ausführlicher eingehen.
Die meisten bisherigen Hypothesen über die Entstehung der Transidentität gehen letztlich alle davon aus, dass wir es hier mit einer pathologischen Form der Geschlechtsidentität zu tun hätten. Heute rücken allerdings viele Autor:innen vom Pathologiekonzept ab und verstehen die Transidentität als eine Variante der Geschlechtsidentität, die, wie die cis Identität, nichts mit psychischer Gesundheit oder Krankheit zu tun hat. Diese Änderung im Verständnis der Transidentität – wir müssen geradezu von einem Paradigmenwechsel sprechen – ist dadurch bedingt, dass wir heute eine weitaus größere Zahl von Transgendern kennen als in früheren Jahren und ihren Lebensweg zum Teil über Jahrzehnte nachverfolgen können. Dadurch haben wir ein wesentlich differenzierteres Bild gewonnen und haben erkannt, dass wir längst nicht bei allen diesen Menschen, sondern nur bei einem kleinen Teil, Zeichen einer wie auch immer gearteten Psychopathologie, in diesem Fall meist reaktive Störungen, feststellen können (einen Überblick über die psychische Gesundheit und die emotionale Befindlichkeit von Transgendern liefern die schottische Studie »Trans Mental Health and Emotional Wellbeing« von McNeil, Bailey, Ellis, Morton u. Regan, 2012, die große Australische Studie »Trans Pathways« von Strauss et al., 2017, sowie die Publikationen von de Vries et al., 2019, Clark et al., 2017, Krell u. Oldemeier, 2017, Pöge et al., 2020, Velasco, Slusser u. Coats, 2022, Timmermanns, Graf, Merz u. Stöver, 2022, Kaprowski et al., 2021 und Szücs et al., 2021).
Die Änderung im Verständnis der Transidentität hat sich auch in ihren Bezeichnungen niedergeschlagen. So wird heute, wie eingangs ausgeführt, statt »Transsexualismus« häufig der Begriff »Transidentität« verwendet. Aus diesem Grund habe ich den Begriff »Transsexualität« aus dem Titel dieser Neuauflage meines Buches entfernt und durch »Transgender« ersetzt.
Die Entpathologisierung der Transidentität hat dazu geführt, dass die trans* Personen heute häufig ein tragfähigeres Selbstwertgefühl und ein positiveres Selbstverständnis besitzen als in früheren Zeiten, in denen sie noch stärker marginalisiert waren. So haben sie heute in vielen Großstädten Selbsthilfegruppen und überregionale Emanzipationsgruppen gebildet, die Informationen liefern, Begegnungsmöglichkeiten anbieten, zum Teil Beratungen durchführen und nicht selten auch mit Lesben- und Schwulenorganisationen zusammenarbeiten (vgl. meine Ausführungen im Kapitel »Was können Transgender selbst tun?«). Gerade der letztere Schritt weist auf ein Selbstverständnis hin, das sich ausdrücklich von wie auch immer gearteten Pathologiekonzepten distanziert.
Ich möchte schon hier das Fazit meiner 54-jährigen Erfahrung mit einer großen Zahl von Transgendern vorwegnehmen, wie ich es in den folgenden Kapiteln, vor allem im Kapitel »Eigene Erfahrungen aus Begutachtungen und Behandlungen«, noch ausführlich darstellen und begründen werde: Nach meiner heutigen Auffassung können wir Transidentität und Transgender nicht als eine Störung der Geschlechtsidentität betrachten, sondern müssen sie als Identitätsvariante ansehen, die – wie die cis Identität – in sich das ganze Spektrum von psychischer Gesundheit bis Krankheit enthält.
Mit dieser sich ausdrücklich von den alten Pathologiekonzepten distanzierenden Sicht eröffnen sich in der Diskussion der Transidentität ganz neue Perspektiven.
Während das Postulat einer Pathologie vor allem zur Frage nach der Ätiologie des »Transsexualismus« geführt hat – mit der mehr oder weniger explizit genannten Hoffnung auf seine Veränderung oder »Beseitigung« – und damit eine Barriere zwischen den transidenten und den cis Personen aufgerichtet hat, erlaubt die Annahme, es handle sich um eine Identitätsvariante, die in keinem ursächlichen Zusammenhang mit Gesundheit oder Krankheit steht, einen wesentlich direkteren, unverstellten Zugang zu Transgendern. Dies hat unmittelbare Konsequenzen für den professionellen Umgang mit ihnen, wie ich ihn vor allem in den Kapiteln »Eigene Erfahrungen aus Begutachtungen und Behandlungen« und »Welche Hilfe können die Professionellen Transgendern bieten?« darstellen werde.
Außerdem ermöglicht es eine solche Ausgangsposition, die Herausforderung, die in der Transidentität liegt, zu erkennen und gesellschaftlich zu nutzen. Davon wird noch im Kapitel »Gendertheoretische Aspekte der Transidentität« die Rede sein.
An dieser Stelle sei noch eine Überlegung mitgeteilt: es ist eine Tatsache, dass die Frage nach der Ätiologie nur bei Phänomenen gestellt wird, die vom Verhalten der Mehrheitsgesellschaft abweichen (vgl. Binswanger, 2016; Rauchfleisch, 2021). So werden die Fragen »Woher kommt das?« und »Wie ist das entstanden?« beispielsweise nicht in Bezug auf die Heterosexualität und die Cisgeschlechtlichkeit, sondern nur bei den davon abweichenden Orientierungen Homo-, Bi-, Pan- und Asexualität, um nur die wichtigsten zu nennen, sowie der Transgeschlechtlichkeit gestellt. Hutfless (2016) hat in diesem Zusammenhang auf die verhängnisvollen Folgen (Ausschlüsse, Abwertungen und Pathologisierungen) solcher kategorialer Unterscheidungen (Homo-/Bisexualität vs. Heterosexualität oder Cis- vs. Transgeschlechtlichkeit) hingewiesen und als konstruktiven Umgang mit diesen Phänomenen vorgeschlagen, die sexuellen Orientierungen und die geschlechtlichen Identitäten als »dynamisch, instabil und prozesshaft« (Hutfless, 2016, S. 101) zu betrachten.
Exkurs: Das »Problem« der Nichtbinarität
Im Grunde ist die Nichtbinarität kein Problem. Aus diesem Grund habe ich das Wort in der Überschrift zu diesem Exkurs in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt. In der aktuellen Diskussion der Transidentität löst dieses Thema jedoch in der Öffentlichkeit wie auch im Fachbereich große Irritation aus. Während die einen die Nichtbinarität vehement mit dem Argument ablehnen, es sei insbesondere für Jugendliche ein von den Social Media propagierter »Hype«, ein »Modephänomen«, das »durch die mediale Aufmerksamkeit angefacht« worden sei (Blage, 2022), sehen andere in der Nichtbinarität den Motor einer dringend notwendigen Emanzipationsbewegung, geradezu die »Rettung« aus einer unsere Lebensgrundlagen bedrohenden Situation (Ebmeyer, 2023). Einen Ausweg aus der Enge der Binarität sieht Baltes-Löhr (2023) darin, das »Geschlecht als Kontinuum« zu verstehen, so der Titel ihres Buches (s. auch Rauchfleisch, 2024a und Vogler, 2023).
In Bezug auf psychologische und soziale Phänomene werden in unserer Kultur binäre Ordnungen (wie weiblich – männlich, Mensch – Tier, Natur – Kultur) beschrieben, die zu einer »Normativitätsauffassung« führen, »die sich historisch unterschiedlich zeigt und mit Macht aufgeladen wird« (Heimerl, 2022, S. 343). Besondere Beachtung hat das Prinzip Binarität – Nichtbinarität in der Diskussion der Geschlechtsidentitäten gefunden (Butler, 1991/2003), wobei das Denken in der binären Ordnung dazu führt, dass der eine Aspekt im Allgemeinen privilegiert wird, wodurch der andere entwertet wird. Daraus resultiert für die Genderdiskussion, dass das unsere Kultur stark prägende Modell der Binarität jegliche Abweichung davon ablehnt, bis hin zur Leugnung, dass es so etwas wie Nichtbinarität überhaupt gibt.
Das unsere Kultur prägende Denken in kategorialen Unterscheidungen und binären Strukturen hat bis heute einen großen Einfluss auch auf die Sexualforschung. So sind verschiedene Versuche, diese Strukturen zu hinterfragen, letztlich alle erfolglos geblieben. Dies gilt beispielsweise für die Forschung von Kinsey (1948, 1953), der die kategoriale Unterscheidung von Hetero-, Bi- und Homosexualität infrage gestellt und auf die fließenden Übergänge zwischen den sexuellen Orientierungen hingewiesen hat.