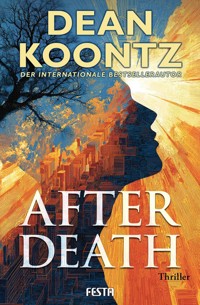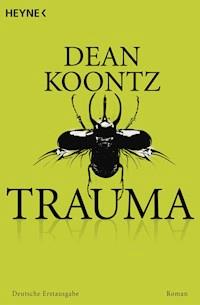
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jimmy Tock wird in der Sekunde geboren, in der sein Großvater stirbt. Doch kurz vor seinem Tode sprach der alte Mann noch ein letztes Mal in zusammenhängenden Worten: Er sagte die Geburtsgröße Jimmys und sein Gewicht voraus – aber auch fünf schreckliche Tage in seinem späteren Leben, die ihn und seine Lieben an den Rand der Existenz führen. Die ersten Informationen erweisen sich als auf Zentimeter und Gramm genau richtig – umso ernster weiß die Familie die Schreckensdaten zu nehmen. Dabei ist der Tag der Geburt noch gar nicht mitgerechnet, an dem bereits Fürchterliches passiert: Ein verrückter Clown, dessen Frau in den Geburtswehen stirbt, zieht seine Pistole und läuft wahllos mordend durchs Krankenhaus. Was für Schrecken mögen auf Jimmy dann erst in der Zukunft warten? Welche Albträume wird er noch durchleben müssen? Und welche unfassbar böse Kraft steht hinter all dem Unheil?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
DAS BUCH
Jimmy Tock wird in der Sekunde geboren, in der sein Großvater stirbt. Doch kurz vor seinem Tode sprach der alte Mann noch ein letztes Mal in zusammenhängenden Worten: Er sagte die Geburtsgröße Jimmys und sein Gewicht voraus – aber auch fünf schreckliche Tage in seinem späteren Leben, die ihn und seine Lieben an den Rand der Existenz führen. Die ersten Informationen erweisen sich als auf Zentimeter und Gramm genau richtig – umso ernster weiß die Familie die Schreckensdaten zu nehmen. Dabei ist der Tag der Geburt noch gar nicht mitgerechnet, an dem bereits Fürchterliches passiert: Ein verrückter Clown, dessen Frau in den Geburtswehen stirbt, zieht seine Pistole und läuft wahllos mordend durchs Krankenhaus.
Was für Schrecken mögen auf Jimmy dann erst in der Zukunft warten? Welche Albträume wird er noch durchleben müssen? Und welche unfassbar böse Kraft steht hinter all dem Unheil?
DER AUTOR
Dean Koontz wurde 1945 in Pennsylvania geboren und lebt heute mit seiner Frau in Kalifornien. Seine zahlreichen Romane – Thriller und Horrorromane – wurden sämtlich zu internationalen Bestsellern.
LIEFERBARE TITEL
Die Anbetung – Bote der Nacht – Chase – Der Geblendete – Die zweite Haut – Frankenstein / Das Gesicht – Frankenstein / Die Kreatur – Geschöpfe der Nacht – Im Bann der Dunkelheit – Kalt – Stimmen der Angst – Todesdämmerung – Vision – Der Wächter
Inhaltsverzeichnis
Für Laura Albano, die so ein gutes Herz hat. Eigenwilliges Köpfchen, aber gutes Herz.
Wer es nicht wagt, den Dorn zu fassen, Sollt’ jede Sehnsucht nach der Rose welken lassen.
ANNE BRONTË, »Der enge Weg«
Einen Seufzer dem, der mich liebt, Ein Lächeln für den, der mich hasst; Ob mein Himmel sich klärt oder trübt, Mein Herz ist auf alles gefasst.
LORD BYRON, »An Thomas Moore«
TEIL EINS
Willkommen auf der Welt, Jimmy Tock!
1
In der Nacht, in der ich geboren wurde, machte Josef Tock, mein Großvater väterlicherseits, zehn Prophezeiungen, die mein Leben bestimmen sollten. Dann starb er in genau der Minute, in der meine Mutter mich gebar.
Bis dahin hatte Josef sich nie als Prophet betätigt. Er war Konditor. Er machte Cremegebäck und Zitronentörtchen, keine Weissagungen.
Manche Leben werden so geradlinig geführt, dass sie sich wie ein eleganter Bogen von dieser Welt in die Ewigkeit hinüber spannen. Ich bin jetzt dreißig Jahre alt und kann nicht genau sagen, wie mein Leben in Zukunft verlaufen wird, aber mein Weg scheint weniger ein geradliniger Bogen als viel mehr eine Zickzacklinie von einer Krise zur anderen zu sein.
Ich bin ein Tollpatsch, womit ich nicht sagen will, dass ich irgendwie dämlich wäre, bloß dass ich ein bisschen kräftig für meine Größe bin und nicht immer genau weiß, wo meine Füße hin wollen.
Diese Wahrheit äußere ich nicht mit Selbstverachtung oder auch nur Demut. Meine Tollpatschigkeit macht offenbar einen Teil meines Charmes aus; sie ist eine geradezu vorteilhafte Eigenschaft, wie ihr noch sehen werdet.
Zweifellos fragt ihr euch jetzt, was ich mit dem Ausdruck »ein bisschen kräftig für meine Größe« sagen will. Eine Autobiographie zu schreiben ist eine kniffligere Aufgabe, als ich anfangs dachte.
Ich bin nicht so groß, wie manche Leute offenbar meinen. Verglichen mit einem professionellen Basketballspieler – oder auch bloß dem Mitglied einer Highschool-Mannschaft – bin ich jedenfalls überhaupt nicht besonders groß. Ich bin auch weder pummelig noch so muskulös wie einer von diesen Fitness-Freaks, die ständig Hanteln stemmen. Höchstens ein bisschen stämmig bin ich.
Trotzdem nennen mich Typen, die größer und schwerer sind als ich, oft »Dicker«. Mein Spitzname in der Schule war »Elch«. Seit meiner Kindheit höre ich Sprüche darüber, dass ich meiner Familie bestimmt die Haare vom Kopf fresse.
Der Widerspruch zwischen meiner wahren Größe und der Art und Weise, wie viele Leute mich wahrnehmen, hat mich immer verblüfft.
Meine Frau, die der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens ist, behauptet, ich hätte ein Auftreten, das viel eindrucksvoller sei als mein Körperbau. Sie sagt, die Leute würden mich nach dem Eindruck beurteilen, den ich auf sie mache.
Ich finde diese Vorstellung absurd. Das ist schlichtweg aus Liebe entstandener Bockmist.
Falls ich manchmal tatsächlich einen besonderen Eindruck auf irgendwelche Leute machen sollte, dann höchstwahrscheinlich, weil ich auf sie drauf geplumpst bin oder ihnen auf die Füße getreten habe.
In Arizona gibt es einen Punkt in der Landschaft, wo es so aussieht, als würde ein auf den Boden geworfener Ball der Schwerkraft zuwider den Hang hinaufrollen. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um eine perspektivische Täuschung, bei der die Elemente der äußerst ungewöhnlichen Landschaft so zusammenwirken, dass das Auge nicht mehr korrekt sehen kann.
Ich habe den Verdacht, dass es sich bei mir um eine ähnliche Laune der Natur handelt. Vielleicht wird das Licht von mir irgendwie seltsam reflektiert, oder es krümmt sich auf einzigartige Weise um mich herum, sodass ich wuchtiger aussehe, als ich bin.
In der Nacht, in der ich im Krankenhaus von Snow Village, Colorado, geboren wurde, hat mein Großvater einer Krankenschwester im Voraus mitgeteilt, ich würde eine Länge von einundfünfzig Zentimetern und ein Gewicht von dreitausendneunhundertzwanzig Gramm haben.
Von dieser Prophezeiung war die Schwester nicht deshalb verblüfft, weil dreitausendneunhundert Gramm besonders viel für ein Neugeborenes wären – viele sind schwerer –, oder weil es sich bei meinem Großvater um einen Konditor handelte, der sich plötzlich als Hellseher gebärdete. Vielmehr hatte er vier Tage vorher einen schweren Schlaganfall bekommen, durch den er rechtsseitig gelähmt war und nicht sprechen konnte; und trotzdem fing er in seinem Bett in der Intensivstation an, mit klarer Stimme – ohne jedes Nuscheln oder Zögern – Weissagungen zu machen.
Außerdem verkündete er der Schwester, ich würde um exakt zehn Uhr sechsundvierzig morgens geboren werden und an Syndaktylie leiden.
Syndaktylie ist – wie die Oberschwester meinem Vater erklärte – eine angeborene Fehlbildung, bei der zwei oder mehr Finger oder Zehen zusammengewachsen sind. In schweren Fällen sind die Knochen der nebeneinander liegenden Glieder so miteinander verschmolzen, dass zwei Finger einen gemeinsamen Nagel haben.
Mehrere Operationen sind erforderlich, um eine solche Fehlbildung zu korrigieren und dafür zu sorgen, dass das betreffende Kind später im Erwachsenenalter in der Lage ist, allen, über die es sich entsprechend ärgert, den Stinkefinger zu zeigen.
In meinem Fall waren die Zehen betroffen; am linken Fuß waren zwei zusammengewachsen, am rechten drei.
Meine Mutter Madelaine, die von meinem Vater liebevoll Maddy gerufen wird, behauptet steif und fest, sie hätten damals in Betracht gezogen, auf die Operation zu verzichten und mich Flipper zu taufen.
Flipper ist der Name eines Delphins, der die Hauptrolle in einer Fernsehserie spielte, die in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre äußerst beliebt war und – schau an, sieh da – den Titel Flipper trug. Meine Mutter meint, sie sei »köstlich, herrlich, irrsinnig dämlich« gewesen. Einige Jahre vor meiner Geburt wurde sie abgesetzt.
Flipper, ein Männchen, wurde von einem abgerichteten Delphinfräulein namens Suzi gespielt. Wahrscheinlich war dies das erste Mal, dass der Transvestismus Einzug ins Fernsehen hielt.
Natürlich ist das genau genommen nicht der richtige Ausdruck, weil Transvestismus sich auf Männer bezieht, die sich zum Lustgewinn wie eine Frau kleiden. Außerdem trug Suzi – alias Flipper – keine Kleider.
Es handelte sich also um eine Sendung, in der der weibliche Star immer nackt auftrat und kernig genug aussah, um als Mann durchzugehen.
Vorgestern beim Abendessen – meine Mutter hatte ihren berüchtigten Brokkoli-Käse-Auflauf gemacht – stellte sie die rhetorische Frage, ob es ein Wunder sei, dass der mit Flipper eingeleitete Zusammenbruch der Fernsehmoral zu der öden Monstrositätenschau geführt habe, aus der das heutige Fernsehen bestehe.
Mein Vater nahm den Faden auf. »Eigentlich hat es mit Lassie angefangen. Die war auch in jeder Folge nackt.«
»Lassie wurde immer von männlichen Hunden gespielt«, erwiderte meine Mutter.
»Na bitte«, sagte mein Vater zufrieden.
Ich kam um den Namen Flipper herum, weil meine Zehen durch eine Reihe erfolgreicher Operationen in den Normalzustand gebracht wurden. In meinem Fall war nur die Haut zusammengewachsen, nicht die Knochen. Die Trennung war eine relativ einfache Angelegenheit.
Nichtsdestoweniger hat sich die Weissagung, die mein Großvater in jener ungewöhnlich stürmischen Nacht gemacht hat, als wahr erwiesen.
Wäre ich in einer Nacht mit völlig unauffälligem Wetter geboren worden, so hätte die Familienlegende daraus eine unheimliche Ruhe fabriziert, in der alle Blätter reglos in der atemlosen Luft gehangen und die Nachtvögel erwartungsvoll geschwiegen hätten. Die Tocks haben eine stolze Tradition, sich selbst zu dramatisieren.
Selbst wenn ein wenig Übertreibung mit im Spiel gewesen sein sollte, muss das Unwetter so gewaltig gewesen sein, dass es die Berge von Colorado bis in ihre felsigen Grundfesten hinein erschütterte. Am Himmel blitzte und krachte es, als herrschte unter den dortigen Heerscharen ein wildes Schlachtgetümmel.
Solange ich mich noch im Mutterbauch befand, nahm ich die ganzen Donnerschläge nicht wahr. Und sobald ich geboren war, haben mich wahrscheinlich meine merkwürdigen Füße abgelenkt.
Es war der 9. August 1974, der Tag, an dem Richard Nixon als Präsident der Vereinigten Staaten zurücktrat.
Nixons Sturz hat nicht mehr mit mir zu tun als die Tatsache, dass »Annie’s Song« von John Denver damals landesweit an der Spitze der Hitparaden stand. Ich erwähne diese Dinge nur der historischen Perspektive wegen.
Nixon hin oder her, was ich bezüglich des 9. Augusts 1974 am bemerkenswertesten finde, sind meine Geburt – und die Prophezeiungen meines Großvaters. Mein perspektivisches Gefühl hat eben eine egozentrische Färbung.
Wegen der ebenso zahlreichen wie lebhaften Schilderungen, die in meiner Familie über diese Nacht kursieren, sehe ich sie möglicherweise deutlicher vor mir, als wenn ich dabei gewesen wäre. Ich sehe, wie mein Vater Rudy Tock von einem Ende des Krankenhauses zum anderen wandert, von der Geburtshilfeabteilung zur Intensivstation und wieder zurück, hin- und hergerissen von der Freude über die bevorstehende Ankunft seines Sohnes und dem Gram darüber, dass sein geliebter Vater immer schneller auf den Tod zugeht.
Mit seinem blau gefliesten Vinylboden, seinen unten blassgrün getäfelten und oben rosa getünchten Wänden, seiner gelben Decke und seinen orange-weißen Vorhängen mit Storchenmuster brodelte es im Wartezimmer für werdende Väter vor überschüssiger negativer Farbenergie. Hier hätte man gut einen Horrorfilm über den Moderator einer Kindersendung drehen können, der ein geheimes Zweitleben als Axtmörder führte.
Der Kette rauchende Clown tat auch nichts dazu, das Ambiente zu verbessern.
Neben Rudy wartete nämlich nur noch ein weiterer werdender Vater im Raum, kein Einheimischer, sondern ein Artist des Zirkus, der für eine Woche auf der Halloway-Farm seine Zelte aufgeschlagen hatte. Er nannte sich Beezo. Merkwürdigerweise war das nicht sein Name als Clown, sondern der, mit dem er geboren worden war: Konrad Beezo.
Manche behaupten, es gebe kein Schicksal und alles, was geschehe, tue das einfach, ohne Sinn und tiefere Bedeutung. Konrads Nachname wäre ein Gegenargument, meine ich.
Verheiratet war Beezo mit Natalie, einer Trapezkünstlerin. Sie stammte aus einer bekannten Familie von Hochseilartisten, die zum zirzensischen Adel gehörte.
Weder Natalies Eltern noch jemand von ihren Geschwistern oder ihren hoch fliegenden Cousins und Cousinen hatten Beezo ins Krankenhaus begleitet. An diesem Abend gab es eine Vorstellung, und die Show musste weitergehen – wie immer.
Offenbar machten die Trapezkünstler sich jedoch auch deswegen rar, weil sie es missbilligten, dass eine von ihnen einen Clown zum Mann genommen hatte. Jede Subkultur und jede Volksgruppe hat wohl ihre Vorurteile.
Während Beezo nervös auf die Niederkunft seiner Frau wartete, murmelte er unfreundliche Bemerkungen über seine angeheirateten Verwandten. »Selbstgefällig«, nannte er sie, und »hintenherum«.
Angesichts des finsteren Blicks, der rauen Stimme und der Bitterkeit des Clowns fühlte Rudy sich zunehmend unbehaglich.
Begleitet von Wolken dichten Zigarettenrauchs, quollen zornige Worte aus Beezos Mund: »heuchlerisch« und »intrigant« und, ziemlich poetisch für einen Clown: »muntere Geister der Lüfte, aber heimtückisch, sobald sie festen Boden unter den Füßen haben.«
Beezo trug nicht sein ganzes Kostüm. Abgesehen davon stand seine Manegenkleidung in der Tradition des traurigen Vagabunden, die deutlich dezenter ist als die bunten, bauschigen Gewänder mit Punktmuster, wie die meisten Clowns sie tragen. Eine komische Figur gab er trotzdem ab.
Auf dem Gesäß seiner ausgebeulten braunen Anzughose prangte ein greller Flicken mit Karomuster. Die Ärmel seiner Jacke waren viel zu kurz. Im Knopfloch blühte eine künstliche Blume, so groß wie ein Frühstücksteller.
Bevor er mit seiner Frau ins Krankenhaus gerast war, hatte er seine Clownsgaloschen gegen Turnschuhe getauscht und seine große, runde Gumminase abgenommen. Rund um die Augen war er jedoch immer noch weiß geschminkt, auf den Wangen lag dickes Rouge, und er trug einen zerbeulten runden Filzhut.
Beezos blutunterlaufene Augen leuchteten so scharlachrot wie seine geschminkten Wangen, vielleicht weil sein Kopf ständig in beißenden Zigarettenrauch gehüllt war. Rudy argwöhnte allerdings, dass womöglich auch Schnaps mit im Spiel war.
In jenen Tagen war Rauchen überall gestattet, selbst in vielen Krankenhauswartezimmern. Um die Ankunft ihres Sprösslings zu feiern, verteilten frisch gebackene Väter gern Zigarren.
Wenn er nicht gerade am Bett seines sterbenden Vaters saß, hätte der arme Rudy eigentlich Zuflucht in diesem Raum finden sollen. Dort hätte die Freude über seine baldige Vaterschaft seinen Gram lindern können.
Leider lagen sowohl Maddy wie auch Natalie sehr lange in den Wehen. Jedes Mal, wenn Rudy von der Intensivstation zurückkehrte, erwartete ihn der finster vor sich hinmurmelnde Clown mit den blutunterlaufenen Augen, der eine Packung filterlose Lucky Strike nach der anderen in Rauch aufgehen ließ.
Während dröhnender Donner den Himmel erschütterte und der Widerschein der Blitze durch die Fenster zuckte, machte Beezo aus dem Wartezimmer eine Bühne. Rastlos schritt er über den blauen Vinylboden, von einer rosafarbenen Wand zur anderen, und stieß zornige Rauchwolken aus.
»Na, was glaubst du, Rudy Tock – können Schlangen fliegen? Klar, das glaubst du nicht. Aber Schlangen können fliegen! Hab sie mit eigenen Augen hoch über der Manege gesehen. Die sind gut bezahlt und kriegen eine Menge Beifall, diese Kobras, diese Klapperschlangen, diese Ottern, diese abscheulichen Giftnattern!«
Auf diese Schmähreden reagierte der arme Rudy mit tröstendem Gemurmel, Zungenschnalzen und mitfühlendem Kopfnicken. Er wollte Beezo zwar nicht noch bestärken, hatte jedoch das Gefühl, dass mangelndes Mitleid ihn zum Ziel für die Wut des Clowns gemacht hätte.
Beezo blieb vor einem der regennassen Fenster stehen. Im Licht der Blitze warfen die Tropfen, die an der Scheibe herunterliefen, kleine Schatten, die sein weiß geschminktes Gesicht mit einem Tupfenmuster überzogen. »Was kriegst du eigentlich, Rudy Tock – Sohn oder Tochter?«, fragte er.
Beezo redete Rudy unweigerlich mit Vor- und Nachnamen an, als handelte es sich um ein Wort: Rudytock.
»Die haben hier eins von diesen neuen Ultraschallgeräten«, erwiderte Rudy, »also könnten sie uns sagen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, aber wir wollen es gar nicht wissen. Wir wollen bloß, dass das Baby gesund ist, das ist alles.«
Beezo richtete sich auf; er hob den Kopf und drehte sein Gesicht dem Fenster zu, als wollte er es im pulsierenden Gewitterlicht baden. »Ich brauche keinen Ultraschall, um rauszukriegen, was ich sowieso schon weiß. Natalie schenkt mir einen Sohn. Nun wird der Name Beezo nicht zugrunde gehen, wenn ich sterbe. Ich werde ihn Punchinello nennen, nach einem der ersten und größten aller Clowns.«
Punchinello Beezo, dachte Rudy. Ach, das arme Kind!
»Er wird zu den allergrößten unserer Zunft gehören«, fuhr Beezo fort. »Der beste Narr, Harlekin, Hanswurst wird er sein. Man wird ihm im ganzen Land zujubeln, ja auf jedem Kontinent. «
Obwohl Rudy gerade erst von der Intensivstation ins Wartezimmer zurückgekehrt war, fühlte er sich bereits als Geisel dieses Clowns, dessen finstere Energie jedes Mal, wenn sich Blitze in seinen fiebrigen Augen spiegelten, von neuem aufzuflammen schien.
»Er wird nicht nur berühmt werden, sondern unsterblich!«
Rudy sehnte sich nach Neuigkeiten über Maddys Zustand und den Fortschritt ihrer Wehen. In jenen Tagen wurden Väter nur selten im Kreißsaal zugelassen, um der Geburt ihrer Kinder beizuwohnen.
»Er wird der Zirkusstar seiner Zeit werden, Rudy Tock, und jeder, der seinen Auftritt sieht, wird wissen, dass sein Vater Konrad Beezo ist, der Patriarch der Clowns!«
Die Stationsschwestern, die eigentlich regelmäßig ins Wartezimmer hätten kommen sollen, um mit den dort harrenden Ehemännern zu sprechen, zeigten sich nicht so oft wie sonst. Zweifellos fühlten sie sich in Gegenwart dieses zornigen Hanswursts nicht besonders wohl.
»Beim Grab meines Vater schwöre ich, dass Punchinello niemals am Trapez hängen wird!«, verkündete Beezo.
Der Donner, der seinen Schwur unterstrich, war der erste von zwei derart mächtigen Schlägen, dass die Fensterscheiben wie Trommelfelle vibrierten und die Lampen nur noch schwach flackerten. Fast wären sie ganz ausgegangen.
»Was hat Akrobatik mit der Wahrheit des menschlichen Daseins zu tun?«, fragte Beezo.
»Nichts«, antwortete Rudy wie aus der Pistole geschossen, denn er war kein aggressiver Mensch. Vielmehr war er liebenswürdig und bescheiden. Er war noch kein Konditor wie sein Vater, sondern nur ein Bäcker, der nun, an der Schwelle zur Vaterschaft, unbedingt vermeiden wollte, von einem rabiaten Clown verdroschen zu werden.
»Komödie und Tragödie, das Werkzeug für die Kunst des Clowns – das ist die Essenz des Lebens«, erklärte Beezo.
»Komödie, Tragödie und ein guter Laib Brot«, sagte Rudy. Es war ein kleiner Scherz, mit dem er sein eigenes Handwerk in die der Lebensessenz dienenden Berufe einschloss.
Diese harmlose Frivolität trug ihm einen grimmig drohenden Blick ein, der wirkte, als könnte er nicht nur Uhren anhalten, sondern die Zeit erstarren lassen.
»Komödie, Tragödie und ein guter Laib Brot«, wiederholte Beezo, vielleicht um meinen Vater zu dem Eingeständnis zu bringen, dass sein Scherz ausnehmend albern gewesen sei.
»He«, sagte mein Vater, »das klingt ja genau wie ich«, denn der Clown hatte mit einer Stimme gesprochen, die sich fast so anhörte wie die meines Vaters.
»He, das klingt ja genau wie ich«, spottete Beezo mit Rudys Stimme. Dann fuhr er mit seinem eigenen, rauen Knurren fort: »Ich hab dir doch gesagt, dass ich begabt bin, Rudy Tock. Auf mehr Arten und Weisen, als du dir vorstellen kannst.«
Rudy meinte zu spüren, wie sein kalt gewordenes Herz langsamer schlug, fast so, als wollte es unter dem Einfluss dieses eisigen Blicks allmählich den Betrieb einstellen.
»Mein Junge wird nie am Trapez hängen. Die abscheulichen Nattern werden zwar zischen, oh, wie sie zischen und zappeln werden, aber Punchinello wird nie am Trapez hängen!«
Ein weiterer Donnerschlag brandete an die Mauern des Krankenhauses, und wieder gingen fast die Lichter aus.
Im Halbdunkel hätte Rudy schwören können, dass die Spitze der Zigarette in Beezos rechter Hand heller glomm, als zöge ein Gespenst mit gierigen Lippen daran – und das, obwohl der Clown sie zur Seite gedreht hielt.
Außerdem meinte Rudy zu sehen, dass Beezos Augen einen kurzen Moment so hell und rot glühten wie die Zigarette. Ein inneres Licht konnte das natürlich nicht sein, aber vielleicht der Widerschein von … irgendetwas.
Während das Echo des Donners verklang, ging auch der Spannungsabfall in der Stromversorgung vorüber, und als das Licht wieder heller wurde, stand Rudy auf.
Er war erst vor kurzem wieder ins Wartezimmer gekommen, aber obwohl er nichts Neues über seine Frau gehört hatte, war er bereit, lieber zu der schrecklichen Szene in der Intensivstation zurückzuflüchten, statt in Gesellschaft von Konrad Beezo einen dritten apokalyptischen Donnerschlag samt dem damit verbundenen Dunkel zu erleben.
Als er die Intensivstation betrat und zwei Schwestern am Bett seines Vaters sitzen sah, fürchtete Rudy das Schlimmste. Obgleich er wusste, dass Josef im Sterben lag, spürte er einen Kloß im Hals und Tränen in den Augen, weil er das Ende kommen sah.
Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass Josef in seinem Bett halb aufrecht saß. Er klammerte sich mit den Händen an den Seitengeländern fest und wiederholte erregt die Prophezeiungen, die er einer der beiden Schwestern bereits mitgeteilt hatte: »Einundfünfzig Zentimeter … dreitausendneunhundertzwanzig Gramm … heute Nacht um zehn Uhr sechsundvierzig … Syndaktylie …«
Als Josef seinen Sohn erblickte, zog er sich ganz zum Sitzen hoch, und eine der Schwestern stellte die obere Betthälfte höher, um seinen Rücken zu stützen.
Er hatte nicht nur die Sprache wiedererlangt, sondern schien auch die halbseitige Lähmung überwunden zu haben, die der Schlaganfall hervorgerufen hatte. Als er Rudys rechte Hand packte, war sein Griff fest, ja geradezu schmerzhaft.
Verblüfft angesichts dieser Entwicklung, nahm Rudy zuerst an, sein Vater sei auf wundersame Weise irgendwie genesen. Dann jedoch spürte er die Verzweiflung eines Sterbenden, der eine wichtige Botschaft mitzuteilen hatte.
Josefs abgehärmtes Gesicht sah so eingefallen aus, als habe der Tod wie ein Taschendieb schon vor Tagen begonnen, ihm seine Lebensenergie zu stehlen, Gramm für Gramm. Die Augen hingegen wirkten riesig. Furcht schärfte seinen Blick, als er ihn fest auf seinen Sohn richtete.
»Fünf Tage«, sagte Josef mit qualvoll rauer Stimme. Er war förmlich ausgedörrt, weil er nur intravenös mit Flüssigkeit versorgt worden war. »Fünf schreckliche Tage!«
»Ganz ruhig, Dad, reg dich nicht auf«, mahnte Rudy, sah jedoch auf dem EKG-Monitor, dass die schillernde Kurve, die den Herzschlag seines Vaters anzeigte, ein nahezu regelmäßiges Muster hatte.
Eine der Schwestern ging hinaus, um einen Arzt zu rufen. Die andere trat vom Bett zurück und blieb wartend stehen, um sofort helfen zu können, falls der Patient einen neuen Schlaganfall bekam.
Josef leckte sich über die aufgesprungenen Lippen, um seinem Flüstern einen Weg zu bahnen, dann machte er seine fünfte Prophezeiung: »James. Er wird James heißen, aber niemand wird ihn James nennen. Jim auch nicht. Alle werden ihn Jimmy rufen.«
Rudy war verblüfft. Er und Maddy hatten tatsächlich den Namen James ausgesucht, falls das Baby ein Junge werden sollte, und Jennifer für ein Mädchen. Darüber gesprochen hatten sie allerdings mit niemandem.
Auch Josef konnte es also nicht gewusst haben. Und doch wusste er es.
Mit zunehmender Dringlichkeit fuhr Josef fort: »Fünf Tage. Du musst ihn warnen. Fünf schreckliche Tage.«
»Ruhig, Dad«, wiederholte Rudy. »Du wirst wieder gesund.«
Sein Vater, bleich wie ein angeschnittenes Weißbrot, wurde noch bleicher, bis sein Gesicht weißer war als Mehl in einem Messbecher. »Ich werde nicht gesund. Ich sterbe.«
»Du stirbst nicht. Schau dich doch an. Die Lähmung ist vorbei, und du …«
»Ich sterbe«, beharrte Josef. Seine raue Stimme wurde lauter, in den Schläfen pochte das Blut, und die Anzeige auf dem Monitor wurde hektischer, während er versuchte, die beruhigenden Worte seines Sohnes abzuwehren und ihn zur Aufmerksamkeit zu zwingen. »Fünf Daten. Schreib sie auf. Schreib sie jetzt auf. Jetzt sofort!«
Verwirrt und voller Angst, das hartnäckige Drängen könnte einen weiteren Schlaganfall auslösen, besänftigte Rudy seinen Vater.
Er borgte sich von der Schwester einen Kugelschreiber. Papier hatte sie keines, und die am Fußende des Betts hängende Patientenkarte ließ sie ihn nicht benutzen.
Aus seinem Portemonnaie zog Rudy den ersten Gegenstand, auf dem genügend freier Platz zum Schreiben war: ausgerechnet eine Freikarte für den Zirkus, in dem Beezo auftrat.
Die Karte hatte Rudy eine Woche vorher von Huey Foster bekommen, einem Beamten der örtlichen Polizei. Die beiden waren seit ihrer Kindheit miteinander befreundet.
Eigentlich hatte Huey Konditor werden wollen wie Rudy. Er hatte jedoch kein Talent für eine Karriere in der Backstube. An seinen Muffins biss man sich die Zähne aus. Seine Zitronentörtchen beleidigten jeden Gaumen.
Wenn Huey dank seines Jobs etwas umsonst bekam – Eintrittskarten für den Zirkus, Freifahrscheine für die Fahrgeschäfte auf dem Rummelplatz, Probepackungen Patronen von verschiedenen Munitionsfabriken –, gab er Rudy etwas davon ab. Im Gegenzug versorgte Rudy seinen Freund mit Keksen, die einem nicht den Appetit verdarben, Kuchen, bei deren Geruch man nicht die Nase rümpfte, sowie Torten und Strudeln, bei denen es einem nicht hochkam.
Auf der Vorderseite der Freikarte prangten rote und schwarze Blockbuchstaben, geschmückt mit Elefanten und Löwen; die Rückseite war leer. Auseinandergefaltet war das Billett etwa acht mal dreizehn Zentimeter groß und bot damit so viel Platz wie eine mittlere Karteikarte.
Während heftiger Regen an ein nahes Fenster prasselte und das Geräusch unzähliger trappelnder Füße entstehen ließ, klammerte sich Josef wieder ans Geländer, um sich zu verankern. Vielleicht hatte er Angst davonzuschwimmen. »Neunzehnhundertvierundneunzig. Fünfzehnter September. Ein Donnerstag. Schreib das auf!«
Rudy, der neben dem Bett stand, nahm das Diktat auf. Er tat dies in der gestochenen Schrift, mit der er seine Rezeptkarten ausfüllte: DONNERSTAG, 15. SEPT. 1994.
Josefs weit aufgerissene Augen blickten wild wie die eines Kaninchens, das einen hungrigen Kojoten im Visier hat. Er starrte auf einen Punkt hoch oben an der Wand gegenüber seinem Bett. Dabei schien er noch etwas anderes zu sehen als die Wand, etwas dahinter. Vielleicht die Zukunft.
»Warne ihn«, sagte der Sterbende. »Um Gottes willen, warne ihn!«
Verdutzt fragte Rudy: »Wen soll ich warnen?«
»Jimmy. Deinen Sohn Jimmy, meinen Enkel.«
»Der ist doch noch gar nicht geboren.«
»Gleich. Noch zwei Minuten. Warne ihn! Neunzehnhundertachtundneunzig. Neunzehnter Januar. Ein Montag.«
Wie gebannt von dem gespenstischen Ausdruck auf dem Gesicht seines Vaters, stand Rudy mit über dem Papier schwebendem Kugelschreiber da.
»Schreib es auf!«, brüllte Josef. Sein Mund verzog sich dabei so gewaltsam, dass seine trockene, rissige Unterlippe platzte. Ein roter Faden floss langsam am Kinn hinab.
»Neunzehnhundertachtundneunzig«, murmelte Rudy beim Schreiben.
»Neunzehnter Januar«, wiederholte Josef krächzend. Der Schrei hatte seine ausgedörrte Kehle ruiniert. »Ein Montag. Schrecklicher Tag.«
»Wieso?«
»Schrecklich, schrecklich.«
»Und wieso wird er schrecklich sein?«, fragte Rudy hartnäckig.
»Zweitausendzwei. Dreiundzwanzigster Dezember. Wieder ein Montag.«
Rudy notierte das dritte Datum. »Dad, mir wird langsam unheimlich«, sagte er dabei. »Ich hab keine Ahnung, was das soll.«
Josef klammerte sich immer noch links und rechts an dem eisernen Bettgeländer fest. Plötzlich schüttelte er es so heftig und mit so unvermuteter Kraft, dass sich das Geländer förmlich aus den Scharnieren zu lösen schien. Das Klappern hätte sich auch in einem gewöhnlichen Krankenzimmer laut angehört, aber in der sonst mucksmäuschenstillen Intensivstation klang es wie eine Detonation.
Zuerst stürzte die Schwester, die das Ganze besorgt beobachtete, aufs Bett zu, vielleicht um den Patienten zu beruhigen, aber dann hielt sie inne. Offenbar schreckte die alarmierende Kombination von wildem Zorn und Grauen, die Josefs bleiches Gesicht verzerrte, sie ab. Als dann auch noch das Gebäude von einem derart heftigen Donnerschlag erschüttert wurde, dass Staub von den schalldämpfenden Deckenfliesen rieselte, zog sie sich wieder zurück. Fast hatte es den Anschein, als dächte sie, Josef könnte die Detonation selbst heraufbeschworen haben.
»Schreib es auf!«, forderte er.
»Hab ich ja schon getan«, beruhigte ihn Rudy. »Dreiundzwanzigster Dezember zwotausendzwo, wieder ein Montag.«
»Zweitausenddrei«, sagte Josef eindringlich. »Der sechsundzwanzigste November. Ein Mittwoch. Der Tag vor Thanksgiving.«
Nachdem Rudy auch dieses vierte Datum auf der Rückseite der Freikarte notiert hatte, hob er den Kopf. Sein Vater hatte gerade eben damit aufgehört, am Bettgeländer zu rütteln, und Rudy sah plötzlich eine andere Gemütsbewegung in Josefs Gesicht, in seinen Augen. Der Zorn und das Grauen waren verschwunden.
In Josefs Augen stiegen Tränen. »Armer Jimmy, armer Rudy«, sagte er.
»Dad?«
»Armer, armer Rudy. Armer Jimmy. Wo ist Rudy?«
»Ich bin Rudy, Dad. Bin direkt neben dir.«
Josef blinzelte, einmal, zweimal. Die Tränen versiegten, und ein anderes Gefühl ergriff ihn, das nicht so leicht zu definieren war. Man hätte es Verwunderung nennen können, vielleicht auch ein Staunen der reinen, unverfälschten Art, wie es ein Säugling zeigt, wenn er zum ersten Mal ein bunt schillerndes Zauberding erblickt.
Nach einem Augenblick erkannte Rudy es als einen Zustand, der tiefer reichte als bloßes Staunen. Es war Ehrfurcht, die vollständige Verneigung des Geistes vor etwas unendlich Großem und Gewaltigem.
Die Augen seines Vaters leuchteten vor Verblüffung. Auf seinem Gesicht standen Entzücken und Furcht im Widerstreit.
Josefs immer heiserer werdende Stimme senkte sich zu einem Flüstern: »Zweitausendfünf.«
Sein Blick blieb auf eine andere Wirklichkeit gerichtet, die er offenbar überzeugender fand als diese Welt, in der er siebenundfünfzig Jahre lang gelebt hatte.
Mit zitternder Hand, wenn auch noch immer lesbar, notierte Rudy die fünfte Jahreszahl und wartete.
»Ah«, sagte Josef, als hätte sich ihm ein erschreckendes Geheimnis offenbart.
»Dad?«
»Bloß das nicht, bloß das nicht!«, klagte Josef.
»Dad, was ist denn?«
Die verunsicherte Schwester wagte sich näher ans Bett heran. Offenbar überstieg ihre Neugier nun die Angst.
Ein Arzt betrat den kleinen Raum. »Was ist denn hier los?«
»Trau bloß dem Clown nicht!«, sagte Josef gerade.
An der leicht gekränkten Miene des Arztes war zu erkennen, dass er meinte, der Patient habe seine medizinischen Fähigkeiten in Zweifel gezogen.
Rudy beugte sich übers Bett, um seinen Vater aus dessen visionärem Zustand wieder ins Diesseits zurückzuholen. »Dad, woher weißt du etwas von diesem Clown?«, fragte er.
»Der sechzehnte April«, sagte Josef. »Woher weißt du von diesem Clown?«
»Schreib es auf!«, donnerte Josef. Im selben Augenblick rannte der Himmel erneut gegen die Erde an.
Während der Arzt zur anderen Seite des Betts ging, schrieb Rudy das Datum auf die Rückseite der Freikarte. Als sein Vater den Tag nannte, komplettierte er die fünfte Zeile mit »SAMS-TAG«.
Der Arzt griff mit der Hand unter Josefs Kinn und drehte ihm den Kopf zur Seite, um ihm besser in die Augen schauen zu können.
»Er ist nicht der, für den du ihn hältst«, sagte Josef, nicht zum Arzt, sondern zu seinem Sohn.
»Wer ist nicht wer?«, fragte Rudy.
»Er.«
»Wer ist er?«
»Also bitte, Mr. Tock«, sagte der Arzt tadelnd, »Sie wissen ganz genau, wer ich bin. Ich bin Dr. Pickett.«
»Ach, welch Tragödie!«, sagte Josef mit einer Stimme voller Jammer, als wäre er kein Konditor, sondern ein Schauspieler in einem Shakespeare-Drama.
»Was für eine Tragödie?«, erkundigte sich Rudy bekümmert.
Dr. Pickett zog ein Ophthalmoskop aus der Tasche seines weißen Kittels. »Hier gibt’s keine Tragödie«, widersprach er. »Was ich da sehe, ist ein bemerkenswerter Fortschritt.«
Josef entzog sich dem Kinngriff des Arztes. »Nieren!«, sagte er mit zunehmender Erregung.
»Nieren?«, wiederholte Rudy fassungslos.
»Verdammt noch mal, warum sind Nieren bloß so wichtig?«, sagte Josef. »Es ist absurd, das Ganze ist total absurd!«
Bei diesen Worten verließ Rudy endgültig der Mut, denn es hatte den Anschein, als verwandelte sich die kurze geistige Klarheit seines Vaters in unzusammenhängendes Gestammel.
Dr. Pickett brachte seinen Patienten unter Kontrolle, indem er ihn wieder am Kinn packte; dann schaltete er das Ophthalmoskop ein und richtete das Licht auf Josefs rechtes Auge.
Josef Tock stieß mit explosiver Kraft die Luft aus, als wäre der feine Lichtstrahl eine Nadel, die sich in sein Leben bohrte wie in einen Luftballon. Er sank auf sein Kissen zurück und war tot.
Mit sämtlichen Methoden und Instrumenten, die einem gut ausgestatteten Krankenhaus zur Verfügung stehen, wurden Wiederbelebungsversuche unternommen, aber zwecklos. Josef war ins Jenseits weitergezogen und kam nicht mehr zurück.
Dafür kam ich, James Henry Tock, auf die Welt. Die Zeit auf dem Totenschein meines Großvaters entspricht der auf meiner Geburtsurkunde: 22.46 Uhr.
Verständlicherweise blieb Rudy an Josefs Bett stehen. Er hatte seine Frau zwar nicht vergessen, doch der Gram lähmte ihm die Glieder.
Fünf Minuten später teilte ihm eine Schwester mit, dass Maddys Wehen ein kritisches Stadium erreicht hätten, weshalb er sofort zu ihr eilen müsse.
Bestürzt von der Aussicht, in derselben Stunde Vater und Frau zu verlieren, floh Dad aus der Intensivstation.
So wie er die Geschichte erzählt, waren die Flure unseres bescheidenen Landkrankenhauses zu einem weiß getünchten Labyrinth geworden. Mindestens zweimal bog er falsch ab. Zu ungeduldig, um auf den Aufzug zu warten, rannte er über die Treppe vom zweiten Stock ins Erdgeschoss hinunter, wo ihm einfiel, dass die Geburtshilfeabteilung sich im ersten Stock befand.
Genau in dem Moment, als Dad im Wartezimmer eintraf, krachte dort ein Pistolenschuss. Konrad Beezo hatte den behandelnden Arzt seiner Frau erschossen.
Am Anfang dachte Dad, Beezo hätte eine Clownpistole verwendet, eine Spielzeugwaffe, aus der rote Tinte spritzte. Allerdings stürzte der Arzt nicht mit komischem Überschwang zu Boden, sondern mit grässlicher Endgültigkeit, und auch der Geruch von Blut, der sich verbreitete, war nur allzu realistisch.
Beezo drehte sich zu Dad um und hob die Pistole.
Trotz des zerbeulten Filzhuts, der kurzärmeligen Jacke und des bunten Flickens auf dem Hosenboden, trotz der weißen Schminke und der rot bemalten Wangen war in diesem Augenblick nichts an Konrad Beezo clownesk. Seine Augen waren die einer Dschungelkatze, und man konnte sich leicht vorstellen, dass es sich bei seinen gefletschten Zähnen um die Fänge eines Tigers handelte. Dämonisch stand er da, ein Musterbild mörderischen Wahnsinns.
Dad meinte schon, auch er werde nun erschossen, doch Beezo sagte: »Aus dem Weg, Rudy Tock. Mit dir hab ich nichts zu schaffen. Du bist kein Trapezkünstler.«
Beezo stieß mit der Schulter die Tür zur Entbindungsstation auf, marschierte hindurch und schlug sie hinter sich wieder zu.
Dad kniete sich neben den Arzt und stellte fest, dass diesem noch ein letzter Lebenshauch geblieben war. Der Verwundete versuchte zu sprechen, doch es gelang ihm nicht. Offenbar war ihm Blut in den Hals gelaufen, denn er würgte.
Behutsam hob Dad den Kopf des Arztes an und schob ein paar alte Zeitschriften darunter, um ihm das Atmen zu erleichtern. Dann rief er um Hilfe, während das wieder auffrischende Gewitter die Nacht mit apokalyptischen Donnerschlägen erschütterte.
Der Arzt hieß Ferris MacDonald und war Maddys Gynäkologe. Man hatte ihn hinzugezogen, um sich zusätzlich um Natalie Beezo zu kümmern, als diese unerwartet mitten in den Wehen ins Krankenhaus gebracht worden war.
Obwohl Dr. MacDonald tödlich verwundet war, sah er eher verdutzt als verängstigt aus. Nachdem es ihm gelungen war, sich zu räuspern und wieder zu atmen, erklärte er meinem Vater: »Sie ist bei der Geburt gestorben, aber mein Fehler war das nicht.«
Einen grauenhaften Augenblick lang dachte mein Dad, Maddy sei gestorben.
Das merkte Dr. MacDonald, denn seine letzten Worte lauteten: »Nicht Maddy. Die Frau des Clowns. Maddy … ist am Leben. Es tut mir so leid, Rudy.«
Ferris MacDonald starb mit der Hand meines Vaters auf seinem Herzen.
Während der Donner auf einen fernen Horizont zurollte, hörte Dad hinter der Tür, durch die Konrad Beezo verschwunden war, einen weiteren Schuss.
Irgendwo hinter dieser Tür lag Maddy, seine Frau, die nach ihren schweren Wehen völlig hilflos war. Auch ich war dort drin, ein Säugling, noch nicht fähig, sich zu wehren.
Mein Vater, damals noch Bäcker, war nie ein Mann der Tat gewesen; das wurde er auch dann nicht, als er einige Jahre später zum Status des Konditormeisters aufstieg. Er ist durchschnittlich groß und schwer, körperlich zwar nicht gerade schwach, aber auch nicht für den Boxring geboren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er ein angenehmes Leben geführt, ohne irgendeine schlimme Not, ohne jeden Streit.
Die Angst um seine Frau und sein Kind versetzte ihn dennoch in eine seltsame, kalte Panik, die sich eher durch Berechnung als durch Hysterie auszeichnete. Ohne Waffe und Plan, aber urplötzlich mit dem Mut eines Löwen ausgestattet, stieß er die Tür auf, um Beezo zu verfolgen.
Obwohl seine Fantasie innerhalb weniger Sekunden tausend blutige Szenarien spann, sagt mein Vater heute, er habe nicht vorhergesehen, was dann tatsächlich geschah. Noch weniger vorhersehen konnte er natürlich, welche schrecklichen und erstaunlichen Folgen die Geschehnisse jener Nacht in den folgenden dreißig Jahren auf sein Leben und auf meines haben sollten.
2
In unserem Krankenhaus führt die innere Tür des Wartezimmers für werdende Väter in einen kurzen Flur, in dem sich linker Hand ein Lagerraum und rechter Hand eine Toilette befinden. Die Neonlampen an der Decke, die weißen Wände und die weißen Keramikfliesen des Bodens zeugen von mustergültiger Keimfreiheit.
Ich kenne diesen Flur, weil mein eigenes Kind in derselben Geburtshilfeabteilung das Licht der Welt erblickt hat – in einer ebenso unvergesslichen Nacht voll unvergleichlichem Chaos.
In jener Unwetternacht des Jahres 1974, in der Richard Nixon heimwärts nach Kalifornien entschwunden und Beezo auf Randale gegangen war, sah mein Vater auf dem Boden eine Krankenschwester liegen. Sie war aus nächster Nähe erschossen worden.
Er erinnert sich noch daran, dass er vor Mitgefühl und Verzweiflung fast auf die Knie gesunken wäre.
So schrecklich der Tod von Dr. MacDonald gewesen war, er war Dad nicht richtig ins Bewusstsein gedrungen, weil er so plötzlich und surreal gewesen war. Nun, wenige Augenblicke später, schnitt ihm der Anblick dieser toten Schwester – jung, hübsch, wie ein gefallener Engel in weißen Gewändern, mit goldenem Haar, das wie ein Heiligenschein das merkwürdig heitere Gesicht umrahmte – mit ganzer Wucht ins Herz, sodass er die Wahrheit und die Bedeutung der beiden Tode auf einmal begriff.
Er riss die Tür des Lagerraums auf, um nach etwas zu suchen, was er als Waffe verwenden konnte. Leider fand er nur frische Laken, Flaschen mit antiseptischem Reiniger, einen verschlossenen Medikamentenschrank …
Im Rückblick kommt ihm seine Denkweise in diesem Moment seltsam komisch vor, aber damals meinte er mit feierlichem Ernst und mit der Logik der Verzweiflung, er habe im Verlauf der Jahre so viel Teig geknetet, dass seine Hände gefährlich stark geworden seien. Wenn er es schaffte, Beezos Pistole auszuweichen, dann würde er bestimmt genügend Kraft haben, um ihn zu erwürgen – schließlich konnte doch keine provisorische Waffe jemals so tödlich sein wie die gestählten Hände eines zornigen Bäckers. Das blanke Entsetzen, das diese irrsinnige Idee hervorgebracht hatte, verlieh ihm merkwürdigerweise auch noch echten Mut.
Der kurze Flur kreuzte sich mit einem längeren, der nach links und rechts führte. In diesem neuen Flur gab es drei Türen. Zwei führten in die beiden Entbindungszimmer, die dritte in die Säuglingsstation, wo die gewindelten Neugeborenen in ihren Körbchen lagen und über ihre neue Realität aus Licht, Schatten, Hunger, Unzufriedenheit und Steuern nachsannen.
Dad suchte meine Mutter und mich, fand jedoch nur sie. Allein und bewusstlos lag sie in einem der Entbindungszimmer auf dem Geburtsbett.
Zuerst dachte er, sie müsse tot sein. Um ihn wurde es Nacht, doch bevor er endgültig in Ohnmacht fiel, sah er, dass seine geliebte Maddy atmete. Er klammerte sich an der Kante ihres Bettes fest, bis es ihm vor den Augen wieder heller wurde.
Mit ihrem grauen, in Schweiß gebadeten Gesicht sah sie nicht wie die lebhafte Frau aus, die er kannte, sondern zart und zerbrechlich.
Blut auf den Laken wies darauf hin, dass sie entbunden hatte, doch ein schreiendes Kind war nirgendwo zu sehen.
Irgendwo anders brüllte Beezo: »Wo seid ihr, ihr Schweine?«
Obwohl er meine Mutter nur äußerst ungern allein ließ, machte Dad sich nichtsdestoweniger zum Ort des Getümmels auf, um zu schauen, inwiefern er helfen konnte, was – so behauptet er jedenfalls – wohl jeder Bäcker getan hätte.
Auf dem Geburtsbett des zweiten Entbindungszimmers sah er Natalie Beezo liegen. Die schlanke Trapezkünstlerin war erst vor so kurzer Zeit an den Komplikationen der Geburt gestorben, dass ihre Leidenstränen auf den Wangen noch nicht getrocknet waren.
Laut Dad war sie selbst im Tod und nach all den Qualen noch zauberhaft schön. Ein makellos olivfarbener Teint. Rabenschwarzes Haar. Ihre Augen waren von einem so offenen, leuchtenden Grün, dass sie aussahen wie Fenster zu einer Wiese im Himmel.
Für Konrad Beezo, der unter der Schminke sicher nicht besonders gut aussah, der keine besonderen Besitztümer sein Eigen nannte und dessen Persönlichkeit selbst unter gewöhnlichen Umständen zumindest ein klein wenig unsympathisch sein musste, war diese Frau zweifellos ein unglaublicher Schatz gewesen. Seine gewaltsame Reaktion auf ihren Verlust konnte man daher durchaus verstehen, wenn auch nicht rechtfertigen.
Als Dad aus dem zweiten Entbindungszimmer trat, stand er dem mörderischen Clown unversehens Auge in Auge gegenüber. Beezo hatte die Tür der Säuglingsstation aufgestoßen und war in den Flur gestürmt. In seiner linken Armbeuge lag ein in eine Decke gewickelter Säugling.
Auf so nahe Entfernung sah die Pistole in seiner rechten Hand doppelt so groß aus wie vorher im Wartezimmer. Dad fühlte sich an Alice im Wunderland erinnert, wo die Gegenstände ohne Rücksicht auf die Vernunft und die Gesetze der Physik abwechselnd größer wurden oder schrumpften.
Vielleicht hätte mein Vater Beezo am Handgelenk gepackt und mit seinen starken Bäckerhänden um den Besitz der Waffe gekämpft, aber er wagte es nicht, irgendetwas zu tun, was das Baby gefährdet hätte.
Das Baby wiederum sah mit seinem verkniffenen roten Gesicht und der gefurchten Stirn entrüstet und beleidigt aus. Sein Mund stand weit offen, als hätte es losgebrüllt, wenn es nicht von der Erkenntnis geschockt gewesen wäre, dass sein Vater ein wahnsinniger Clown war.
Ich muss dem Himmel für das Baby danken, hat Dad oft gesagt. Wenn es nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt mausetot. Du wärst vaterlos aufgewachsen und hättest nie gelernt, eine erstklassige Crème brulée zu machen.
Im linken Arm das Baby, in der rechten Hand die Pistole, herrschte Beezo meinen Vater an: »Wo sind sie, Rudy Tock?«
»Wo ist wer?«, fragte Dad.
Der rotäugige Clown schien gleichermaßen von Gram gebeugt und von Zorn zerrissen zu sein. Tränen liefen ihm über die Schminke. Seine Lippen zitterten, als könnte er jeden Augenblick unbeherrscht losschluchzen, aber dann zogen sie sich zu einem derart grausamen Ausdruck von den Zähnen zurück, dass Dad einen eisigen Stich in den Eingeweiden spürte.
»Stell dich nicht blöder, als du bist«, sagte Beezo warnend. »Da müssen doch noch mehr Schwestern dabei gewesen sein, vielleicht auch noch ein zweiter Arzt. Ich will die Schweine alle umbringen, alle, die Natalie im Stich gelassen haben!«
»Die sind weggerannt«, sagte mein Vater, weil er es für besser hielt zu lügen, als wahrheitsgemäß darauf zu bestehen, dass er kein weiteres medizinisches Personal gesehen hatte. »Sie haben sich hinter deinem Rücken rausgeschlichen, als du reingekommen bist, durchs Wartezimmer. Jetzt sind sie schon lange fort.«
Von seinem Zorn genährt, schien Konrad Beezo anzuschwellen, als wäre Zorn die Speise von Riesen. Nicht die geringste Spur zirzensischer Possenreißerei erhellte sein Gesicht, und der Hass in seinen Augen war so tödlich wie das Gift einer Kobra.
Um nicht als Ersatz für das Personal zu dienen, das sich nicht mehr in Beezos Reichweite befand, fügte Dad rasch hinzu: »Die Polizei ist auf dem Weg hierher. Sie will dir das Baby wegnehmen. « Er sagte das ohne jeden drohenden Ton in der Stimme, so als wollte er nur hilfreich sein.
»Mein Sohn gehört mir!«, erklärte Beezo mit solcher Leidenschaft, dass man den Gestank des schalen Zigarettenrauchs, der aus seiner Kleidung aufstieg, fast für eine Ausdünstung seiner feurigen Gefühle hätte halten können. »Ich werde alles tun, damit er nicht von den Trapezkerlen aufgezogen wird«, sagte er.
Mit seiner Erwiderung beschritt mein Vater einen schmalen Grat zwischen kluger Manipulation und offenkundiger Schmeichelei im Interesse der Selbsterhaltung: »Dein Junge wird der Größte deiner Zunft werden – der tollste Clown, Narr, Harlekin, Franzwurst.«
»Hanswurst«, berichtigte der Mörder, aber ohne Feindseligkeit. »Ja, er wird der Größte sein. Das wird er. Und ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand meinem Sohn sein Schicksal verbaut!«
Mit Baby und Pistole drängte Beezo sich an meinem Dad vorbei und eilte den kurzen Flur entlang. Über die tote Krankenschwester trat er so achtlos hinweg, als hätten ihm Eimer und Mopp der Putzfrau im Weg gestanden.
So fieberhaft Dad auch versuchte, sich etwas einfallen zu lassen, womit er den Mörder aufhalten konnte, ohne das Baby in Gefahr zu bringen – er konnte ihm nur frustriert hinterherschauen.
Als Beezo die Tür zum Wartezimmer erreicht hatte, zögerte er und warf einen Blick zurück. »Ich werde dich nie vergessen, Rudy Tock. Niemals!«
Meinem Vater wurde nicht recht klar, ob es sich bei dieser Ankündigung um den Ausdruck fehlgeleiteter Zuneigung handelte – oder um eine Drohung.
Beezo stieß die Tür auf und verschwand.
Sogleich eilte Dad in das andere Entbindungszimmer zurück, weil seine erste Sorge verständlicherweise meiner Mutter und mir galt.
Noch immer lag meine Mutter auf dem Geburtsbett, auf dem Dad sie vor wenigen Augenblicken entdeckt hatte. Sie hatte auch noch immer ein graues Gesicht und war schweißgebadet, aber immerhin war sie wieder bei Bewusstsein.
Sie stöhnte vor Schmerz und blinzelte vor Verwirrung.
Ob sie nur desorientiert oder regelrecht im Delirium war, ist heute ein gewisser Streitpunkt zwischen meinen Eltern. Mein Vater behauptet jedenfalls, er habe Angst um sie gehabt, als sie gesagt habe: »Wenn du zum Abendessen Käse aufs Brot willst, müssen wir noch in den Supermarkt, welchen kaufen.«
Mom hingegen behauptet, in Wirklichkeit habe sie gesagt: »Glaub nach dem ganzen Theater hier bloß nicht, dass du mich jemals wieder anrühren darfst, du mieser Bock.«
Die Liebe der beiden reicht tiefer als Begierde, als Zuneigung, als Achtung, so tief, dass ihre Quelle der Humor ist. Humor ist ein Blatt an der Blüte der Hoffnung, und die Hoffnung blüht an der Ranke des Vertrauens. Die beiden haben Vertrauen zueinander und Vertrauen darin, dass das Leben Sinn hat. Aus diesem Vertrauen entsteht ihre unerschütterliche gute Laune, die ihr größtes Geschenk füreinander ist – und für mich.
Ich bin in einem Haus aufgewachsen, das voller Lachen war. Egal, was mir in Zukunft zustoßen mag, dieses Lachen habe ich genossen. Und sehr, sehr leckeres Gebäck.
In diesem Bericht über mein Leben werde ich immer wieder Zuflucht zur Heiterkeit nehmen, denn Lachen ist die beste Medizin für das gequälte Herz und Balsam für das Elend. Täuschen werde ich euch dabei jedoch nicht. Ich werde das Lachen nicht als Schleier nutzen, um euch den Anblick von Grauen und Verzweiflung zu ersparen. Wir werden zusammen lachen, aber manchmal wird das Lachen wehtun.
Daher …
Ob meine Mutter sich im Delirium befand oder bei klarem Verstand war, ob sie meinem Vater die Schuld an ihren schmerzhaften Wehen gab oder bemerkte, man müsse noch Käse besorgen, muss also im Dunkeln bleiben, aber darüber, was dann geschah, sind die beiden sich einigermaßen einig. Neben der Tür entdeckte mein Vater an der Wand ein Telefon, mit dem er um Hilfe rief.
Weil es sich bei dem betreffenden Gerät eher um eine Sprechanlage als um ein Telefon handelte, hatte es keine vollständige Tastatur, sondern nur vier deutlich beschriftete Tasten: PERSONAL, APOTHEKE, HAUSMEISTER und WACHDIENST.
Dad drückte die letztgenannte Taste und teilte dem sich meldenden Wachmann mit, dass Menschen erschossen worden seien, dass der als Clown verkleidete Täter in diesem Augenblick aus dem Gebäude flüchte und dass Maddy sofort ärztlichen Beistands bedürfe.
Falls meine Mutter bisher nicht bei klarem Verstand gewesen sein sollte, dann war sie es jetzt, denn sie rief vom Bett aus: »Wo ist mein Baby?«
Den Hörer noch am Ohr, drehte mein Vater sich ebenso verblüfft wie angstvoll zu ihr um. »Du weißt nicht, wo es ist?«
Mit schmerzverzerrtem Gesicht versuchte meine Mutter erfolglos, sich aufzusetzen. »Woher soll ich das denn wissen?«, fragte sie. »Ich bin in Ohnmacht gefallen oder so. Was hast du da gesagt, jemand ist erschossen worden? Um Himmels willen, wer denn? Was geht hier eigentlich vor? Wo ist mein Baby?«
Obgleich das Entbindungszimmer keine Fenster hatte und von Fluren und anderen Zimmern umgeben war, die es zusätzlich vor der Außenwelt abschirmten, hörten meine Eltern in der Ferne leises Sirenengeheul.
Aus Dads Erinnerung stieg ein Bild auf, bei dem ihm plötzlich übel wurde: Beezo, der im Flur stand, mit der Pistole in der rechten Hand und dem Baby im linken Arm. Bittere Säure brannte in Dads Kehle, und sein ohnehin gequältes Herz jagte noch schneller als bisher.
Vielleicht war nicht nur die Frau von Beezo bei der Geburt gestorben, sondern auch das Kind. Vielleicht war der Säugling im Arm des Clowns nicht sein eigener gewesen, sondern der kleine James – oder die kleine Jennifer – Tock.
Mir kam das Wort »gekidnappt« in den Sinn, sagt Dad, wenn er von diesem Augenblick erzählt. Ich hab an das Baby von Charles Lindbergh gedacht und daran, wie viel Lösegeld man für Frank Sinatra junior gezahlt hat, ich hab an Rumpelstilzchen gedacht und an Tarzan, der unter Affen aufgewachsen ist. Klar, das war alles Unsinn, aber trotzdem ging es mir in diesem Moment durch den Sinn. Ich wollte schreien, konnte aber nicht, und da hab ich mich genauso gefühlt wie dieses rotgesichtige Baby, das den Mund aufgerissen hatte, aber trotzdem still war, und als ich an dieses Baby dachte, da hab ich einfach gewusst, das bist du, nicht Beezos Sohn, sondern du, mein Jimmy.
Fest entschlossen, Beezo zu finden und ihn aufzuhalten, ließ Dad den Hörer fallen, stürmte durch die offene Tür in den Flur – und wäre fast mit Charlene Coleman zusammengeprallt, einer Schwester, die mit einem Baby in den Armen auf ihn zukam.
Dieser Säugling hatte ein breiteres Gesicht als der, den Beezo in die stürmische Nacht entführt hatte. Sein Gesicht war nicht mit roten Flecken, sondern mit einem gesunden Rosa überzogen. Wenn man Dad Glauben schenkt, so leuchteten seine Augen klar und blau, und sein Gesicht glühte vor Staunen.
»Ich hab mich mit Ihrem Baby versteckt«, sagte Charlene Coleman. »Vor diesem grässlichen Mann. Ich hab gleich gewusst, dass der Probleme macht, wie er da so mit seiner Frau aufgetaucht ist. Der hat doch tatsächlich hier drin diesen grässlichen Hut aufbehalten und sich nicht mal dafür entschuldigt.«
Ich wünschte, ich könnte aus persönlicher Erfahrung bestätigen, dass das, was gleich von Anfang an Charlenes Argwohn geweckt hatte, nicht Beezos Schminke gewesen war, nicht sein giftiges Zetern über seine am Trapez turnenden Verwandten, nicht seine Augen, die so irre waren, dass sie sich fast wie Windrädchen drehten, sondern einfach nur sein Hut. Leider war ich damals kaum eine Stunde alt und hatte noch nicht sprechen gelernt, ja noch nicht einmal herausbekommen, wer diese ganzen Leute eigentlich waren.
3
Bebend vor Erleichterung nahm Dad mich entgegen und brachte mich zu meiner Mutter.
Nachdem Schwester Charlene das Kopfende des Geburtsbetts angehoben und zusätzliche Kissen geholt hatte, war meine Mutter endlich in der Lage, mich in die Arme zu nehmen.
Dad schwört, ihre ersten Worte zu mir hätten folgendermaßen gelautet: »Hoffentlich bist du die ganzen Schmerzen wert, kleines Blauauge, denn wenn du ein undankbares Kind sein solltest, dann mache ich dir das Leben zur Hölle, darauf kannst du dich verlassen!«
Weinend und erschüttert von allem, was geschehen war, berichtete Charlene, was sich zugetragen hatte und wie es ihr gelungen war, mich in Sicherheit zu bringen, als der erste Schuss fiel.
Dr. MacDonald, der nicht darauf vorbereitet gewesen war, gleich zwei Frauen in fortgeschrittenen, schwierigen Wehen beizustehen, hatte zu so später Stunde vergeblich versucht, einen qualifizierten Kollegen zu Hilfe zu holen. Deshalb hatte er seine Zeit zwischen den beiden Patientinnen aufteilen müssen, war von einem Entbindungszimmer ins andere gehastet und hatte sich darauf verlassen müssen, dass die Schwestern ihn in seiner Abwesenheit ersetzten. Zusätzlich erschwert wurde seine Arbeit durch das periodisch schwächer werdende Licht und die Sorge, ob sich der Krankenhausgenerator tatsächlich in Gang setzen würde, falls das Unwetter die Stromversorgung gänzlich lahm legte.
Natalie Beezo hatte keine Schwangerenvorsorge in Anspruch genommen. Ohne es zu wissen, litt sie an Präeklampsie. Im Verlauf der Wehen trat eine voll ausgeprägte Eklampsie auf, gekennzeichnet von gewaltsamen Krämpfen, bei denen keine Behandlung anschlug und die nicht nur ihr eigenes Leben bedrohten, sondern auch das ihres ungeborenen Kindes.
Zur selben Zeit durchlitt meine Mutter ebenfalls schauderhafte Wehen, weil ihr Gebärmutterhals sich nicht ausreichend erweiterte. Auch die intravenöse Injektion von synthetischem Oxytocin führte anfangs keine ausreichenden Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur herbei, um mich in die Welt hinauszupressen.
Natalie entband als Erste. Dr. MacDonald versuchte alles, um sie zu retten – ein Endotrachealschlauch zur Erleichterung der Atmung, mehrere Injektionen krampflösender Substanzen –, doch ein extrem ansteigender Blutdruck und die Krämpfe führten zu einer massiven Gehirnblutung, die sie nicht überlebte.
Noch während die Nabelschnur zwischen dem kleinen Beezo und seiner toten Mutter abgebunden und durchtrennt wurde, spürte meine Mutter, die trotz ihrer Erschöpfung weiterhin versuchte, mich ins Freie zu drücken, endlich mit einem Mal, wie ihr Muttermund sich erweiterte.
Die Jimmy-Tock-Show hatte begonnen.
Bevor er sich an die deprimierende Aufgabe wagte, Konrad Beezo zu berichten, dass er einen Sohn bekommen und seine Frau verloren hatte, half Dr. MacDonald mir heraus und verkündete laut Charlene Coleman, aus diesem stämmigen kleinen Bündel würde bestimmt mal ein großer Footballspieler.
Nachdem meine Mutter mich erfolgreich aus ihrem Bauch in eine größere Welt befördert hatte, fiel sie unverzüglich in Ohnmacht. Sie hörte die Prophezeiung des Arztes nicht, und mein breites, rosafarbenes, staunendes Gesicht sah sie erst, als meine Beschützerin Charlene ins Zimmer zurückkehrte und mich meinem Vater in die Arme legte.
Dr. MacDonald übergab mich an Schwester Charlene, die mich abtupfte und mich in ein weißes Baumwolltuch wickelte. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass meine Mutter wirklich nur in Ohnmacht gefallen war und in wenigen Augenblicken mit oder ohne Riechsalz wieder zu sich kommen würde, streifte er seine Latexhandschuhe ab, zog die Operationsmaske herunter und begab sich ins Wartezimmer, um Konrad Beezo so gut Trost zuzusprechen, wie er konnte.
Stattdessen wurde er angebrüllt, mit bitteren, anklagenden Worten und paranoiden Anschuldigungen, mit übelsten Flüchen, ausgestoßen mit der zornigsten Stimme, die man sich vorstellen konnte.
Selbst in dem normalerweise stillen, gut schallgeschützten Entbindungszimmer hörte Schwester Charlene das Gezeter. Auch wenn sie nicht im Einzelnen verstand, wie Konrad Beezo auf den Tod seiner Frau reagierte, den Tenor seiner Äußerungen begriff sie sehr wohl.
Als sie das Zimmer verließ und in den Flur trat, um Beezo besser verstehen zu können, befahl ihr ihre Eingebung, mich – eingewickelt in die dünne Decke – mitzunehmen.
Im Flur traf sie auf Lois Hanson, eine andere Schwester, die den kleinen Beezo im Arm trug. Auch Lois hatte sich herausgewagt, um dem ungezügelten Ausbruch des Clowns zu lauschen.
Lois beging jedoch einen tödlichen Fehler. Gegen Charlenes Rat ging sie auf die geschlossene Tür des Wartezimmers zu, weil sie glaubte, der Anblick seines kleinen Sohnes werde Beezos wilden Zorn besänftigen und den tiefen Gram lindern, der seinen Ausbruch verursacht hatte.
Da Charlene selbst vor gar nicht langer Zeit einem gewalttätigen Ehemann entkommen war, vertraute sie mitnichten darauf, dass die Gnade der Vaterschaft die Empörung eines Mannes zähmen konnte, der selbst im Augenblick eines schweren Verlusts sofort und als Erstes mit Wut und der Androhung von Gewalt reagierte statt mit Tränen, Schock oder Verleugnung. Außerdem dachte sie an seinen Hut, den er ohne Rücksicht auf jedwede Manieren auf dem Kopf gelassen hatte. Charlene spürte Unheil heraufziehen, großes Unheil.
Sie zog sich mit mir über den hinteren Flur der Entbindungsabteilung in die Säuglingsstation zurück. Als deren Tür hinter uns zuschwang, hörte sie den Schuss, der Dr. MacDonald tötete.
Der Raum enthielt mehrere Reihen von Körbchen, in denen die Neugeborenen lagen. Die meisten träumten, einige gurrten, noch schrie keines. Der größte Teil der hinteren Längswand bestand aus einem riesigen Schaufenster, hinter dem momentan jedoch weder stolze Väter noch Großeltern standen.
Die Kinder wurden von zwei Säuglingsschwestern betreut. Diese hatten das Gebrüll und dann den Schuss gehört und zeigten sich empfänglicher für Charlenes Ratschlag, als es Lois gewesen war.
Vorausahnend versicherte Schwester Charlene den beiden, der Mörder werde den Babys kein Haar krümmen, jedoch mit Sicherheit jedes Mitglied des Krankenhauspersonals umbringen, dessen er habhaft werden konnte.
Bevor die beiden Schwestern flohen, griffen sie sich dennoch jede einen Säugling – und machten sich wortreich Sorgen um jene, die sie zurücklassen mussten. Aufgeschreckt von dem zweiten Schuss folgten sie Charlene endlich durch die Tür neben dem großen Fenster, die aus der Entbindungsabteilung in den Hauptflur des Krankenhauses führte.
Samt ihren Schützlingen verbargen die drei sich dann in einem Zimmer, in dem ein alter Mann nichtsahnend einfach weiterschlief.
Ein trübes Nachtlicht drängte die Finsternis kaum zurück, und die hinter dem Fenster flackernden Blitze ließen die Schatten vor insektenhafter Energie zittern.
Die drei Krankenschwestern verhielten sich so mäuschenstill, dass sie kaum zu atmen wagten. Sie drängten sich zusammen, bis Charlene in der Ferne Sirenen hörte. Das willkommene Jaulen lockte sie ans Fenster, durch das man den Parkplatz vor dem Krankenhaus sehen konnte. Sie hoffte, einen Polizeiwagen zu sehen.
Stattdessen sah sie von ihrer Warte im ersten Stock aus, wie Beezo mit seinem Baby über den regennassen Asphalt marschierte. Er sah, behauptet sie, wie eine der seltsamen Gestalten aus, die durch schlimme Träume huschen, wie etwas, das man in der Nacht sehen mochte, in der die Welt endete und die Erde sich auftat, um die wütenden Legionen der Verdammten freizulassen.
Charlene kommt aus Mississippi und ist eine Baptistin, deren Seele von der Poesie des Südens erfüllt ist.
Beezo hatte seinen Wagen so weit weg abgestellt, dass angesichts der Regenschleier und des trüben gelben Scheins der Natriumdampflampen nicht erkennbar war, was für eine Marke er fuhr, geschweige denn, welches Modell in welcher Farbe. Charlene sah ihn davonfahren und hoffte, die Polizei werde ihn abfangen, bevor er die nahe Landstraße erreichte, doch seine Rücklichter verschwanden unbehelligt in der feuchten Finsternis.
Da die Bedrohung nun fort war, kehrte Charlene gerade in dem Augenblick ins Entbindungszimmer zurück, als die Gedanken meines Vaters hektisch von der Tragödie um Lindberghs Baby zu Rumpelstilzchen und dem von Affen aufgezogenen Tarzan sprangen. So konnte sie ihm rechtzeitig mitteilen, dass ich doch nicht von einem mörderischen Clown gekidnappt worden war.
Später stellte mein Vater dann fest, dass die Minute meiner Geburt, meine Körperlänge und mein Gewicht exakt den Prophezeiungen entsprachen, die mein Großvater auf dem Totenbett gemacht hatte. Der erste Beweis dafür, dass die Geschehnisse in der Intensivstation nicht nur außergewöhnlich, sondern übernatürlich gewesen waren, stellte sich jedoch schon früher ein. Als meine Mutter mich in den Armen hielt, schlug Dad das Wickeltuch zurück, entblößte dabei meine Füße und sah, dass meine Zehen zusammengewachsen waren, genau wie Josef es vorhergesagt hatte.
»Syndaktylie«, hauchte mein Vater.
»Das kann man operieren«, beruhigte ihn Charlene. Dann machte sie vor Staunen große Augen. »Woher kennen Sie denn einen solchen Fachbegriff?«
Mein Vater wiederholte nur: »Syndaktylie«, während er behutsam, liebevoll und voll Verwunderung meine zusammengewachsenen Zehen betastete.
4
Syndaktylie ist nicht nur die Bezeichnung für die Missbildung, mit der ich geboren wurde, sondern auch seit nun schon dreißig Jahren das Motto meines Lebens. Oft stellt sich nämlich heraus, dass die Dinge auf unvorhergesehene Weise miteinander verwachsen sind. Zum Beispiel verknüpfen sich manchmal unerwartet durch viele Jahre getrennte Augenblicke, als würde das Raum-Zeit-Kontinuum irgendwie zusammengefaltet – von einer Kraft, die entweder einen merkwürdigen Sinn für Humor hat oder einen möglicherweise sinnvollen Zweck verfolgt, der jedoch so komplex ist, dass man ihn nicht begreift. Ein anderes Beispiel sind einander völlig unbekannte Menschen, die mit einem Mal feststellen, dass sie vom Schicksal so fest miteinander verbunden sind wie zwei Zehen, die von derselben Haut umhüllt werden.
Chirurgen haben mein Zehenproblem schon vor so langer Zeit behoben, dass ich keinerlei Erinnerung mehr an die Operationen habe. Ich kann gehen, ich laufe, wenn es sein muss, und ich kann tanzen, wenn auch nicht besonders gut.
Bei allem Respekt vor dem Gedenken an Dr. Ferris MacDonald muss ich doch feststellen, dass ich mich nie zu einem großen Footballspieler entwickelt habe und auch gar keine Lust dazu hatte. In meiner Familie hat sich noch nie jemand für Sport interessiert.
Stattdessen sind wir große Liebhaber von Windbeuteln, Eclairs, Törtchen, Torten, Kuchen und Biskuits, aber auch von dem berüchtigten Brokkoli-Käse-Auflauf, den Sandwiches mit Käse, Wurst und Sauerkraut und all den anderen kalorienreichen Köstlichkeiten, die meine Mutter zubereitet. Mit Freuden tauschen wir Spannung und Ruhm aller Spiele und Turniere, die die Menschheit je erfunden hat, gegen ein gemeinsames Abendessen ein und gegen die vergnügte Unterhaltung, die uns vom Entfalten der Servietten bis zum letzten Schluck Kaffee begleitet wie ein rasch dahinfließender Strom.