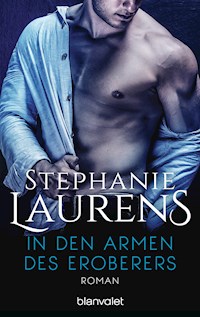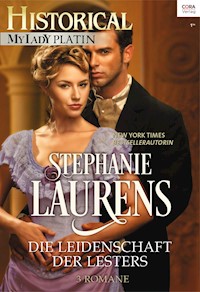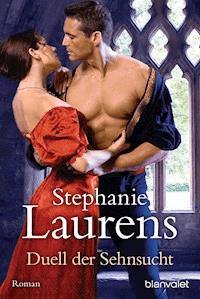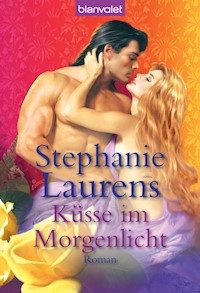4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bastion Club
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Er hat Schlachten geschlagen und in Kriegen gekämpft. Doch diese Lady ist seine größte Herausforderung.
Jahrelang hat der geheimnisvolle Royce Varisey für sein Land gekämpft und zahllosen Gefahren getrotzt. Nun nimmt er seine bisher schwierigste Aufgabe in Angriff: die Dame seines Herzens zu finden und endlich zu heiraten. Zahlreiche Ladies liegen ihm zu Füßen, aber sie alle erscheinen ihm berechenbar und langweilig. Erst als er die wunderschöne und abweisende Minerva Chesterton trifft, ist er fasziniert. Denn er ahnt, dass sich hinter der strengen Fassade der Schlossherrin eine Frau von glühender Sinnlichkeit verbirgt. So setzt Royce alles daran, Minervas Herz zu erobern. Doch diese eigensinnige Lady macht es ihm nicht leicht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 762
Ähnliche
Buch
Royce Varisey, zehnter Duke of Wolverstone, kehrt nach dem Tod seines Vaters in die englische Heimat zurück. Als er nach langen Jahren der Abwesenheit erstmals die Burg seiner Vorfahren wieder betritt, stößt er prompt mit der resoluten Miss Minerva Chesterton zusammen, die als Waisenkind von Royce’ Eltern aufgenommen und später von ihnen zur Burgherrin ernannt wurde. Schon als junges Mädchen hegte Minerva heimliche Gefühle für Royce. Als die beiden sich nun auf einem dunklen Flur regelrecht in die Arme laufen, flammt das Feuer sofort wieder auf. Doch Minerva hat Royce’ Eltern am Sterbebett geschworen, dass sie für Royce eine standesgemäße Ehefrau finden würde. Und ihr ist klar, dass sie selbst nicht seine Braut werden kann …
Autorin
Stephanie Laurens begann mit dem Schreiben, um etwas Farbe in ihren wissenschaftlichen Alltag zu bringen. Ihre Bücher wurden bald so beliebt, dass sie ihr Hobby zum Beruf machte. Stephanie Laurens gehört zu den meistgelesenen und populärsten Liebesromanautorinnen der Welt und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einem Vorort von Melbourne, Australien.
Von Stephanie Laurens bei Blanvalet lieferbar:
Ein feuriger Gentleman, In den Armen des Spions, Eine stürmische Braut, Ein süßes Versprechen, Ein widerspenstiges Herz, Stürmische Versuchung, Ein sinnliches Geheimnis
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
Stephanie Laurens
Triumphdes Begehrens
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Jutta Nickel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem TitelMastered by Love bei Avon Books,an imprint of HarperCollins Publishers, New York.
1. AuflageDeutsche Erstveröffentlichung März 2016bei Blanvalet, einem Unternehmen derVerlagsgruppe Random House GmbH, MünchenCopyright © der Originalausgabe 2009 beiSavdek Management Proprietory Ltd.published by arrangement with Avon,an imprint of HarperCollins Publishers, LLC.Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016by Verlagsgruppe Random House GmbH, MünchenUmschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,unter Verwendung von Motiven von Chris Cocozzaund Shutterstock.comRedaktion: Sabine WiermannBS · Herstellung: samSatz: DTP Service Apel, HannoverISBN: 978-3-641-17341-8V001www.blanvalet.de
1
September 1816Coquetdale, Northumbria
So sollte es nicht sein.
Eingehüllt in seinen Übermantel und allein auf dem Kutschbock seines exzellent gefederten Zweispänners, lenkte Royce Henry Varisey, der zehnte Duke of Wolverstone, die Postpferde des letzten Gespanns, mit dem er die Hauptstraße von London aus hinaufgerast war, auf die Nebenstraße nach Sharperton und Harbottle. Das sanft gewellte Vorland der Cheviot Hills fing ihn ein wie die Arme einer Mutter; Wolverstone Castle, Heim seiner Kindheit und kürzlich geerbter Hauptsitz der Familie, lag nahe am Dorf Alwinton, hinter Harbottle.
Eines der Pferde geriet aus dem Tritt. Royce hielt es zurück, bis beide sich wieder im Gleichschritt befanden, ehe er sie aufs Neue antrieb. Die Kraft der Tiere ließ nach. Seine eigenen reinrassigen Rappen hatten ihn am Montag bis nach St. Neots gebracht. Danach hatte er die Pferde ungefähr alle fünfzig Meilen gegen ein ausgeruhtes Gespann gewechselt.
Es war Mittwochmorgen, er hatte London ein gutes Stück hinter sich gelassen – nach sechzehn langen Jahren – und drang wieder einmal in heimisches Gebiet ein. In das Territorium seiner Vorfahren. Rothbury und die dunklen Lichtungen seiner Wälder lagen hinter ihm. Vor ihm hingegen dehnten sich die welligen, größtenteils baumlosen Ausläufer der Cheviots, die hier und da mit den unvermeidlichen Schafen gesprenkelt waren, die sich rund um die noch öderen Hügel ausbreiteten – Hügel, deren Rückseite wiederum die Grenze zu Schottland bildeten.
Bei der Entstehung des Herzogtums hatten Hügel und Grenze eine entscheidende Rolle gespielt. Nach der normannischen Eroberung war Wolverstone als von der Krone unabhängiges und eigener Gesetzgebung unterworfenes Grenzland gegründet worden, um England vor Plünderungen durch die marodierenden Schotten zu schützen. Die nachfolgenden Herzöge, weithin als Wölfe des Nordens bekannt, hatten innerhalb ihrer Gebiete jahrhundertelang die Privilegien eines Königtums genossen.
Viele Leute würden behaupten, dass sich daran nichts geändert hatte.
Zweifellos waren sie ein außerordentlich mächtiger Clan geblieben, dessen Reichtum durch Tapferkeit auf dem Schlachtfeld immer weiter wuchs. Sie schützten sich dadurch, dass sie die nachfolgenden Herrscher davon überzeugten, solche verschlagenen, politisch mächtigen ehemaligen Königsmacher am besten sich selbst zu überlassen – und ihnen die Middle March zuzuweisen, welche sie bewirtschaftet hatten, seit sie ihren elegant beschuhten normannischen Fuß das erste Mal auf die englische Scholle gesetzt hatten.
Royce musterte das Gebiet mit einem Blick, der durch lange Abwesenheit geschärft war. Seine Vorfahren fielen ihm ein, und er fragte sich aufs Neue, ob die althergebrachte Unabhängigkeit als Herrscher des Grenzlandes – die ursprünglich erkämpft worden war, anerkannt durch Sitte und Gewohnheit und garantiert durch königlichen Erlass, danach gesetzlich aufgehoben, aber niemals wahrhaft enteignet und noch weniger tatsächlich aufgegeben –, er fragte sich also, ob diese althergebrachte Unabhängigkeit die Kluft zwischen ihm und seinem Vater nicht noch stärker aufgerissen hatte.
Wie die meisten seiner Standesgenossen hatte sein Vater der alten Schule der Lordschaft angehört. Nach deren Credo war die Treue zum Land oder zum Herrscher nicht mehr als eine Ware, die gehandelt und gekauft wurde; etwas, wofür sowohl die Krone als auch das Land einen angemessenen Preis entrichten mussten, bevor es gewährt wurde. Mehr noch: Für Dukes und Earls der Art seines Vaters hatte »Land« zweierlei Bedeutung – als Könige innerhalb ihrer eigenen Domänen galt ihre erste Sorge diesen Domänen, während das Reich ein eher nebulöses und entferntes Dasein fristete, das sicherlich weniger auf ihre Ehre rechnen konnte.
Während Royce eingestehen würde, dass der Schwur der Gefolgschaft gegenüber dem derzeitigen König – dem verrückten König George und seinem liederlichen Sohn, dem Prinzregenten – keine reizvolle Aussicht war, ließ er an seinem Schwur der Gefolgschaft und dem Dienst an seinem Land – England – gegenüber keinerlei Zweifel zu.
Als man ihm, dem einzigen Sohn einer mächtigen Herzogsfamilie und daher durch jahrhundertealte Gewohnheit von den Diensten auf dem Schlachtfeld ausgeschlossen, im zarten Alter von einundzwanzig Jahren angetragen hatte, ob er auf ausländischem Boden ein Netzwerk englischer Spione knüpfen wolle, hatte er die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Nicht nur, dass sich die Aussicht geboten hatte, einen Beitrag zu Napoleons Niederlage zu leisten; wegen seiner ausgedehnten persönlichen und familiären Kontakte, kombiniert mit der ihm angeborenen Fähigkeit zu inspirieren und zu befehlen, war ihm diese Position wie auf den Leib geschneidert.
Für seinen Vater allerdings hatte es eine Entwürdigung seines Namens und Titels bedeutet, einen Flecken auf dem Familienwappen. Seinen altmodischen Ansichten zufolge galt Spionage fraglos als unehrenhaft, selbst wenn sie sich gegen tatkräftige militärische Feinde richtete; eine Ansicht, die zur damaligen Zeit viele ältere Standesgenossen vertraten.
Das allein war schon schlimm genug. Aber als Royce sich geweigert hatte, den Auftrag abzulehnen, hatte sein Vater ihm eine Falle gestellt, und zwar in aller Öffentlichkeit im White’s zu einem Zeitpunkt am Abend, an dem der Klub immer voll war. Mit seinen Kumpanen im Rücken hatte sein Vater vor allen Anwesenden ein scharfes, vernichtendes Urteil über Royce gefällt.
Nach einer schier endlosen Rede hatte sein Vater triumphierend erklärt, dass es, falls Royce sich dem Edikt widersetze und sich stattdessen in den Dienst der Macht stelle, die ihn rekrutiert habe, dass es dann für ihn, den neunten Duke, so sein würde, als ob er keinen Sohn habe.
Obwohl der Angriff seines Vaters ihn vor Wut hatte schäumen lassen, war Royce das »als ob« nicht entgangen. Er war der einzige legitime Sohn seines Vaters; ganz gleich also, wie zornig der Mann auch sein mochte, formal enterben würde er ihn nicht. Das Verdikt würde ihn jedoch vom Land seiner Familie verbannen.
Umgeben von einem Heer von Aristokraten, die fasziniert zuschauten, hatte er seinen wutentbrannten Vater über den purpurroten Teppich des exklusiven Klubs angeschaut und reglos abgewartet, bis der alte Herr seine wohl eingeübte Rede beendet hatte. Hatte abgewartet, bis das erwartungsvolle Schweigen um sie herum undurchdringlich geworden war, und dann lediglich drei Worte erwidert: Wie Sie wünschen.
Danach hatte er sich umgedreht und den Klub verlassen; das war der Tag gewesen, an dem er aufgehört hatte, der Sohn seines Vaters zu sein. Von diesem Tag an hatte er Dalziel geheißen, nach einem Namen, der aus einem obskuren Zweig der Familie seiner Mutter stammte, aber trotzdem passte, da es ebenfalls der Name seines damals bereits verstorbenen Großvaters mütterlicherseits war – des Mannes, der ihn das Credo gelehrt hatte, nach dem zu leben er sich entschieden hatte. Mochten die Variseys auch Herrscher der Grenzregion sein, so waren die Debraighs doch nicht weniger mächtig, nur dass ihr Land im Herzen Englands lag und dass sie König und Land – hauptsächlich dem Land – jahrhundertelang selbstlos gedient hatten. Zahllosen Monarchen hatten die Debraighs als Krieger und Staatsmänner eng zur Seite gestanden; die Pflicht ihrem Volk gegenüber war ihnen ein wichtiges Anliegen.
Die Debraighs bedauerten das Zerwürfnis mit seinem Vater, während sie Royce’ Haltung zugleich guthießen. Auch damals schon hatte Royce ein Gespür für die Dynamiken der Macht besessen und die tatkräftige Unterstützung der Debraighs abgelehnt. Sein Onkel, der Earl of Catersham, hatte schriftlich angefragt, ob er etwas tun könne. Wie schon auf die Anfrage seiner Mutter hatte Royce ihm abschlägig geantwortet, denn der Streit spielte sich zwischen ihm und seinem Vater ab, weshalb sich niemand sonst einmischen sollte.
Er hatte eine Entscheidung getroffen – an die er sich in den folgenden sechzehn Jahren gehalten hatte. Niemand hatte erwartet, dass es so lange dauern würde, Napoleon zu besiegen.
Hatte es aber.
Während dieser Jahre hatte er die Besten aus seiner Generation zu einer königlichen Garde rekrutiert, hatte sie zu einem Netzwerk aus Geheimagenten organisiert und erfolgreich in den von Napoleon besetzten Gebieten platziert. Ihr Erfolg war Stoff für Legenden. Eingeweihte wussten, dass dem Netzwerk zahllose britische Leben zu verdanken waren und dass es unmittelbar einen Beitrag zu Napoleons Sturz geleistet hatte.
Sein Erfolg auf dieser Bühne war berauschend gewesen. Mit Napoleons Verbannung nach St. Helena hatte er seine Truppe aufgelöst und in ihr ziviles Leben entlassen. Und seit Montag hatte auch er sein früheres Leben – sein Leben als Dalziel – hinter sich gelassen.
Er hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass ihm mehr als der Höflichkeitstitel des Marquis of Winchelsea gewährt würde. Hatte nicht damit gerechnet, dass er unverzüglich die Herrschaft über das Herzogtum und alles, was dazugehörte, übernehmen würde.
Seine fortdauernde Verbannung – nie hatte er erwartet, dass sein Vater nachgeben würde, genauso wenig wie er selbst – hatte ihn gründlich von den Häusern des Herzogtums, seinem Land und den Menschen entfremdet – und ganz besonders von dem Ort, der ihm am meisten bedeutete: das eigentliche Wolverstone. Die Burg war mehr als nur ein Zuhause. Ihre Steinmauern und Wehrgänge hatten etwas an sich – eine Magie –, die in seinem Blut pulsierte, in seinem Herzen, in seiner Seele. Sogar seinem Vater war dieses Gefühl vertraut gewesen; und so hatte Royce es auch erlebt.
Obwohl mittlerweile sechzehn Jahre verstrichen waren, verspürte Royce, während die Pferde weiterrasten, den Sog, diese Zugkraft in seinem Inneren, die nur noch stärker wurde, als er durch Sharperton ratterte und Wolverstone immer näher rückte. Es überraschte ihn doch ein wenig, dass trotz der Jahre und trotz des Zerwürfnisses immer noch … heimische Gefühle in ihm schlummerten.
Dass Zuhause nichts von seiner Bedeutung eingebüßt hatte.
Dass es ihn immer noch tief in der Seele bewegte.
Damit hatte er nicht gerechnet, ebenso wenig wie damit, so wie jetzt zurückzukehren – allein, gehetzt, ohne seinen langjährigen Burschen Henry, der ihn, ebenfalls ein Ausgestoßener von Wolverstone, in die Verbannung begleitete.
Am Montag hatte er die letzten Dalziel-Akten von seinem Schreibtisch geräumt und seine Rückkehr nach Wolverstone geplant. Er hatte sich vorgestellt, in leichten Etappen von London hochzufahren, um frisch und ausgeruht auf der Burg anzukommen – in einem Zustand, der es ihm erlaubte, seinem Vater unter die Augen zu treten … und abzuwarten, was wohl als Nächstes geschehen würde.
Er hatte sich vorgestellt, dass vielleicht, ganz vielleicht sogar eine Entschuldigung von seinem Vater zu dem Auftritt gepasst hätte; ja, er war neugierig gewesen, wenn er auch nicht unbedingt den Atem angehalten hatte.
Jetzt würde er es niemals mehr erfahren.
Sein Vater war am Sonntag gestorben.
Und das Zerwürfnis zwischen ihnen – tief und bösartig, nur allzu verständlich, da sie beide Variseys waren – war nicht bereinigt. Unangesprochen und nicht aufgearbeitet, um endlich ruhen zu können.
Ihm war nicht klar, wen er verfluchen sollte – seinen Vater oder das Schicksal –, weil es jetzt ihm überlassen blieb, die Wunde auszubrennen.
Ungeachtet dessen stand die Beschäftigung mit seiner Vergangenheit nicht mehr ganz oben auf seiner Tagesordnung. Es würde ihn höchste Aufmerksamkeit kosten, die Zügel des ausgedehnten Herzogtums nach sechzehnjähriger Abwesenheit wieder in die Hand zu nehmen. All seine Fähigkeiten musste er dafür einsetzen, durfte sich um nichts anderes kümmern. Und es würde ihm auch gelingen – daran zweifelte er nicht. Welche andere Möglichkeit hätte es auch gegeben? Aber wie lange es dauern und was es ihn kosten würde … und wie zum Teufel er es anstellen sollte, nein, das wusste er nicht.
So sollte es nicht sein.
Für einen Mann in den Sechzigern war sein Vater noch gut beieinander gewesen. Jedenfalls nicht kränklich; Royce vertraute darauf, dass in einem solchen Fall jemand das Verbot seines Vaters gebrochen und ihn benachrichtigt hätte. Doch stattdessen war er überrumpelt worden.
In seiner Version von Rückkehr hätten sein Vater und er Frieden geschlossen oder zumindest einen Waffenstillstand, wie auch immer das Arrangement im Einzelnen ausgesehen hätte. Anschließend hätte er seine Kenntnisse über die Ländereien aufgefrischt, hätte die Lücke geschlossen zwischen damals, als er mit einundzwanzig zuletzt auf Wolverstone gewesen war, und seinen gegenwärtigen siebenunddreißig Jahren.
Stattdessen war sein Vater gestorben und hatte es ihm überlassen, die Zügel mit einem Rückstand von sechzehn Jahren wieder in die Hand zu nehmen; der Rückstand im Wissen um den Zustand der Ländereien hing ihm wie ein Mühlstein um den Hals.
Während er schier grenzenlos darauf vertraute – mit dem Selbstvertrauen eines Varisey –, die Position seines Vaters mehr als angemessen auszufüllen, freute er sich keineswegs darauf, den Notbefehl über die ihm nicht vertrauten Truppen in einem Gebiet zu übernehmen, das sich in sechzehn Jahren auf unvorhersehbare Weise entwickelt haben konnte.
Sein Naturell war, wie das aller Variseys und besonders der männlichen, furchterregend; das Temperament der Variseys war ebenso vernichtend wie vor Jahrhunderten ihr Breitschwert. Mit der Zeit hatte er diese Waffe besser beherrscht als sein Vater, hatte gelernt, sich im Zaum zu halten – eine weitere Waffe, die er nutzte, um zu erobern und zu überwältigen. Nicht einmal wer ihn kannte, konnte den Unterschied zwischen milder Verärgerung und mörderischer Rage erspüren – es sei denn, Royce wünschte es. Schon vor langer Zeit hatte er es sich zur zweiten Natur gemacht, seine Gefühle zu kontrollieren.
Seit er vom Hinscheiden seines Vaters erfahren hatte, war seine Stimmung aufwallend, unruhig und größtenteils unvernünftig gewesen. Es war, als würde es ihn mit aller Macht nach Erleichterung hungern, wohl wissend, dass das verfluchte Schicksal ihm die einzige Erleichterung, die ihn befriedigt hätte, für immer versagt hatte.
Dass er keinen Feind mehr hatte, nach dem er ausschlagen und an dem er sich rächen konnte, ließ ihn mit einem Gefühl von Ohnmacht zurück, als würde er auf einem schmalen Grat wandern.
Mit versteinerter Miene raste er durch Harbottle. Eine Frau auf der Straße starrte ihn neugierig an. Ja, er war eindeutig nach Wolverstone unterwegs, denn diese Straße führte zu keinem anderen Ziel, welches ein Gentleman seines Standes sonst hätte ansteuern können. Aber er hatte auch zahlreiche Cousins, die alle so ähnlich aussahen wie er. Selbst wenn die Frau vom Tod seines Vaters gehört hatte, war es unwahrscheinlich, dass sie ihn erkannte.
Hinter Sharperton hatte die Straße sich am Ufer des Coquet entlanggeschlängelt, und unter den trommelnden Hufen der Pferde hörte er den Fluss in seinem steinigen Bett gurgeln. Dann kam eine Kurve nach Norden. Eine Steinbrücke spannte sich über den Fluss. Der Zweispänner ratterte hinüber; angespannt atmete er ein, als er in die Ländereien der Wolverstones einfuhr.
Und spürte, wie diese undefinierbare Verbindung ihn mit festem Griff packte.
Er straffte sich auf dem Kutschbock, dehnte seine langen Rückenmuskeln, drosselte das Tempo der Pferde und ließ den Blick schweifen.
Sog den vertrauten Anblick in sich ein, der sich ihm ins Gedächtnis eingebrannt hatte. Fast überall sah es so aus wie erwartet – und genauso, wie er es in Erinnerung hatte, nur sechzehn Jahre älter.
Vor ihm lag eine Furt durch den Fluss Alwin. Noch einmal drosselte er das Tempo der Pferde und sorgte dafür, dass sie sich ihren Weg suchten. Als die Räder sich wieder aus dem Wasser drehten, klatschte er vorsichtig mit den Zügeln und lenkte das Gespann die leichte Anhöhe hinauf, wo die Straße nach Westen abbog.
Nachdem der Zweispänner die Anhöhe überquert hatte, zügelte er die Pferde in den Schritt.
Die Schieferdächer von Alwinton lagen direkt vor ihm. Näher und zu seiner Linken standen zwischen der Straße und dem Coquet die graue Steinkirche mit dem Pfarrhaus und drei Cottages. Die Kirche würdigte er kaum eines Blickes und schaute an ihr vorbei über den Fluss hinüber zu dem massiven Gebäude aus grauem Stein, das sich in majestätischer Pracht erhob.
Wolverstone Castle.
Die schwer befestigte normannische Burg, erweitert und erneuert von nachfolgenden Generationen, blieb das zentrale, alles beherrschende Gebäude. Wehrgänge mit Zinnen erhoben sich über die niedrigeren Dächer der einzigartig abgespreizten Flügel aus der frühen Tudorzeit. Einer verlief erst nach Westen, dann nördlich, der andere erst nach Osten, dann südlich. Die Burg war nach Norden ausgerichtet und gewährte einen unverstellten Blick auf ein schmales Tal, durch das die zur Grenzmarkierung gehörende Clennell Street von den Hügeln herunterkam. Weder Räuber noch Kaufleute konnten die Grenze auf dieser Route überqueren, ohne unter Wolverstones stets wachsame Augen zu treten.
Aus der Entfernung konnte er über das Hauptgebäude hinaus wenig ausmachen. Die Burg stand auf sanft sich wellendem Land über der Schlucht, die der Coquet im Westen des Dorfes Alwinton gegraben hatte. Der Park der Burg dehnte sich nach Osten, Süden und Westen aus; das Land hob sich weiter an, bis es schließlich zu Hügeln wurde, welche die Burg südlich und westlich schützten. Die Cheviots ihrerseits schützten die Burg vor Nordwinden; nur aus dem Osten, der Richtung, aus der die Straße sich näherte, war die Burg sogar durch die Naturelemente verwundbar.
Dies war immer der erste Anblick gewesen, den er auf sein Zuhause gehabt hatte. Und trotz alldem, was geschehen war, spürte er, wie die Verbundenheit ihn einfing und das Gefühl einer Seelenverwandtschaft sich in ihm breitmachte.
Er hatte an den Zügeln geruckt und die Pferde stehen bleiben lassen, bis er sie schließlich wieder lostrotten ließ, während er sich noch aufmerksamer umschaute.
Felder, Zäune, Ernte und Cottages schienen einigermaßen in Ordnung. Mit gleichmäßiger Geschwindigkeit durchfuhr er das Dorf, das nicht größer war als ein Weiler. Die Dorfbewohner würden ihn erkennen. Manche mochten ihn sogar anhalten wollen, aber er war nicht bereit, sie zu begrüßen und Beileidsbekundungen zum Tode seines Vaters entgegenzunehmen – noch nicht.
Eine weitere Steinbrücke spannte sich über die tiefe, schmale Schlucht, durch die der Fluss sprudelte und schäumte. Die Schlucht war der Grund, warum keine Armee jemals versucht hatte, Wolverstone einzunehmen. Die Annäherung war einzig über die Steinbrücke möglich, die leicht zu verteidigen war. Wegen der Hügel auf allen anderen Seiten war es unmöglich, Steinschleudern oder andere Belagerungswaffen in Stellung zu bringen – immer waren sie für Bogenschützen auf den Wehrgängen leicht erreichbar.
Royce fuhr über die Brücke. Das Hufgeklapper ertrank im Gebrüll des Wassers, das wild und turbulent unter ihm dahinschoss. Genau wie sein Temperament. Je näher er der Burg kam – und all dem, was ihn dort erwartete –, desto mächtiger brodelten die Gefühle in ihm und desto ruheloser und nervöser machten sie ihn.
Hungriger, rachedurstiger und fordernder.
Die großen schmiedeeisernen Tore vor ihm standen offen wie immer. Die Darstellung eines großen zähnefletschenden Wolfskopfs in der Mitte eines jeden Flügels passte zu den Bronzestatuen oben auf den Steinsäulen, an deren Seiten die Tore herabhingen.
Royce ließ die Zügel klatschen und die Pferde durch das Tor stürmen. Als ob die Tiere spürten, dass die Reise sich dem Ende näherte, legten sie sich noch einmal ordentlich ins Geschirr, flitzten an den Bäumen vorbei, an den massiven alten Eichen, die den Rasen zu beiden Seiten säumten. Er bemerkte es kaum, denn seine gesamte Aufmerksamkeit und all seine Sinne hatte er auf das Gebäude gerichtet, das sich vor ihm erhob.
Es war so massiv und so fest im Boden verankert wie die Eichen. Seit so vielen Jahrhunderten stand es dort, dass es zum Teil der Landschaft geworden war.
Als die Pferde sich dem Vorhof näherten, ließ er sie langsamer gehen, sog den Anblick des grauen Steins in sich ein, der schweren Mauerstürze und der weit zurückgesetzten, mit Blei eingefassten Fensterrauten, die in das dicke Mauerwerk eingelassen waren. Die Vordertür lag in einem hohen Steinbogen, der ursprünglich ein Fallgatter gewesen war und keine Tür – genau wie die Eingangshalle dahinter mit ihrer gebogenen Decke ursprünglich ein Tunnel war, der in den inneren Burghof führte. Die Frontfassade, die sich über drei Stockwerke erstreckte, war aus der Mauer des inneren Burghofs errichtet worden. Die Mauer des äußeren Burghofs war vor langer Zeit abgerissen worden, und der eigentliche Wohnbereich befand sich tiefer im Innern des Gebäudes.
Royce ließ die Tiere an der Fassade entlanggehen und versank eine Weile in seinen Gefühlen. Über der unbeschreiblichen Freude, wieder zu Hause zu sein, lag ein tiefer Schatten, der sie in einem Netz dunklerer Gefühle gefangen hielt. Seinem Vater so nahe zu sein – dem Ort, an dem sein Vater sich hätte aufhalten sollen, sich aber nicht länger aufhielt – wetzte nur die ohnehin schon rasiermesserscharfe Klinge seines ruhelosen, unversöhnlichen Zornes.
Unvernünftigen Zornes – Zorn, der sich gegen nichts richtete. Den er aber trotzdem empfand.
Er atmete tief durch, füllte seine Lunge mit der kühlen, knackigen Luft, biss die Zähne zusammen und ließ die Pferde zur Rückseite des Hauses trotten.
Als er den Nordflügel umrundet hatte und die Ställe ins Blickfeld rückten, fiel ihm ein, dass er in der Burg keinen passenden Gegner finden würde, an dem er sein Temperament austoben konnte, seinen abgründigen, beständigen Zorn.
Er fügte sich in die Aussicht auf eine weitere schlaflose Nacht mit rasenden Kopfschmerzen.
Sein Vater war tot.
So sollte es nicht sein.
Zehn Minuten später betrat er das Haus durch den Nebeneingang, den er auch früher schon benutzt hatte. Die wenigen Minuten im Stall hatten nichts gegen seine Laune ausrichten können; Stallmeister Milbourne, der noch aus früheren Zeiten stammte, hatte sein Beileid bekundet und ihn zu Hause willkommen geheißen.
Für die gut gemeinten Worte hatte Royce sich mit einem kurzen Nicken bedankt und die Postpferde der Fürsorge seines Stallmeisters überlassen, als ihm einfiel, dass Milbournes Neffe Henry in Kürze mit Royce’ eigenem Gespann eintreffen würde. Er hatte sich erkundigen wollen, wer aus der früheren Dienerschaft sonst noch anwesend war, es dann aber doch unterlassen. Milbourne sah zu verständnisvoll aus, was dazu führte, dass Royce sich … entblößt fühlte.
Ein Gefühl, das er ganz und gar nicht schätzte.
Der Übermantel schwang ihm um die Stiefel, als er zur Westtreppe eilte. Er zog die Kutscherhandschuhe aus, stopfte sie in seine Tasche und nahm drei schmale Stufen auf einmal.
Die letzten achtundvierzig Stunden hatte er allein verbracht, war gerade angekommen – und musste jetzt wieder allein sein, um die unerwartet heftigen Gefühle, die es in ihm aufgewühlt hatte, auf diese Weise zurückkehren zu lassen, einzufangen und irgendwie zu unterdrücken. Er musste seine Ruhelosigkeit besänftigen und besser in den Griff bekommen.
Der Flur im ersten Stockwerk erstreckte sich vor ihm. Er stürmte die letzten Stufen hinauf, betrat den Flur, drehte sich schwungvoll in Richtung des Westturms – und stieß mit einer Frau zusammen.
Er hörte, wie sie nach Luft schnappte.
Spürte, wie sie stolperte, und fing sie auf – schloss seine Hände um ihre Schultern und brachte sie ins Gleichgewicht. Hielt sie fest.
Noch bevor er ihr ins Gesicht geschaut hatte, wollte er sie nicht mehr gehen lassen.
Dann fing sein Blick sich in ihren aufgerissenen, dunklen, braunen Augen, in denen goldene Flecken tanzten und die von dichten braunen Wimpern umrahmt waren. Ihr langes Haar schimmerte wie weizengoldfarbene Seide; dicke Strähnen waren ineinandergedreht und hoch auf ihrem Kopf festgesteckt. Ihre Haut war perfekt, sahnig, die Nase aristokratisch gerade, das Gesicht herzförmig, das Kinn adrett gerundet. Nachdem er ihre Züge mit einem Blick erfasst hatte, betrachtete er ihre Lippen. Rosa wie eine Rosenblüte, vor Schreck geteilt, die untere zitterte leicht, und ihn überfiel der beinahe überwältigende Drang, seine Lippen auf sie zu drücken.
Unversehens hatte sie ihn in den Bann geschlagen. Er hatte nicht die geringste Ahnung gehabt, dass sie überhaupt dort war, denn der dicke Teppichläufer hatte das Geräusch ihrer Schritte verschluckt. Offenkundig hatte er sie erschreckt; die geweiteten Augen und ihr leicht geöffneter Mund verrieten ihm, dass sie ihn umgekehrt auch nicht auf der Treppe gehört hatte. Bestimmt hatte er sich wie üblich leise bewegt.
Sie war rückwärts gestolpert. Nur wenige Zoll trennten seinen harten Körper von ihrem viel weicheren. Er wusste, dass sie weich war, hatte gespürt, wie ihre reife Figur sich vorn an ihn gedrückt und in dieser flüchtigen Sekunde der Berührung seine Sinne versengt hatte.
Sein Verstand fragte sich, wie eine Lady wie sie dazu kam, durch diese Hallen zu wandern, während er auf einer primitiveren Ebene gegen den Drang kämpfte, sie aufzuheben, in sein Zimmer zu tragen und den plötzlichen, erschütternd heftigen Schmerz in seinen Lenden zu erleichtern – und sein Temperament auf diese einzig mögliche Art zu zerstreuen, von der er sich nie hätte träumen lassen, dass sie ihm zur Verfügung stehen könnte.
Und die eher primitive Seite in ihm erkannte es nur als sein Recht an, dass dieses weibliche Wesen – wer auch immer es sein mochte – genau an diesem Ort zu genau diesem Zeitpunkt entlangging und dass sie genau das richtige weibliche Wesen war, das ihm diesen einzigartigen Dienst leisten sollte.
Wut, sogar Zorn konnte sich in Lust verwandeln. Mit der Verwandlung war er vertraut, ohne dass sie ihn jemals mit solcher Geschwindigkeit oder solcher Wucht ereilt hatte. Noch nie zuvor hatte das Ergebnis seine Selbstbeherrschung infrage gestellt.
Die verzehrende Lust, die er in dieser Sekunde nach ihr empfand, war so heftig, dass es sogar ihn erschütterte.
Es reichte, um den Drang niederzuringen, die Kiefer noch fester aufeinanderzupressen, seinen Griff zu verstärken und sie hinzustellen.
Er musste seine Hände bewusst zwingen, sie loszulassen.
»Ich bitte um Entschuldigung.« Royce klang beinahe knurrend. Mit einem kurzen Nicken in ihre Richtung und ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, marschierte er weiter und brachte rasch Distanz zwischen sich und sie.
Hinter sich hörte er, wie zischend eingeatmet wurde, hörte ihre Röcke rascheln, als sie herumwirbelte und ihm nachstarrte.
»Royce! Dalziel … oder wie auch immer du dich heute nennst … bleib stehen!«
Er marschierte weiter.
»Verdammt, ich werde dir nicht nachlaufen … ich weigere mich!«
Er hielt inne. Hob den Kopf und überlegte, wer es wagen würde, ihn mit solchen Worten und in solchem Tonfall anzureden.
Die Liste war nicht besonders lang.
Langsam vollführte er eine halbe Drehung und warf einen Blick zurück auf die Lady, die offenkundig nicht wusste, in welcher Gefahr sie gerade schwebte. Ihm nachlaufen? Sie sollte lieber in die andere Richtung die Flucht ergreifen. Aber …
Lang verschüttete Erinnerungen verknüpften sich endlich mit den Tatsachen der Gegenwart. Die Augen in den satten Farben des Herbstes waren der Schlüssel. Er zog die Stirn kraus.
»Minerva?«
Die wunderschönen Augen waren nicht länger aufgerissen, sondern vor Ärger ganz eng geworden, und ihre üppigen Lippen hatte sie zu einem grimmigen Strich zusammengepresst.
»Allerdings.« Sie zögerte, verschränkte die Hände vor dem Bauch und hob das Kinn. »Ich nehme an, dass du gar nicht darüber Bescheid weißt, aber ich bin hier die Châtelaine.« Sie war also verantwortlich für den Haushalt der Burg.
Anders als von Minerva erwartet, sorgte die Aufklärung nicht dafür, dass das versteinerte Gesicht, das sie anschaute, weicher wurde. Die strenge Linie seiner Lippen entspannte sich nicht, und in seinen dunklen Augen glänzte kein Wiedererkennen auf – keinerlei Anzeichen, dass ihm aufgefallen war, er könnte auf ihre Hilfe angewiesen sein, obwohl er sie inzwischen immerhin eingeordnet hatte: Minerva Miranda Chesterton, die verwaiste Tochter einer Freundin seiner Mutter aus deren Kindertagen. Nachfolgend die Sekretärin seiner Mutter, ihre Gesellschafterin sowie Vertraute – und vor nicht langer Zeit dasselbe für seinen Vater, was Royce aber höchstwahrscheinlich nicht klar war.
Von ihnen beiden war Minerva diejenige, die wusste, wer sie war, was sie war und was sie zu tun hatte. Royce hingegen war sich des Ersteren zumindest unsicher, des Zweiten noch unsicherer und hatte fast keine Ahnung, was das Dritte betraf.
Darauf war sie vorbereitet. Worauf sie jedoch nicht vorbereitet war und was sie nicht vorhergesehen hatte, war das riesige Problem, dem sie jetzt gegenüberstand. Die ganzen ein Meter achtzig, größer und unendlich viel mächtiger, als sie es sich in ihrer lebhaften Fantasie ausgemalt hatte.
Der elegante Übermantel hing ihm über den Schultern, die breiter und schwerer waren, als sie sie in Erinnerung hatte. Aber schließlich hatte sie ihn das letzte Mal gesehen, als er einundzwanzig war. Außerdem war er einen Hauch größer geworden, und er hatte eine Härte angenommen, die zuvor nicht da gewesen war – die strengen Gesichtszüge mit Konturen wie gemeißelt, der steinharte Körper, der beinahe dafür gesorgt hatte, dass sie zu Boden stürzte.
Ja, er hatte dafür gesorgt, dass sie stürzte, mehr als nur körperlich.
Sein Gesicht sah so aus, wie sie es in Erinnerung hatte, und doch auch nicht. Verschwunden war jedes Anzeichen zivilisierter Maskierung. Die breite Stirn über auffallenden schwarzen Brauen, die sich an den Enden leicht teuflisch nach oben bogen, die Nase wie eine Klinge. Dünne bewegliche Lippen, die garantiert jedes weibliche Wesen auf gefährliche Weise in den Bann schlugen, und wohlplatzierte Augen, so tiefbraun, dass sie gewöhnlich nichts preisgaben. Die langen schwarzen Wimpern, die ihm wie Fransen über die Augen hingen, hatten sie schon immer ein wenig neidisch gemacht.
Sein Haar war immer noch schwarz, und die dicken Locken fielen ihm elegant über den wohlgeformten Kopf. Auch seine Kleidung war elegant und modisch, dabei diskret, untertrieben und kostspielig. Obwohl er eine anstrengende Reise hinter sich hatte und zwei Tage lang über das Land gerast war, sah der Knoten seines Halstuchs aus wie ein feinsinniges Kunstwerk, und die Lederstiefel glänzten unter dem Straßenstaub.
Ungeachtet dessen gab es keine Mode, die die ihm angeborene Männlichkeit verschleiern oder jene gefährliche Aura abschwächen konnte, die jede Frau mit Augen im Kopf entdecken würde. Die vergangenen Jahre hatten ihn geschliffen und poliert, hatten den durchtriebenen, mächtigen und unglaublich raubtierhaften Mann, der in ihm steckte, nur noch deutlicher hervortreten lassen.
Es schien, als ob seine wirklichen Züge noch vollendeter hervorgetreten waren, falls das überhaupt möglich war.
Er stand immer noch fünf Meter entfernt und musterte sie mit krauser Stirn, machte aber keine Anstalten, näher zu kommen, was ihren erschrockenen, beinahe ohnmächtigen und verzückten Sinnen mehr Zeit verschaffte, sich an ihm zu ergötzen.
Dabei hatte sie geglaubt, dass sie aus ihrer Verliebtheit herausgewachsen war. Sechzehn Jahre nach ihrer Trennung hätten sicherlich reichen sollen, diese Verliebtheit absterben zu lassen.
Offenkundig nicht.
Der Auftrag, den sie vor Augen gehabt hatte, war gerade unermesslich viel komplizierter geworden. Und falls er von ihrer albernen Empfänglichkeit für ihn erfuhr – die für ein dreizehnjähriges Mädchen vielleicht entschuldbar sein mochte, für eine erwachsene Lady von neunundzwanzig aber furchtbar peinlich –, würde er sein Wissen rücksichtslos ausnutzen, um sie daran zu hindern, ihn zu drängen, etwas zu tun, was er nicht tun wollte. In diesem Moment bestand der einzige Vorteil der Situation darin, dass sie in der Lage gewesen war, ihre Reaktion auf ihn als verständliche Überraschung zu kaschieren.
Auch künftig würde sie diese Reaktion verbergen müssen.
Einfach … würde es nicht werden.
Die Variseys waren ein schwieriges Geschlecht. Allerdings bewegte sie sich bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr unter ihnen und hatte gelernt, wie man mit ihnen umging. Mit allen Variseys, außer diesem … oh, das war nicht gut. Unglücklicherweise gab es nicht nur ein, sondern zwei Versprechen, die sie am Sterbebett gegeben hatte und nun erfüllen musste.
Sie räusperte sich, versuchte mit aller Macht, die Verwirrung loszuwerden, die ihre Sinne immer noch verstörte.
»So früh habe ich dich hier nicht erwartet. Aber ich bin froh, dass du es so schnell geschafft hast.« Mit erhobenem Kopf und den Blick auf ihn gerichtet, trat sie ein paar Schritte vor. »Es gibt viel zu entscheiden …«
Er drehte sich weg und ruhelos wieder zu ihr hin.
»Ja, das mag wohl stimmen. Aber erst mal muss ich mir den Staub abwaschen.« Seine Augen – dunkel, unergründlich, mit unglaublich scharfem Blick – tasteten ihr Gesicht ab. »Ich nehme an, dass du zuständig bist?«
»Ja. Und …«
Er drehte sich wieder um, war wieder fort. Seine langen Beine trugen ihn rasch über die Galerie.
»In einer Stunde bin ich zurück. Dann können wir alles besprechen.«
»Sehr wohl. Aber zu deinem Zimmer geht es nicht in dieser Richtung.«
Er hielt inne. Wieder blieb er drei Herzschläge lang abgewandt stehen, ehe er sich langsam umdrehte.
Wieder spürte sie das düstere Gewicht seines Blickes, der sie diesmal noch fester durchbohrte. Aber anstatt über die gähnende Kluft zwischen ihnen zu sprechen, die sie mittlerweile lieber aufrechterhalten als zuschütten wollte, kam, oder besser, stapfte er langsam zu ihr zurück.
Er ging so lange weiter, bis kaum mehr als ein Schritt zwischen ihnen lag, und beugte sich drohend über sie. Körperliche Einschüchterung war den männlichen Variseys zur zweiten Natur geworden; das hatten sie von der Wiege an gelernt. Sie hätte gern behauptet, dass der Trick bei ihr nicht funktionierte, denn es stimmte sogar, er übte nicht die Wirkung auf sie aus, die er beabsichtigt hatte. Nein, die Wirkung war ganz anders, heftiger und kraftvoller, als sie es sich je hatte träumen lassen. Innerlich bebte und zitterte sie; äußerlich hielt sie seinem Blick stand und wartete ruhig ab.
Erste Runde.
Er senkte leicht den Kopf, sodass er ihr direkt ins Gesicht schauen konnte.
»In all den Jahrhunderten, in denen es die Privatwohnungen der Burg nun schon gibt, sind sie nicht in eine andere Richtung rotiert.« Auch die Stimme hatte er gesenkt, nur dass sein Tonfall nichts von seiner tödlichen Schärfe verloren hatte – sondern eher noch schärfer geworden war. »Was zu bedeuten hat, dass der Westturm hinten an der Galerie liegt.«
Sie fing seinen düsteren Blick auf. Ihr war klar, dass es besser war, nicht zu nicken. Den Variseys ließ sich niemals auch nur das kleinste Zugeständnis abringen; wer ihnen den kleinen Finger reichte, dem rissen sie die ganze Hand ab.
»Ja, in diese Richtung geht es zum Westturm. Aber dein Zimmer ist nicht mehr dort.«
Spannung pulsierte wie eine Welle durch seinen Körper. Seine Kiefermuskeln zeichnete sich hart und deutlich ab, und als er sprach, hatte seine Stimme sich zu einem warnenden Knurren gesenkt.
»Wo sind meine Sachen?«
»In den herzoglichen Gemächern.« Das hieß, im zentralen Wohnbereich, der nach Süden zeigte; sie musste ihm nicht erklären, was er ohnehin schon wusste.
Sie trat genau so weit zurück, dass sie ihm mit einer Handbewegung bedeuten konnte, ihr zu folgen, und war so kühn, ihm den Rücken zuzukehren und tiefer in den Wohnbereich hineinzugehen.
»Du bist jetzt der Herzog, und dort sind deine Räume. Die Dienerschaft hat sich abgerackert, alles rechtzeitig fertig zu haben. Das Zimmer im Westturm ist als Gästezimmer hergerichtet worden. Und bevor zu fragst«, sie hatte gehört, dass er ihr zögernd folgte und mit seinen langen Beinen den Abstand zu ihr mit wenigen Schritten überwand, »alles, was sich im Westzimmer befand, ist jetzt in den herzoglichen Gemächern. Einschließlich all deine Armillarsphären, wie ich vielleicht anfügen darf. Jede einzelne musste ich selbst hinbringen, denn die Zofen und sogar die Lakaien haben sich geweigert, sie anzufassen, aus Angst, sie könnten ihnen in den Händen zerbrechen.«
Er hatte eine beachtliche Sammlung dieser astronomischen Weltmechaniken zusammengetragen. Minerva hoffte darauf, dass er sich ermutigt fühlen würde, die notwendig gewordene Verfrachtung zu akzeptieren, wenn sie die Sammlung ausdrücklich erwähnte.
Einen Moment lang ging er schweigend neben ihr her.
»Meine Schwestern?«, fragte er dann.
»Dein Vater ist am Sonntag gestorben, kurz vor Mittag. Ich habe unverzüglich den Boten zu dir losgeschickt, war mir aber nicht sicher, was du wünschst. Also habe ich beschlossen, vierundzwanzig Stunden abzuwarten, bis ich deine Schwestern benachrichtige.« Sie schaute ihn an. »Du warst am weitesten entfernt, aber dich brauchten wir zuerst hier. Ich erwarte sie morgen.«
Er fing ihren Blick auf.
»Danke. Ich schätze es sehr, dass ich mich hier erst umsehen kann, bevor ich mich mit ihnen beschäftigen muss.«
Was natürlich der Grund war, weshalb sie so entschieden hatte.
»Ich habe einen Boten mit dem einem Brief an dich zu Collier, Collier & Whitticombe geschickt.«
»Ich habe ihn in einen Umschlag mit einem Brief von mir gesteckt und sie gebeten, mich hier zu erwarten, so schnell wie möglich und mit dem Testament.«
»Das heißt, dass sie ebenfalls morgen eintreffen werden. Höchstwahrscheinlich am späten Nachmittag.«
»In der Tat.«
Als sie um die Ecke in einen kleinen Flur einbogen, schloss am Ende des Flures ein Lakai gerade eine massive Eichentür. Der Lakai entdeckte sie, verbeugte sich tief und zog sich zurück.
»Jeffers wird dafür sorgen, dass dein Gepäck hochgetragen wird. Falls du sonst noch was brauchst …«
»Ich werde läuten. Wer ist inzwischen Butler?«
Minerva hatte sich immer gefragt, ob er irgendjemanden im Haushalt hatte, der ihn mit Nachrichten versorgte. Offenkundig nicht.
»Retford der Jüngere, der Neffe des alten Retford. Er war vorher stellvertretender Butler.«
Er nickte.
»Ich kann mich an ihn erinnern.«
Sie näherten sich der Tür zu den Räumlichkeiten des Herzogs. Wie es sich für eine würdige Châtelaine gehörte, blieb sie draußen stehen.
»In einer Stunde komme ich zu dir ins Arbeitszimmer.«
Er schaute sie an.
»Ist das Arbeitszimmer noch dort, wo es vorher war?«
»Es hat sich nicht vom Fleck gerührt.«
»Und das will was heißen, nehme ich an.«
Sie senkte den Kopf und wollte sich gerade abwenden, als ihr auffiel, dass er den Türknauf zwar mit der Hand umschlossen hatte, ihn aber nicht umdrehte.
Er stand da und starrte die Tür an.
»Es liegt länger als zehn Jahre zurück, dass dein Vater diese Räume genutzt hat«, sagte sie, »nur für den Fall, dass es für dich wichtig ist.«
Dafür kassierte sie einen düsteren Blick.
»Welche Räume hat er stattdessen genutzt?«
»Er ist in das Zimmer im Ostturm gezogen. Seit seinem Tod ist es unberührt geblieben.«
»Wann ist er dort eingezogen?« Sein Blick fiel auf die Tür. »Und hier ausgezogen?«
Es war nicht ihre Art, die Wahrheit zu verschweigen.
»Vor sechzehn Jahren.« Für den Fall, dass er nicht begriff, fügte sie hinzu: »Nach seiner Rückkehr aus London, als er dort den Bann über dich verhängt hatte.«
Er zog die Stirn kraus, als ob das alles keinen Sinn ergab.
Was sie wiederum erstaunte, aber sie hielt den Mund und wartete ab. Royce stellte keine weiteren Fragen.
Stattdessen verabschiedete er sich mit einem knappen Nicken, drehte den Türknauf und öffnete.
»Wir sehen uns in einer Stunde im Arbeitszimmer.«
Sie senkte gelassen den Kopf, drehte sich um und ging fort.
Und spürte seinen düsteren Blick im Rücken, spürte, wie er von ihren Schultern auf die Hüften glitt und schließlich auf ihre Beine. Schaffte es, ihren Schauder zu unterdrücken, bis sie seinem scharf beobachtenden Blick entkommen war.
Dann nahm sie ihren raschen Schritt wieder auf und marschierte entschlossen auf ihr eigenes Terrain – in das Morgenzimmer der Herzogin. Ihr blieb eine Stunde, sich eine ausreichend dicke Rüstung anzulegen, mit der sie sich gegen die unerwartete Wirkung des zehnten Duke of Wolverstone wappnen konnte.
Kaum hatte Royce die Räumlichkeiten des Herzogs betreten, blieb er auch schon stehen, schloss die Tür und schaute sich um.
Jahrzehnte waren vergangen, seit er dieses Zimmer das letzte Mal gesehen hatte. Trotzdem hatte sich nur wenig verändert. Die Polster waren neu, aber das Mobiliar dasselbe, alles in massiver, polierter Eiche, die mit reicher Goldpatina glänzte und deren Kanten durch das Alter abgerundet waren. Er wanderte durch das Wohnzimmer, fuhr mit den Fingern über die polierte Oberfläche der Anrichte, über die gebogenen Lehnen der Sessel und ging anschließend ins Schlafzimmer – das groß und geräumig war und einen prächtigen Blick nach Süden gewährte, über die Gärten und den See bis hin zu den Hügeln in der Ferne.
Er stand vor dem breiten Fenster und sog den Anblick förmlich in sich ein, als es klopfte.
»Herein«, rief er.
Der Lakai, den er zuvor schon gesehen hatte, tauchte mit einer großen Porzellanschale in der Tür auf.
»Heißes Wasser, Euer Gnaden.«
Er nickte und schaute zu, wie der Mann das Zimmer durchquerte, in das Ankleidezimmer trat und dann in die Badekammer.
Royce drehte sich zum Fenster zurück, als der Lakai wieder auftauchte.
»Verzeihung, Euer Gnaden, aber wünschen Sie, dass ich Ihr Gepäck auspacke?«
»Nein.« Royce schaute den Mann an, der in jeder Hinsicht durchschnittlich war: Größe, Körperbau, Alter, Teint. »Es ist nicht viel, worum es sich zu kümmern gilt … Jeffers, richtig?«
»In der Tat, Euer Gnaden. Ich war der Kammerdiener des verstorbenen Herzogs.«
Royce war nicht überzeugt, dass er einen Kammerdiener brauchte, nickte aber.
»Mein Diener Trevor wird in Kürze eintreffen. Höchstwahrscheinlich morgen. Er ist Londoner, arbeitet aber schon seit langer Zeit für mich. Obwohl er sich früher schon hier aufgehalten hat, wird er Hilfe brauchen, um sich wieder einzufinden.«
»Ich schätze mich glücklich, ein Auge auf ihn zu haben und ihn zu unterstützen, wo immer ich es kann, Euer Gnaden.«
»Gut.« Royce drehte sich wieder zum Fenster. »Sie dürfen sich entfernen.«
Als er hörte, wie die äußere Tür ins Schloss klickte, verließ er das Fenster und eilte ins Ankleidezimmer. Während er sich auszog, sich wusch und abtrocknete, versuchte er nachzudenken. Er sollte in Gedanken auflisten, was er alles zu erledigen hatte, und es in die richtige Reihenfolge bringen … aber es schien, als wäre er nur mehr zu Gefühlen fähig.
Sein Geist schien mit Belanglosem beschäftigt, mit Angelegenheiten, die keine unmittelbare Bedeutung hatten. Zum Beispiel, warum sein Vater direkt nach ihrer Konfrontation aus den Gemächern des Herzogs ausgezogen war.
Der Akt hatte einen Beigeschmack von Thronverzicht. Und doch … er begriff nicht, was ein solches Vorgehen mit der Wirklichkeit zu tun hatte; es passte einfach nicht in das Bild, das er sich im Geiste von seinem Vater gemacht hatte.
Seine Reisetasche enthielt eine vollständige Garnitur frischer Kleidung – Hemd, Halstuch, Weste, Jacke, Hose, Strümpfe, Schuhe. Er zog sich an und fühlte sich sofort viel besser in der Lage, den Herausforderungen zu begegnen, die ihn jenseits der Tür erwarteten.
Ehe er durch das Schlafzimmer ins Wohnzimmer zurückkehrte, ließ er den Blick schweifen und nahm Maß.
Minerva – seine Châtelaine – hatte recht gehabt. Nicht nur, dass dies die angemessenen Räumlichkeiten für ihn waren, jetzt, wo er Herzog geworden war; die Atmosphäre fühlte sich richtig an. Royce beschlich auch die leise Ahnung, dass sein altes Zimmer ihm nicht mehr angemessen gewesen wäre. Mittlerweile zog er es vor, mehr Platz und einen größeren Ausblick zu haben.
Im Schlafzimmer fiel sein Blick aufs Bett, und er war sich sicher, dass es ihm genauso gefallen würde. Das Zimmer wurde beherrscht von vier massiven Bettpfosten, die die geradezu dekadent dicke Matratze samt Seidendecken trugen, auf denen wiederum Kissen hoch aufgetürmt waren. Das Bett zeigte zum Fenster. Der Ausblick würde immer beruhigend, aber trotzdem interessant sein.
Im Moment jedoch konnte das Beruhigende, aber trotzdem Interessante seine Not nicht lindern. Royce ließ den Blick zu dem purpurroten und goldenen Bettüberwurf aus Seidenbrokat zurückschweifen, betrachtete die purpurroten Seidenlaken und ergänzte die Laken gedanklich mit dem Anblick seiner Châtelaine, die sich hier ausruhte.
Nackt.
Er ließ sich die Vision durch den Kopf ziehen, schwelgte ganz bewusst darin; seine Einbildungskraft war für die Aufgabe mehr als gerüstet.
Und wie es mit unerwarteten Entwicklungen zu sein pflegte, gewann seine Châtelaine den Preis. Die kleine Minerva war schließlich nicht mehr so klein. Und doch …
Dass sie unter dem Schutz seiner Mutter und daher auch unter dem seines Vaters gestanden hatte, hätte normalerweise bedeutet, dass sie für ihn außer Reichweite war. Nur dass sowohl sein Vater als auch seine Mutter jetzt tot waren, sie aber noch da, hier in diesem Haushalt, eine eingeführte Jungfrau seines Standes, und sie war … wie alt genau? Neunundzwanzig?
Innerhalb ihrer Kreise war sie jetzt nach allgemeiner Einschätzung Freiwild, außer … während er sofortige und heftige Lust für sie entwickelt hatte, hatte sie keinerlei Anzeichen zu erkennen gegeben, dass sie sein Interesse erwiderte. Die ganze Zeit war sie kühl, gelassen und ungerührt aufgetreten.
Wenn sie auf ihn so reagiert hätte wie er auf sie, dann würde sie sich jetzt hier drinnen befinden – mehr oder weniger so, wie er es sich in seiner Fantasie vorstellte, völlig entspannt und wie benommen, mit einem Lächeln der Befriedigung, das ihr auf den lüsternen Lippen lag, während sie sich nackt und nach allen Regeln der Kunst verwöhnt auf seinem Bett wälzte.
Und er würde sich viel besser fühlen, als es der Fall war. Sexuelle Hingabe war die einzige Zerstreuung, die seinem Temperament die Schärfe nehmen konnte – sie abstumpfen, dämpfen, auspumpen.
Da seine Stimmung so ungeheuerlich zugespitzt war und er verzweifelt nach einem Ventil suchte, war er nicht überrascht, dass er sich sofort auf die erste attraktive Frau fixierte, die seinen Weg gekreuzt und seine Stimmung innerhalb eines Herzschlags in eine triebhafte, lustvolle Leidenschaft verwandelt hatte. Nein, ihn überraschte die Heftigkeit, die unglaubliche Klarheit, mit der jeder Sinn, jede Faser seines Daseins sich auf sie gestürzt hatte.
Unumschränkt und besitzergreifend.
Seine Arroganz kannte kaum Schranken. Und doch, alle Ladys, die seinen Blick jemals auf sich gezogen hatten … immer hatte er ihren zuerst eingefangen. Dass er Minerva wollte, während sie ihn nicht wollte, hatte ihn aus dem Gleichgewicht gebracht.
Ihr Desinteresse und seine nachfolgende Unruhe hatten sein Verlangen nach ihr leider nicht im Mindesten gedämpft.
Er würde einfach ein Grinsen aufsetzen und es ertragen müssen – weiterhin sein Temperament zügeln und diesem Temperament die Erleichterung verwehren, nach der es drängte, während er gleichzeitig den Abstand so groß wie möglich werden ließ. Es mochte sein, dass sie seine Châtelaine war. Aber sobald er sich bei seinem Verwalter, seinem Agenten und all den anderen, die für den Überblick über seine Angelegenheiten verantwortlich waren, über den Zustand des Herzogtums informiert hatte, würde er den Kontakt zu ihr einschränken können.
Royce warf einen Blick auf die Uhr auf dem Kaminsims. Vierzig Minuten waren verstrichen. Zeit, sich im Arbeitszimmer umzuschauen, ehe sie dort eintraf. Ein paar Minuten würde er brauchen, bis er sich daran gewöhnt hatte, auf dem Stuhl hinter dem Schreibtisch seines Vaters zu sitzen.
Er ging ins Wohnzimmer zurück und schaute hoch – und sah seine Armillarsphären auf dem Kaminsims gegenüber aufgereiht. Der Spiegel dahinter bot den perfekten Schaukasten, und der Anblick zog ihn magisch an. Er überflog die Sammlung mit dem Blick, strich behutsam mit den Fingern wie über lange vergessene Freunde, blieb vor einer Sphäre stehen und ließ die Finger auf der vergoldeten Rundung ruhen, als er sich daran erinnerte, wie sein Vater sie ihm zu seinem achtzehnten Geburtstag geschenkt hatte.
Kurz darauf schüttelte er die Erinnerung ab und schaute sich jede einzelne Armillarsphäre mit den ineinander verschränkten polierten Metallkurven an …
Die Dienstmädchen und sogar die Lakaien weigern sich, sie zu berühren, aus Angst, dass sie in ihren Händen zerbrechen könnten.
Er hielt inne und schaute genauer hin, aber er hatte recht gehabt. Die Sphären waren nicht nur abgestaubt worden – sondern jede einzelne liebevoll poliert.
Royce ließ den Blick noch einmal über die aufgereihten Armillarsphären schweifen, ehe er sich abwandte und zur Tür ging.
2
Rüstungen der Art, wie Minerva sie brauchte, waren nicht leicht zu finden. Bei einem Blick auf die Uhr im Morgenzimmer der Herzogin beschwor sie sich, dass sie dann eben so zurechtkommen musste. Vor gut einer Stunde hatte sie Royce allein gelassen; schließlich konnte sie sich nicht ewig verstecken.
Seufzend stand sie auf und strich ihre stumpfen schwarzen Röcke glatt. In den nächsten drei Monaten würde sie Trauerkleidung tragen, aber zum Glück standen ihr die Farben einigermaßen gut.
Eine kleine Beruhigung, an die sie sich klammern konnte.
Sie schnappte sich die vorbereiteten Unterlagen und eilte zur Tür. Royce sollte mittlerweile im Arbeitszimmer angekommen sein und sich eingerichtet haben. Auf dem Flur hoffte sie, dass sie ihm ausreichend Zeit gewährt hatte. Weil sie damals so in ihn verknallt gewesen war, hatte sie ihn immer beobachtet, wenn sie sich an demselben Ort aufhielten– das hieß, die gesamte Zeitspanne, die er seit seinem vierzehnten Lebensjahr auf Wolverstone oder in London verbracht hatte, gleich nachdem sie als Sechsjährige in der Burg aufgenommen worden war, ihren ersten Blick auf ihn geworfen und sich sofort in ihn verliebt hatte, bis zu seinem einundzwanzigsten Lebensjahr. Deshalb kannte sie ihn besser, als er es wohl ahnen konnte. Und seinen Vater hatte sie sogar noch besser gekannt. Was sie zu besprechen hatten, die Entscheidungen, die Royce an diesem und in den nächsten Tagen zu treffen hatte, würden nicht leicht zu treffen sein und ihn auch gefühlsmäßig einiges kosten.
Damals bei dem Streit im White’s hatte Minerva sich mit seiner Mutter in London aufgehalten. Ihr waren genug Schilderungen zu Ohren gekommen, um einen einigermaßen klaren Eindruck davon zu gewinnen, was sich bei dem Streit unterschwellig tatsächlich abgespielt hatte. Bedachte man Royce’ Verwirrung, als er erfahren hatte, dass sein Vater aus den herzoglichen Gemächern ausgezogen war, war sie sich überhaupt nicht mehr sicher, dass er– Royce – so abgeklärt auf das lang vergangene Debakel zurückblickte wie sie. Abgesehen von allem anderen war er damals in einem Zustand der Erschütterung, nein, des wütenden Zornes, gewesen. Während sein Intellekt ausgezeichnet funktionierte und seine Beobachtungsgabe gewöhnlich unbestechlich scharf war, so vermutete sie doch, dass seine höheren geistigen Fähigkeiten nicht so gut arbeiteten, wenn der Zorn der Variseys ihn gepackt hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!