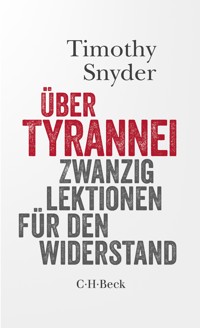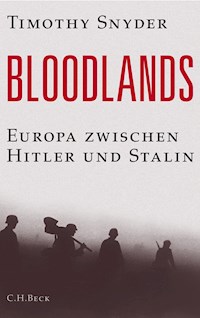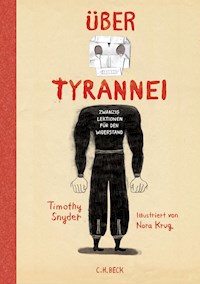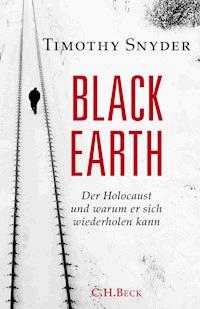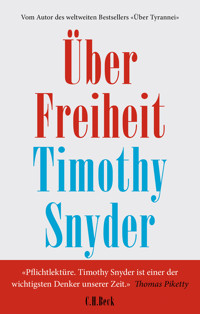
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sadopopulistische Demagogen vom Schlage eines Donald Trump oder Wladimir Putin und digitale Oligarchen im Silicon Valley, ukrainische Soldaten an der Front und Schwerverbrecher in einem Hochsicherheitsgefängnis in Connecticut – sie alle treten auf in diesem Buch. So wie Simone Weil, Edith Stein, Vaclav Havel und die Freiheitsglocke, die Timothy Snyder als Kind geläutet hat. «Über Freiheit» handelt vom alltäglichen Rassismus und der Social Media-Überflutung unseres Denkens, von der aggressiven sozialen Ungleichheit und der gigantischen Fehlentwicklung eines vergeudeten halben Jahrhunderts. Snyders Buch ist ein Weckruf, die Zukunft endlich in die Hand zu nehmen und uns gegen die Welle der Unfreiheit zu wehren, die über uns hereingebrochen ist. Timothy Snyder ist «der führende Interpret unserer düsteren Zeiten» genannt worden. Nur wenige Intellektuelle haben wie er mehr als eine halbe Million Follower bei X und schreiben Bücher, die bei Erscheinen in zwei Dutzend Sprachen übersetzt werden. Sein Weltbestseller «Über Tyrannei» hat Millionen Menschen in Washington, Kiew und Hongkong ermutigt, sich für die Freiheit einzusetzen und notfalls auch Widerstand zu leisten. Nun legt der unermüdlich gegen Putin wie gegen Trump kämpfende Historiker ein brillantes Buch vor, das erklärt, was Freiheit bedeutet, wie sie oft missverstanden wird und warum sie unsere einzige Chance ist zu überleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Timothy Snyder
ÜBER FREIHEIT
Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn
C.H.BECK
Übersicht
Cover
INHALT
Textbeginn
INHALT
Titel
INHALT
Widmung
VORWORT
EINLEITUNG: FREIHEIT
JUBILÄEN
FLÜGE
HOLOCAUSTS
GLOCKEN
GLEICHGEWICHT
EXZEPTIONALISMUS
OLIGARCHIE
BLEIBEN
KAPITEL 1: SOUVERÄNITÄT
LEIB
LEBEN
NÄCHSTER
GEHEIMNIS
STADION
TOD
RACE
GLÜCK
GESUNDHEIT
FANGEN
WERFEN
ATMEN
ERKENNEN
ANERKENNEN
SEHEN
SCHWIMMEN
KONTRAKT
KONTAKT
DARLEHEN
ÖFFNEN
KAPITEL 2: UNBERECHENBARKEIT
UNWAHRSCHEINLICHE ZUSTÄNDE
BEKUNDUNGEN UND ANPASSUNGEN
ENTROPIE UND SCHWERKRAFT
UNSERE MASCHINEN
UNSERE KOSMONAUTEN
MENSCHENRECHTE
PLASTIC PEOPLE
NORMALE DISSIDENTEN
EMANZIPATION
GLASSTOCK
DIENER
BIOGRAFIE
MAIDAN
EINGESPERRTSEIN
CELLY
VERLORENE ZEIT
WIEDERGEFUNDENE ZEIT
UNMENSCHLICHE BARRIEREN
ZOMBIES RATIONALISIEREN
BRAINHACKS
EXPERIMENTELLE ISOLATION
EISIGER TUMULT
FÜHRERLOS GEFÜHRT
SELBSTGEBAUTE KÄFIGE
RADIKALE TRADITION
KAPITEL 3: MOBILITÄT
WOLFS WORT
DER BOGEN DES LEBENS
KÖNNEN SIE SICH DAS VORSTELLEN?
FREEDOM RIDES
ÖFFENTLICHES TRAUMA
DREI DIMENSIONEN
STALINS ZUKUNFT
UNTER IMPERIEN
GESCHLOSSENE FRONTIER
SOZIALE MOBILITÄT
MITTELSCHICHT
MASSENINHAFTIERUNG
GROSSE ZONE
RASSISTISCH BEDINGTE UNFREIHEIT
POLITIK DER IMMOBILISIERUNG
RUSSISCHER GAST
KONVERGENTE STAGNATION
STRASSEN UND SCHIENEN
SADOPOPULISMUS
ZEITSCHLEIFEN
EIN PROZENT DES EINEN PROZENT
UNSÄGLICHER REICHTUM
POLITIK DER EWIGKEIT
ÖKOLOGISCHER KRIEG
VERANTWORTUNGSPOLITIK
KAPITEL 4: FAKTIZITÄT
LEBENDIGE WAHRHEIT
SONNEN
FUSION
LEBENDIGE HARMONIEN
WINZIGE STERNE
AUSLÖSCHUNGSSPIRALE
DAS BEDEUTENDE RAUHE
PARTEILINIE
PERFEKTE OPFER
AMERIKAS ENDE
DIKTATOREN WÄHLEN
FEHLENDE REPORTER
DER HORIZONT DER WAHRHEIT
SPRUDELNDER QUELL
MACHTVOLLE LÜGEN
MÖRDERISCHE BEFEHLE
FREIE REDNER
KAPITEL 5: SOLIDARITÄT
GERECHTE MENSCHEN
ZEUGNIS ABLEGEN
BÜRGERRECHTE
ZIVILGESELLSCHAFT
PRAKTISCHE POLITIK
BLASENMENSCHEN
STERBLICHKEIT
VENUS
LEERE
SUBJEKTE
OBJEKTE
HAND
EFFIZIENZ
LIBERTÄRE UNFREIHEIT
DIE HEUCHELEI DER OLIGARCHEN
CYBORG-POLITIK
TODESKULT
NOTALITARISTEN
SEE UND WALD
SCHLUSS: REGIERUNG
ERWACHEN
GEOMETRIE
INDIVIDUEN
SPALTUNGEN
DEMOKRATEN
WÄHLER
REPUBLIKANER
HISTORIKER
KINDER
SOUVERÄNE
ELTERN
BEWEGER
ARBEITER
HÄFTLINGE
VERTEILUNGEN
VERSTAND
ZUHÖRER
NACHRICHTEN
RINGE UND TÖNE
VERSTÄNDNIS
INKLUSION
CHANCE
ANHANG
POSITIVE UND NEGATIVE FREIHEIT
DANK
ANMERKUNGEN
VORWORT
EINLEITUNG: FREIHEIT
KAPITEL 1: SOUVERÄNITÄT
KAPITEL 2: UNBERECHENBARKEIT
KAPITEL 3: MOBILITÄT
KAPITEL 4: FAKTIZITÄT
KAPITEL 5: SOLIDARITÄT
SCHLUSS: REGIERUNG
PERSONENREGISTER
Zum Buch
Vita
Impressum
2
3
6
7
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
4
Für all jene, die frei sein möchten
VORWORT
«Was denkst du?», fragte Mariia lächelnd in ihrem hellen Kleid, als ich mit eingezogenem Kopf durch die niedrige Tür ihrer ordentlichen kleinen Hütte nach draußen trat, zurück in die Sonne und die Trümmer. «Ist alles so, wie es sein sollte?» Das war es. Ihre Teppiche und Decken waren in schönen geradlinigen Mustern ausgelegt, die mich an futuristische ukrainische Kunst denken ließen. Die Kabel, die zu ihrem Generator führten, waren ordentlich verlegt, und Wasserflaschen standen griffbereit. Ein dickes Buch lag aufgeschlagen auf ihrem Bett.
Außerhalb ihres metallenen Domizils, einer von einer internationalen Organisation zur Verfügung gestellten provisorischen Behausung, hingen Wollpullover zum Trocknen auf einer Leine. Auf einer Bank lag eine hübsche, mit Filz ausgekleidete Holzschublade, wie eine offene Büchse der Pandora. Als ich ihr ein Kompliment dazu machte, bot Mariia mir die Schublade als Geschenk an. Sie war ein Überbleibsel ihres Hauses, das direkt vor uns lag, eine Ruine nach dem Beschuss mit Bomben und Granaten. Nervös blickte sie gen Himmel zu einem vorbeifliegenden Flugzeug. «Alles ist passiert», seufzte sie, «und nichts davon war nötig.»
Wie alle anderen Häuser im Dorf wurde auch das von Mariia während des russischen Angriffs auf die Ukraine zerstört. Posad-Pokrovske, ganz im Süden der Ukraine gelegen, inmitten von Sonnenblumenfeldern in dieser fruchtbaren Gegend, befand sich am Rande des russischen Vormarschs. Ende 2022 hat die ukrainische Armee die Russen so weit zurückgedrängt, dass ihre Artillerie nicht mehr bis hierher reicht, sodass eine sichere Rückkehr oder ein Besuch im Dorf wie meiner jetzt, im September 2023, möglich sind.
Während ich auf der Bank Platz nehme und Mariia zuhöre, denke ich über Freiheit nach. Das Dorf, so könnte man sagen, ist befreit worden. Sind die Menschen hier frei?
Ohne Zweifel ist etwas Schreckliches aus dem Leben von Mariia verschwunden: die tägliche Bedrohung durch einen gewaltsamen Tod, eine Besetzung durch Folterer und Mörder. Aber ist das, selbst das, eine Befreiung?
Mariia ist 85 Jahre alt und lebt allein. Jetzt, da sie ihre hübsche kleine Unterkunft hat, ist sie sicherlich freier als zu der Zeit, als sie obdachlos war. Das hat damit zu tun, dass ihre Familie und Freiwillige gekommen sind, um ihr zu helfen. Und weil eine Regierung gehandelt hat, mit der sie sich durch ihre Wählerstimme verbunden fühlt. Mariia beklagt sich nicht über ihr Schicksal. Weinen muss sie nur, wenn sie von den schwierigen Herausforderungen spricht, vor denen ihr Präsident steht.
Das ukrainische Wort «Deokkupation», das wir in unserem Gespräch verwenden, ist präziser als die gängige «Befreiung». Es lädt uns dazu ein, darüber nachzudenken, was wir, über die Beseitigung von Unterdrückung hinaus, für die Freiheit brauchen könnten. Es ist viel Arbeit nötig, um eine ältere Frau in die Lage zu versetzen, Gäste willkommen zu heißen und die normalen Interaktionen eines würdevollen Menschen durchzuführen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Mariia wirklich frei war, ohne ein richtiges Haus mit einem Stuhl und ohne einen freigeräumten Weg zur Straße für ihren Rollator.
Freiheit ist nicht nur die Abwesenheit des Bösen, sondern auch die Anwesenheit des Guten.
—
Die südliche Ukraine ist Steppe; die Nordukraine besteht aus Wald. Als ich eine deokkupierte Stadt im Norden der Ukraine besuchte, hatte ich ähnliche Gedanken. Ich, der ich meine Kinder an einladenden Schulen in New Haven abgesetzt hatte, stand nun vor einem verwaisten Schulgebäude in Jahidne, das die russischen Besatzer in ein kleines Konzentrationslager verwandelt hatten. Fast die ganze Zeit über hatten die Russen dreihundertfünfzig Zivilisten, die gesamte Bevölkerung, im Keller der Schule festgehalten, zusammengepfercht auf einer Fläche von weniger als zweihundert Quadratmetern. Siebzig dieser Dorfbewohner waren Kinder, das jüngste ein Säugling.
Jahidne wurde im April 2022 deokkupiert, und ich besuchte den Ort im September desselben Jahres. Im Erdgeschoss hatten die russischen Soldaten das Mobiliar zerstört. An den Wänden hinterließen sie entmenschlichende Schmierereien über Ukrainer. Es gab keinen Strom. Im Licht der Taschenlampe meines Smartphones tastete ich mich in den Keller vor und inspizierte die Wandzeichnungen der Kinder dort. Ich konnte lesen, was sie geschrieben hatten («Nein zum Krieg»); meine Kinder halfen mir später, die Figuren zu identifizieren (beispielsweise einen Hochstapler aus dem Spiel Among Us).
An einem Türrahmen entdeckte ich zwei mit Kreide geschriebene Listen mit den Namen derjenigen, die umgekommen waren: auf der einen Seite diejenigen, die hingerichtet wurden (soweit ich sehen konnte, waren das siebzehn); auf der anderen diejenigen, die an Erschöpfung oder Krankheit gestorben waren (das waren zehn).
Zu dem Zeitpunkt, als ich in Jahidne ankam, befanden sich die Überlebenden nicht mehr im Keller. Waren sie frei?
Eine Befreiung suggeriert ein Leid, das sich verflüchtigt hat. Aber die Erwachsenen brauchen Unterstützung, die Kinder eine neue Schule. Es ist unglaublich wichtig, dass die Stadt nicht mehr besetzt ist. Aber es wäre falsch, die Geschichte von Jahidne mit dem Moment zu schließen, in dem die Überlebenden aus dem Untergrund auftauchten, oder die Geschichte von Posad-Pokrovske mit dem Ende der Bombardierung.
Der Herr, dem der Schlüssel für die Schule in Jahidne anvertraut war, bat um Hilfe beim Bau eines Spielplatzes. Inmitten eines zerstörerischen Krieges mag das wie ein seltsamer Wunsch erscheinen. Die Russen töten Kinder mit Raketen und kidnappen sie, um sie zwangsweise zu Russen zu machen. Aber dass diese Verbrechen nicht mehr da sind, reicht nicht; Deokkupation genügt nicht. Kinder brauchen Orte zum Spielen, zum Laufen, zum Schwimmen, Orte, um sich selbst zu verwirklichen. Ein Kind kann keinen Park und kein Schwimmbad bauen. Die Freude der Jugend besteht darin, solche Dinge in der Welt zu entdecken. Es bedarf kollektiver Arbeit, um Strukturen der Freiheit zu schaffen, für die Jungen genauso wie für die Alten.
—
Ich bin während des Krieges in die Ukraine gekommen, weil ich dieses Buch über Freiheit schreiben wollte. Hier ist das Thema allerorten greifbar. Einen Monat nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sprach ich mit einigen ukrainischen Parlamentariern: «Wir haben uns für die Freiheit entschieden, als wir nicht geflohen sind.» «Wir kämpfen für die Freiheit.» «Die Freiheit selbst ist die Wahl.»
So redeten nicht nur die Politiker. Als ich zu Kriegszeiten in der Ukraine mit Soldaten, Witwen und Bauern, Aktivisten und Journalisten sprach, hörte ich immer wieder das Wort «Freiheit». Interessant war, wie sie es verwendeten. Da ein Großteil ihres Landes unter völkermörderischer Besatzung stand, hätten die Ukrainer, so könnte man annehmen, allen Grund gehabt, von Freiheit als Befreiung von, als Abwesenheit des Bösen zu sprechen. Das tat aber niemand.
Auf die Frage, was sie mit «Freiheit» meinten, nannte nicht eine einzige Person, mit der ich sprach, die Freiheit von den Russen. Ein Ukrainer erklärte mir: «Wenn wir ‹Freiheit› sagen, meinen wir nicht ‹Freiheit von etwas›.» Ein anderer definierte den Sieg als «für etwas zu sein, nicht gegen etwas». Die Besatzer hatten sich dem Gefühl in den Weg gestellt, dass die Welt sich öffnete, dass die nächste Generation ein besseres Leben haben würde, dass die jetzt getroffenen Entscheidungen in den kommenden Jahren von Bedeutung sein würden.
Es war wichtig, die Unterdrückung zu beseitigen, das zu erlangen, was Philosophen «negative Freiheit» nennen. Aber die Deokkupation, die Beseitigung des Leids, war nur eine notwendige Bedingung für die Freiheit, nicht die Sache selbst. Ein verwundeter Soldat in einem Rehabilitationszentrum sagte mir, bei der Freiheit gehe es darum, dass jeder die Chance hat, nach dem Krieg seine eigenen Ziele zu verwirklichen. Ein Veteran, der auf eine Prothese wartete, meinte, Freiheit wäre ein Lächeln auf dem Gesicht seines Sohnes. Ein junger Soldat auf Fronturlaub erklärte, Freiheit, das seien die Kinder, die er eines Tages haben werde. Ihr Oberbefehlshaber im versteckten Stabsraum, Walerij Saluschnyj, meinte zu mir, Freiheit bedeute ein normales Leben mit Perspektiven.
Freiheit, das war eine Zukunft, in der einige Dinge gleich blieben und andere besser waren. Sie bedeutete ein Leben, das sich ausdehnt und wächst.
—
In diesem Buch versuche ich, Freiheit zu definieren. Diese Aufgabe beginnt mit der Rettung des Wortes vor übermäßigem Gebrauch und Missbrauch. Ich fürchte, dass wir in meinem eigenen Land, den Vereinigten Staaten, von Freiheit sprechen, ohne wirklich darüber nachzudenken, was sie bedeutet. Amerikaner denken dabei oft an die Abwesenheit von etwas: von Besatzung, Unterdrückung oder sogar von Regierung. Ein Individuum ist frei, glauben wir, wenn die Regierung aus dem Weg ist. Negative Freiheit ist unser gängiges Verständnis.
Natürlich ist es verlockend, Freiheit als «wir gegen die Welt» zu betrachten, wie es der negative Freiheitsbegriff ermöglicht. Wenn die Schranken das einzige Problem sind, dann muss mit uns alles in Ordnung sein. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Wir glauben, wir wären frei, wäre nicht die Welt da draußen, die uns übel mitspielt. Aber reicht die Beseitigung von etwas in der Welt aus, um uns frei zu machen? Ist es nicht mindestens genauso wichtig, Dinge hinzuzufügen?
Wenn wir frei sein wollen, werden wir bejahen, nicht nur verneinen müssen. Manchmal werden wir zerstören müssen, aber sehr viel häufiger werden wir schöpferisch tätig sein müssen. Am häufigsten werden wir sowohl die Welt als auch uns selbst in Übereinstimmung bringen müssen, auf der Grundlage dessen, was wir wissen und wertschätzen. Wir brauchen Strukturen, und zwar genau die richtigen, sowohl moralische als auch politische. Tugend ist untrennbarer Bestandteil von Freiheit.
«Steinmauern machen kein Gefängnis/und Eisenstangen keinen Käfig» – sagt der Dichter. Manchmal tun sie es, manchmal aber auch nicht. Unterdrückung ist nicht nur eine Frage der Behinderung, sondern auch der menschlichen Absichten, die dahinter stehen. Im ukrainischen Donezk wurde eine verlassene Fabrik in ein Kunstlabor umgewandelt; unter russischer Besatzung wurde dasselbe Gebäude zu einer Foltereinrichtung. Der Keller einer Schule kann, wie in Jahidne, ein Konzentrationslager sein.
Die ersten Konzentrationslager der Nationalsozialisten befanden sich deshalb in Bars, Hotels und Burgen. Das erste feste KZ, Dachau, war eine aufgelassene Fabrik. Auschwitz war zuvor ein polnischer Militärstützpunkt, der die Menschen vor einem deutschen Angriff schützen sollte. Kozelsk, ein sowjetisches Kriegsgefangenenlager, in dem polnische Offiziere vor ihrer Hinrichtung gefangen gehalten wurden, war ein Kloster gewesen – und zwar genau das, in dem Fjodor Dostojewski in Die Brüder Karamasow den Dialog mit der berühmten Frage stattfinden lässt: Wenn Gott tot ist, ist dann alles erlaubt?
Keine höhere Macht macht uns frei, genauso wenig das Fehlen solch einer höheren Macht. Die Natur gibt uns die Chance, frei zu sein: nicht weniger und nicht mehr. Man sagt uns, dass wir «frei geboren» sind: Das stimmt nicht. Wir werden schreiend geboren, verbunden mit einer Nabelschnur und bedeckt mit dem Blut einer Frau. Ob wir frei werden, hängt von den Handlungen anderer ab, von den Strukturen, die diese Handlungen ermöglichen, von den Werten, die diesen Strukturen Leben einhauchen – und erst dann von einem Flackern der Spontaneität und dem Mut unserer eigenen Entscheidungen.
Die Strukturen, die uns behindern oder befähigen, sind physischer und moralischer Natur. Es ist wichtig, wie wir über Freiheit sprechen und denken. Freiheit beginnt damit, dass wir unseren Geist von falschen Ideen deokkupieren. Und es gibt richtige und falsche Ideen. In einer Welt des Relativismus und der Feigheit ist die Freiheit das Absolute unter den Absoluten, der Wert der Werte. Nicht weil Freiheit das eine Gut ist, dem sich alle anderen beugen müssen. Sondern weil Freiheit die Voraussetzung ist, unter der all die guten Dinge in und zwischen uns fließen können.
Freiheit ist auch kein Vakuum, das ein toter Gott oder eine leere Welt hinterlassen haben. Sie ist keine Abwesenheit, sondern eine Präsenz, ein Leben, in dem wir vielfältige Verpflichtungen wählen und Kombinationen davon in der Welt verwirklichen. Tugenden sind real, so real wie der Sternenhimmel; wenn wir frei sind, lernen wir sie, stellen sie zur Schau, erwecken sie zum Leben. Im Laufe der Zeit definiert unsere Wahl der Tugenden uns als Menschen mit Willen und Individualität.
—
Wenn wir davon ausgehen, dass Freiheit etwas Negatives ist, die Abwesenheit von diesem oder jenem, glauben wir, dass wir nur ein Hindernis beseitigen müssen. In dieser Denkweise ist die Freiheit der Normalzustand des Universums, der uns von einer höheren Macht gebracht wird, wenn wir den Weg frei machen. Das ist naiv.
Den Amerikanern wird beigebracht, dass uns die Freiheit durch unsere Gründerväter, unseren Nationalcharakter oder unsere kapitalistische Wirtschaft gegeben ist. Nichts davon stimmt. Freiheit kann nicht gegeben werden. Sie ist kein Erbe. Wir nennen Amerika ein «freies Land», aber kein Land ist frei. Der eritreische Dissident und Dichter Y. F. Mebrahtu wies einmal auf die unterschiedliche Rhetorik von Unterdrückern und Unterdrückten hin und bemerkte: «Sie reden vom Land, wir reden von den Menschen.» Nur Menschen können frei sein. Wenn wir glauben, dass etwas anderes uns frei macht, lernen wir nie, was wir tun müssen. In dem Moment, in dem wir glauben, dass Freiheit gegeben ist, ist sie weg.
Wir Amerikaner glauben gerne, dass Freiheit eine Frage der Beseitigung von Dingen ist und dass der Kapitalismus diese Arbeit für uns erledigt. Doch es ist eine Falle, an diese oder irgendeine andere äußere Quelle der Freiheit zu glauben. Wenn wir Freiheit mit äußeren Faktoren in Verbindung bringen, und uns jemand sagt, dass die Welt da draußen jetzt eine Bedrohung darstellt, dann opfern wir die Freiheit für die Sicherheit. Das erscheint uns sinnvoll, denn in unserem Herzen waren wir bereits unfrei. Wir glauben, dass wir Freiheit gegen Sicherheit eintauschen können. Das ist ein fataler Fehler.
Freiheit und Sicherheit gehen Hand in Hand. In der Präambel der amerikanischen Verfassung heißt es, dass neben dem «allgemeinen Wohl» und der «Landesverteidigung» auch das «Glück der Freiheit» zu erstreben sei. Wir müssen Freiheit und Sicherheit haben. Damit Menschen frei sein können, müssen sie sich sicher fühlen, insbesondere als Kinder. Sie müssen die Chance haben, sich gegenseitig und die Welt zu kennen. Als freie Menschen entscheiden sie dann, welche Risiken sie eingehen wollen, und aus welchen Gründen.
Als Russland in die Ukraine einmarschierte, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj seinem Volk nicht, dass es seine Freiheit gegen Sicherheit eintauschen müsse. Er sagte den Menschen, dass er im Land bleiben werde. Nach meinem Besuch in Jahidne sprach ich mit ihm in seinem Büro in Kyjiw, hinter vielen Sandsäcken. Er bezeichnete die Deokkupation als Chance, sowohl Sicherheit als auch Freiheit wiederherzustellen. Er sagte, dass der «Verlust der Freiheit Unsicherheit» und dass «Unsicherheit der Verlust der Freiheit» sei.
—
Bei der Freiheit geht es darum, zu wissen, was wir wertschätzen, und es mit Leben zu füllen. Sie hängt also davon ab, was wir tun können – und das wiederum hängt von anderen ab, von Menschen, die wir kennen, und von Menschen, die wir nicht kennen.
Während ich dieses Vorwort in einem Nachtzug aus Kyjiw in Richtung Westen schreibe, weiß ich, wie viel Zeit mir noch bleibt, bis ich die polnische Grenze erreiche. Dieses Wissen gibt mir ein wenig Sicherheit und ein wenig Freiheit zum Arbeiten – dank der Arbeit anderer Menschen. Jemand anderes hat die Gleise verlegt und repariert sie, wenn sie beschossen werden, jemand anderes hat die Waggons gebaut und kümmert sich um sie, jemand anderes steuert den Zug. Wenn die ukrainische Armee Städte von den Besatzern befreit, hisst sie die Flagge und teilt die Fotos. Aber die Ukrainer betrachten Städte meist erst dann als wirklich befreit, wenn der Bahnverkehr wiederhergestellt ist.
Russische Propagandisten behaupten, es gebe kein «richtig» und kein «gut», und deshalb sei alles erlaubt. Die Folgen dieser Sichtweise sind in der deokkupierten Ukraine allgegenwärtig, in den Todesgruben, die ich in Butscha gesehen habe, in zerstörten Siedlungen wie Posad-Pokrovske, in Konzentrationslagern wie Jahidne. Russische Soldaten in der Ukraine bezeichnen Städte, die sie zerstören, als «befreit». Und in der Tat: Aus ihrer Sicht sind alle Hindernisse beseitigt worden. Sie können die Trümmer und Leichen, wie in Mariupol, mit Bulldozern platt machen, etwas anderes bauen, es verkaufen. In diesem negativen Sinne von «frei» sind sie frei, zu morden und zu stehlen.
Die Räder und Schienen unter mir machen mich nicht frei, aber sie bringen mich voran, schaffen Voraussetzungen für meine Freiheit, die ich selbst nicht schaffen könnte. Ich wäre jetzt ein weniger freier Mensch, wenn es keinen Zug gäbe oder wenn Russland den Bahnhof von Kyjiw zerstört hätte. Die Menschen in der Ukraine waren nicht freier, als Russland öffentliche Versorgungseinrichtungen und Schulen zerstört hat.
Wir ermöglichen Freiheit nicht, indem wir es ablehnen, regiert zu werden, sondern indem wir die Freiheit als Leitfaden für eine gute Regierung bejahen. Wenn wir von der richtigen Definition von Freiheit ausgehen, werden wir meiner Meinung nach zur richtigen Art von Regierung gelangen. Und so beginnt dieses Buch mit einer einleitenden Betrachtung über die Freiheit und endet mit einer abschließenden Betrachtung über die Regierung. Die fünf Kapitel dazwischen weisen den Weg von der Philosophie zur Politik.
—
Wie manifestiert sich die Freiheit in unserem Leben? Die Verbindungen zwischen der Freiheit als Prinzip und der Freiheit als Praxis bilden die fünf Formen von Freiheit.
Diese Formen schaffen eine Welt, in der die Menschen auf der Grundlage von Werten handeln können. Das sind keine Regeln oder Anweisungen. Sie sind das logische, moralische und politische Bindeglied zwischen gemeinsamem Handeln und der Ausbildung freier Individuen. Diese Formen lösen einige scheinbare Rätsel: Ein freier Mensch ist ein Individuum; aber niemand wird allein zu einem Individuum; Freiheit wird während eines einzigen Lebens empfunden, muss aber das Werk von Generationen sein.
Die fünf Formen sind: Souveränität oder die erlernte Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen; Unberechenbarkeit oder die Fähigkeit, physikalische Gesetzmäßigkeiten den persönlichen Zwecken anzupassen; Mobilität oder die Fähigkeit, sich wertegeleitet durch Raum und Zeit zu bewegen; Faktizität oder der Bezug zur Welt, der es uns ermöglicht, sie zu verändern; und Solidarität oder die Erkenntnis, dass Freiheit für alle da ist.
Die Mühen der Freiheit beginnen nach den Wehen einer Mutter. Ein Baby verfügt über das Potenzial, die Welt einzuschätzen und zu verändern, und entwickelt die dafür erforderlichen Fähigkeiten mit Unterstützung und in Gemeinschaft anderer. Das ist Souveränität.
Mit dem Erwachsenwerden lernt ein junger Mensch, die Welt zu sehen, wie sie ist, und sich vorzustellen, wie sie sein könnte. Ein souveräner junger Mensch mischt gewählte Tugenden mit der Außenwelt, um etwas Neues zu schaffen. Deshalb ist Unberechenbarkeit die zweite Form der Freiheit.
Unser Körper braucht Orte, an die er gehen kann. Als junge Menschen können wir nicht selbst die Bedingungen schaffen, die es uns ermöglichen, souverän und unberechenbar zu sein. Aber wenn diese Bedingungen erst einmal geschaffen sind, rebellieren wir gegen genau die Institutionen, die sie erst ermöglicht haben, und gehen unseren eigenen Weg. Und diese Mobilität, die dritte Form der Freiheit, gilt es zu fördern.
Wir sind nur frei, Dinge zu tun, die wir tun können, und nur frei, an Orte zu gehen, an die wir gehen können. Was wir nicht wissen, kann uns schaden, und was wir wissen, kann uns ermächtigen. Die vierte Form der Freiheit ist Faktizität.
Kein Mensch erlangt Freiheit allein. Praktisch und ethisch bedeutet Freiheit für dich Freiheit für mich. Dies anzuerkennen ist Solidarität, die letzte Form der Freiheit.
Die Lösung des Freiheitsproblems besteht nicht, wie manche Rechte meinen, darin, den Staat lächerlich zu machen oder abzuschaffen. Die Lösung besteht auch nicht, wie einige Linke meinen, darin, die Rhetorik der Freiheit zu ignorieren oder zu verwerfen.
Freiheit rechtfertigt Regierung. Die Formen der Freiheit zeigen uns, wie.
—
Dieses Buch folgt der Logik einer Argumentation und der Logik eines Lebens. Die ersten drei Formen der Freiheit beziehen sich auf verschiedene Lebensphasen: Souveränität auf die Kindheit, Unberechenbarkeit auf die Jugend, Mobilität auf das junge Erwachsenenalter. Faktizität und Solidarität sind die reifen Formen der Freiheit und ermöglichen die anderen. Jeder dieser Formen ist ein Kapitel gewidmet.
In der Einleitung erzähle ich aus meinem eigenen Leben, beginnend mit der Erinnerung an die Zeit, als ich zum ersten Mal über Freiheit nachgedacht habe: im Sommer 1976, während der Zweihundertjahrfeier der USA. Ich werde versuchen, anhand meiner eigenen Fehler aus fünf Jahrzehnten zu zeigen, wie unser falsches Freiheitsverständnis zum Teil entstanden ist und was wir tun könnten, um es richtigzustellen. Der Schluss beschreibt eine gute Regierung, eine, die wir gemeinsam schaffen könnten. Darin stelle ich mir ein Amerika vor, das im Jahr 2076, zum dreihundertsten Jahrestag, ein Land von Freien ist.
Die Kapitel sind in Vignetten unterteilt. Einige enthalten Erinnerungen, die mir in den Sinn kamen, als ich versuchte, ein philosophisches Thema zu behandeln. Die Erinnerungsblitze ermöglichen eine gewisse Reflexion. Sie erlauben mir, auf mein früheres Ich eine bescheidene Version der sokratischen Methode anzuwenden: den Sinn von Wörtern und die Lebensgewohnheiten zu hinterfragen, um das zu wecken, was in gewisser Weise bereits bekannt ist. Es geht darum, Wahrheiten über dieses Land und über die Freiheit herauszufinden, die mir damals im jeweiligen Moment nicht klar waren und die mir auch heute nicht klar wären, wenn ich diese früheren Erfahrungen nicht gemacht hätte.
Das ist eine philosophische Methode, die sich (so hoffe ich) für einen Historiker eignet. Als solcher stütze ich mich auf historische Beispiele, weiß ich über die Vergangenheit mancher Gegenden besser Bescheid als über andere. Dieses Buch handelt von den Vereinigten Staaten, aber ich ziehe dabei Vergleiche mit Westeuropa, Osteuropa, der Sowjetunion und Nazideutschland.
Dabei bin ich im Austausch mit Philosophen der Antike, der Moderne und der Gegenwart. Manchmal lasse ich die Bezüge unausgesprochen; wer sich dafür interessiert, wird sie erkennen. Explizit zitiere ich fünf Denker und Denkerinnen: Frantz Fanon, Václav Havel, Leszek Kołakowski, Edith Stein und Simone Weil. Diese Persönlichkeiten sind, von gewissen Ausnahmen abgesehen, in den Vereinigten Staaten nicht wirklich bekannt, sie lebten nicht dort und haben nicht über die USA geschrieben. Manchmal brauchen wir den Anstoß durch eine andere Tradition (oder durch einen Begriff aus einer anderen Sprache), um uns von Fehleinschätzungen zu befreien. Von diesen Denkern und Denkerinnen übernehme ich jeweils eine bestimmte Vorstellung, die meiner Argumentation förderlich ist. Ich will damit nicht behaupten, dass sie in jeder Frage untereinander (oder mit mir) übereinstimmen.
Dieses Buch ist konservativ, weil es aus der Tradition schöpft, gleichzeitig aber radikal, weil es etwas Neues propagiert. Es ist Philosophie, aber es beharrt auf Erfahrung. Einige Sätze dieses Buches sind Textnachrichten, die ich mir selbst geschrieben habe, als ich während einer Krankheit, die mich fast das Leben gekostet hätte, in einem Krankenhausbett mit Unterbrechungen bei Bewusstsein war. Einige Thesen entstanden, als ich in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis ein Seminar gab. Geschrieben habe ich das Folgende großteils während dreier Reisen in die vom Krieg gebeutelte Ukraine.
Die grundsätzlichen Fragen wurden von Leserinnen und Lesern gestellt. Meine Bücher Bloodlands und Black Earth, Studien über Massentötungen, führten zu öffentlichen Diskussionen, die mich zum moralischen Thema dieses Buches brachten. Wenn ich das Schlimmste beschreiben kann, kann ich dann nicht auch das Beste verschreiben? Nach einer politischen Streitschrift Über Tyrannei und einem zeitgeschichtlichen Buch mit dem Titel Der Weg in die Unfreiheit wurde ich gefragt, wie ein besseres Amerika aussehen könnte. Dies hier ist meine Antwort.
Die Freiheit definieren zu wollen ist etwas anderes als sie zu verteidigen. Ich befrage mein früheres Ich; ich befrage andere; und andere befragen mich. Die Methode ist Teil der Antwort: Es mag eine Wahrheit über die Freiheit geben, aber wir werden sie nicht allein oder allein durch Deduktion herausfinden. Freiheit ist etwas Positives; sie in Worte zu fassen ist genauso ein Akt der Schöpfung, wie sie zu leben.
Dieses Buch soll ein Beispiel für die Tugenden sein, die es empfiehlt. Es ist, so hoffe ich, vernünftig, aber auch unberechenbar. Es soll nüchtern, aber auch experimentell sein. Es feiert nicht, wer wir sind, sondern die Freiheit, die unsere sein könnte.
Draußen vor meinem Fenster geht die Sonne auf. Die Grenze kommt näher. Ich beginne meine Betrachtung an einem Sommertag.
T. S. im Zug von Kyjiw nach Dorohusk Wagen 10, Abteil 9 6:10 Uhr, 10. September 2023
EINLEITUNG
FREIHEIT
JUBILÄEN
Es ist Sommer 1976, ein sonniger Nachmittag auf einer Farm in Ohio. Wolkenfetzen huschen über den Himmel; Kies drückt unter den Füßen. Ein Junge von sechs, bald sieben Jahren steht in der Schlange neben einem Farmhaus, um eine Glocke zu läuten: das Ich, das ich einmal war, voller Zukünfte.
Ein Schotterweg windet sich von der Landstraße nach oben. Dort, wo die Anhöhe erreicht ist, macht er eine Kurve, zwischen einem Ahornbaum, dessen ausladende Äste bis zu den ersten Reihen eines Maisfelds reichen, und einer alten Platane, die dem Farmhaus Schatten spendet. Am Ahornbaum hängt eine Schaukel, die nun, nach meinem Sprung auf den Boden, langsam ausschwingt. Hinter dem Haus führt der Weg weiter zu zwei runden Maisbehältnissen und einer alten Holzscheune und verliert sich dann in einem schmalen Pfad, der sich zu einem Teich hinunterschlängelt. Zu beiden Seiten des Weges sind Felder voller Fossilien und Pfeilspitzen, wie ich sie mir vorstelle, die jetzt von wachsenden Maisstängeln bedeckt sind.
Ich bin mit der Familie meiner Mutter auf der Farm, um Sommergeburtstage zu feiern und der amerikanischen Unabhängigkeit vor zweihundert Jahren zu gedenken. Alle Cousins und Cousinen, feinsäuberlich aufgereiht vom Ältesten bis zur Jüngsten, läuten nacheinander die Glocke. Ihr charakteristisches Doppelläuten hallt durch meine Kindheit: ein schöner hoher Ton, gefolgt von einem plumpen tieferen, wenn der Klöppel der Glocke ein zweites Mal unbeabsichtigt auf die Lippe trifft. Die Glocke hat eine Macke.
Jetzt bin ich an der Reihe. Die Glocke wiegt so viel wie ich, aber sie ist gut befestigt, und ich weiß, wie man sie in Bewegung versetzt. Die Hände um das Seil geballt, die Augen geschlossen, beuge ich mich nach hinten, um aus meinem Körper einen Hebel zu machen. Die Schwerkraft erledigt meine Arbeit. Die Glocke ertönt, unüberhörbar und unvollkommen. Ich öffne meine Augen, immer noch zurückgebeugt, und sehe nichts als Blau. Ich denke an die Freiheit.
Nachdem alle Kinder die Glocke geläutet haben, stolpern wir allesamt über eine weiß getünchte, überdachte Veranda, wo an der gegenüberliegenden Wand der Stoßzahn eines Mastodons hängt. Ich halte für einen Moment inne, um meine Turnschuhe zu suchen, und trete dann in die Küche, um mich als Letzter in den Kreis zu setzen, der sich zum stillen Tischgebet gebildet hat. Ich werfe einen Blick auf den Korb mit der ausgehenden Post, der hinter mir an der Wand hängt. Auf den Briefmarken mit der Freiheitsglocke ist die biblische Aufforderung zu lesen, die in die Glocke eingraviert ist: In einem Jubiläumsjahr «ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes aus!»
Die Freiheitsglocke hat einen Sprung. Der Riss war auf der Briefmarke deutlich zu erkennen. Die fragliche Glocke wurde 1752 für das Pennsylvania Statehouse in Philadelphia für ein anderes Jubiläum gegossen, nämlich das halbe Jahrhundert der Charter of Privileges, der Charta über die Religionsfreiheit der Kolonie. Der Makel, den wir heute sehen, trat auf, als sie zum Geburtstag von George Washington im Jahr 1846 geläutet wurde.
Die nächsten Worte dieses Bibelverses legen nahe, wie sich der Sprung interpretieren lässt: «Jeder von euch soll zu seinem Grundbesitz zurückkehren, jeder soll zu seiner Sippe heimkehren.» (Lev 25,10) Im 19. Jahrhundert verstanden die Abolitionisten diese Worte als Aufruf zur Beendigung der amerikanischen Sklaverei. Sie erklärten die Glocke am Philadelphia Statehouse zu ihrem Symbol und gaben ihr den Namen, den wir heute kennen. Später wurde die Freiheitsglocke von der Frauenbewegung in ihrem Kampf für das Wahlrecht benutzt.
Im Jahr 1976 schrieb die Briefmarke eine patriotische Legende fest: dass eine Freiheitsglocke geläutet wurde, als im Juli 1776 in Philadelphia die Unabhängigkeitserklärung verkündet wurde. Weder wurde die Glocke damals geläutet, noch hieß sie so. Ihren Namen bekam die Freiheitsglocke in Anspielung auf diejenigen, die keine Freiheit erlangten. Sie sollte den Anspruch auf eine bessere Zukunft symbolisieren, nicht an eine ideale Vergangenheit erinnern.
Die Zweihundertjahrfeier war für ein Kind eine verzwickte Angelegenheit. Sie versetzte mich in eine Welt, in der die Freiheit vor zwei Jahrhunderten errungen worden war, weil etwas, ein britisches Empire, beseitigt worden war. Wir, die Amerikaner, sollten fortan auf ewig befreit sein. Als Symbol der Zweihundertjahrfeier wurde die Freiheitsglocke ihres Verweises auf Frauen und Schwarze beraubt, was suggeriert, die Freiheit sei vollständig und ein für allemal errungen.
Auf den ersten Blick könnte es logisch erscheinen, dass die Freiheit eine Absenz ist, und angemessen, dass die Regierung uns alle gleichermaßen in Ruhe lassen sollte. Diese intuitive Annahme bezieht ihre Plausibilität aus einer Geschichte der Ausbeutung. Traditionell betrachteten sich einige Menschen als frei, weil sie die Arbeitskraft von Sklaven und Frauen ausbeuteten. Diejenigen, die sich für frei halten, weil sie über andere bestimmen, definieren Freiheit negativ, als Abwesenheit einer Regierung, eben weil nur eine Regierung die Sklaven emanzipieren oder den Frauen das Wahlrecht geben konnte. Die Verschmelzung einer Freiheitsglocke mit der amerikanischen Revolution weicht der Frage aus, was Freiheit ist und für wen diese Glocke läutet.
Als Junge von sechs, bald sieben Jahren hatte ich den Ausdruck «Underground Railroad» gehört und mich gefragt, wie es wohl wäre, sich im Keller eines Farmhauses zu verstecken. Aber es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, zu fragen, ob die amerikanische Unabhängigkeit Freiheit für alle bedeutete. Schwarze Kinder in meinem Alter hätten diese Frage nicht stellen müssen, denn die Antwort lag da draußen, im Leben selbst.
FLÜGE
Die Glocke läutet. Zeit für die Freiheit. Zeit fürs Abendessen. Da mein Geburtstag am nächsten liegt, springe ich an die Spitze der Schlange. Das Buffet beginnt an der Tür, die von der Veranda ins Haus führt, und folgt dann der Theke um die Küche herum: zuerst der Mais (der noch im Topf kocht), dann Fleisch und Gemüse und Kartoffelpüree, dann Aufläufe und Brot sowie Nachspeisen und Kaffee. Auf der Veranda liegt eine Wassermelone, wer will, kann sich später ein Stück abschneiden und es draußen essen.
Ein Tisch steht in der Küche, andere sind im Erdgeschoss verteilt, einige unter Porträts der Vorfahren. Zwischen diesen Porträts hängen eine gerahmte Besitzurkunde und eine Urkunde des Staates Ohio, die ein Jahrhundert ununterbrochene Eigentümerschaft bestätigt. Die Familie meiner Mutter lebte hier während des Krieges von 1812, während des Bürgerkriegs, während des Ersten Weltkriegs und während der Großen Depression. Meine Mutter wurde hier inmitten des Zweiten Weltkriegs geboren. Mein Vater stammte ebenfalls aus einem Farmhaus, auf der anderen Seite des Countys.
Meine Mutter brachte mich in einem Krankenhaus zur Welt, das nach einem Erfinder aus Ohio benannt war, mitten im Vietnamkrieg und wenige Wochen nach der Mondlandung von 1969. Ein paar Meilen weiter nördlich, in ihrer Fahrradwerkstatt in Dayton, hatten die Gebrüder Wright ihr Projekt eines Fluges «schwerer als Luft» verwirklicht.
Dayton war ein bedeutendes amerikanisches Zentrum für Innovation und Industrie. Hier fanden der erste kommerzielle Frachtflug und der erste Hubschrauberflug statt. Im Jahr 1900 wurde die Stadt zu einem Eisenbahnknoten, an dessen Union Station täglich Dutzende von Zügen hielten. Charles Kettering, der Namensgeber des Krankenhauses, erfand den elektrischen Anlasser für Automobile. Er begann seine Arbeit bei National Cash Register (heute NCR), gründete DELCO (Dayton Engineering Laboratories Company) und leitete die Forschung bei General Motors.
Zusammen mit der Wright-Patterson Air Force Base waren diese drei Unternehmen in den 1970er Jahren, als ich im Südwesten Ohios aufwuchs, die wichtigsten lokalen Arbeitgeber. Die Beschäftigten waren gewerkschaftlich organisiert. Die Bauern nannten National Cash Register «the Cash» und Wright-Patterson Air Force Base «the Field» (während die Stadtkinder «NCR» und «Wright-Pat» sagten). Neil Armstrong, der erste Mensch, der den Mond betrat, stammte aus Wapakoneta, einem Ort nördlich von Dayton. Als Kinder besuchten wir das ihm gewidmete Museum und trafen ihn sogar persönlich. Meine Großmutter mütterlicherseits hatte ein signiertes Foto des Astronauten. Ihr jüngerer Bruder war Pilot und Ingenieur, der an der Raumfähre mitarbeitete; der Start der Columbia war der ekstatische Moment in meiner Kindheit. Ich habe ihn im Fernsehen verfolgt und bin dann nach draußen gegangen, um in den Himmel zu schauen. Der Flug schwerer als Luft im Jahr 1903, die Mondlandung 1969, die Raumfähre 1981: Diese Flugbahn versprach eine Zukunft voller abenteuerlicher Mobilität.
Meine Eltern wuchsen auf Farmen in Clinton County, Ohio, auf, bevor sie den Sprung an die Ohio State University schafften. Ich habe einen Großteil meiner Kindheit auf diesen Farmen verbracht. Während des Sommers ließ mein Großvater väterlicherseits mich und meine Brüder mitarbeiten und nahm uns mit auf den örtlichen Jahrmarkt. Seine alten Baseballschläger und -handschuhe bewahrte er neben der Verandatür auf, so als ob jeden Moment ein Spiel beginnen könnte. Ich brachte meinen eigenen Handschuh mit und richtete es so ein, dass ich auf dem Hof Baseball üben konnte. Es konnte sein, dass drinnen die Cincinnati Reds im Fernsehen zu sehen waren, während ich draußen ein imaginäres Spiel spielte. Meine Großmutter väterlicherseits brachte mir bei, den Mais nicht zu lange zu kochen, erzählte mir ihre historischen Romane und achtete sehr darauf, wie man sprach. Sie hatte meinen Vater in einem Ein-Zimmer-Schulhaus unterrichtet.
Auf der anderen Seite des Countys, im Haus meiner Großeltern mütterlicherseits, dem mit der Glocke, zog ich mich gerne ins obere Stockwerk zurück. Inmitten der Fossiliensammlungen meiner Großmutter mütterlicherseits vertiefte ich mich in ihre Bücher über die Vergangenheit, die Gegenwart und alternative Zukünfte: Paläontologie, Zoologie, Die Zeitfalte.
Am Neujahrstag 1982 war es auf diesem Dachboden kalt und zugig, als ich von der Verhängung des Kriegsrechts im kommunistischen Polen las. In den Zeitungen machten sich die Amerikaner Sorgen über Instabilität und Atomkrieg, aber ich hatte das Gefühl von etwas Lebendigem und Interessantem. Auf den Fotos in den Zeitschriften kontrastierte das Grau der gepanzerten Mannschaftswagen und des schmutzigen Schnees mit dem Rot der Transparente der unterdrückten Gewerkschaft Solidarność.
HOLOCAUSTS
In meiner Kindheit schien die Sowjetunion immer ganz nah zu sein, nur ein paar Flugminuten mit einer ballistischen Interkontinentalrakete entfernt. Reader’s Digest brachte Artikel über die sowjetischen und die amerikanischen Atomwaffenarsenale. Das obsessive Interesse an der Zerstörungskraft der Supermächte war eine Möglichkeit, die Menschen zu ignorieren, die unmittelbar unter dem Kalten Krieg zu leiden hatten, wie die Lateinamerikaner, bei denen wir Amerikaner immer wieder einmarschierten, und die Osteuropäer, bei denen die Sowjets immer wieder einmarschierten.
In den 1980er Jahren, als sich die soziale Mobilität in den Vereinigten Staaten verlangsamte, war immer offener von einer nuklearen Konfrontation die Rede. 1984 ging ich ans Telefon, natürlich ein Festnetzapparat, und nahm an einer Umfrage teil. Der Meinungsforscher stellte mir zwei Fragen: «Ist es sicher, in Supermärkten zu arbeiten?» und «Haben Sie Angst vor einem Atomkrieg?» Daran fand ich nichts Seltsames.
Amerikanische Atomraketen wurden «Minutemen» genannt, nach den Milizen des Revolutionskriegs. In den 1970er und 1980er Jahren gehörte die Vision eines atomaren Schlagabtauschs zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zum Alltag. Hinter unserem Haus (Richtung Westen) erstreckte sich eine Wiese bis zu den eine Viertelmeile entfernten Eisenbahnschienen, auf denen bei Sonnenuntergang Güterzüge vorbeifuhren, als ich ein kleines Kind war. Durch die Wiese floss ein Bach, der ein kleines Wäldchen bewässerte, wo wir versuchten, Fische zu fangen. Südlich von unserem Haus, auf der anderen Seite der Straße, erstreckte sich ein Maisfeld hügelan bis zu einem Konvikt. Eine Sirene auf dessen Glockenturm warnte vor Tornados, aber die Kinder der Gegend assoziierten ihr Heulen mit Luftangriffen. Wenn wir vom Bach («crick») aufblickten, wo wir mit Styroporbechern Flusskrebse («crawdads») zu fangen versuchten, dachten wir an Pilzwolken und wussten, dass es Mittag war.
Es war ein Schock, als meine Großmutter mütterlicherseits, Lucile, mir erklärte, dass die Gefahr nicht aus der Ferne kam. Anlässlich des vierzigsten Jahrestags des D-Day im Jahr 1984 schickte mich eine Lehrerin mit dem Auftrag nach Hause, sie über den Zweiten Weltkrieg zu befragen. Lucile, die mir am Küchentisch gegenüber saß, meinte, dass man den Krieg nicht verstehen könne, wenn man Verwandte ausfrage. Da sie selbst Lehrerin war, nahm sie meine Schulaufgabe zum Anlass, um sicherzustellen, dass ich auch etwas lernte. Sie lachte immer und bot mir Kaubonbons an; mit vierzehn wusste ich nicht wirklich, wie sie mit ernster Miene aussah. An diesem Tag fand ich es heraus. Ihre Augen waren weit aufgerissen und ihre Wangenmuskeln angespannt, als sie mich darauf hinwies, woran ich denken sollte. Wenn ich über den Krieg schreiben würde, sollte ich an «all diese jüdischen Menschen» denken. Sie seufzte und lächelte dann wieder.
Der Holocaust an den Juden war noch gar nicht so lange her. Ich hatte das Tagebuch der Anne Frank gelesen, das ich in der fünften Klasse zufällig in einem Regal in der Schule gefunden hatte. Doch zu der Zeit, als ich meine Großmutter befragte, war der Massenmord an den Juden noch kein so bedeutsamer Teil der Erinnerung an den Krieg, wie er es dann später wurde. Das Wort Holocaust in dieser Bedeutung kam in den USA nach einer Fernsehserie 1978 allgemein in Gebrauch, doch in den 1980er Jahren war der Begriff noch zweideutig. The Day After, ein Fernsehfilm von 1983 über den nuklearen Holocaust, wurde von einhundert Millionen Amerikanern gesehen. An einem Dezembernachmittag im Jahr 1985 saß ich auf einer orangefarbenen Couch in der örtlichen öffentlichen Bibliothek und hörte zu, wie einige ältere Kinder ihren Plan für einen Atomkrieg erläuterten: sich ein Sixpack besorgen, zur Wright-Pat fahren und durch den Atomblitz sterben statt an der Strahlung danach.
Vielleicht lenkte dieser hypothetische nukleare Holocaust die Aufmerksamkeit ab von dem, was uns der jüdische Holocaust hätte lehren können. Eine mögliche Katastrophe mit Langstreckenraketen überschattete den jüngsten Beleg dafür, wie leicht ein partiell demokratisches System wie das unsere zusammenbrechen kann, wie schnell große Lügen trotzige alternative Realitäten schaffen können und wie kaltblütig Menschen sich gegenseitig umbringen können. Während des Kalten Kriegs brachten die amerikanische und die sowjetische Propaganda die jeweils andere Seite unerbittlich mit den Nazis in Verbindung; womöglich hat die jahrzehntelange gegenseitige Beschuldigung alle blind gemacht gegenüber der tatsächlichen Gefahr, die darin bestand, dass der Faschismus womöglich im eigenen Land erwuchs.
Als Jugendlicher hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass die Angst das Land unfreier machte. Als ich 1987 aufs College ging, wollte ich Atomwaffenunterhändler werden. Obwohl dieses Berufsziel nichts Unanständiges an sich hatte, wandte ich mich damit von der amerikanischen Realität ab. Ich ignorierte die Quellen der Angst, die sich direkt vor mir befanden.
GLOCKEN
In den späten 1980er Jahren, als College-Student, war ich fasziniert von Menschen, die eine Politik jenseits der Angst gefunden hatten: den osteuropäischen Dissidenten. Andrej Sacharow, einer der Begründer des sowjetischen Atomprogramms, forderte die Menschen im Westen auf, weniger an nukleare Einschüchterung und mehr an die Menschenwürde zu denken. Ich erinnere mich, dass ich meine Augen von seinem Text abwandte und in den Himmel schaute, als mir die Sache klar wurde. Wir sollten die Ursachen der Angst beseitigen, wenn wir können; wir sollten auch die Verantwortung für unsere Ängste übernehmen. Freiheit kann nicht einfach nur eine Abwesenheit sein, sie muss aus uns heraus entstehen und in die Welt hineinwachsen.
Im Herbst 1989, während meines dritten Studienjahrs, kam mir meine geplante Karriere im Bereich der nuklearen Abrüstung abhanden. Der Kommunismus in Osteuropa ging zu Ende, und die Rüstungskontrollgespräche mit der UdSSR mündeten rasch in konkrete Verträge. Es war spannend, die Berichte der amerikanischen Reporter aus Osteuropa zu lesen. Dank eines Studentenjobs am Center for Foreign Policy Development der Brown University lernte ich ein paar der Dissidenten kennen, als sie an die Macht kamen. Bei einigen Treffen in Washington war ich für den tschechoslowakischen Außenminister Jiří Dienstbier zuständig und schaffte es nicht, ihn rechtzeitig auch nur zu einem dieser Treffen zu bringen. Er hielt sich einfach nicht an den Zeitplan und legte immer wieder Pausen ein, um eine zu rauchen. Wir ließen den Vizepräsidenten und den Außenminister warten. Meine Vorstellung von Freiheit war zu diesem Zeitpunkt von Effizienz geprägt, und ich war ein wenig irritiert, dass seine so ganz anders war.
Im zweiten Studienjahr hatte ich eine Abschlussarbeit über nukleare Rüstungskontrolle geschrieben; im dritten Studienjahr konzentrierte ich mich eher auf die Wirtschaft und begann mit Projekten, aus denen Abschlussarbeiten über die sowjetische Verteidigungsreform sowie über die sowjetische Monopolwirtschaft hervorgehen sollten. Im November 1990, im Herbst meines Abschlussjahres, wurde ich nach Moskau eingeladen, um Teile meiner Arbeiten vorzustellen. Es war mein erster Transatlantikflug, und er folgte der Flugbahn all dieser imaginären Raketen. Im Landeanflug blickte ich auf einen Flickenteppich von Kolchosen hinunter.
Das Land steckte mitten in der Reformperiode von Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow, ich war einundzwanzig und leichtsinnig, und ich betrachtete die sowjetische Hauptstadt als einen Ort, den es zu erkunden galt. Ich gab den mit einem schweren Anhänger versehenen Zimmerschlüssel an der Rezeption des Hotels Akademicheskaia ab und nahm die schnellen Rolltreppen hinunter zu den tiefgelegenen U-Bahnhöfen, die auch als Bombenschutzräume gedacht waren, prägte mir Stationsnamen ein und bat Fremde um Hilfe. Die eiligen Blicke der Mitreisenden, die leeren Regale in den Geschäften, die ungepflegten Gehöfte: Diese Eindrücke bestätigten, was ich in meinem Aufsatz geschrieben hatte, nämlich dass es mit diesem Land nicht mehr lange gut gehen würde.
Die Menschen beschrieben mir die Wege, was gut war; die Stadt war groß, die Tage waren kalt und kurz, und die Gebäude schienen sich von Stadtbezirk zu Stadtbezirk zu wiederholen. Ein russischer Wissenschaftler, der an der Konferenz teilnahm, nahm mich freundlicherweise bei sich auf, und seine beiden Kinder, die etwa in meinem Alter waren, führten mich durch Moskau. Als ich reichlich taktlos über den bevorstehenden Zusammenbruch der UdSSR sprach, zeigte sich auf ihren Gesichtern einfach nur Traurigkeit. Sie zweifelten nicht daran, wenn der junge amerikanische Wissenschaftler dies sagte. Aber das postsowjetische Russland, das sie sich vorstellten, war ein Reich mit einem Zaren. In der Wohnung zeigten sie mir kostbare Relikte des Russischen Reiches, einer vor-sowjetischen Vergangenheit.
An dem Tag, an dem wir drei den Kreml besuchten, schneite es. Die Flocken schmolzen auf einer Glocke von unfassbarer Größe: der «Zarenglocke». Sie war ungefähr so groß wie die Wohnung der Familie und wog etwa zweihundert Tonnen. Das eiserne Ungetüm, das einen absoluten Herrscher verherrlichen sollte, ruhte auf dem Boden und tat nichts. Das klanglose Objekt ließ mich an die Missverhältnisse in der sowjetischen Wirtschaft denken, die ich auf der Konferenz in Moskau ansprechen sollte.
GLEICHGEWICHT
In der Sprache der Physik befindet sich eine Glocke, die an einem Pfosten in einem Farmhaus hängt, im Gleichgewicht: Die Schwerkraft, die sie nach unten zieht, wird ausgeglichen durch die Kraft des Bodens, die auf die Struktur zurückwirkt. Um eine Glocke in die Luft zu bringen, damit sie geläutet werden kann, ist sorgfältige Arbeit erforderlich. Nicht jedes Gleichgewicht ist gleich. Die Zarenglocke befindet sich in einem Gleichgewicht, in dem sie nicht geläutet werden kann.
Auch Wirtschaftswissenschaftler sprechen von Gleichgewichten. Sie mögen Situationen, in denen die Dinge im Gleichgewicht zu sein scheinen, als Ergebnis eines Aggregats menschlicher Handlungen, das sich als größere, unpersönliche Kraft betrachten lässt. Ein Beispiel: Das Angebot, also die Menge an Waren, soll die Nachfrage ausgleichen, also wie viele Menschen diese Waren haben wollen. Ein Gleichgewicht ist wie ein Happy End: Alles geht gut aus. Wir müssen nicht über Menschen als Individuen mit bestimmten Absichten nachdenken: Die Märkte übernehmen das Denken für uns. Wir müssen nicht fragen, wie Menschen in die Welt kommen, warum sie wollen, was sie wollen, oder was es heißt, frei zu sein.
Als ich im Herbst 1990 in die Sowjetunion reiste, arbeitete ich an wirtschaftswissenschaftlichen Projekten, belegte zugleich aber auch Kurse in Geschichte und hatte mich für ein Stipendium beworben, um diese Studien im Rahmen eines Doktorandenprogramms fortzuführen. An der Geschichtswissenschaft mochte ich ihre Unerschöpflichkeit – in jedem neuen Buch, hinter jedem halb verstandenen Ereignis, in jeder neuen Sprache wartete eine Überraschung. Die Vergangenheit ist voll von wilden Möglichkeiten, die tatsächlich Wirklichkeit wurden, wie etwa die bolschewistische Revolution oder die amerikanische. Die osteuropäischen Revolutionen von 1989, so unvorhersehbar sie auch gewesen waren, ließen mich darüber nachdenken, ob weitere Überraschungen bevorstehen könnten.
Im November 1990 in Moskau verschaffte mir die Geschichte eine gemeinsame Sprache mit den sowjetischen Wissenschaftlern. Wir sprachen über die russische Wirtschaft in den späten Jahren des Zarenreichs, vor der Revolution, und über den Zusammenbruch der Industrialisierung in den 1930er Jahren. Ich konnte den sowjetischen Teilnehmern darin zustimmen, dass das Problem der Transformation ihrer Planwirtschaft in etwas anderes in den Lehrbüchern der Wirtschaftswissenschaften nicht vorgesehen war.
In dem kalten und zugigen Konferenzraum ließ ich meine Gedanken schweifen und kritzelte kleine Glöckchen an den Rand meiner Notizen. Im Russischen Reich waren Glocken 1591 und 1771 zur Strafe nach Sibirien verbannt worden, weil man davon ausging, dass sie öffentliche Versammlungen herbeigeführt hatten. Im Jahr 1510 eroberte Moskau die Stadt Pskow, und die neuen Herrscher schafften die Glocke ab, mit der dort zu öffentlichen Versammlungen gerufen wurde.
Neben die Glocken zeichnete ich ein paar Handschellen. In der Sowjetunion, so wusste ich aus meinen eigenen Recherchen, wurden in Pskow die Handschellen hergestellt. (2014 marschierten Truppen aus Pskow in die Ukraine ein; 2022 ermordeten sie Zivilisten in Butscha.) Der Rest der sowjetischen Wirtschaft war ähnlich zentralisiert: Wichtige Produkte wurden an wenigen Standorten oder sogar nur in einer einzigen Fabrik hergestellt. Auch die Gewinnung und Verteilung von Erdgas und Erdöl erfolgte sehr zentralisiert.
Als Ausgangsbedingung für eine Marktwirtschaft, so versuchte ich zu erläutern, sei das Monopol nicht wirklich vielversprechend. Die radikalen Kritiker des Kapitalismus (Wladimir Lenin) und seine radikalen Befürworter (Friedrich Hayek) waren sich einig, dass Monopole Unterdrückung bedeuteten. Märkte sollten Wettbewerb ermöglichen, Informationen verbreiten und die Wirtschaft von der Politik trennen. Doch was würde passieren, wenn die riesigen sowjetischen Unternehmen in private Hände gerieten?
Die Monopolisten würden versuchen, Wettbewerb zu verhindern, die Medien zu besitzen und die politische Macht in die Ecke zu treiben. Sobald die Sowjetunion zu zerfallen begann (so argumentierte ich), würde ihre industrielle Konzentration den Desintegrationsprozess beschleunigen, weil die Einheimischen, die die Kontrolle über wertvolle Vermögenswerte erlangten, versuchen würden, ihre neuen Besitztümer zu schützen, indem sie versuchen würden, neue Staaten zu kontrollieren.
Jeder Übergang zum Kapitalismus in der Sowjetunion musste also als Teil einer längeren politischen Geschichte verstanden werden, nicht als Schaffung einer tabula rasa, die perfekte Märkte hervorbringen würde. Ausgehend von der sowjetischen Realität, die mich im November 1990 umgab, konnte das Laisser-faire nicht zum richtigen Ergebnis führen. Auch die Oligarchie, die Herrschaft der sehr Reichen, ist ein Gleichgewicht. Eine schwere Glocke kann einfach auf dem Boden bleiben.
Ich glaube nicht, dass es mir in Moskau gelungen ist, viel davon zu vermitteln: Der riesige Sitzungssaal verwandelte alle Äußerungen in hallende Echos; in Schals gehüllte Männer bibberten während der Vorträge; der Zigarettenrauch, der durch den Raum waberte, war erstaunlicherweise wärmer als die Luft.
Über die nicht-russischen Nationen machte sich damals niemand großen Gedanken. Die Amerikaner sagten «Russland» statt «UdSSR» und «Russen», wenn sie «Sowjetbürger» meinten. Ich war auch nicht besser, obwohl ich die Geografie aufgrund meiner Beschäftigung mit Militäreinrichtungen und großen Fabriken kannte. Die Hälfte der Bevölkerung der Sowjetunion war nicht russisch, und ein Viertel des Territoriums lag in den nicht-russischen Republiken. Die russische Republik selbst wurde wegen ihrer enormen Vielfalt als Föderation bezeichnet: Sie umfasste zum Beispiel die Tataren, eine der größten sowjetischen Nationalitäten. Die Ukraine war nach Russland am bevölkerungsreichsten. In Moskau sahen die amerikanischen Konferenzteilnehmer die Oper Mazeppa über den ukrainischen Hetman und seinen Bruch mit Zar Peter; in der Pause fragten die Wirtschaftswissenschaftler in der Gruppe die Russen, ob die Ukraine ein eigenes Land sei. Nicht wirklich, so die einhellige Meinung.
Mit Jetlag und nächtlicher Lektüre für ein College-Seminar über Marxismus dachte ich in Moskau über die frappierende Ähnlichkeit zwischen den Propheten des Kommunismus und den Propheten des Kapitalismus nach. Die Kapitalisten wussten, dass sich die kommunistischen Gesellschaften automatisch neu ausrichten würden, sobald das Privateigentum wiederhergestellt war, so wie die Marxisten einst gewusst hatten, dass sich die kapitalistischen Gesellschaften automatisch neu ausrichten würden, sobald das Privateigentum abgeschafft war. Ich spürte die Anziehungskraft der erstgenannten Auffassung: Wäre es nicht schön, einfach neu anzufangen, frei von der Vergangenheit? Aber dieser Reiz ähnelte doch zu sehr der Zuversicht von Marx und Engels oder auch der von Lenin und Trotzki, als das sowjetische Experiment begann.
Zwischen Frühjahr 1989 und Frühjahr 1991 arbeitete ich als Student am Center for Foreign Policy Development, im Sommer 1990 war ich in Washington bei der Zeitschrift Foreign Policy und im Sommer und Herbst 1991 wieder in Washington am Institute for International Economics tätig. Hier bekam ich ich ein gutes Gespür für den Eliten-Konsens zwischen dem Ende des Kommunismus in Osteuropa Ende 1989 und dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991. Nur sehr wenige kluge Köpfe erwarteten beides. Die Regierung von George H. W. Bush unterstützte Gorbatschow bis zum allerletzten Moment. Die Politik der USA bestand darin, die Sowjetunion zusammenzuhalten. Präsident Bush reiste am 1. August 1991 nach Kyjiw, allerdings nur, um die Ukrainer dazu zu drängen, sich nicht für unabhängig zu erklären.
Am 18. August 1991 ging ich in meinem kleinen Zimmer in Georgetown, in dem ich zur Untermiete wohnte, früh zu Bett. Ich hatte den ganzen Tag über Russisch und Deutsch gelernt und dann für einige Freunde gekocht, um meinen 22. Geburtstag zu feiern. Ein russischer Freund weckte mich mit einem Telefonanruf: «Massive Revolution!» Er meinte den Putschversuch gegen Gorbatschow, der den Anfang vom Ende der UdSSR markieren sollte. Am 24. August erklärten die ukrainischen Kommunisten ihre Republik für unabhängig. Einen Monat später beendete ich meine Studie über das sowjetische Monopol und brach zu einem Graduiertenstudium der Geschichte in Oxford auf. Als die UdSSR im Dezember formell aufgelöst wurde, war ich gerade in der Tschechoslowakei. Gleich nach Neujahr fuhr ich mit dem Nachtzug von Prag nach Warschau. Als ich im April 1992 in Wien einen Vortrag über sowjetische Monopole hielt, vertraten die Wirtschaftswissenschaftler aus der nunmehr einstigen UdSSR jetzt die neuen unabhängigen Staaten.
Mit dem Zerfall der Sowjetunion wich die amerikanische Angst einer seltsamen Euphorie. Die Amerikaner hatten Revolution und Zerfall nicht erwartet. Und doch sprachen viele nun voller Zuversicht über das, was darauf unausweichlich folgen würde: ein dauerhaftes kapitalistisches Gleichgewicht, das Demokratie und Freiheit mit sich bringen würde. Fairerweise muss man sagen, dass die besseren Ökonomen in Sorge über die Strukturen waren. Aber die negative Freiheit gab den Ton an: Sobald die Barrieren sowjetischer Planwirtschaft und sowjetischen Staatseigentums beseitigt waren, konnte nur Gutes folgen. Diese merkwürdige Zuversicht in Sachen Zukunft war einer der Gründe, warum ich mich entschloss, die Vergangenheit zu studieren.
EXZEPTIONALISMUS
Der Kalte Krieg war für die Vereinigten Staaten eine moralische Herausforderung gewesen. Der Antikommunismus führte zu den denunziatorischen Auswüchsen des McCarthyismus. Er wurde zudem zu einer Rechtfertigung für die Unterstützung rechter Diktatoren, den Einmarsch in karibische und lateinamerikanische Länder und den Sturz demokratisch gewählter Machthaber.
Mit dieser Sichtweise wurde ich erzogen. Meine Eltern hatten in der Dominikanischen Republik im Peace Corps gedient, als die Vereinigten Staaten 1965 intervenierten. Anschließend waren sie nach El Salvador versetzt worden. Als ich klein war, verbrachte ein Mädchen aus El Salvador sechs Monate bei uns zu Hause und kümmerte sich um mich und meine Brüder. Meine Mutter besuchte während meiner gesamten Kindheit immer wieder Lateinamerika und lehrte Lateinamerikastudien an einer örtlichen Universität.
Die Herausforderung durch die Sowjetunion hat die Vereinigten Staaten aber auch zu mancherlei Stärken gezwungen. Sie hatte den Mondflug von 1969 und bedeutsame technologische Nebeneffekte zur Folge. Sie ermutigte die Amerikaner, sich mit europäischer und russischer Kultur zu beschäftigen, und führte zu staatlichen Investitionen in die Universitäten, auch in den Bereichen Sprachen und Geisteswissenschaften. An amerikanischen Universitäten wurden Seminare über Russland und die Sowjetunion angeboten (wenn auch selten über Osteuropa und fast nie über die Ukraine). Avantgardistische amerikanische Kunst, Musik und Literatur wurden im Ausland verbreitet, um zu zeigen, dass Demokratie hip und lebendig sein konnte. Die sowjetische Erinnerung an die amerikanische Ungleichheit stärkte den amerikanischen Wohlfahrtsstaat und half der Bürgerrechtsbewegung. Solange der Marxismus eine Alternative darstellte, versuchten die Amerikaner, ihr eigenes System mit Hilfe von Ideen zu rechtfertigen und mit Hilfe von Strukturen zu schützen.
Der Zerfall der UdSSR im Jahr 1991 war wie ein Judo-Wurf, der die Vereinigten Staaten gegen sich selbst kehrte. Aus Behauptungen wurden Wahrheiten: Der Kapitalismus werde den Kommunismus ersetzen und der Welt die Demokratie bringen. Als ein negatives Freiheitsverständnis in den Vereinigten Staaten zum Common Sense wurde, ersetzte ein Determinismus den anderen; wenn das Fehlen von Privateigentum keine Freiheit gebracht hatte, so würde das Vorhandensein von Privateigentum das sicherlich tun. Da die ehernen Gesetze der Geschichte jeden befreien würden, war es nicht nötig, die Vergangenheit zu kennen – selbst die Details von Kommunismus und Faschismus, den beiden großen politischen Alternativen des 20. Jahrhunderts, durfte man getrost vergessen. In dem Moment, in dem ich mich für die Geschichte entschied, wurde sie als irrelevant angesehen. Und doch muss es bei der Freiheit um mögliche Zukünfte gehen, und jede mögliche Zukunft steht in einer Linie mit einer tatsächlichen Vergangenheit. Wie könnten wir diese Linien ohne Geschichte ziehen?
OLIGARCHIE
In den frühen 1990er Jahren geschahen unerwartete Dinge: gewalttätige Rassenunruhen in Los Angeles, über die ich in polnischen Zeitungen las, als ich die Sprache an der Ostseeküste lernte; die erste Bewerbung des Milliardärs Ross Perot um das Präsidentenamt, der für mich auf einer BBC-Wahlkarte in einem Gemeinschaftsraum in Oxford real wurde; die Jugoslawien-Kriege, die Flüchtlinge nach Wien trieben, wo ich mich mit einigen von ihnen anfreundete. Doch in dieser Stimmung schien jede Krise etwas Besonderes und jede Herausforderung etwas Technisches zu sein. Geschichte war nicht etwas, das man lernte, sondern das man verantwortlich machte – die ethnischen Säuberungen auf dem Balkan waren angeblich eine Folge «uralten Hasses». Amerika sollte der zeitlose Maßstab für Freiheit sein.
Wenn Freiheit negativ besetzt ist, wird Politik zur praktischen Arbeit, den Müll der Vergangenheit zu beseitigen: Im Jargon der 1980er und 1990er Jahre hieß das «Deregulierung», «Privatisierung», «Sozialstaatsreform». Man erwartet, dass die Wirtschaft oder die Natur den Rest erledigen. Die Vorstellung von Freiheit als etwas Negativem hatte zur Folge, dass die Amerikaner den Osteuropäern schlechte Ratschläge erteilten: Privatisiert so schnell wie möglich; begreift den Wohlfahrtsstaat als kommunistische Deformation; ignoriert die Kultur. In den USA