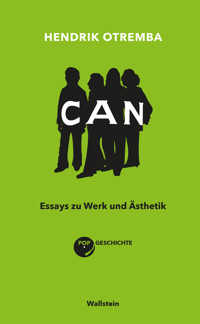ÜBER UNS DER SCHAUM lesen...
Für Dommi.
1
»Das ist die Arbeit, das ist der Preis
So geht’s bei Detektiven
Eine Pflanze wächst im Kleiderschrank
Nimm dich in Acht vor ihren Trieben«
Weynberg
Ich bin Weynberg, ich fahre Auto wie ein junger Gott, und ich ficke wie ein junger Gott. Ich breche Nasen und Herzen, wenn mir einer dumm kommt, mach ich ihn kaputt. Mir kann keiner was, ich brauche keinen Lehrer, ich dulde keine Schüler, ich brauche niemanden. Meine Fäuste sind wie Stahl, mein Geist ist wach, ich durchdringe alles, ich durchdringe dich, ich kriege jeden, ich kann es mit euch allen aufnehmen, es lohnt nicht, sich vor mir zu verstecken. Ich mache keine Witze, und es gibt auch nichts zu lachen, und keiner kann mir widerstehen, ich werde gewinnen, auch wenn es kein Spiel gibt, das überhaupt zu gewinnen wäre. Wer meinen Schwanz will, darf sich anstellen, aber hofft auf nichts, ich ficke nur, wen ich ficken will. Krabbelt, krabbelt doch, und ich lache nur, sonst nichts. Oh, ich mache es so gut. Ich mache es so gut. Keiner macht es so gut wie ich. Aber macht euch keine Hoffnung. Ich mache nur noch, was ich will, ich mache nur noch, was ich will, mache nur noch, was ich will. Was wollt ihr denn von mir? Kommt doch her, ich nehme jeden von euch ran, ich zerschmeiße euch wie Fliegen, ihr entkommt mir nicht. Wenn ihr mich anguckt, ach, wenn ihr nur an mich denkt, habt ihr schon verloren. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt wie gerade jetzt in diesem Augenblick, verdammt, mein Saft wird für euch alle reichen, ich mache es euch allen gleich, oh – es wird euch nicht gefallen, aber ihr könnt nicht anders, ihr braucht es. Ich brauche gar nichts, keiner kann mir was.
So schreit es in mir, für eine Weile. Mein ganzer Körper zittert, ich liege auf der fleckigen Matratze eines Bettes, das nicht mir gehört, kalter Schweiß steht mir im Gesicht, überall, meine blöden Haare kleben mir auf der Stirn, es ist so komisch heiß hier drin, aber ich kann die Jacke nicht ausziehen. Ich glaube, ich habe zu viel genommen, zu viel versucht, das Portobin frisst sich überall durch, ich brauche irgendwas, um runterzukommen. Ich würde so gerne schlafen, aber mein Herz geht zu schnell, geht immerzu schneller, es rast, mein Körper zuckt, die Atmung geht viel zu schnell, alles geht gerade viel zu schnell. Ich bin in einem dunklen Zimmer, durch die Löcher in den Vorhängen fällt ein wenig Licht, meine Augen brennen. Ich muss in der Dunkelheit bleiben, und ich brauche Ruhe, muss schlafen, endlich schlafen.
Wenn ich rechne, wenn ich die Stunden mit der Zungenspitze an meinen Zähnen abzähle, bemerke ich es. So geht es nicht weiter. Aber ich muss mich melden, muss Bericht erstatten, ich bin doch noch gar nicht weit gekommen, Lang wird mich opfern, er wird einen Anderen beauftragen, er wird sich meiner entledigen, bald bin ich weg. Und sie, sie wird doch nicht auftauchen, ich warte, seit zwei Tagen warte ich hier. Ich will sie sehen, wird es mich auch wieder zerreißen.
Meine Beine liegen weit ausgestreckt, schon bin ich halb zerrissen, die Hose offen, der Oberkörper lehnt ab einem der oberen Wirbel krumm am Kopfe des Bettes. Es ist nicht bequem, aber ich kann mich nicht bewegen, meine Arme sind wie tot, ausgestreckt, sie sind einfach so da, ich liege hier, seit Stunden liege ich nur da. Das Fenster, ich muss aus dem Fenster schauen, aber es ist viel zu weit weg. Ich kann nicht mehr, ja, mein Arm, der tut weh, tut so weh. Das Portobin macht mich irre, ich fühle mich so gut, im einen Moment, also länger, länger als nur für einen Moment, und glaube auch daran, und kurz darauf bin ich wie Dreck, klebe wie Scheiße am Boden, das geht so nicht weiter.
Nachdem ich das letzte Portobin genommen hatte, ging es richtig ab, es war noch ein bisschen zu viel für einen Versuch, doch nicht genug für zwei Rationen, da habe ich alles fertig gemacht, alles probiert, jetzt weiß ich, dass es zu viel war, jetzt habe ich Angst. Ich brauche irgendwas anderes, irgendwas dagegen, ich muss irgendetwas essen, aber ich habe keinen Hunger. Ich brauche ein neues Loch im Gürtel. Dreck! Was mache ich wieder? An was ich alles gedacht habe, zu was ich in der Lage wäre. Aber es geht, es ist Phantasie, da geht das, da kann ich alles machen, da tut es niemandem weh.
Außerdem ist es das Portobin, es verschärft alles. Immer, wenn ich gekommen bin, war da ein Moment von Klarheit, wenigstens, und davor auch. Aber jetzt, wo die Wirkung nachlässt, wo die Euphorie nicht mehr zurückzuholen ist, kehrt sich alles ins Gegenteil. Die Angst. Ich kann nicht mehr, alles tut mir weh. Aber ich weiß ja, was es ist. Langsam, ganz langsam, beruhigt sich mein Atem. Das ist trügerisch, kann auch nur eine kurze Phase sein, im Runterkommen, das kenne ich schon, habe ich zu oft schon erlebt – es kann jeden Augenblick wieder losgehen, ich muss aufpassen, darf mich nicht wieder aufregen, darf keine Angst haben. Angst ist das Schlimmste. Angst erzeugt nur Angst, Angst hat keinen Sinn, Angst ändert nichts an der Situation, Angst verhindert Veränderung. Respekt hätte ich haben sollen, Respekt sollte ich haben, nicht dumm sein, nicht so, wie ich es jetzt bin.
Langsam, langsam jetzt. Atmen. Atmen. Langsam. Atmen. An der Decke über mir taxiere ich einen alten Wasserfleck, der das schmutzige Weiß verdunkelt. Braun ist die Decke da geworden, eine gescheckte Fläche, das Wasser hat den Staub und alles, was im Boden war, mit sich nach unten gezogen, hat einen Fleck gezeichnet. Es sieht so aus, als habe jemand, ein früherer Bewohner dieses Zimmers, die Ränder des Wasserflecks immer wieder mit einem dünnen Bleistift nachgezogen, immer aufs Neue, wenn er um einen Zentimeter gewachsen war. So erinnert das Gebilde an eine Insel auf einer Landkarte, eine dreckige Insel aus der Perspektive eines Vogels, eine Insel von Welt, mit Gebirgen, riesigen Bergen aus Scheiße und Morast, die sich zum Himmel erheben. Ich verliere mich in den Schluchten der Insel und entkomme. Das bringt mich runter, wie ich da den Fleck beobachte, mit der Zunge im Mund seine Umrisse nachzeichne, sie mit den Augen verfolge. So schreit es in mir, für eine Weile, und nun wird es langsam still.
Ich vernehme das leise Quietschen des Ventilators an der Decke, der einen milden Sturm über die Insel fegt, höre den Atem der Insekten, die tippelnden Schritte der Kakerlaken. Ich beruhige mich, das alles beruhigt mich. Aber ich weiß schon, dass ich es wieder tun werde, manchmal geht es ja auch, manchmal ist es richtig gut, wenn ich nicht so leichtfertig damit umgehe, wenn ich vernünftiger bin. Dann geht es, dann ist es manchmal gut.
Ich wache langsam wieder richtig auf und fühle mich wie vertrocknet, mein Glied tut weh, mein Mund ist ganz stumpf und taub, und ich fühle mich furchtbar, ich stinke, ich schäme mich für alles. Vorsichtig ziehe ich die Fliegerjacke aus, mein Arm beginnt unmittelbar zu pochen, und da ich den rechten Ärmel an der Stelle, an der es mich erwischt hat, mit Panzerband umwickelt habe, muss ich einige Verrenkungen anstellen, um die Jacke loszuwerden. Verdammt, die schöne Jacke. Der Ärmel ist zerfetzt, und das Blut unter dem Panzerband bekomme ich auch nicht mehr weg. Oder ich lasse sie einfach so. Meine vom Dreck steifen Jeans strampele ich ab, die Unterhose ebenso, mit dem Hemd halb offen stolpere ich ins Bad. Ich sehe nicht gut aus, keiner würde mich mögen, käme ich jemandem so unter. Gut, dass ich hier alleine bin. Gut, wenn überhaupt irgendetwas gut ist gerade.
Diese Zimmer geben mir den Rest. Schön ist es hier sicher einmal gewesen, davon zeugen noch die Armaturen, der große Spiegel, das Holz, doch das ist lange her, nun sind die Räume eine traurige Erinnerung an eine andere Zeit geworden. Wie passiert so etwas, und wie lange dauert es, bis ein Raum alles verliert? Irgendwann mal fühlte sich jemand beim Betreten dieser Räume erhaben, da bin ich sicher. Irgendwann vor Jahren. Jetzt sind hier nur noch Schmutz und Verfall.
Ich hänge so halb über dem breiten Waschbecken. Der fleckige Marmor, der es umschließt, fühlt sich an meinen Unterarmen kalt an, selbst durch den Stoff des Hemdes. Ich stemme mich hoch, drücke mich mit den Händen ab. Klingelt im anderen Zimmer ein Telefon? Mein Gegenüber im Spiegel scheint sich langsamer zu bewegen als ich, aber ich bin es, muss es sein, das Wesen da sieht so furchtbar aus wie ich. Langsam geht es. Etwas Vernünftiges beginnt in mir zu walten. Wenn ich leben will, wenn ich weiter machen will, brauche ich eine Pause, muss ich an mich denken. Ich werde den Fall abgeben. Fast ist es eine rationale Entscheidung. Etwas zu essen, eine Dusche oder ein Bad, Wasser, viel Wasser, und schlafen, bis die Träume wieder schön werden. Wie ich aussehe, wie ich zugerichtet bin.
Ich meine, ein Saxophon zu hören. Vielleicht ist es auch gar nicht da, das habe ich manchmal, wenn ich runterkomme, dann, wenn alles in Watte, alles etwas langsamer ist. Oder ist es auf der Straße? Ein paar Worte erheben sich zur Melodie in meinem Kopf.
Die Haut ist Leinwand eines Lebens
Die Haut trägt Spuren mit davon
Die Haut, sie zeichnet Tag und Nacht nach
Die Haut ist schön, kennt kein Pardon
Solche Einfälle kommen immer in den dümmsten Momenten. Ich hätte ein blöder Dichter werden sollen, dann würde ich wenigstens mit Stil verarmen. Wann ist man eigentlich ein Dichter? Wenn man arm ist und die Worte sich aufeinander reimen. Die Sätze versuche ich mir zu merken.
So drehe ich den Hahn auf, wische mir kaltes Wasser ins Gesicht, streife das Hemd ab. Der Verband am Arm hat sich gelockert, den weißen Mull unterm Panzerband ziert ein rotbrauner Fleck. Aber ein bisschen zögere ich noch, ihn zu wechseln. Ich zünde mir eine Zigarette an, um ruhiger zu werden, schmeiße das Streichholz ins Waschbecken. Kurz zischt es auf, dann ist es nutzlos. Mein Körper gleicht einem mit Wachs überzogenen Skelett. Diese Selbstversuche werden mich noch umbringen. Das Portobin frisst mich auf. Ich muss damit aufhören. Ich schleiche zurück ins Schlafzimmer, so, als ob ich mich vorsehen wollte, jemanden zu wecken; aber da ist ja wirklich niemand.
Neben dem Bett hängt ein Gemälde, der Akt eines Mannes. Mit Stift und Pinsel hat der Maler die Rippen hervorgeholt, ihnen mit Tusche und Wasserfarben eine Textur gegeben, ganz dreckig sieht die Haut aus, ein ausgemergeltes Bild. Die Haut ist Leinwand eines Lebens. Ich bleibe hängen, starre das Gemälde an, starre hindurch und sehe nur mich. Nicht mehr lange und ich sehe aus wie so einer, mit diesen Rippen. Ich muss mir angewöhnen, wieder regelmäßig zu essen, sonst werde ich weiter durchhängen, nicht vorwärtskommen, ständig nur kassieren, wenn es zur Sache geht. Und das Portobin muss ich einschränken oder endlich aufhören mit diesem Dreck, überhaupt rauche ich zu viel und trinke auch über die Maßen. Ich habe schon wieder die Spur verloren und hänge in der Luft.
Ob Maude gegenüber auftaucht? Der alte Wurmfresser, ein Trinker, ein Porto, ein Fixer vor dem Herrn, hat es mir erzählt. Er war ihr selbst lange nachgelaufen, tat es auf eine Art noch immer.
Hier gegenüber trifft sie sich mit Männern, manchmal auch mit Frauen, manchmal mit Männern und Frauen, in der Wohnung eines Freundes, der ihr genauso verfallen ist, wie jeder, dessen Herz mal gebrochen war. Und wessen Herz ist nicht gebrochen worden in dieser Stadt? Manchmal schaute der Freund ihnen zu, erzählte der Wurmfresser. Ein Voyeur, wie ich.
Ich denke an den Wurmfresser, seinen Geierkopf. Sein Herz war schon lange gebrochen. Sie hatte es zu Staub zerrieben. Er lallte bereits, als ich mit ihm sprach, Mitte der Woche ist das gewesen. Ein Trinker. Ein Fixer. Ein Porto wie ich. Nachdem ich auf der Straße ein paar Leute vorsichtig durchgeschüttelt, ihr Gedächtnis abgeklopft und mir dabei den Arm verletzt hatte – jemand mir den Arm verletzt hatte –, wusste ich, dass sie manchmal in diese Bar ging, ins Kim, und weil ich das am besten konnte, hatte ich eine Nacht dort getrunken und beobachtet, hatte dabei eines von Langs Fotos, die er mir gegeben hatte, von Zeit zu Zeit in den Händen gedreht und angestarrt, meinen Köder geworfen. Als sich bereits eine Melancholie in dem Stimmgewirr der anderen Gäste durchzusetzen begann, hatte der Wurmfresser angebissen, hatte sie auf dem Foto erkannt, mich angesprochen, hatte mir dann sein Herz ausgeschüttet, wie sie ihn aufgelesen hatte, an einem guten Abend, wie er ihr verfallen war, sie dann mit Geschenken überhäuft hatte, obwohl er doch kein Geld besaß, nicht für seine Kinder zahlen konnte, und wie sie ihn immer nur so weit an sich herangelassen hatte, dass er die Hoffnung nicht aufgeben konnte. Bis sie irgendwann ein neues Spielzeug gefunden hatte. Das sagte er nicht so, aber das war es, was er dachte. Ich konnte in seinen Kopf sehen. Eine kurze Geschichte. Eine traurige Geschichte. Er war ihr nachgelaufen, bis er von einem ihrer Liebhaber ein paar Hiebe bekommen hatte. Manchmal drückte er sich noch durch die dunklen Gassen um ihre Wohnung, die ich nun seit zwei Tagen beobachte. Er konnte mir versichern, dass sie dort wenigstens ein Mal die Woche auftauchte, häufig zwei Mal. Doch ich scheine Pech zu haben, seit ich hier bin, ist da niemand.
Irgendwas zieht mich zum Fenster, eine Ahnung. Ich bin unruhig. Das kommt meistens mit der wiederkehrenden Klarheit, der relativen Klarheit – die Unruhe. Ich gehe also zum gekippten Fenster und schnippe die Zigarette durch den Spalt in die tiefe Häuserschlucht, blicke hinaus. Es hat aufgehört zu regnen, die giftige Feuchtigkeit hängt noch in der Luft. Es ist ungemütlich da draußen. Ich bin im 15. Stock. Unten auf den Straßen ist niemand, so scheint es, manchmal fährt ein Auto vorbei. Ich blicke rüber in den 14. Da erwischt es mich. Fast mantrisch habe ich immer wieder hinübergeschaut in den vergangenen zwei Tagen, langsam den Glauben daran verloren, dass sie dort noch auftauchen wird. Die letzten Stunden habe ich zudem mit dem Versuch an einer guten Menge Portobin vertan, bin fast am Schüttelfrost erfroren und dann wieder nahezu verbrannt, in der Einsamkeit, habe Stunden in einem Zustand zugebracht, da ist mir die Aufmerksamkeit abgegangen.
Doch nun ist etwas, jetzt passiert etwas. Gegenüber regt sich etwas. Endlich, die zwei Tage haben mir nicht gutgetan, außerdem ist es vergeudete Zeit, wäre vergeudete Zeit gewesen. Plötzlich allerdings ändern die vergangenen 48 Stunden ihre Vorzeichen. Sie ändert die Vorzeichen. Maude Anandin – wer bist du nur?
Sie betritt das Zimmer, wie ich es gerade im Bad geahnt habe. Das bin ich einfach, ich weiß es manchmal, wenn jemand kommt. Ewig habe ich sie nicht mehr gesehen, so kommt es mir in diesem Moment jedenfalls vor, so befreiend und schmerzhaft ist es. Und wieder geht mir ein Stich durch den Körper. Sie ist mit zwei Männern da, Lachen, das gelbliche Licht entflammt, zeigt die edle Einrichtung der alten Wohnung, mit ihren hohen Decken, dem schweren Teppich, dem luxuriösen Mobiliar, so weit aus der Zeit, dass die Einrichtung sich ganz von ihr befreit hat. Endlich habe ich ihre Fährte wiedergefunden. Ich ziehe die schweren Vorhänge ein wenig zu, lösche das wenige Licht, hole mir einen Stuhl heran und beobachte aufgeregt die großen Fenster gegenüber.
Ein Treiben, ja. Es trifft mich schmerzlich. Noch kein Wort habe ich mit ihr gesprochen. Doch es tut weh, sie mit diesen Männern zu sehen. Ich weiß, was jetzt passieren wird, es erregt mich und fühlt sich gleichzeitig an wie ein Schlag in die Magengrube. Ich beobachte sie bereits eine Weile und es ist nicht das erste Mal, dass ich etwas in dieser Richtung anschaue. Und alle, mit denen ich geredet habe, der Wurmfresser, Gustav Lang selbst, die Männer in den Bars, die Jungs auf der Straße, haben mir Geschichten erzählt, Puzzleteile, aus denen sich langsam ein Bild geformt hat. Mein Herz rast, ich sitze da auf diesem Stuhl, mein Körper zittert. Sie ist so schön, und diese Männer, sie haben beide etwas Unheimliches, sind umgeben von einer dunklen Aura. Warum geht sie mit solchen Ungeheuern mit? Warum nimmt sie sie mit? Diese Männer sind so hässlich.
Das ist ihre einzige Gemeinsamkeit, die Hässlichkeit, sonst könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Der eine ist untersetzt, dick, er trägt einen Zopf, seine schwarzen Haare werden schon licht, außerdem glänzen sie, vielleicht Fett, vielleicht Wachs, vielleicht sein Verderben. Pardon my Pǔtōnghuà, aber er hat etwas sehr Schmieriges. Ich kann seine kleinen, wachen Augen sehen, sie sind glasig, er hat irgendwas genommen oder getrunken, seine Kleidung sieht mehr nach Pulver aus als nach Alkohol, vielleicht auch Portobin. Er hat etwas von einem Insekt, von einer Schabe, seine Bewegungen sind flink, die kurzen Beine tippeln schneller als sie müssten. Er trägt einen Anzug, ein helles Grau, darunter ein Hemd, ein gutes Stück aufgeknöpft, so dass seine Brusthaare herausstehen. Das Spiel hat noch kaum begonnen, da will ich ihn schon unter meinem Schuh zerquetschen, will, dass er knackt und sein Inneres verspritzt, wie die Kakerlake, die er ist.
Der Andere ist groß und hager, unscheinbarer, trägt dunkle Kleidung, die Haut ganz blass. Die Haare stehen ganz kurz geschoren auf seinem Schädel. Wie vom Krebs zerfressen sieht er aus. Tief liegen die Augen in ihren Höhlen, die Ohren stehen ab, alles wirkt ein wenig zu groß und wie in einer Karikatur. Ein Eckendrücker. Nicht einer, der rumsteht, eher einer, der sich versteckt, der lauert. Auch er lächelt, aber anders, verhaltener. Etwas Obsessives steht in seinem Gesicht, eine unbändige Lust, ein Trieb, gleichzeitig ein Desinteresse an den Dingen des Lebens, das damit gar nicht zusammengeht. Er hat etwas von einem Toten. Ja, er ist ein Toter. Ich will ihn einen Toten nennen. Wie zwei Fliegen ums Licht kreisen die beiden um sie herum. Maude, das Licht.
Sie wirft ihren Mantel ab, ein Werfen ist es kaum, vielmehr lässt sie ihn einfach auf die Erde gleiten. So liegt er jetzt da, mitten im Raum, wie die abgestreifte Haut einer Schlange. Ein Kamelhaarmantel, alt und fleckig, trotzdem edel, so wie sie ihn trägt, mit einem Pelzkragen. Ihre Haare hat sie auf ihrem Kopf zu einem Zopf geflochten, die Wimpern, ihre Lider und ihre Lippen sind stark geschminkt, die großen Augen blitzen. Der breite Mund, den sie beim Sprechen weit aufreißt, lässt vermuten, dass sie sehr laut redet, sehr laut lacht, vergnügt ist. Was vergnügt sie nur an diesen Insekten? Unter dem Mantel trägt sie ein Kleid, es sieht ein wenig aus wie ein Kettenhemd, nur leichter, irgendein goldener, glitzernder Stoff, eng geschnitten, mit weitem Ausschnitt, so dass man viel von ihren Brüsten sehen kann. Die Brüste stehen weit auseinander, kein Büstenhalter, der sie zusammendrückt, und ich möchte mit meinem Finger nur ganz langsam dazwischen durch streichen. Ihre spitzen Schuhe sind unaufdringlich, schwarz, Lack, kaum Absatz, und die Beine stecken in einer dünnen, schwarzen Strumpfhose, vielleicht sind es auch Kniestrümpfe. Ja, es sind ganz bestimmt Kniestrümpfe. Sie hat ihre Kleidung heute Morgen nach einem Plan ausgewählt. Wahrscheinlich wie an jedem Morgen. Der Plan, jemanden zu verspeisen.
Maude lässt sich auf einen cremefarbenen Clubsessel fallen und spreizt lachend die Beine über die Lehnen, lässt ihren Kopf auf die Holzlehne fallen. Der kleine Dicke lässt sich direkt auf die Knie runter und schiebt ihr das Kleid hoch, wie ein Hund, der auf diesen Befehl nur sehnsüchtig gewartet hat. Maude trägt kein Höschen. Das hat Hedy nie so gehandhabt. Der Andere, der Tote, setzt sich auf den Boden und beobachtet, was der kleine Dicke mit Maude macht, fängt an, seinen Schwanz durch den Stoff der Hose zu massieren. Die Schabe nähert sich dem dunklen Dreieck zwischen ihren Beinen, taucht in ihr schwarzes, buschiges Schamhaar ein. Er bewegt sich wie ein Mann, der Hund spielt. In dem Moment, als er mit der Zunge wie in Zeitlupe ganz in ihrem Schoß verschwindet, lässt sie die grüne Sektflasche fallen, aus der sie noch zuvor einige tiefe Schlucke genommen hat. Die Flüssigkeit sprudelt schäumend auf den Teppich, sie blickt kurz an die Decke – ihr Körper spannt sich an –, lässt den Kopf dann wieder nach hinten sinken und schließt die Augen, packt den Dicken mit einer Hand bei seinen schmierigen Haaren, scheint ihn ganz in ihren Schoß pressen zu wollen.
Ich will diese Männer kaltmachen, will die Schabe zertreten und den Toten ganz begraben. Doch der ist gar nicht tot, der sieht nur so aus, steht jetzt auf und holt seinen Schwanz raus. Mir wird immer komischer. Die unheimliche, große Gestalt stellt sich hinter Maude, grinst, sie züngelt an seinem steifen Glied, den Kopf in den Nacken geworfen. Er packt sie an den Haaren und gibt ihr eine Ohrfeige, noch eine, sein Blick hat etwas Irres. Sie lacht. Mir wird schlecht vor Aufregung. Es ist wie bei einem Unfall, ich fahre daran vorbei mit dem Wunsch, das, was da geschieht, schnell zu passieren, werde aber langsamer, muss alles sehen, auch wenn ich weiß, dass es sich mir auf immer einbrennen wird. Nein, ich will das alles nicht sehen, aber irgendetwas in mir zwingt mich dazu. Die Bilder verschwimmen.
Sie ähnelt Hedy so sehr, nicht nur in ihrem Aussehen, auch in der Art, wie sie sich bewegt. Hedy. Ich bemerke die Tränen in meinen Augen. Die Luft bleibt mir weg, ein Schmerz drückt auf die Brust, es pocht hinten in meinem Kopf. Ich fühle mich ganz taub, das kenne ich schon. Es durchfährt mich immer wieder seitdem, ich werde es nicht los. Fast sehne ich mich danach. Weil es sie mir für einen Augenblick vergegenwärtigt. Hedy! Dann ist sie wieder verschwunden.
Ich werde eifersüchtig auf etwas, das nicht existiert, auf ein Phantom, einen Geist. Jemanden zu sehen, der ihr so ähnelt. Ich hatte Hedy begehrt wie niemand anderen, das erste Mal in meinem Leben hatte ich jemanden wirklich begehrt, das weiß ich, denn nur wer jemanden begehrt hat, den er nun nicht mehr haben kann, weiß, was Begierde wirklich ist. Und nun ist sie verschwunden, und dieser Mensch dort gegenüber, der ihr wie ein Zwilling gleicht, gibt sich zwei Männern hin, lässt zwei Männer sich ihr hingeben, ich rase, mein Herz beginnt wieder zu rasen. Langsam. Warum kann sie nicht hier sein? Hedy!
Trotz allem werde ich ein bisschen hart. Ich kann einfach nicht anders; wenn ich Menschen beobachte, die etwas tun, bei dem sie kaum gesehen werden möchten, zieht mich das an – selbst in Situationen wie diesen. Vielleicht bin ich deshalb Detektiv geworden, wobei man ja nicht die Entscheidung trifft, so etwas zu tun. Eigentlich ist es das einzige, was einem bleibt, wenn man alles andere vergeigt hat. Vielleicht interessiere ich mich nur für die Wahrheit, weil ich ein Voyeur bin. Nervös fingere ich nach einer neuen Zigarette und beruhige mich ein wenig. Mein Schwanz tut weh. Wie irre das doch ist, wie ich da nur reingeraten bin. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ich weiß ja, dass es nicht Hedy sein kann, und langsam lässt auch der Wahn nach, der noch immer dem Portobin geschuldet ist. Ich kann wieder einigermaßen klar denken, will ich damit sagen.Als sie das Zimmer betraten, war ich wirklich eifersüchtig. Ruhig jetzt! – sage ich mir – tu’ jetzt das, wofür du bezahlt wirst.
Ich betrüge mich sicher selbst, aber ich denke, dass sie Hedy noch ähnlicher wird. In der kurzen Zeit schon, die ich sie verfolge, hat sich ihr Äußeres verändert, auch ihr Wesen, das, was man aus der Distanz davon verspürt, es scheint gewandelt. Ihr dunkelbraunes, fast schwarzes Haar hat an Masse gewonnen, die Augen sind dunkler geschminkt, sie bewegt sich mit mehr Schwung, mehr wie ein Tier im Kampf oder in der Balz. So wie Hedy, in der ich immer ein Raubtier gesehen habe, ein mildes Raubtier. Sie scheinen sich immer ähnlicher zu werden, in der kurzen Zeit, in der ich nicht umhinkomme, sie in ihrer äußeren Erscheinung zu vergleichen, in der ich erinnert werde an etwas, das ich vergessen möchte. Fang nicht wieder an, konzentrier dich!
Ihre Augen leuchten, die Blicke fressen die Umgebung auf, alles, was sie taxiert, scheint zu Nahrung zu werden. Sie verschlingt die Welt. Etwas geht in ihr vor, eine Lust, und sie scheint bis in dieses Zimmer zu sprühen. Ich will sie, will ihre warmen Schenkel spüren, ich will spüren, dass sie feucht ist, will ihren Nacken beißen, sie festhalten, sie zu fest halten an den Stellen, wo sie ein bisschen Speck hat, an der Hüfte, an den Schenkeln. Und ich will diese zwei Berserker umbringen, mit denen sie im Zimmer gegenüber gestrandet ist. Das ist nicht Hedy, nein, sie ist es nicht. Gut, dass es nicht Hedy ist. Wäre sie es doch ... Auch, wenn es mir in diesem Moment albern vorkommt, verfehlt es doch nicht seine Wirkung, und so schlage ich mir ins Gesicht, zische mir laut zu! Die drei auf der anderen Seite verlieren sich immer mehr im Rausch, bieten sich mir dar wie auf einer Schaubühne, sie werden zu einem fleischigen Ball, Maude und die Schabe lassen sich auf den schweren, tiefen Teppich fallen, er auf allen Vieren und schon wieder mit dem Kopf zwischen ihren Beinen. Der Tote trinkt aus einer großen, grünen Flasche, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe – oder ist das die, die sie gerade hat fallen lassen? Sie rollen jetzt eng umschlungen über den Teppich, lachen immer mehr, wirken fast hysterisch auf eine Art, ich kann an ihren Zähnen vorbei in ihre Rachen sehen, wie in Zeitlupe geschieht das.
Mein Zimmer liegt höher als das ihre, so kann ich den ganzen Raum überblicken. Ich hole die Kamera aus meiner Tasche und drehe den Stuhl um, schiebe ihn ganz ans Fenster, stütze den Apparat auf der Lehne auf, wie auf einem Stativ, um in der Dunkelheit die Aufnahmen nicht zu verwackeln. Die welken Zimmerpflanzen neben den Fensterbänken kitzeln an meinen Armen. Zwischen Vorhang und Fenster hängt eine Jalousie, ich spreize die Lamellen mit den Fingern auseinander und schiebe das Objektiv hindurch. Im Sucher ist nun alles noch näher, sieht noch wirklicher aus, obwohl es fast wie in so einem alten, schlechten und dreckigen Film erscheint, völlig verwackelt und nervös. Die beiden Typen ziehen Maude nach und nach aus, grob, löschen die Lichter nicht, so als ob sie wollten, dass man ihnen zusieht, dass ich ihnen zusehe. Aber sie wissen nicht, dass ich sie beobachte. Ich bin gut, selbst in diesem Zustand bin ich wie ein Schatten. Oder gerade in diesem Zustand? Ich bin so sehr in der Dunkelheit, dass mich, wollte ich es so, niemand mehr sehen könnte. Ich könnte in ihrem Zimmer in einer Ecke stehen und keiner würde mich im gedimmten Licht bemerken.
Maude ist jetzt ganz nackt, er hat ihr die Strümpfe von den Beinen gezogen. Sie ist eine so schöne Frau, ihr Körper sieht so echt aus. Ich will sie berühren. Sie nagen an ihr, beißen ihre Brustwarzen, die Schwänze lugen aus ihren geöffneten Hosen, hart und spitz wie Pflöcke, sie ganz feucht und fahrig. Die Haut an der Innenseite ihrer Schenkel glänzt, das kann ich deutlich sehen. Es hat so etwas Obszönes, dass sie ganz nackt ist und die es nicht sind.
Ich muss wieder an die Worte denken, die mir vorhin eingefallen sind. Die Haut ist Leinwand eines Lebens? Ihre Haut ist schön, wie Alabaster. Ich will sie berühren, an ihr riechen. Aber meine Haut? Nur Flecken.
Ich schieße die Fotos. Ich habe binnen kürzester Zeit jegliche Distanz verloren, bin wie besessen. Das muss ich in den Griff bekommen. Aufnahme um Aufnahme entsteht so, Penetration, Samen auf ihrer Haut, verschwitzte, klebrige Haare und weit aufgerissene Augen, die in der Leere, in die sie blicken, etwas Schönes finden, etwas Schöneres zumindest als in der Gegenwart. Und Zungen, Zungen und Zähne, die aufeinanderschlagen, immer wieder. Wenn ich ihm diese Bilder zeige, es wird ihn zerreißen. Mich zerreißt es schon. Ich weiß natürlich, dass ich diese Fotos auch für mich mache, oder dass ich sie gegen mich mache. Aber wenn ich sie ihm zeige, wird es ihn zerreißen.
2
»Wer kann die Welt heut’ nicht mehr sehen
Ich werde niemals von dir gehen«
Weynberg
Als Gustav Lang in Begleitung seiner Beschützer in mein Büro getreten war, vor über einem Monat, ging es mir nicht schlecht, ging es mir gar nicht mehr so schlecht. Ich hatte mich einige Male mit einer Frau getroffen, merkte, dass ich noch lange nicht so weit war, fühlte mich aber gut, besser, als ich gedacht hatte. Ich aß einigermaßen regelmäßig, hatte das Portobin auf eine niedrige Dosierung am Abend heruntergefahren, die mir zwar noch immer fiebrige Träume bescherte – doch wenigstens schlief ich jetzt überhaupt! So ließ ich mich von seiner Erscheinung erst nicht einschüchtern, wenn sie mich auch beunruhigte.
Es war schon weit nach Mitternacht, draußen war ein brutaler Regen niedergegangen, über eine Stunde, gerade hatte es aufgehört und die Stille war gespenstisch. Ich vermutete, dass sie schon eher hatten hochkommen wollen, der Wolkenbruch sie allerdings gezwungen hatte, eine ganze Weile im Auto zu verharren. Ihre Mäntel jedenfalls waren nicht nass. Der eine Eisenschrank, ein unvorstellbar bulliger und brutal wirkender Kerl, etwas älter als ich, Ende dreißig etwa, ging zum Fenster und drehte die Jalousie zu, der Andere, nicht minder bullig, aber kleiner, untersetzter und mit einer unsagbar hässlichen Visage, sah sich intensiv im Raum um, drehte ein paar Gegenstände in seinen groben Fingern, nickte Lang schließlich zu. So, als ob der Raum ihnen gehörte.
Ich bat die Männer, sich zu setzen, lächelte ihnen entgegen und musste dabei darauf achten, mich nicht hinter meinem Schreibtisch zu übergeben. Lang nickte zur Tür, woraufhin die klobigen Männer mein Büro so plötzlich verließen, wie sie es betreten hatten.
»Herr Weynberg. Ich gehe davon aus, dass Sie mich bereits erkannt haben?«
»In etwa.«
Natürlich hatte ich ihn erkannt, oft genug waren die Zeitungen voll gewesen von seinem Gesicht, immer wieder hatten sie ihm aufgelauert, ihm Fragen gestellt, sein sich mürrisch und angeekelt abwendendes Gesicht fotografiert. Die Zeitungen hatten ihn verewigt, ob er wollte oder nicht. Denn egal wie viel Macht man hatte, egal welche Leute hinter einem standen, an den Zeitungen kam man nicht vorbei. Ich war käuflich, ich war sogar gerne bereit, mich für ein bisschen Kohle herzugeben. Ich kannte auch Loyalität gegenüber Auftraggebern; zumindest, wenn ihr Anliegen mir etwas bedeutete. Doch gib mir genug Geld und ich vergesse alles. Aber die Journalisten dieser Zeit, warum auch immer, waren einer Art Ehre verpflichtet, die ihrem Berufsstand eigentlich längst abgegangen war. Es musste viel geschehen, damit ein Journalist einknickte. Manche von ihnen blieben auf der Strecke oder ließen sich auf die ein oder andere Art und Weise doch überzeugen, ihren Idealismus zu verwerfen, oft war auch hässliche Gewalt im Spiel, aber es blieben immer genug übrig, um den Dreck an die Oberfläche zu kehren.
Selbst wenn es sie nicht gegeben hätte, wenn sie nicht Zeile um Zeile über Gustav Lang geschrieben hätten: Wer in der Stadt lebte, in dieser dampfenden Kloake, der kam an dem verlebten Gesicht Gustav Langs, wenigstens für eine Zeit, nicht vorbei. Eine furchige Visage, die mit ihren aufmerksamen Augen den Niedergang der zivilisierten Welt zynisch lächelnd beobachtete, lachte, während die groben Fäuste noch ihren Profit daraus schlugen.
Gustav Lang hatte Gelder von Krona veruntreut, Gelder für den Wiederaufbau, mit dem sich der Konzern gern schmückte, ein sensibles Thema, wurde aber in solidarischer Arroganz vom Konzern gedeckt. So wie die Kirche, die über die Jahrhunderte ihre Kinderschänder deckte und unbehelligt ließ. Die Justiz, wohlwissend um die Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens, zitierte ihn trotzdem ein paar Mal vor Gericht, der Prozess zog sich. Von Anfang an war dabei klar, dass er auf freiem Fuß bleiben würde. Nicht die Justiz entschied, sondern der Konzern. Für einen Augenblick dann aber wirkte es, als wollte die Staatsanwaltschaft an Gustav Lang ein Exempel statuieren. Doch das Geld, die Macht, die Anwälte und nicht zuletzt die Schläger des Konzerns hielten ihm den Rücken frei. Die Richter hatten Angst.
Nur die Journalisten in ihrer Masse fürchteten ihn nicht, und so schien es manchmal fast, als fände in ihrem Schmutz, den sie reißerisch an die Tagesoberfläche hievten, doch die Gerechtigkeit Platz, die sich der korrupte Rest der Welt nicht mehr leisten konnte. Das letzte Überbleibsel Anstand befand sich auf dünnem Papier, das am nächsten Tag in den Öfen landete. Natürlich geschah das nicht ohne Abrechnung. Ab und zu fand man damals, in diesem stickigen, heißen Sommer vor etwa zehn Jahren, einen von ihnen aufgeknüpft in den Gassen, einen Fotografen oder einen Schreiberling. Auch Menschen, die ich kannte. Ihre Mörder blieben immer im Dunkeln und ich weiß bis heute nicht, ob es Leute des Konzerns waren, die die vielen Toten hervorbrachten. Vielleicht hatte das auch nichts mit Gustav Lang zu tun, in dieser Stadt starb es sich wie bei den Fliegen. Doch ich erinnere diesen Sommer meiner späten Jugend als einen, in dem nicht wenige meiner Kontakte verschwanden. Es gab kaum eine Berufsgruppe, deren Vertreter man nicht von Zeit zu Zeit aufgeknüpft irgendwo vorfand. Leute wie Gustav Lang kamen seltener zu Tode, auch wenn es vorkam. Aber von Menschen seiner Sorte gab es nur ein paar wenige. Menschen meines Schlages hingegen mussten häufig sterben in diesen Tagen und müssen es auch heute noch.
Der Prozess verlief irgendwann im Sand. An Gerechtigkeit glaubte sowieso niemand mehr in dieser Stadt. Gustav Lang machte weiter sein Geld, wenn er auch fortan aus dem Verborgenen agierte, weil er untergetaucht war, seine Ämter abgegeben hatte und nun wie unsichtbar ein paar der Fäden zog. Das erzählte man sich. Sicher hatten sie ihm eine Abreibung verpasst, aber Krona, der Konzern, strukturierte sich als eigene Welt, mit eigenen Gesetzen.
Der ganze Vorgang war eine Farce, eine Verhöhnung des Rechtssystems, in Kommentaren und auf der Straße hieß es sogar, das Ganze sei vom Konzern inszeniert worden, um der ohnehin schon gebeutelten Stadt ihre Machtlosigkeit vorzuführen. Damals hielt ich es für übertrieben, auch wenn es nicht ganz abwegig schien. Ab einem gewissen Niveau des Reichtums gelten andere Gesetze. Nun, Gustav Langs Reichtum überstieg meine Vorstellungskraft.
Das zog mich in diesem Moment auch an. Das Geld zog mich an. Gustav Lang saß vor mir. Und dass er hier vor mir saß, in diesem Loch von einem Büro, bedeutete Geld. Geld für mich. Er sah deutlich älter aus als in den Zeitungen damals, hatte die letzten zehn Jahre im Verborgenen sicher nicht untätig und auch nicht ohne Exzesse verbracht. Seine Haut lag lose auf dem Gesicht, wie eine Maske.
Ich offenbarte ihm mein leichtes Erstaunen, versucht, möglichst unbeeindruckt zu klingen. Allein die Tatsache, dass einer wie er sich in diesen Bezirk verirrte, überraschte mich. Mir wurde schon zu diesem Zeitpunkt klar, dass es hier um ein sehr persönliches Anliegen gehen musste. In meinem Kopf ratterte es. Der Konzern hatte seine eigenen Schnüffler, widerliche Kerle, denen gegenüber ich mich fast als eine moralische Instanz verstand. Es musste also etwas sein, das bei Krona nicht bekannt werden durfte. Selbst wenn der Konzern mit Externen arbeitete, und selten kam das überhaupt vor, wurden diese von irgendwelchen Delegierten kontaktiert. Niemals von den wenigen Köpfen, niemals von Leuten wie Gustav Lang. Vielleicht kam mir all das auch deshalb so seltsam vor, kommunizierte ein Gustav Lang doch sonst nicht mit solchen wie mir. Er stöhnte. Fast zitternd formten seine Lippen ihren Namen. Ich weiß noch, wie wohlig diese Laute auf mich wirkten, auch wenn sie aus dem Mund eines Mannes kamen, für den ich nur Verachtung übrig hatte.
Er sagte: Maude Anandin.
Maude Anandin, dachte ich.
»Sie kennen sie nicht, und auch ich weiß so gut wie nichts über sie. Ich dachte es, aber ich weiß doch nichts. Sie sollen das ändern, Herr Weynberg.«
Pause.
»Sie entschwindet mir, immer wieder, sie lässt sich durch nichts beeindrucken, nicht kaufen, mein Geld spielt für sie keine Rolle. Ich muss erfahren, wer sie ist, wie ich sie bekommen kann. Ich finde sie nicht wieder. Ich muss wissen, wo sie ist. Ich brauche sie, ich will sie haben.«
Fast klang er wie ein jammerndes Kind. Er machte sich lächerlich.
»Nun, das werden wir sehen. Warum wenden Sie sich an mich in dieser Sache?«
»Ich brauche jemanden, der in unseren Reihen unbekannt ist. Ich denke, Sie haben häufiger mit solchen Dingen zu tun. Ich habe mich über Sie informiert, Weynberg. Sie sind fertig, heißt es. Und dass Sie trotzdem noch der Beste seien, den man finden kann! Sie sollen Maude Anandin finden. Mehr noch: Ich muss alles wissen, muss wissen, mit wem sie verkehrt. Ich will wissen, wie sie funktioniert, wie ich sie kriegen kann, was ich machen muss, damit sie zu mir kommt.«
Diese Sätze hatte er sich zurechtgelegt.
»Ich kenne Sie ja, also weiß ich auch um ihre Situation. Warum leisten Sie sich keine andere?«
Warum konnte ich den Mund nicht halten? Er funkelte mich an, beherrschte sich aber. In seinen Augen lag etwas Gefährliches. Auch wenn die Hülle alt war, so zeigte sein Blick ganz deutlich, dass man sich mit ihm nicht anlegen sollte.
»Herr Weynberg, Sie verstehen nicht, diese Frau ist anders. Mich interessiert einfach niemand sonst. Schauen Sie mich an. Ich bin ein alter Mann. Ich habe alles gehabt, was ich haben wollte. Und nun will ich Maude. Aber es klappt nicht. Ich kann sie nicht kaufen, kann nicht dafür sorgen, dass sie zu mir will.«
»Ich verstehe sehr wohl, verzeihen Sie. Dennoch muss ich Ihnen diese Fragen stellen.«
»Das ist Ihr Beruf.«
Das Wort Beruf brachte er nicht ohne Ironie über die schwulstigen Lippen, doch längst war ein milder Hund aus ihm geworden, die Hierarchie im Zimmer verschob sich, fast konnte ich es quietschen hören. Eine Frau also. Es mag banal klingen: wenn Geld kein Kriterium mehr ist, spielen irgendwann nur noch Dinge eine Rolle, die man nicht kaufen kann. Er hatte sie für eine Weile an sich binden können, aber ihr Herz, so wähnte ich schon damals, ließ sich nicht durch Geld und Macht erobern. Er hatte sich verliebt, und Maude Anandin, deren unvergleichliche Ausstrahlung ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht erahnen konnte, hatte für eine Weile mit ihm gespielt. Er hatte sein Leben lang bekommen, was er wollte, und nun, wo er sich aufgebraucht hatte, war jemand aufgetaucht, der ihn wieder in Wallung brachte, ihm wieder etwas schenkte, das ihn erfüllte. Eine Lust. Doch er konnte sie nicht haben, und da war er einem Gefühl verfallen, das meinen Berufsstand quasi begründet: Die Hölle der Eifersucht.
Eigentlich war seine Geschichte eine, die ich schon oft erzählt bekommen hatte. Eigentlich war es aussichtslos, eigentlich fütterte ich in solchen Fällen nur noch die Obsessionen meiner Auftraggeber, ließ ihren Wahn wachsen, sie hoffnungsloser werden. Davon lebte ich. Mehr oder weniger. Gustav Lang hatte sich wirklich verliebt, wenn ich auch seine Interpretation von Liebe nicht teilte. Es hatte ihn sensibel gemacht, zumindest sich selbst gegenüber, seine arrogante und machtvolle Hülle glitt immer deutlicher von ihm ab. Er wurde nervös. Das war noch, bevor er mir ihre Bilder vorlegte. Im Kopf hatte ich den Auftrag ohnehin schon angenommen, ich wollte sein Geld und es klang einfach.
Ich würde sie finden, das konnte ich. Beschattung, ein Personenprofil, das ihm Dinge zeigte, die er noch nicht wusste, Tagesabläufe, kleine Geheimnisse, dabei keinen Staub aufwirbeln, im Schatten bleiben. Vielleicht würde ich auch wirklich etwas finden, das ihm nützte. Selbst wenn ich nicht daran glaubte. Meine Neugierde war geweckt. Und ich mochte ihren Namen, wollte wissen, wer sich hinter diesem Wohlklang verbarg. Ich dachte auch, dass sie sehr hübsch sein müsste. Maude Anandin. Außerdem fürchtete ich, von den zwei Schränken alle Knochen zerrieben zu bekommen, sollte ich den Auftrag ablehnen. Wenn ich nicht ohnehin als Mitwisser früher oder später würde sterben müssen. Doch das konnte ich mir zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr aussuchen.
Fast tat er mir da ein bisschen Leid, war ich doch bereits von der Enttäuschung und dem Schmerz überzeugt, die ihm die Ergebnisse meiner Ermittlungen bescheren würden. Ich kannte diese Konstellationen. Aber solche Aufgaben gehörten zu meinem täglichen Brot. Schnüffeleien in den Kisten paranoider Männer und Frauen, eifersüchtiger Eheleute, Liebhaber oder intriganter Konkurrenten. Fast immer dank der Verzweiflung eines gekränkten Menschen. Häufig deprimierend. Ich nickte also nur, seufzte in mich hinein, suggerierte ihm, fortzufahren. Noch immer klangen seine Worte wie abgelesen, doch etwas Ehrliches zog ein. Gustav Lang war ein Spieler, anders hätte er es nicht so weit gebracht, und das Schauspiel lag ihm, aber jetzt, in seinen Erzählungen, war er weicher geworden. In seinen Augen sah ich es. Dieses Gespräch kostete ihn viel mehr Überwindung, als vor Gericht auszusagen oder sich im Vorstand zu rechtfertigen.
Seine Nase fing an zu bluten, ein dünnes Rinnsal floss aus dem rechten Loch. Ich wies ihn darauf hin.
»Oh.«
Mehr entfuhr ihm nicht, nur eine gehauchte Rundung seines Mundes und das Mindeste an Laut. Ich reichte ihm ein Taschentuch, kurz berührten sich unsere Hände, seine Haut fühlte sich kalt und gespannt an.
Das Blut hörte schnell wieder auf zu fließen, er wischte es weg. Zwischen Nase und Oberlippe war die Haut nun leicht rötlich gefärbt, und mit den glasigen Augen sah er aus wie einer meiner tuntigen Freunde am Ende einer langen Pulverparty, mit verschmiertem Lippenstift, früher, als ich noch ausgegangen war, als ich noch Freunde hatte. Er griff in die Innentasche seines Mantels.
»Ich denke, Sie werden verstehen.«
Ich schwieg, saugte auf, taxierte ihn.
Dann legte er mir die Fotos vor, elf Bilder, und mein Herzschlag setzte aus. Da war Hedy auf diesen Bildern. Es war nicht Hedy, sie konnte es nicht sein, Hedy war tot, aber sie sah aus wie Hedy. Hedy.