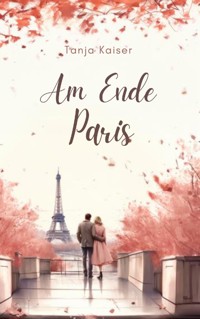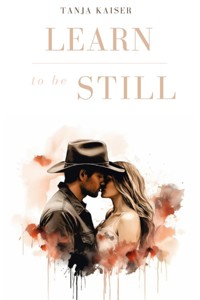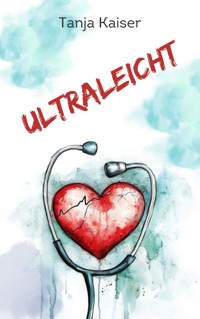
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Viktoria hat alles im Griff – einen soliden Job, klare Ziele und einen Partner, der perfekt zu ihrem durchgeplanten Leben passt. Doch als Isaak, der alles durcheinanderwirbelt, auftaucht, beginnt ihr sorgsam geordnetes Leben ins Wanken zu geraten. Wie entscheidest du dich, wenn das Herz etwas anderes will als der Kopf? Und was passiert, wenn du feststellst, dass du die falsche Wahl getroffen hast? Viktoria steht vor einer Entscheidung, die ihr gesamtes Leben verändert. Doch ist sie bereit, die Konsequenzen zu tragen, oder flüchtet sie in die Sicherheit – koste es, was es wolle? Ein Roman über die Leichtigkeit des Seins, die Schwere der Entscheidungen und die Frage, ob man wirklich beides haben kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tanja Kaiser
Ultraleicht
Texte: Tanja Kaiser
Umschlaggestaltung: Copyright Tanja Kaiser
Vertrieb: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Prolog:
Die Flasche lag kühl in meiner Hand und der Wind klatschte unerbittlich in mein ohnehin feuchtes Gesicht. Wann genau ich diese Idee gefasst und für gut befunden hatte, daran erinnerte ich mich kaum. Allerdings war es nun viel zu spät, und die Fahrt mit dem kleinen Touristenschiffchen würde sicher noch eine halbe Stunde dauern.
Das Ticket für die Fahrt hatten, außer mir, erstaunlicherweise noch andere gekauft, obwohl das Wetter ganz eindeutig nicht auf unserer Seite war. Im Grunde war ich froh darüber, denn ganz alleine auf dem Schiff hätte ich mich vermutlich noch unwohler gefühlt.
Trotz des eigentlich ganz gut verlaufenen Sommers hatte ich genau den Tag erwischt, an dem dieser eindeutig eine Pause machte, denn von Sonne oder auch nur halbwegs blauem Himmel konnte keine Rede sein. Es war düster, windig und rau, und vor allem regnete es seit einer Ewigkeit, ohne nur die geringste Pause. Kurz hatte ich überlegt, meinen Plan auf einen anderen Tag zu verschieben, aber irgendwie passte das Wetter ja auch zu meinem Gemütszustand, und so hatte ich mich, mit Windjacke und fast herbstlicher Kleidung, trotzdem auf den Weg zur Anlegestelle gemacht. Weitere Tage konnte ich nicht so verbringen, es konnte einfach nicht so weitergehen, und auch an einem sonnigeren Tag wäre der Anlass nicht um einen einzigen Prozentsatz schöner gewesen.
Das Rheintal lag ein wenig im Nebel, und die Spitzen der Berge konnte ich nicht erkennen, aber irgendwie gefiel mir sogar das. Die melancholische Stimmung, in der ich mich befand, wurde in dieser Umgebung widergespiegelt, und sicher hatte irgendjemand dort oben dieses Szenario nur für mich erschaffen. Passend zu einem Abschied, passend zu einem Schlussstrich. Dem Schlussstrich, um den ich mich so lange vehement gedrückt hatte und vor dem ich mich im Geiste fürchtete. Nicht immer war das, was man im Grunde wollte und plante, konform mit dem, was man auch wirklich tat, und ich gehörte eindeutig zu den Leuten, die sich um solche Entscheidungen viel zu lange drückten.
Der Nieselregen machte es mir nicht gerade angenehmer, aber schlussendlich spielte auch das nur eine untergeordnete Rolle. Meine Oma, Gott habe sie selig, hätte sicher behauptet, der Himmel würde weinen. Weinen worüber, das würde ich selbst kaum beschreiben können, aber Grund hätte er sicher.
Es galt, Abschied zu nehmen, von einer Erinnerung und von der Last, die mich begleitet hatte. Viel zu lange hatte ich mich mit diesen Dingen beschäftigt, hatte mir eingeredet, es würde irgendwann von alleine aufhören, aber dieser Zustand war nie eingetreten. Selbst nach mehr als zwei Jahren hatte ich ihn ständig in meinem Kopf, selbst nachts, und manchmal sprach ich seinen Namen laut aus, nur um ihn zu hören. Immer wieder erwischte ich mich dabei, auch beim Autofahren, und immer war ich erschrocken darüber. Er drang über meine Lippen, lange bevor mein Gehirn es überhaupt aufnehmen konnte, und immer atmete ich danach laut aus, weil ich einfach nicht verstehen konnte, wie mein Körper und mein Geist darauf reagierten.
Ich hatte lange geglaubt, so sei es eben bei allen Menschen – man litt unter Verlusten, und irgendwann vergaß man sie einfach. Nur bei mir war es nicht so. Ich träumte von ihm, dachte über ihn nach, und noch immer fragte ich mich jeden Morgen, ob meine Kleidung oder meine Haare ihm wohl gefallen würden. Kurz darauf saß ich dann in meinem Auto, die Musik laut, und manchmal sang ich mit, nur um dann unvermittelt seinen Namen auszusprechen. Erschrocken hielt ich dann inne und verstand selbst nicht, warum ich es tat.
Eigentlich war die Sache klar, klarer als alles andere in meinem Leben. Er würde nicht zurückkommen, war vielleicht nie wirklich da gewesen, und ganz sicher würde es kein Zurück mehr geben. Ich selbst wusste das, mehr als genug, aber das winzige kleine Ich in mir, das wollte einfach nicht verstehen. Immer wieder gängelte es mich mit Erinnerungen, ließ mich nachts erschrocken aufwachen, und immer wieder sagte es mir, dass es nie so weit hätte kommen dürfen. Ich hätte es verhindern können, wenn ich nicht diese wahnsinnig feige und unsichere Person wäre.
Es war belastend, jede Nacht aufzuwachen und sofort an ihn denken zu müssen. Dieses Gefühl der Unruhe und das ständige Kreisen meiner Gedanken ließen mich nicht los. Der Schlaf, den ich so dringend brauchte, wurde mir durch diese wiederkehrenden Träume geraubt, und selbst die Stunden, in denen ich nicht an ihn denken wollte, wurden von diesen Störungen überschattet.
Außerdem wusste ich, dass ich dieses Leben selbst gewählt hatte, ohne wirklich zu wissen, was das bedeutete. Der Gedanke, dass ich mich bewusst dafür entschieden hatte, machte die Sache nicht einfacher, sondern verstärkte nur das Gefühl der Verlorenheit, das mich jede Nacht heimsuchte. Doch selbst wenn ich es bereute, durfte ich das niemals zugeben – nicht vor mir selbst, und schon gar nicht vor anderen. Diesen Weg hatte ich gewählt, und ich würde ihn bis zum Ende gehen, ohne auch nur einmal zurückzuschauen.
Immer wieder hatte ich mir genau das vorgenommen, und am Ende weinend in meinem Bett gelegen, weil ich ihn so sehr vermisste. Wie sehr man überhaupt Reue empfinden konnte, einen Menschen vermissen konnte, und vor allem sich selbst hassen konnte, hatte ich erst durch ihn gelernt.
Der Verlust, den ich mir selbst zugefügt hatte, war so groß, dass ich im Grunde kein ganzer Mensch mehr war.
Ich war die Hülle, die funktionierte, lachte, atmete, arbeitete. Aber nicht mehr der Mensch, der ich vor all dem gewesen war.
Außer mir gab es noch eine ganze Reihe Rentner und Familien mit kleinen Kindern, alles Menschen, die das wenig schöne Wetter nicht von einer Fahrt abgehalten hatten. Allerdings hatten alle außer mir einen Platz unter Deck gefunden, wo ein Alleinunterhalter eine merkwürdige Kombination aus Schlagern und deutschen Achtziger-Jahre-Hits zum Besten gab. Ich hatte bei den anderen ausgeharrt, bis er „Himbeereis zum Frühstück“ gespielt hatte, und bis zu dem Zeitpunkt, wo eine der Rentnergruppen dazu mehr oder minder begeistert begonnen hatte, Foxtrott zu tanzen.
Das alles war nun wirklich nicht meine Welt, mal ganz abgesehen von meiner tiefen Abneigung zu allem, was auch nur im Entferntesten nach Boot aussah. Wasser mochte ich, ich wohnte gerne nah am Wasser und liebte es, mich dort aufzuhalten, aber darauf zu sein, das gehörte eindeutig nicht dazu. Mein Weg hatte mich an Deck geführt, ganz hinten zum Ende des Schiffes, und hier gab es endlich Stille. Niemand sonst hatte den Wunsch, hier zu sein, und irgendwie war ich ganz froh darüber.
Dieser Abschied gehörte mir, mir allein, und ich wünschte mir einfach, dass ich irgendwann danach das Gefühl von Leichtigkeit wieder erleben würde. Viel zu lange schon fühlte ich mich schwer und träge, jeder Tag der letzten 856 hatte sich schwer wie Blei angefühlt, und nur selten hatte ich mich nach dem Klingeln des Weckers halbwegs wach gefühlt.
Eigentlich war ich ziemlich sicher, dass es verboten war, Gegenstände vom Schiff ins Wasser zu werfen, und so hatte ich die kleine Glasflasche unter meiner Jacke versteckt und fest an mich gedrückt.
Es war schon schwer genug gewesen, überhaupt eine Flasche aus Glas zu finden, die man noch verschließen konnte, aber für eine PET-Flasche schien mir mein Auftrag doch zu wichtig. Heute waren Glasflaschen mit Schraubverschluss Mangelware, die meisten waren aus Plastik, und die wenigen aus buntem Glas hatten mir einfach nicht gefallen. Ein so wichtiger Auftrag benötigte auch eine angemessene Flasche, und so hatte ich tagelang nach dem perfekten Behälter für meinen Kummer gesucht.
Auch das war mir ganz gelegen gekommen, denn so hatte ich Zeit gewonnen, meinen Plan weiter hinauszuschieben. So wirklich überzeugt war ich einfach immer noch nicht, schon gar nicht, weil niemand mir sagen konnte, wer genau meine Flasche vielleicht finden würde. Kummer in Flaschen zu versenken, das machte Sinn. Aber Kummer in Flaschen zu versenken, ohne zu wissen, wer diese am Ende fand, das war kein angenehmer Gedanke.
In meinem Kopf war die Flasche weiß gewesen, vielleicht höchstens mit einem leichten Grünstich, und der Verschluss auf der Flasche sollte keine Werbung haben. Eine Wasserflasche, so wie sie sich in Kästen befand, war meine erste Wahl. Aber mit dem Blättern darin fand ich sie dann nicht mehr schön und stellte sie zurück in den Kasten im Flur. Irgendwie erschien es mir falsch, meine innersten Gefühle und Gedanken in einer derart schnöden Verpackung auf die Reise zu schicken.
Erst nach einem Besuch in einem Trödelladen fand ich die perfekte Flasche und zahlte am Ende eine absurd hohe Summe dafür. Die Flasche war sicher fünfzig Jahre alt, fast bläulich von der Farbe, und mit einem schwarzen Schraubverschluss, wie es ihn heute nicht mehr gab. Trotzdem war es die erste Flasche, die ich tatsächlich geeignet fand, und so hatte ich meine Blätter gerollt, darin verstaut und zur Sicherheit den Verschluss mit Wachs versiegelt.
Minutenlang hatte ich sie in meiner Badewanne auf die Probe gestellt, gewartet, ob sie wirklich meinen Schatz würde schützen können, und sie danach sorgfältig wieder abgetrocknet. Wer wusste schon, wie dicht ein so alter Korken sein konnte, und ob er nicht vielleicht meine so mühsam aufs Papier gebrachten Worte nicht ausreichend schützen würde?
Jetzt, an die Reling gelehnt, fühlte ich mich einsam und völlig fehl am Platz. Boote, Schiffe oder alles, was mit diesen zusammenhing, gehörte nicht zu meinem Leben. Mehr als fraglich, ob ich mich wirklich danach besser fühlen würde. Aber jetzt war ich hier, und die Flasche würde ich ganz sicher nicht mehr mit nach Hause nehmen. Tagelang hatte sie auf dem Küchentisch gestanden, und immer wieder war ich in Versuchung gekommen, das Wachs vom Verschluss zu kratzen, nur um einen letzten Blick auf die Worte darin zu werfen.
Hatte ich genug geschrieben? Wirklich alles aufgeschrieben, was ich so dringend hinter mir lassen wollte? Reichten die Worte, um wirklich den letzten Rest Kummer auszulöschen, oder hatte ich irgendein entscheidendes Detail vergessen? Musste ich nicht vielleicht noch ein letztes Mal kontrollieren, ob ich auch wirklich alles richtig wiedergegeben hatte?
Ich verbot es mir, denn es würde nichts ändern, und mit der Flasche würden hoffentlich auch die Erinnerungen an all das Leid in den Wassermassen verschwinden.
Es war Jahrzehnte her, dass ich das letzte Mal eine Flaschenpost versenkt hatte, und irgendwie hatte ich mich danach wirklich etwas besser gefühlt. Meine Oma hatte es mir geraten, als der Hund meiner Familie verstorben war, und sie hatte mir versichert, dass mein Kummer und meine Sorgen mit der Flasche von mir gehen würden.
Als Charlie starb, alt und vom Krebs gezeichnet, hatte ich es nicht verstanden. Er war da gewesen, solange ich mich erinnern konnte und als Kind glaubt man einfach an die Ewigkeit. Man hatte versucht, es mir schonend beizubringen, hatte mir erzählt, er sei nun im Himmel und würde dort viele Hundefreunde haben. Aber die Traurigkeit war trotzdem da gewesen, und die Einsamkeit auch. Jeden Abend hatte ich mich in den Schlaf geweint, und selbst mein sonst eher dröger Vater hatte irgendwann Mitleid mit mir gehabt. Er hatte vorgeschlagen, einen neuen Hund zu kaufen, aber ich hatte nicht gewollt. Man konnte Charlie nicht ersetzen, und seinen Platz mit einem anderen zu füllen, erschien mir einfach nicht richtig.
Nach Wochen des Kummers, der Verweigerung von Essen und allem, was mich an ihn erinnerte, hatte meine Oma endlich die zündende Idee. Ich sollte ihn gehen lassen, Abschied nehmen und abschließen mit allem, was mir die Kraft raubte. Ich hatte es geglaubt und ein Bild gemalt, denn Schreiben war mir noch nicht möglich gewesen. Darauf sah man meinen treuen Gefährten an einem besseren Ort, einer Wiese mit Bäumen und Blumen, und ich war damals sicher, dass er dort eben jetzt in der Sonne lag.
Meine Oma war mit mir zum Wasser gegangen, ich holte so weit aus, wie ich mit meinen sieben Jahren eben konnte, und ich warf die Flasche in den Fluss. Ganze 1,50 Meter weit. Ich sah sie an der Oberfläche treiben, ganz nah und doch unerreichbar, und hatte dann zugesehen, wie die Strömung sie davongetrieben hatte. Ob sie weit davontrieb, das konnte ich nicht sagen. Sie konnte Meter später am Ufer angespült worden sein oder auch Kilometer weiter. Vielleicht hatte sie es auch bis ans Meer geschafft, wer wusste das schon, auch wenn es mir heute eher unwahrscheinlich vorkam.
Jedenfalls fühlte ich mich danach besser, es war, als hätte ich eine Last von mir geworfen, und irgendwie hoffte ich, dieser Effekt würde sich auch heute wieder einstellen.
Ich sah mich um, aber sah niemanden außer mir selbst. Die Flasche hatte ich noch immer in der Hand, sie fühlte sich schwer und irgendwie falsch in ihr an. Sie gehörte nicht zu mir, nicht in mein Leben, und das, was sich darin befand, schon gar nicht. Sie musste weg, egal wie, und ich gönnte mir einen letzten Blick auf die fein säuberlich beschriebenen Blätter. Ich hatte sie ausgedruckt und nicht mit der Hand beschrieben, aus lauter Angst, jemand könnte meine Schrift erkennen. Wie irrsinnig, denn die Wahrscheinlichkeit ging gegen null, aber irgendwie hatte es mir das Gefühl von Anonymität gegeben. Wie neurotisch man doch manchmal war, gerade wenn es um die eigenen Gedanken ging.
Die meisten Menschen würden mich sicher für verrückt halten, aber ich hatte keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Wenn dich etwas so sehr belastete, dich in deinem Leben und Denken einschränkte, dann waren manchmal auch die verrücktesten Ideen eine Lösung. Und ich war eindeutig verzweifelt. Endlich, nach mehr als zwei Jahren Kummer und Gedanken, die mich fast umbrachten, war es endlich an der Zeit, all das hinter mir zu lassen. Ich würde neu anfangen, endlich wieder zu mir selbst finden, und zusammen mit der Flasche all die schlimmen und auch schönen Erinnerungen von mir werfen.
Vor allem die Schönen, denn die waren am schlimmsten. Wenn Menschen sich selbst wegen schlechter Erinnerungen bemitleideten, dann verstand ich es meistens nicht. Schlechte Erinnerungen waren Grund für Hass oder den Wunsch, es anders zu machen, damit konnte ich umgehen. Aber die schönen Erinnerungen, die machten es einem schwer. Wann immer mich etwas an die schönen Zeiten mit ihm erinnerten – ein Song oder ein Geruch, manchmal auch der Blick oder die Optik eines anderen Menschen – dann traf es mich schmerzlich und beschäftigte mich ewig. Nein, ich wollte mich nicht mehr an ihn erinnern, erst recht nicht an die schönen Dinge, auch wenn es nur wenige gab.
Ich sah mich ein letztes Mal um, und warf die Flasche, so weit ich konnte, in den Rhein. Nicht mal den Aufprall sah ich, ich hörte nur das laute Klatschen des Wassers, und so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte sie nicht ausmachen. Das schlechte Wetter, das unruhige Wasser und der noch immer fallende Regen verhinderten jeden Blick auf meine Vergangenheit. Minutenlang noch stand ich dort, dumpf hörte ich die Musik aus dem Inneren des Schiffes, aber das Gefühl von Befreiung stellte sich nicht ein.
Egal wie sehr ich es auch erwartet hatte, gehofft hatte, meine Probleme würden sich in Luft auflösen, das Gefühl von Verlust war stärker. Ich hatte meine Erinnerung dem Wasser übergeben, das Letzte, was mich noch mit ihm verband, und ein wenig fühlte es sich an wie Verrat. Verrat, weil ich ihn aufgab, unser Geheimnis jemandem anvertraut hatte, und es nicht rückgängig machen konnte. Wer auch immer je die Flasche finden würde, würde wissen, was genau passiert war, und er würde ebenso wissen, wie sehr ich noch immer darunter litt.
Kapitel 1:
„Zimmer 405. Aber nicht erschrecken.“
Ich nahm die Kladde aus dem Fach mit der genannten Zimmernummer, und sah auf Kristin, die völlig übermüdet auf ihrem Bürostuhl wippte. Ja, Nachtschichten waren eine echte Herausforderung, vor allem, weil sie unerbittlich von Tagschichten abgelöst wurden.
Falls jemals jemand geglaubt hatte, Ärztin oder Krankenschwester zu sein, wäre ein erstrebenswerter Berufswunsch, musste dieser Mensch ein Vollidiot sein.
Vielleicht war es irgendwann in grauer Vorzeit wirklich mal so gewesen, aber heute war man eigentlich nur noch eine Art Dienstleister. Keiner von uns bekam die Anerkennung, die er vielleicht verdient hatte, und am Ende war der Dank eine erneute Schicht für das nächste Wochenende.
Wann überhaupt jemand sich das letzte Mal bei einer der Schwestern bedankt hatte, daran konnte ich mich nicht mal mehr erinnern. Noch vor ein paar Jahren war das anderes gewesen, die Leute hatten Schokolade oder Kuchen gebracht, aber in diesem Jahr war das noch nicht einmal passiert.
Still fragte ich mich, ob die Qualität einfach schon so sehr gelitten hatte, dass die Leute wirklich nicht mehr dankbar waren. War das System schon so weit unten, dass die Patienten wirklich keinen Funken Dankbarkeit mehr empfanden?
Gewundert hätte es mich nicht, immerhin blieben für jeden von ihnen nur wenige Minuten, und für Nettigkeiten gab es auch kaum Zeit.
Vielleicht lag es tatsächlich an uns – wir waren alle so erschöpft und überarbeitet, dass es letztlich nichts mehr gab, wofür man uns noch hätte danken können.
Die meisten von uns waren müde. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, und auch die Wellen von unerklärlichen Krankheitsfällen innerhalb der Belegschaft, hatten in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen.
Ich selbst, seit mehr als fünf Jahren Ärztin, kämpfte ebenfalls mit den unmenschlichen Arbeitszeiten und den ständigen Schichtwechseln. Die endlosen Nächte im Dienst, gefolgt von frühen Morgenvisiten, ließen die Tage ineinander verschwimmen. Manchmal wusste ich kaum noch, welcher Wochentag es war, geschweige denn, wann ich das letzte Mal mehr als vier Stunden am Stück geschlafen hatte.
Mein Mitleid mit Kristin und all den anderen Pflegern und Schwestern hielt sich zwar in Grenzen – schließlich war ich selbst kaum besser dran –, aber ich konnte ihren Frust und ihre Erschöpfung nur zu gut nachvollziehen. Wir alle befanden uns in demselben unerbittlichen Kreislauf, in dem Schlafmangel und Überarbeitung die Norm waren, und dennoch wurde von uns erwartet, stets professionell und mit einem Lächeln auf den Lippen zu funktionieren. Der Druck, keine Fehler machen zu dürfen, obwohl wir am Rande unserer Kräfte standen, war allgegenwärtig.
Wir alle waren Opfer des enormen Personalmangels, und manchmal stellte ich meine Fähigkeiten vor lauter Müdigkeit doch sehr in Frage. Ich sollte Menschenleben retten, wichtige Entscheidungen treffen, und das alles, nach mehr als vierundzwanzig Stunden herum Gerenne.
Sicher gab es Pausen, manche auch länger, aber selten reichten diese wenigen Minuten oder Stunden aus, um einen halbwegs wachen Zustand zu erreichen.
Gerade an den Wochenenden, wo Unfälle jeder Art und jedes Schweregrades praktisch im Stundentakt auf mich einriselten, kam man kaum zu Schlaf.
Ständig in Alarmbereitschaft zu sein, immer auf das Klopfen, oder das Piepen des kleinen Gerätes an meinem Hosenbund wartend, ließen einen einfach nicht zur Ruhe kommen.
„Autsch. Hört sich übel an.“
Ich überflog die Akte, und plötzlich durchzuckte ein scharfer Schmerz meine linke Gesichtshälfte. Es war nicht das erste Mal, dass mir so etwas passierte, eine Art Phantomschmerz, der mich wie ein Echo einholte.
Manchmal, wenn ich mich tief in eine Akte vertiefte, spürte ich diesen empathischen Schmerz, der wie eine ungewollte Erinnerung an eigene Verletzungen in mir aufstieg.
Für eine Ärztin sicher ungewöhnlich, denn eigentlich prasselten all diese Eindrücke und Leiden in solchen Mengen auf uns ein, dass man irgendwann abstumpfen müsste. Aber bei mir passierte das einfach nicht. Vielleicht war das eine Schwäche, dieser empathische Reflex, der sich nicht abstellen ließ. Vielleicht hielt mich auch genau das in diesem Beruf – die Tatsache, dass ich nicht aufhören konnte, mitzufühlen.
„Jupp. Ist mit dem Auto überschlagen. Aber sonst gehts im gut.“
Ich klappte die Kladde mit dem Bericht zu, und versuchte mir das Kommende schon mal vorzustellen. Manchmal half es, man war dann weniger schockiert, und vor allem merkte man es mir weniger an.
Auch wenn die Menschen etwas anderes dachten, auch mich schockierten entstellte Gesichter. Ich ekelte mich nicht, immerhin war dafür in meinen Beruf kein Platz, aber trotzdem konnte ich mir Schöneres vorstellen.
Auch das diese Verletzung für den Menschen selbst eine Katastrophe war, machte die Sache nicht einfacher. Wie sagte man jemandem, dass sein Leben, so wie er es kannte, vorbei sein würde?
Wie machte man ihm klar, dass auch der beste Plastische-Chirurg der Welt, diese Tatsache nicht mehr würde ändern können?
Ich tappte über den Flur in Richtung der 405, und wappnete mich für den Moment des Eintritts. Freundlich sein, Lächeln, nichts anmerken lassen.
Übel. Echt übel.
Der Mann in dem Krankenhausbett sah halbwegs wach, aber sehr müde aus.
Die untere linke Gesichtshälfte wurde von einem riesigen Pflaster verdeckt, und aufgrund der Akte wusste ich, dass sich darunter eine Hauttransplantation befand.
„Herr Marx?“
Ich trat näher an das Krankenbett, nicht sicher ob er würde antworten können. Mit einer derart großen Wunde, und auch der damit verbundenen Schwellung, würde es vielleicht nicht mal möglich sein. Obwohl in der Akte stand, dass die Transplantation schon mehr als vier Wochen her war, sagte das nichts über seinen tatsächlichen Zustand aus.
Heilungsphasen waren sehr unterschiedlich, manchmal völlig unvorhersehbar, und jeder Körper verarbeitete Transplantationen anderes. Bei dieser hier schien es nicht gut zu laufen, jedenfalls nicht perfekt, und ich versuchte zu erkennen, ob der Patient vor mir überhaupt ansprechbar war.
Obwohl seine Augen geöffnet waren, schien er abwesend, und ich linste auf meine Unterlagen, um zu erkennen, mit was genau sie ihn kalt gestellt hatten.
In der Medizin bedeutete „kaltstellen“ oft, dass man jemanden mit starken Medikamenten, meist Schmerzmitteln oder Sedativa, ruhigstellte. Es war ein gängiges Vorgehen, um Patienten von extremen Schmerzen zu befreien und ihnen eine gewisse Erleichterung zu verschaffen.
Kalt stellen war nicht immer eine schlechte Sache, wenn der Schmerz zu groß war, konnte es Erlösung sein, und sicher war es besser, als sich dem ganzen Drama in vollem Bewusstsein zu stellen.
„Wann kann ich nach Hause?“
Die müde Stimme spiegelte seinen Zustand perfekt wieder. Ja, es ging ihm schlecht, und es würde noch für eine ganze Weile so bleiben.
„Nicht heute. Wie fühlen sie sich?“
Ich sah in seine dunklen Augen, die trotz seiner Situation eine gewisse Wärme und Sanftheit ausstrahlten. Sein Haar, fast schwarz, war inzwischen zerzaust, aber man konnte noch erahnen, dass es einmal zu einer sehr geschäftsmäßigen Frisur gestylt worden war. Ja, er war sicher einer dieser Geschäftsleute, einer von denen mit dem typischen Seitenscheitel, und irgendwie strahlte er selbst jetzt noch aus, dass er in dem, was er tat, erfolgreich war.
Wenn man so viele Menschen traf wie ich, aus jeder erdenklichen Gesellschaftsschicht, dann lernte man, solche Prognosen zu stellen. Dieser hier, egal wie mitgenommen er im Moment war, war im echten Leben definitiv jemand, der Erfolg hatte. Die perfekte Frisur, die ausgeprägte Kieferpartie, die unfassbar gepflegten Hände und die makellose Haut – das alles sprach für jemanden, der großen Wert auf sein Äußeres legte.
Mein Blick wanderte zu der riesigen silbernen Armbanduhr auf dem Nachttisch. Sie war definitiv nicht billig, das konnte man auf den ersten Blick erkennen. Ich mutmaßte, dass sie ihm sehr wichtig war. Warum sonst sollte man eine derart teure Uhr so offen auf dem Tischchen neben dem Bett liegen lassen? Die meisten Menschen, die ich kannte, brachten ihre Wertsachen im Krankenhaus in Sicherheit, sorgten dafür, dass ihre Schätze gut aufgehoben waren. Aber dieser Mann nicht. Entweder wollte er damit ein Zeichen setzen, seine Identität als jemand, der sich auch im Krankenhaus nicht versteckt, oder es gab eine tiefere Verbindung zu dieser Uhr.
Vielleicht erinnerte sie ihn an bessere Zeiten, an die guten Zeiten, und brauchte sie deshalb in seinem Sichtfeld.
„Wann kann ich nach Hause?“
Armes Schwein. Der Gedanke schoss durch meinen Kopf, und sofort verurteilte ich mich selbst dafür. Ja, er war ein armer Kerl, sogar einer von der ganz armen Sorte, aber trotzdem sollte ich mir derartige Gedanken nicht erlauben.
Er war, nach meiner Erfahrung, ärmer als all die anderen, gerade weil er wohl einmal sehr gut ausgesehen haben musste. Menschen wie er, die es gewohnt waren, wegen ihres Äußeren bewundert zu werden, hatten es ungleich schwerer, mit Entstellungen umzugehen. Sie litten intensiver, tiefer, weil ihr Selbstwertgefühl so stark mit ihrem Aussehen verknüpft war.
Wer vorher schon in der Masse untergegangen war, ohnehin im unteren Mittelmaß rangierte, der fand viel schneller zurück in ein normales Leben. Menschen, die keine großen Erwartungen an die Reaktionen ihrer Mitmenschen hatten, die nicht darauf angewiesen waren, von anderen positiv wahrgenommen zu werden, die lebten sich viel schneller wieder in die Gesellschaft ein. Sie waren es gewohnt, nicht im Mittelpunkt zu stehen, und ein solcher Rückzug fiel ihnen daher leichter.
Aber er? Er würde das nicht können. Er war andere Reaktionen gewohnt. Wenn er einen Raum betrat, hatten die Menschen die Köpfe zu ihm gewandt. Sicher hatten viele Frauen auf sein Auftreten reagiert, vielleicht sogar mit einem gewissen Glanz in den Augen, und dabei einen Blick auf sein Handgelenk und die teure Uhr erhascht. Sie hatten sich wohl überlegt, wie der passende Wagen dazu aussehen würde, was für ein Leben dieser Mann führte – ein Leben, das nun in Scherben lag. Nie wieder würde das aus den gleichen Gründen passieren. Die Köpfe würden sich zwar weiterhin drehen, aber nicht mehr aus Bewunderung oder Interesse. Stattdessen würden die Menschen starren, weil er anders war, weil er nicht mehr in ihr Bild von Perfektion passte. Jetzt war er eine Anomalie, eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie schnell sich alles ändern kann.
„Herr Marx, ich verstehe sie. Sie möchten nach Hause, und das wird auch so kommen. Aber nicht heute, und auch nicht morgen. Sie müssen sich erholen, und wir müssen sie im Auge behalten, damit die Haut nicht abgestoßen wird. Morgen werde ich das Pflaster entfernen, dann kann ich ihnen eine Prognose nennen.“
Ich griff nach dem Arm des Mannes und drückte ihn leicht, so wie ich es bei allen Patienten tat. Es war eine Geste, die mehr bedeutete, als Worte es in diesem Moment könnten. Ein Mittel, um Mitgefühl zu transportieren, vielleicht auch ein stummes Zeichen von Verständnis, aber vor allem, um Vertrauen zu schaffen. In meinem Beruf war Vertrauen das A und O – ohne es kamen wir keinen Schritt weiter, aber mit ihm öffneten sich Türen, die sonst verschlossen blieben.
„Warum nicht heute?“
Fast flehentlich sahen mich seine dunklen Augen an, und ich versuchte, so verständnisvoll wie möglich auszusehen. Er hoffte, dass ich ihm eine gute Nachricht geben könnte, dass ich ihm sagen würde, dass er bald nach Hause könnte. Aber die ehrliche Antwort, dass mein bis zum Rand gefüllter Terminkalender es nicht zuließ, ihn vorzuziehen, konnte ich unmöglich aussprechen. Die Planung sah anders aus. Jemand wie er konnte warten, während viele andere Patienten einfach dringender behandelt werden mussten. Es war hart, aber so lief es nun mal.
„Geben Sie der Wunde noch eine Nacht,“ sagte ich mit ruhiger Stimme. „Das macht manchmal viel aus. Schlafen Sie, und wenn Sie morgen wach werden, dann komme ich, und dann schauen wir uns das Ganze an.“
Ich drückte seinen Arm erneut, diesmal etwas fester, als wollte ich ihm auf diese Weise zusätzlich Halt geben. Dann wandte ich mich der Infusion mit dem Antibiotikum zu. Warum auch immer er dieses noch benötigte – eigentlich war die Transplantation lang genug her, um ohne auszukommen. Den Grund dafür würde ich vielleicht erst viel später erfahren, dann nämlich, wenn ich irgendwann meine lange Runde über die Flure beendet hatte und endlich die Krankenakte vollständig lesen konnte.
Auch das war eigentlich ein Unding. Ich arbeitete mit gefährlichem Halbwissen, huschte von Patient zu Patient, immer nur mit einem flüchtigen Blick auf die Akten, gerade genug, um das Nötigste zu wissen. Jeden Tag improvisierte ich, in der Hoffnung, dass nichts Wichtiges übersehen wurde, dass die entscheidenden Details nicht untergingen. Erst abends, wenn der Sturm des Tages sich legte und mein Dienst fast um war, hatte ich die Zeit, mich wirklich in die Akten zu vertiefen und zu verstehen, was meine Patienten wirklich brauchten. Oft erkannte ich erst dann das eigentliche Problem, und ich dankte Gott dafür, dass ich bisher noch keinen gravierenden Behandlungsfehler gemacht hatte.
Wir alle, Ärzte wie Schwestern, standen jederzeit mit einem Bein im Gefängnis. Sobald einer von uns versagte, war der Aufschrei groß. Niemand interessierte sich dafür, dass wir absurde Stunden arbeiteten, ständig unter enormem Zeitdruck standen. Es spielte keine Rolle, dass oft nur zwei Schwestern für vierzig oder mehr Patienten zur Verfügung standen. Auch nicht, dass jemand wie ich an einem Tag über vierzig Schicksale bearbeiten musste – Schicksale, die oft keine Zeit zum Warten hatten.
Ich hastete jeden Tag von Zimmer zu Zimmer, immer den Faktor Zeit im Nacken, und versuchte verzweifelt, die Unmengen von Informationen zu verarbeiten, die auf mich einstürmten. Nicht immer gelang es mir. Manchmal gingen mir gerade die wichtigen Kleinigkeiten einfach durch, und jedes Mal machte ich mir dann Vorwürfe.
Ich sah ein letztes Mal zu dem müden Mann, strich ihm über den Arm und zupfte dann die Decke etwas zurecht. Wenigstens für diese kleinen Gesten musste Zeit sein. Wenigstens der Funken Anteilnahme musste einfach drin sein, egal wie stressig der Tag war.
Kapitel 2:
„Sind Sie sich sicher, dass es kein Krebs ist?“
Die ältere Dame lag verschreckt in ihrem Krankenbett und zog die Decke noch ein Stück weiter nach oben.
„Nein, Frau Gerlach, kein Krebs. Sie haben lediglich einen nervösen Magen, und Sie sollten Schonkost zu sich nehmen.“
Ich strich auch ihr beruhigend über den Arm und klappte mit einer Hand die Akte auf meinem Arm zu. Krebs war die Angst aller Menschen in dieser Zeit, und oft war das ein echtes Problem. Jeder, der auch nur das geringste Wehwehchen hatte, wurde von Panik ergriffen.
„Sind Sie sich wirklich sicher? Es geht mir wirklich nicht gut!“
Die Dame sah mit großen Augen zu mir auf, und ich nickte erneut.
„Ganz sicher. Aber Sie sollten aufhören, das hier zu essen, und dann wird es Ihnen sehr schnell besser gehen.“
Mit der rechten Hand zog ich die Schublade des Nachtschränkchens auf, und ein Berg Pralinenschachteln mit Weinbrandbohnen erschien. Schon beim Bluttest hatte ich mich über den Alkohol in ihrem Blut gewundert, und meine Theorie hatte sich nach kurzer Zeit bestätigt. Wann immer der Aufräumtrupp die Mülleimer geleert hatte, waren die silbernen Papierchen aufgetaucht.
„Aber...!“
„Kein ‚Aber‘. Das hilft Ihnen nicht weiter, das beunruhigt Ihren Magen nur noch mehr.“
Ich schloss die Schublade und verschränkte die Arme vor dem Körper. Ihr die Schachteln abzunehmen, würde nichts bringen. Wo auch immer diese herkamen, gab es sicher mehr davon, und am Ende lag es immer bei jedem selbst. Manchmal machten sich die Angehörigen keine Gedanken über solche Dinge, meinten es vielleicht sogar gut, und jeder Versuch, es ihnen auszureden, versandete ungehört. Sie selbst musste sich dagegen entscheiden, und nicht ich würde diese Entscheidung treffen.
Wie lange Frau Gerlach sich schon mit Weinbrandbohnen betäubte, konnte ich nur ahnen. Vermutlich war es ein schleichender Prozess gewesen, vermutlich eine über Jahre entstandene Angewohnheit, und am Ende hatte ihre ohnehin angeschlagene Magenschleimhaut einfach darauf reagiert. Fälle wie diese gab es hundertfach. Manchmal trieb die Einsamkeit die Leute dazu, und tatsächlich nahmen solche Fälle in letzter Zeit zu.
Ich verabschiedete mich von ihr und riet ihr erneut, von den kleinen Bohnen Abstand zu gewinnen. Vielleicht würde ich auch einen Vermerk über Suchtverhalten machen und jemanden Geeignetes vorbeischicken. Meistens brachte es nichts; die meisten Leute wollten von solchen Dingen einfach nichts hören, und nur ein verschwindend geringer Teil der Patienten nahm die Hilfe an.
Sucht, egal wie sie sich äußerte, war ebenso ein Problem wie Krebs. Allerdings waren ein Großteil der Süchte heute kaum mehr außergewöhnlich, weil einfach so viele darunter litten, dass sie gar nicht mehr als solche wahrgenommen wurden.
Richtig bewusst war mir das erst geworden, als die ersten Patienten sich über das schlechte WLAN im Haus beschwerten. Immer mehr Patienten waren panisch, weil ihre Handys nicht richtig funktionierten, und immer mehr von ihnen schleppten sich halbtot auf die Balkone der Stationen, in der Hoffnung, dort besseren Empfang zu haben. Die Panik, nicht erreichbar zu sein, eventuell etwas Wichtiges zu verpassen, und die Abhängigkeit von dem kleinen Display trieben so manchen zu Höchstleistungen an. Nicht immer war das gut; manchmal war Bettruhe einfach zu wichtig, aber bei anderen sah ich Leistungen, die ich nicht im Traum erwartet hätte.
Ich schlich mich zurück zum Schwesternzimmer, meine Beine taten weh und mein Kopf brummte. Alles, nach dem ich mich sehnte, war eine große Tasse starken Kaffees. Mehr als zehn Stunden war ich nun schon auf den Beinen, mit kurzen Unterbrechungen zwar, aber trotzdem anwesend. Auch Kirsten saß noch immer auf ihrem Stuhl, wippte diesen unaufhörlich hin und her, und so langsam vermutete ich, sie hielt sich damit wach. Oft war es hilfreich, in Bewegung zu bleiben, einfach nur zu funktionieren, und sobald man still da saß, wurde einem das volle Maß der Müdigkeit nur allzu bewusst.
„Wie lange musst du noch?“
Ich warf die Akte auf den Tisch und drückte den Knopf der Kaffeemaschine, unter der gnädigerweise jemand eine leere Tasse hinterlassen hatte.
„Stunde noch. Marens Kind ist krank, und ich habe versprochen, ihre Schicht zu überbrücken, bis der Babysitter da ist.“
Die braune Flüssigkeit ergoss sich in die weiße Tasse, und ich roch den vertrauten Geruch. Kaffee war unser aller Untergang, auch wenn wir selbst etwas anderes predigten. Immer wieder rieten wir Patienten davon ab, erklärten, warum Kaffee nicht geeignet war, und schütteten doch alle Liter davon in uns hinein.
„Ich hab’s auch gleich geschafft.“
Zusammenhalt war alles, was wir hatten. Mehr blieb nicht nach all dem anderen, und wenn wir ihn verlieren würden, wären wir alle dem Untergang geweiht. Wir waren nicht mehr die Götter in Weiß, waren es vielleicht nie gewesen, und die Ärzte, Schwestern und Pfleger hatten irgendwann begonnen, eine homogene Masse zu werden. Ohne einander waren wir alle verloren; wir benötigten unser aller Wissen, und wenn ich genau darüber nachdachte, fühlte zumindest ich mich keinen Meter cleverer als die Frauen und Männer, die mir eigentlich unterstellt waren.
Wer von uns Kinder hatte, war ohnehin arm dran, denn die Schichten und langen Arbeitstage waren alles andere als familienfreundlich. Alleinerziehende wie Maren gaben am Ende einen Großteil ihres Gehalts für Betreuung aus, und irgendwie ergab das keinen Sinn. Irgendwann hatten wir uns alle für diese Berufe entschieden, weil wir helfen wollten. Wir wollten kranke Menschen heilen, uns kümmern und gute Menschen sein. Bereut hatten wir diese Entscheidung fast alle irgendwann, und auch ich hatte schon über eine Veränderung nachgedacht.
Mein Privatleben war in den letzten Jahren praktisch gänzlich zum Stillstand gekommen, und es sah nicht so aus, als würde sich daran etwas ändern. Die bescheuerten Schichten verhinderten jede Form normalen Lebens, und wann ich überhaupt das letzte Mal im Kino gewesen war, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Ich war schlicht und ergreifend einfach zu erschöpft.
Die einzigen Freunde, die ich noch als solche bezeichnen konnte, waren ebenso Angestellte des Krankenhauses, und der einzige Mann in meinem Leben war Arzt in der Notfallambulanz. Hin und wieder traf ich mich mit ihm, wenn unsere beiden Arbeitspläne gerade nicht kollidierten, und wir taten, als hätten wir eine echte Beziehung. Dass dies nicht der Fall war, das wussten wir im Grunde beide. Zu selten waren die Treffen, zu wenig kannten wir einander als echte Menschen. Wir kannten unseren Beruf, er verband uns auf eine Ebene, die kaum jemand verstehen würde, aber jenseits davon existierten wir nicht.
Aber es tat gut, sich etwas anderes einzureden, und es tat auch gut, jemanden zu treffen, der die gleichen Probleme teilte.
Er war kein schlechter Kerl, im Gegenteil, aber wir entwickelten uns einfach nicht weiter, und schon gar nicht zusammen. In mehr als zwei Jahren hatten wir noch immer nicht mehr als die zwei Tage eines Wochenendes miteinander verbracht, und schlussendlich wusste ich praktisch nichts über ihn. Weder wie seine Kindheit verlaufen war, noch welche Filme oder Musik er mochte. Nichts davon war je erwähnt worden, und trotzdem redeten wir uns ein, so etwas wie ein Paar zu sein.
Auf jeden anderen musste das merkwürdig wirken, vielleicht auch absurd, aber für uns war es einfach eine Lösung. Nicht einsam zu sein, nicht allein auf der Welt, und vor allem jemanden für die Urinstinkte eines jeden Menschen zu haben, das war genug für uns. Dass ich mir im Grunde etwas anderes, Tieferes wünschte, spielte dabei keine Rolle. Welcher Mann auf der Welt sollte auch mit diesem Leben zurechtkommen? Viele einsame Nächte und auch Wochenenden, ständig auf Abruf zu stehen und den Abendfilm praktisch jeden Tag allein zu sehen, das würde kein Mann auf Dauer mitmachen.
Wie sollte man auch einem normalen Menschen mit normalen Arbeitszeiten klarmachen, dass es so etwas für mich nicht gab? Dass meine Schicht nie nach acht Stunden endete und absolut niemand sich dafür interessierte? Also behalfen wir uns mit dieser Form einer Halbbeziehung, nur um nicht gänzlich den Bezug zu all den echten Menschen zu verlieren, und harrten in unseren Positionen aus. Mit über dreißig war das zwar traurig, aber Realität, und am Ende hatte ich dieses Leben ja selbst gewählt. Ich hatte diesen Beruf erwählt, mit all den Defiziten, die er mit sich brachte, und konnte niemand anderen dafür verantwortlich machen.
Ich überflog das letzte Blatt Papier für diesen Tag und stolperte über den Patienten von 405. Der ungewöhnliche Vorname hatte meinen Blick gestoppt, und erst jetzt fiel er mir wieder ein. Der morgige Tag würde schlimm für ihn werden, egal wie gut sich seine Wunde entwickelt hatte, und ich würde live dabei sein. Sicher hatte er auch schon vor Wochen seine Verletzung angesehen, das taten sie alle ab einem gewissen Zeitpunkt, aber jedes Mal aufs Neue war es ein schreckliches Erlebnis. Manchmal standen sie auf, wenn sie allein in ihrem Zimmer waren, und lösten die Verbände. Zu ahnen, was darunter war, war immer etwas anderes, als es dann wirklich zu sehen. Viele wollten daher dabei allein sein, allein mit sich und ihrem Schicksal, und ohne die Blicke fremder Menschen.
Ob das bei ihm auch der Fall gewesen war, das wusste ich allerdings nicht. Laut Akte war die Transplantation nicht mal groß, gerade mal so wie ein Zwei-Euro-Stück, aber so sichtbar für jeden, war praktisch alles zu groß.
Ich blätterte durch den Rest des Papiers, aber es ergab sich nichts Neues. Autounfall, der Airbag hatte sein Gesicht vermutlich Richtung Seitenscheibe geschleudert, und am Ende war aus dem eloquenten, gutaussehenden Mann etwas anderes geworden.
Erneut blieb ich an seinem Vornamen hängen, aus mir unbekannten Gründen gefiel er mir ausgesprochen gut, und ich konnte mich nicht erinnern, je einen Patienten mit diesem Namen getroffen zu haben. Isaak, ein Name, der selten, und doch vertraut war.
Obwohl der Name so gar nicht zu seinem Nachnamen passte, fand ich ihn doch passend. Er klang erwachsen, erdig und vor allem männlich. Manchmal wunderte ich mich, wie wenig Namen tatsächlich zu den Personen passten, und fragte mich, ob die Eltern versucht hatten, den Kindern irgendein Leben schon mit dem Namen vorzugeben. Unter manchen Namen stellte man sich Erfolg oder Geld vor, bei anderen wusste man sofort, dass man von der Person kaum etwas erwarten konnte.
Spätestens als ich zum ersten Mal eine völlig verhunzte Version des amerikanischen Namens Zachary auf einer der Akten gelesen hatte, wurde mir das volle Ausmaß dessen bewusst. Die Familie, die sich im Nachhinein als die untere Schicht der Unterschicht herausgestellt hatte, hatte den Namen mit „Sachary“ angegeben, und ich hatte unweigerlich an Sacher-Torte gedacht. Der kleine Sachary, der trotz seiner vier Jahre kaum ein Wort sprechen konnte, war jedenfalls ein gutes Beispiel für den Lauf der Welt. Seine Eltern sahen eindeutig zu viel fern, hatten sich die Schreibweise des Namens selbst zusammengereimt, und irgendein Standesbeamter hatte diesen eben so übernommen. Sachary selbst konnte seinen Namen erst recht nicht aussprechen, und stellte sich mir mit einem „Saschariiie“ vor.
In solchen Fällen, wenn die Kinder so weit ab vom eigentlichen notwendigen Stand ihrer Entwicklung waren, fragte ich mich oft, ob das Jugendamt wohl darüber informiert sein könnte. Auch wir riefen sie, immer dann, wenn Gewalt oder Misshandlung nicht auszuschließen waren, aber oft konnte man diese Dinge einfach nicht gut genug einschätzen. Kinder verletzten sich, manchmal auf die bescheuertsten Arten, und nicht immer waren dabei andere Kräfte im Spiel.
„Saschariiie“ jedenfalls hatte eine Kopfwunde, eine von der Sorte, die ich tausendfach bei Kindern sah, und im Großen und Ganzen machte er einen aufgeweckten Eindruck. Keinen Grund zu echter Sorge also, auch wenn ich die Eltern kaum verstand. Die Aussprache der beiden war so schlecht, die Wortwahl so wahllos und unzusammenhängend, dass mich das Sprachdefizit des kleinen Jungen dann auch nicht mehr gewundert hatte.
Leider gab es keine Vorgaben über einen Mindest-IQ zum Aufziehen von Kindern, und leider gab es von ihnen einfach viel zu viele. Niemand würde all diese Kinder retten können, vermutlich wollten sie nicht mal gerettet werden, und am Ende würden sie Erwachsene ohne große Zukunft werden.
Isaak war anders. Man konnte sich wenig oder gar nichts darunter vorstellen, und irgendwie gefiel mir das. Jemand mit einem solchen Namen, im Zusammenhang mit meinen fast ausspionierten Theorien über Erfolg und Geld, schien interessant zu sein. Zu schade, dass ich ihn nicht vor all dem getroffen hatte, zu einem Zeitpunkt, an dem sein Leben noch nicht zum Stillstand gekommen war.
In Krankenhäusern blieb die Zeit stehen, dieser Zustand machte sie zu besonderen Orten. Selbst Menschen, deren Leben auf der Überholspur an ihnen vorbeigerast war, kamen hier für einen Zeitraum X zum Stillstand. Manchmal kam es mir magisch vor, und in anderen Fällen einfach unfair.
Bei Isaak tat es mir leid, denn sicher hatte er ein komfortables Leben gehabt, und mit dem Unfall hatte sich dieser Zustand schlagartig geändert. Er war gestoppt worden, ohne dass er etwas daran ändern konnte, und sicher versetzte ihn diese Entschleunigung in Panik. Nichts tun zu können, völlig machtlos und ausgeliefert zu sein, das war für die meisten Menschen eine schlimme Sache. Man harrte aus, wartete auf Heilung, und eigentlich wollte man nichts anderes, als nach Hause und zurück in das bekannte Leben. Man wollte vergessen, die Krankheit oder Verletzung hinter sich lassen und endlich zum gewohnten Takt zurückkehren. Leider würde es für ihn nicht so laufen, sein Leben würde nicht mehr den gewohnten Takt haben, und sollte er ihn jemals wieder erreichen, würde es sehr lange dauern.
Mit einem neuen Ich, einem veränderten Ich umzugehen, das erforderte Zeit. Er würde erschrecken bei jedem Blick in den Spiegel, sich selbst nicht erkennen, und er würde mit den Blicken, Reaktionen und Fragen seiner Mitmenschen umgehen müssen. Ich selbst war gespannt auf ihn, es interessierte mich brennend, was unter all den Verbänden steckte, und vor allem, wie sehr ihn das alles würde einschränken. Vielleicht würde es gar nicht schlimm sein, vielleicht sogar irgendwann fast unsichtbar, und morgen würden wir es beide wissen.
Kapitel 3:
Schon auf dem Flur hörte ich den Klang einer Gitarre und die tiefe Stimme eines Mannes. Ich blieb stehen, um herauszufinden, woher die Musik kam, aber so richtig gelang es mir nicht. Musik war hier selten zu hören, eigentlich so gut wie nie, und ich wunderte mich, dass es niemand anderem aufgefallen war. Natürlich durften Patienten Radio hören oder überhaupt Musik abspielen, aber die Ansage lautete stets: nur mit Kopfhörern, um die anderen nicht zu stören.
Trotzdem hörte ich sie jetzt laut und deutlich, und schon bald erkannte ich den Song: „Ain’t No Sunshine,“ sogar die Originalversion von Bill Withers, einen Song, den ich selbst auch sehr mochte. Der langsame, soulige Takt entsprach genau meinem Geschmack.
Ich ging weiter, blieb vor jedem der Zimmer stehen, aber lauter wurde die Musik nicht. Erst vor der 405, dem Zimmer meines Sorgenkindes, konnte ich die Quelle eindeutig ausmachen. Fast musste ich lächeln – laute Musik war ein Zeichen von guter Laune, und in diesem Fall war ich tatsächlich versucht, ein Auge zuzudrücken. Jemand, der Musik hörte, noch dazu laut, war eindeutig weniger depressiv, als ich es befürchtet hatte.
Ich sparte mir das übliche Klopfen – bei dieser Lautstärke würde er es vermutlich ohnehin nicht hören – und trat einfach ein. Noch immer sah er mitgenommen und müde aus, aber zumindest war die Infusion an seinem Arm verschwunden. Auch sonst wirkte er wacher als gestern, und fast schon glaubte ich, er würde mich ebenso anlächeln, wie ich ihn.
„Morgen!“
Ich trat näher an das Bett und strich über seinen Arm, der sich erstaunlicherweise lebendiger anfühlte als noch gestern. Immer wieder waren mir ähnliche Dinge aufgefallen – man spürte die Lebendigkeit eines Menschen manchmal bei einer Berührung, und auch in diesem Fall war es erstaunlich. Seine Haut schien fester, muskulöser und wärmer.
„Morgen.“
Das winzige Lächeln gefiel mir, und ich griff nach dem Handy auf dem Tisch, aus dem noch immer laut die Musik erklang. „Sie müssen das ausmachen! Das ist leider nicht erlaubt, auch wenn ich den Song mag!“
Ich musste sehr laut sprechen, um die Stimme von Bill Withers zu übertönen, und sofort griff Isaak nach dem Handy, um die Musik auszuschalten. Die Stille, die darauf folgte, war merkwürdig, und irgendwie schien der Raum abzukühlen – was natürlich absolut unmöglich war. Wie sehr Musik das eigene Empfinden verändern konnte, erstaunte mich immer wieder. Sie beeinflusste Gefühle, Gedanken, und selbst die gefühlte Temperatur eines Raumes. Eben noch war es fröhlich und warm gewesen, und Sekunden später hatte der Raum seine kühle, fast sterile Aura zurückerlangt.
„Entschuldigung. Mir war danach.“
Seine Stimme hatte noch nicht ihre volle Kraft zurückerlangt, aber zumindest schien es ihm nicht wehzutun. Dass man mit einer Verletzung wie seiner besser keine Monologe hielt, war mehr als einleuchtend. Trotzdem war Sprechen nicht schlecht, manchmal sogar hilfreich, da sonst die Muskeln und die Haut einfach nicht in angemessener Weise gedehnt wurden.
„Ist okay. Ich mag den Song auch.“
Ich lächelte erneut und erwartete fast, dass er mich danach fragen würde, aber er schwieg.
„Es scheint Ihnen besser zu gehen, das freut mich. Sie sehen jedenfalls fitter aus, und wenn Sie schon Musik hören können, dann geht es jetzt wohl aufwärts.“
Ich legte die Akte mit den Unterlagen auf den kleinen Tisch und fragte mich, wo die protzige Uhr geblieben war. Sie lag nicht mehr an ihrem Platz, und an seinem Handgelenk war sie auch nicht zu sehen.
„Ja, ich fühle mich etwas besser. Werden Sie den Verband abnehmen?“
Es klang hoffnungsvoll, und ich nickte leicht. Ja, ich würde den Verband abnehmen, und eine Schwester würde ihn erneuern.
„Ich denke schon. Aber wir müssen auf die Schwester warten, die wird einen neuen machen.“
Die Ablenkung durch die Musik, die mich in meinem Zeitplan durcheinandergebracht hatte, hatte mich an einem viel zu frühen Zeitpunkt in dieses Zimmer geführt. Geplant hatte ich es anders, nämlich erst in mehr als einer Stunde, aber auch damit würde ich umgehen können. Manchmal tat es gut, die Abläufe anzupassen und sich den Dingen zu widmen, die einem wichtig vorkamen. Isaak kam mir wichtig vor, warum auch immer, und was auch immer mich auf meiner Liste vor ihm erwartete, würde eben noch ein paar Minuten warten müssen.
„Keine Schwester. Ich möchte das nicht. Können Sie es nicht tun, und die Schwester erst später rufen?“
Konnte ich? Konnte ich mit ihm alleine den Verband abnehmen, ihm die nötige Zeit lassen, und die Schwester erst dann rufen? Ich verstand seinen Wunsch, hatte oft ähnliche Wünsche gehört und würde es vielleicht selbst so wollen. Jeder fremde Mensch würde es nur schwerer machen, und jedes weitere Paar Augen würde mehr schmerzen. Auch wenn er seine Verletzung nicht zum ersten Mal sehen würde, war unklar, wie sie sich entwickelt hatte. Er war hier nicht umsonst, wenn alles gut wäre, würde er nicht hier vor mir liegen. Wir konnten also beide davon ausgehen, dass das Ergebnis unter dem Verband nicht sonderlich erfreulich sein würde.
Ich sah auf die Uhr an meinem Handgelenk und überlegte, wie viel Zeit mir bleiben würde, bevor mein Zeitplan völlig aus dem Ruder lief.
„Ich denke, das ist möglich.“
Isaak setzte sich auf, und erst jetzt erkannte ich, wie groß er tatsächlich sein musste – sicher über 1,85 m, mindestens einen Kopf größer als ich. Liegend in den Betten wirkten alle Menschen gleich zerbrechlich und klein. Wenn sie nicht unter Kleinwuchs litten, waren sie alle irgendwie gleich groß, und manchmal erkannte ich sie kaum wieder, wenn sie aufrecht irgendwann über die Flure liefen.
„So schnell geht das nicht, ich muss erst noch Material holen.“
Auch wenn es so einfach klang, man konnte einen Verband nicht einfach so abnehmen. Man benötigte Handschuhe und Desinfektionsmittel, denn Bakterien waren immer der größte Feind. Eine weitere Infektion würde sicher die Abstoßung bedeuten, und das konnte man auf keinen Fall zulassen.
Ich ging aus dem Zimmer zurück auf den Flur, um meine Sachen zu holen, und schlagartig wurde mir klar, wie intim die kommende Situation werden würde. Wir beide würden diesen Moment erleben, gemeinsam und allein, und ich würde als einzige Person auf dieser Welt seine Reaktion miterleben. Bei allen, vielleicht ähnlichen Situationen dieser Art, die ich je erlebt hatte, waren immer noch andere Menschen im Raum gewesen – Schwestern oder Pfleger, aber nie war ich allein.
Manchmal hatten die Patienten geweint, manchmal verstört reagiert, und ich zweifelte sofort an mir selbst, ob ich in angemessener Weise auf seine Reaktion würde reagieren können. Mit solchen Dingen war ich nicht gut, es fiel mir schwer, mit starken Emotionen umzugehen und vor allem, irgendetwas Tröstendes zu sagen. Sicher gab es Floskeln, die man immer wieder benutzte, aber oft halfen sie einfach nicht.
Die Abstumpfung war dabei ein Problem – ich hatte einfach zu viel schon gesehen, und das auch noch zu oft. Für mich war es eine Wiederholung, einfach nichts Neues, aber für den Patienten war es immer das erste Mal. Für eine Ärztin war ich emphatisch, ich hatte noch mitgefühlt, aber ganz sicher entsprach es nicht den Erwartungen der Menschen da draußen.
*
Ich nahm auf der Kante des Bettes Platz, etwas, das man normalerweise nicht tat, und half ihm, sich gänzlich aufzusetzen. Außer dem Verbandmaterial und den Handschuhen hatte ich auch einen kleinen Handspiegel mitgebracht, denn ich wollte nicht, dass er aufstand. Soweit ich sehen konnte, waren alle anderen Verletzungen des Unfalls, wie das verletzte Bein, schon lange wieder intakt. Der Unfall selbst war mehr als drei Monate her. Man hatte damals wohl versucht, die Wunde in seinem Gesicht mit anderen Mitteln zu schließen, und hatte dann irgendwann eingesehen, dass es einfach nicht funktionierte.
Trotzdem war Aufstehen sicher keine gute Idee. Manch einem sackte bei dem erschreckenden Anblick der Kreislauf ab, und ich würde diesen großen Mann alleine wohl kaum halten können.
„Sind Sie bereit?“
Ich sah ihn aufmunternd an, und er nickte fast unmerklich, woraufhin ich begann, die Pflaster so vorsichtig wie möglich zu entfernen. Er selbst hatte die Augen geschlossen und schien sich zu konzentrieren, was mich irgendwie unter Druck setzte. Was auch immer sich jetzt unter diesem Verband befinden würde, es würde riesigen Einfluss auf sein Leben haben.
„Wer hat Sie vor mir behandelt?“
Ich hielt es für eine gute Idee, ein belangloses Gespräch zu beginnen, denn natürlich wusste ich, wer vor mir für ihn zuständig gewesen war. Die Rotation der Ärzte in diesem Krankenhaus war unaufhörlich, und ich vertrat aktuell den Kollegen, der Isaak in all der Zeit vor mir behandelt hatte.
Dr. Marteen, ein etwas kauziger und manchmal verschrobener Kollege, war in meinen Augen ein guter Arzt, und ich war mir sicher, dass er gute Vorarbeit geleistet hatte. Aber auch ihm stand Urlaub zu, und soweit ich wusste, befand er sich aktuell in einem Ferienhaus an der Ostsee. Es war seine Art, Abstand zu finden, abzuschalten, und ich verstand es nur zu gut. Auch ich hätte liebend gern einen solchen Zufluchtsort gehabt, aber als alleinstehende Person machte es nicht wirklich Sinn. Alleine an diesem Ort zu sein, würde meine Einsamkeit und mein Einsiedlertum nur verstärken, und die wenigen sozialen Kontakte vermutlich gänzlich zum Erliegen bringen.
„Dr. Marteen. Ist ein guter Arzt.“
Er nuschelte fast, weil ich zeitgleich an dem letzten Stück Pflasterband zog, und ich nickte einfach nur. Es gab nur zwei Arten von Patienten – die, die erkannten, was für ein guter Arzt er war, und die, die einfach etwas anderes erwarteten. Wer einen aufmerksamen Zuhörer erwartete, jemanden, der einem Märchen erzählte oder einem über das angeschlagene Gemüt strich, der war bei ihm an der falschen Stelle. Er brachte die Dinge auf den Punkt, scheute sich nicht vor der unangenehmen Wahrheit, und verhielt sich zu jeder Zeit hoch professionell, ohne dabei Emotionen zu zeigen.
„Sieht gar nicht mal so schlecht aus.“
Ich rückte ein Stück von ihm ab und ärgerte mich darüber, mich überhaupt zu dieser Aussage hinreißen lassen zu haben. Sicher sah es schlimm aus, alles andere als schön, aber der Heilungsprozess war einfach noch nicht abgeschlossen. „Gar nicht mal so schlecht“ führte zu einer Erwartungshaltung, und diese würde der Anblick auf keinen Fall erfüllen. Für mich, als Ärztin, sah die Wunde gut aus. Für jeden anderen war es eine scheußliche, vielleicht auch abstoßende Verletzung. Sie sah aus, als gehörte sie nicht zu ihm, als sei sie dort so fehl am Platz wie ein drittes Auge auf der Stirn, und war weit entfernt von „nicht so schlecht“.
Manche Menschen behaupteten ja, eine solche Verletzung sei nicht schlimm. Oder behaupteten, sie selbst würden sich durch eine solche nicht beeinflussen lassen. Das war allerdings in der Regel auch nur bei denen so, die nicht selbst betroffen waren. In dem Moment, wo sie mit Haut von ihrem Hintern oder Bein im Gesicht herumlaufen müssten, würde das allerdings anders aussehen. Der Prozentsatz der Leute, die von der ersten Sekunde an mit einer so gut sichtbaren Einschränkung im Gesicht gut klar kamen, war so verschwindend gering, dass er kaum erwähnt werden konnte.
„Wird es in Ordnung kommen?“
Er sah mir in die Augen, und ich sah Hoffnung und Schmerz. Ich suchte nach einer passenden Antwort. Was würde „in Ordnung“ sein? Ab wann konnte man davon sprechen?
„Ja, wird es. Es dauert noch ein bisschen, aber es scheint gut angenommen worden zu sein. Die Farbe stimmt noch nicht, aber das gibt sich mit der Zeit. Und auch die Schwellung wird weniger werden.“
Das Stück Haut, etwas größer als eine Briefmarke, war farblich natürlich nicht seiner Gesichtshaut entsprechend. Vermutlich hatten sie es an seinem Oberschenkel entnommen, denn an seinen Armen sah ich keine Narben. Irgendwann, wenn die Heilung abgeschlossen war und wenn die Durchblutung auch die letzte Zelle erreicht hatte, würde sich dieses Problem geben. Sicher würde man es immer noch sehen, aber weniger, und auch das Abschwellen würde helfen. Jetzt allerdings, sah das Stück aus, als hätte ihm jemand einen alten Kaugummi seitlich an das Kinn geklebt. Aber das konnte ich ihm ja nicht sagen.
„Kann ich es sehen?“
Ich griff nach dem Spiegel und reichte ihm diesen, aber er griff nicht danach. Auch diese Reaktion kannte ich nur zu gut. Man wollte es unbedingt sehen, aber der letzte Rest Selbstschutz verhinderte es dann. Man wollte sich an sein altes Ich erinnern und scheute sich vor dem Neuen.
„Es ist wirklich nicht so schlimm. Es mindert Sie nicht, und es wird Sie nicht beeinträchtigen.“
Tatsächlich glaubte ich meine Worte selbst, denn ich fand absolut nicht, dass es irgendetwas an seiner Ausstrahlung veränderte. Absurderweise fand ich es sogar ganz attraktiv, irgendwie besonders, und noch immer fand ich ihn als Mann durchaus ansprechend.
Je länger ich ihn ansah, die kleinen Details seines Gesichtes in mich aufnahm, desto mehr wurde mir klar, dass er tatsächlich noch immer ein gutaussehender Mann war. Wenn man das Gesicht im Ganzen betrachtete und nicht nur auf den fremden Fleck achtete, dann hatte er etwas Aristokratisches, fast Amerikanisches an sich. Er ähnelte den Männern in den Wallstreet-Filmen, denen, die immer Anzug tragen würden, und irgendwie unterstrich die Narbe diese Ausstrahlung. Ja, vielleicht würde es gerade die Narbe sein, die ihn am Ende den letzten Schliff gab. Zumindest für mich, denn ich fand manchmal solche kleinen Makel sehr anziehend. Eine Narbe auf der Stirn, Wange oder oberhalb der Lippe konnte anziehend wirken, und vielleicht würde das auch bei ihm in ein paar Jahren so sein. Dann, wenn er sein Selbstbewusstsein wiedergefunden hatte, und diesen Makel mit absoluter Selbstverständlichkeit trug.
Langsam hob er den Spiegel und ich sah die Veränderungen seiner Pupillen, obwohl sein Gesicht sich nicht veränderte. Sie weiteten sich, bis fast kein Braun mehr zu sehen war, und ich sah fasziniert zu, wie sie kurz darauf ihre normale Größe zurückerlangten.
„Ich bin ein Monster.“
Es klang wie eine Feststellung, und ich wollte augenblicklich protestieren, aber ich hielt mich zurück. Derartige Äußerungen gehörten nicht zu meinem Beruf und auch kein Urteil über seine Meinung. Monster war allerdings wirklich etwas anderes und die Narbe dagegen lächerlich klein. Aber in seiner Welt war das sichere anders, und deshalb stand es mir nicht zu, das für ihn zu entscheiden.
„Es handelt sich wirklich nicht um eine große Transplantation, und in einigen Jahren wird sie kaum mehr zu sehen sein.“
„Einige Jahre!?“
Wie sich das für ihn anhören musste, war mir schon klar. „Einige Jahre“ war ein sehr langer Zeitraum und hörte sich aktuell wohl unerreichbar an. Allerdings würde es tatsächlich einen so langen Zeitraum erfordern, und ich würde den Teufel tun und ihm etwas anderes versprechen. Das oberste aller Gebote war immer Ehrlichkeit. Lügen in meinem Beruf brachten überhaupt nichts und machten einfach alles schlimmer. Ich wollte auch niemals in die Situation kommen, dass ein Patient mich auf irgendeine Aussage festnagelte, und schon gar nicht auf solche Prognosen.
„Ja, es wird sehr lange dauern. Aber nehmen Sie sich als Ganzes wahr, nicht nur als diese Verletzung. Jetzt scheint sie Ihnen riesig vorzukommen, aber sie ist es nicht. Und sie ist nur ein kleiner Teil Ihres Gesichtes, und der Rest ist... wirklich unverschämt gutaussehend.“
Sofort lief mir die Röte ins Gesicht, und ich fragte mich, woher diese Worte gekommen waren. Ich hatte sie nicht mal gedacht, jedenfalls nicht, dass ich es bemerkt hätte, und schon waren sie aus meinem Mund gekommen.
Ich schämte mich wahnsinnig, wäre am liebsten sofort im Boden versunken, und trat mir innerlich selbst in den Hintern, weil ich nicht einfach auf die Schwester im Raum bestanden hatte. Sicher wäre mir das dann nicht passiert, und es wäre nicht so unfassbar peinlich geworden.