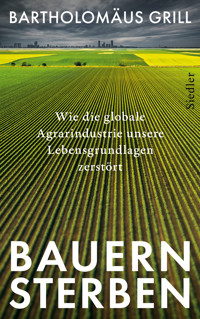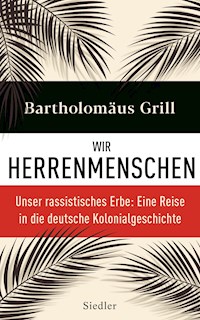15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sprachmächtig , ergreifend, außergewöhnlich
Der Bestsellerautor und preisgekrönte Reporter Bartholomäus Grill erzählt die Geschichte seiner Lebensreise mit dem Tod. Seine eindringlich geschilderten Begegnungen mit dem Sterben, vom frühen Tod der Schwester über das Lebensende der Eltern bis hin zum Massensterben in Afrika und dem Freitod des unheilbar kranken Bruders, machen »Um uns die Toten« zu einer ganz persönlichen und zugleich allgemeingültigen Auseinandersetzung mit dem Tod. Ein literarisches Sachbuch, das unter die Haut geht.
Bartholomäus Grill nimmt den Leser mit auf eine Reise, die von der bayerischen Heimat über Rumänien und Afrika nach Zürich und wieder zurück führt, eine Reise, die zu einem ergreifenden Memento mori wird. Die Erfahrungswelt beginnt im erzkatholischen Bayern, wo der Tod allgegenwärtig und faszinierend erscheint. Als Auslandskorrespondent begegnet ihm der Tod als Massenmörder, in Gestalt von Kriegen, Epidemien und Hungersnöten. Im Kontrast dazu steht das Sterben der Liebsten: der Tod der schwerstbehinderten Schwester, die kurz nach der Geburt stirbt, das einsame Ende des Vaters, der Freitod des Bruders und das erbarmungslose Sterben der Mutter.
Ein sprachgewaltiges Buch, das berührt und lange nachklingt. In dem Sich-vergewissern der eigenen Sterblichkeit, aber auch in der Freiheit, »nicht an den Tod denken zu müssen«, ist »Um uns die Toten« zugleich ein bewegendes und außergewöhnliches Buch über das Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
BARTHOLOMÄUS GRILL
UM UNS DIE TOTEN
Meine Begegnungen mit dem Sterben
Siedler
Die Abbildungen im Innenteil des Buches stammen aus dem Privatbesitz des Autors, mit Ausnahme von: Archiv Wolf-Christian von der Mülbe (1), Kurt Stüber/www.biolib.de (2), Rainer Unkel (3), Pascal Maître/Cosmos (4 u. 5). Die Rechteinhaber der Abbildungen (6) konnten trotz intensiver Recherche bis Redaktionsschluss nicht ermittelt werden. Der Verlag bittet Personen oder Institutionen, die die Rechte an diesen Abbildungen haben, sich zu melden.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2014 by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg, unter Verwendung eines Bildes von Carlos Gotay/Getty Images
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
Reproduktionen: Aigner, Berlin
ISBN 978-3-641-12402-1V002
www.siedler-verlag.de
Inhalt
Die Kappe auf dem Kopf des Kutschers
Durch Leid zur Herrlichkeit –Die Todeskultur auf dem Bergbauernhof
Und der Baum liegt, wie er fällt –Todeserfahrungen in der späten Kindheit
Wir Unsterblichen –Die Sturm- und Drogenjahre
Die Eiserne Jungfrau –An der Schwelle des Todes
Unter Geiern –Kriegsberichterstatter und die Faszination des Todes
Die Gräber sind noch nicht voll –Der Tod als Völkermörder in Ruanda
Der globalisierte Tod –Aids und die Rückkehr der vormodernen Krankheitserfahrung
Der Tod, ein Fest fürs Leben –Streifzüge im afrikanischen Ahnenreich
Der Schnitter im Weizen –Abschied vom Vater
Endstation Zürich –Die letzte Reise meines Bruders
Barbarei oder Barmherzigkeit? –Ein Streitgespräch über das Recht zu leben und zu sterben
Der Tod ist ein Mörder –Abschied von der Mutter
Die Gleichgültigkeit der Gestirne –Von der Freiheit, nicht an den Tod zu denken
Dank
Für Urban
Die Kappe auf dem Kopf des Kutschers
Es sei ein kalter, sonniger Februartag gewesen, Tante Afra erinnert sich noch genau. Mir fällt niemand ein, den ich sonst noch fragen könnte, und es leben auch nicht mehr viele, die eine Antwort wüssten. Ich habe den Tag ganz anders im Gedächtnis: grau und frostig. Ein scharfer Westwind wehte durch den Halmberger Hof, als der Leichenwagen von Kirchreit her kommend in die Durchfahrt zwischen Getreidestadel und Bauernhaus einbog, ein Gespann mit zwei kastanienbraunen Gäulen, auf dem Kutschbock saß ein Mann mit kantigem Gesicht. Kurz bevor das Gefährt vor der Haustür zum Stehen kam, riss eine Bö die Kappe von seinem Kopf. »Brrrrrrrr«, rief er den Pferden zu und fasste auf sein entblößtes Haupt. Der Leichenwagen stand still, und der Kutscher stieg ab, um die Kappe aufzuheben.
Ich stand unter dem Lederapfelbaum im Obstanger und verfolgte gebannt das Geschehen. Es war meine erste Begegnung mit dem Tod. Drei Tage vorher, am 8. Februar 1958, war der Großvater gestorben. Er hieß Bartholomäus, wie ich. Er lag aufgebahrt im Hausflur, trug seinen besten Anzug und rührte sich nicht mehr. Er ist jetzt bei den Engeln, erklärte die Großmutter. Die Toteneinsagerin, ein altes, dickes Weiblein, hatte die Nachricht in die Gemeinde getragen und zum Sterberosenkranz gebeten. Nun, am Morgen der Beerdigung, versammelten sich die Angehörigen, Verwandten und Nachbarn im Hausgang, um vom Halmberger Bartl Abschied zu nehmen. Die Trauernden trugen schwarze oder graue Gewänder, sie sahen aus wie die Rabenvögel, die draußen auf den kahlen Äckern herumhüpften. Sie sprachen gedämpft, raunten, flüsterten. Waren sich einig, dass er eigentlich einen schönen Tod gehabt habe, in Prutting, am Tag nach der Hochzeit seiner Nichte. Er sei Trauzeuge gewesen, erzählt seine Tochter, die Tante Afra, der Schlag habe ihn am nächsten Tag getroffen, unmittelbar nach der Sonntagsmesse.
Mein Vater aber tischte eine Version auf, die ich viel attraktiver fand: Großvater sei mitten im Hochzeitstanz niedergesunken und habe sich gleichsam hineingedreht ins ewige Leben. Vater berichtete auch von einem prophetischen Traum der Großmutter. Der Gatte sei ihr zwei Nächte nach seinem Tod erschienen und habe sie auf das Geld in der Innentasche seines Anzugs hingewiesen, zweihundert Mark. Am anderen Morgen sei die Großmutter an die Bahre im Hausgang getreten, habe das Jackett aufgeknöpft und die Scheine gefunden. Ich nehme an, dass mein Vater diesen Vorfall frei erfunden hat, er neigte zu Übertreibungen und Mythologisierungen. Seinerzeit aber nahm ich seine Geschichte für bare Münze. In meinen Augen war der wundersame Fund eine jener mysteriösen Begebenheiten, die sich beim Tod eines Menschen ereignen.
Ein Hauch des Übersinnlichen liegt auch über dem Testament des Großvaters, er hatte es, sein baldiges Ende offenbar ahnend, am 1. Februar handschriftlich verfasst, genau eine Woche vor dem Herzinfarkt. Überdies hat sich der Tod schon im Spätherbst 1957 angekündigt, am Tag der Beerdigung der alten Mare, seiner Tante, die nie geheiratet hatte und auf dem Hof von ihrem Leibgedinge zehrte. Als nämlich der Leichenwagen mit ihrem Sarg abfuhr, scheuten die Pferde, stemmten sich gegen die Deichsel und schoben das Fuhrwerk eine Radumdrehung zurück. Ein Nachbarbauer meinte, dies sei ein untrügliches Zeichen dafür, dass aus diesem Haus schon bald der Nächste heraussterben werde. Der Nächste war der Großvater.
Mehr weiß ich von seinem Heimgang nicht mehr. Der Platz am schmalen Bürotisch in der Stube war fortan leer, die Schreibmaschine, eine Mercedes Prima aus Zella-Mehlis, hatte zu klappern aufgehört. Die Zither blieb stumm, das Sachs-Motorrad unbewegt. Es sollte keine Spazierfahrt mehr geben, bei der ich vorne auf dem Benzintank sitzen durfte. Gegenüber dem Kachelofen hing ein Bild des Großvaters. Sein strenger, traurig anmutender Blick hat meine ganze Kindheit und Jugend begleitet.
Großvater Bartholomäus, gestorben am 8. Februar 1958
Die schwebende Kappe des Kutschers des Leichenwagens, ein gefrorener Augenblick, eine magische Sekunde – diese Szene bleibt in meinem Gedächtnis wie ein surrealistisches Gemälde von Giorgio de Chirico. Es war meine erste bewusste Anschauung des Todes. Sie sollte sich als dessen Urgestalt in meine kindliche Vorstellungswelt einschreiben.
Fast ein halbes Jahrhundert später, an einem Novembertag des Jahres 2004, trat eine neue Gestalt des Todes in das Bild, ein Mann in einem beinlangen, schwarzen Ledermantel. Er trug eine Sonnenbrille und stand just an der Stelle vor der Haustür, an der einst der Leichenwagen angehalten hatte, um den Sarg des Großvaters abzuholen. Es war ein warmer, bernsteingelb leuchtender Spätherbstmorgen. Der Mann schaute sich noch einmal um. Das Bauernhaus. Der Obstanger. Der Hühnerstall. Der Getreidespeicher. Der Taubenkobel. Das leere Storchennest auf dem Dachfirst. Der letzte Blick – ein Abschied für immer. Der Mann war Urban, mein unheilbar kranker Bruder. Er stieg an diesem Tag in ein Auto, das ihn nach Zürich brachte, zu den Sterbehelfern von Dignitas. Er hatte sich für den assistierten Freitod entschieden. Dreißig Stunden später sollte er nicht mehr unter uns sein.
Zwischen diesen beiden Ereignissen liegen all meine Begegnungen mit dem Tod, die ich in diesem Buch beschreibe. Es birgt, um falschen Erwartungen vorzubeugen, keine Abhandlung über das Altern und die Begleiterscheinungen des biologischen Verfalls. Auch Querverweise auf den Generationenkonflikt in einer modernen westlichen Gesellschaft, in der immer mehr Alte und immer weniger Junge um begrenzte Zukunftsressourcen konkurrieren, werden die Leser vergeblich suchen. Das Buch will auch kein Ratgeber zum Thema Sterben und Sterbehilfe sein. Es ist vielmehr der Versuch einer sehr subjektiv gefärbten Phänomenologie des Todes, ein Herantasten an die Gestalten, Figuren oder Personifikationen, in denen er mir erschienen ist, die sich in mein Bewusstsein gesenkt und mit kollektiven Repräsentationen vermengt haben, mit jener Vielfalt von Vorstellungen, Sinnbildern, Metaphern und Ideen vom Tode, die wir mit uns herumtragen. Aber es sind eben nur schattenhafte Abbilder des Todes – sein Wesen bleibt uns so verschlossen wie den gefesselten Menschen in Platons Höhlengleichnis, die ihre Sinneseindrücke für die Wirklichkeit halten.
Im Zentrum steht der Freitod meines Bruders Urban, sein langer Kampf gegen den Krebs, schließlich sein unwiderruflicher Entschluss, das Leiden und den endlos sich hinziehenden Prozess des Sterbens zu beenden. Er sprach von seiner letzten Freiheit, von der Freiheit des erlösenden Todes. Urban bat mich, seine Geschichte aufzuschreiben, um Menschen, die sich in einer ähnlich verzweifelten Lage befinden, einen Ausweg anzubieten. Nachdem er gegangen war, zögerte und zauderte ich ein ganzes Jahr, ehe ich den Text zu Papier brachte. In dieser Zeit, ich war gerade fünfzig Jahre alt geworden, begann meine bisweilen obsessive Beschäftigung mit dem Sterben und dem Tod – viel zu früh, sagten gleichaltrige Freunde, die im Spätsommer des Lebens noch nichts von den letzten Dingen wissen wollten. Den Fragen aber, die ich im Zusammenhang mit dem assistierten Suizid meines Bruders aufwarf, konnten sie sich nicht entziehen. Niemand kann sich ihnen entziehen, sie stellen sich zwangsläufig im Rahmen der großen ethischen Kontroversen in einer vergreisenden Gesellschaft. Wie gehen wir mit den Verheißungen einer Hochleistungsmedizin um, die die Herrschaft über den Tod an sich gerissen hat? Wie weit soll unsere Hilfe für Schwerstkranke gehen? Wer darf wann lebensverlängernde Geräte abschalten, die oft nichts anderes sind als Sterbeverlängerungsmaschinen? Über diese Fragen habe ich mit einem der bedeutendsten katholischen Moralphilosophen unserer Zeit gestritten, mit Robert Spaemann, einem entschiedenen Gegner jeder Form von Sterbehilfe. Im Kontext dieses Gesprächs schildere ich auch die Folgen, die das Niederschreiben und die Veröffentlichung der Geschichte meines Bruders hatten: die zahllosen Briefe und Hilferufe von Menschen, die ein ähnliches Schicksal durchlitten; den schamlosen Voyeurismus der Medien; den moralischen Druck auf die Familie; schließlich meine Weigerung, öffentlich über den assistierten Freitod zu sprechen. Mein Bruder sollte endlich Ruhe finden. Ich hatte mir eine Art benediktinisches Schweigen auferlegt.
In diesem Buch beende ich zehn Jahre des Schweigens und erzähle von meiner Auseinandersetzung mit dem Tod, die die existenzielle Erfahrung meines Bruders ausgelöst hatte. Sie beginnt mit dem Rückblick auf die alpenländische Totenkultur, die meine Kindheit geprägt hat, auf den Katholizismus und seine Erlösungslehre von der Auferstehung und dem ewigen Leben, auf das Mementomori, das ich in den frühen Jahren verinnerlicht habe, und auf die Ars moriendi, jene mittelalterliche Kunst des Sterbens, welche die Todesfurcht bannen soll. Die Auseinandersetzung endet mit dem Sterben meiner Mutter in der Trostlosigkeit einer Intensivstation, als ich den Tod stärker denn je als ruchlosen Mörder empfand.
Der Tod hat tausend Gesichter, und ich habe in viele geschaut, das brachte mein Beruf als Auslandskorrespondent mit sich. Die ersten Einsätze in den achtziger Jahren führten mich nach Osteuropa, nach Polen, wo Geheimagenten der wankenden Jaruzelski-Diktatur regimekritische Priester entführten und umbrachten. Dann, Weihnachten 1989, nach Rumänien, als der Despot Nicolae Ceauçescu gestürzt und hingerichtet wurde und mir beim Anblick vermeintlicher Folteropfer des Geheimdienstes Securitate der Tod erstmals als furchtbarer Menschenschinder erschien. Drei Jahre später wurde ich von der ZEIT nach Afrika entsandt. Seither habe ich regelmäßig über Kriege, Staatsstreiche, Hungersnöte, Seuchen und Katastrophen berichtet. Den ersten Aids-Toten sah ich in einem Fischerdörfchen am Victoriasee in Uganda, ich ahnte damals nicht, dass mich diese Pandemie von schier unvorstellbaren Ausmaßen in zahlreichen Reportagen immer wieder beschäftigen würde. Kein Ereignis hat mich indes so erschüttert wie der Genozid und dessen Nachwehen in Ruanda. Ich stand vor Leichenbergen, ich sah, wie Hunderte von toten Körpern auf Lastwagen verladen und in Gruben gekippt wurden, ich sprach mit Opfern, deren Angehörige bestialisch abgeschlachtet wurden, und mit Tätern, die wenig Reue zeigten oder ihre Verbrechen leugneten. Ich erlebte die Unfasslichkeit des anonymen Massentodes und empfand jenen Abscheu vor der Barbarei, jenen abgrundtiefen Zweifel an der Menschlichkeit, der uns beim Begehen nationalsozialistischer Konzentrationslager überwältigt: Das Grauen! Das Grauen! Der Tod, ein Völkermörder. Mein Auschwitz lag im Herzen Afrikas, und ich wurde dort auch mit einem persönlichen Versagen konfrontiert, das mich bis heute aufwühlt: Ich habe einen kleinen Jungen, den ich womöglich hätte retten können, in seiner ausweglosen Lage alleingelassen.
Oft ist mir der Tod in Afrika aber auch auf ganz andere Art und Weise begegnet. Zum Beispiel in Ghana bei der grandiosen Trauerfeier für den verstorbenen König der Asanti. Oder in Mali beim Tanz der Masken, die in der Kultur der Dogon die Seele eines Toten aus dem irdischen Dasein hinüber in das Zwischenreich der Ahnen begleiten. Oder in Benin bei Voodoo-Beschwörungen und dem Treiben der revenants, der Wiedergänger aus dem Jenseits. Es waren kollektive Rituale, um die dem Menschen innewohnende Angst vor dem Ende zu lindern. Bei solchen Anlässen erschien mir der Tod als Fest fürs Leben.
*
Que philosopher c’est apprendre à mourir – Philosophieren heißt sterben lernen. Ich habe Philosophie studiert und sie nach dieser Maxime von Michel de Montaigne erschlossen: im Ringen mit letzten Fragen, deren Beantwortung je nach Lebensalter höchst unterschiedlich ausfiel. In meiner Sturm-und-Drang-Zeit habe ich den Tod verachtet, er war ein bedeutungsloser Narr, ein Gesell für Glasperlenspiele in der immerwährenden, unzerstörbaren Jugend. Ich fürchtete ihn so wenig, wie ihn meine Helden der Weltrevolution gefürchtet hatten. Ich übte mich im Existenzialismus eines Jean-Paul Sartre und praktizierte spätpubertäre Todesverspottungsrituale. Je älter man wird, desto näher kommen die Einschläge. Man stellt sich die Frage nach der Endlichkeit des Lebens und der Vergeblichkeit allen Strebens neu, man thematisiert das Sterben viel ernsthafter, zumeist auch behutsamer und ängstlicher, man lernt das bisschen Leben, das man hat, als zerbrechliche Kostbarkeit zu schätzen. Und einige Grundwerte des Christentums, aber auch die fundamentalen Zweifel an dessen Dogmen leuchten wieder auf. Wir müssen im Gegensatz zum Tier mit dem ständigen Bewusstsein unserer Sterblichkeit leben – ohne zu wissen, wann uns die Stunde schlägt. In diesem Bewusstsein, das bis ins 20. Jahrhundert hinein Kindern, Geisteskranken und sogenannten Primitiven abgesprochen wurde, erkennen wir den innersten Kern unserer Menschlichkeit. Weil wir es nicht abschalten können, haben wir uns ein gewaltiges Arsenal von Verdrängungsinstrumenten zugelegt. Wir weigern uns, an das Ende zu denken. Wir tabuisieren den Tod und sperren ihn im Vorbewussten ein, damit er uns im Alltag nicht belästige. Wir versuchen, das Leben so zu leben, dass wir uns im Angesicht des Todes sagen können, es in vollen Zügen genossen zu haben. Wir trösten uns, sofern wir gläubig sind, mit den Versprechen der Wiedergeburt und des ewigen Lebens. Oder wir lassen uns von den Weisheiten der Philosophen beruhigen. »Wie wir in das Leben hineingelockt werden durch den ganz illusorischen Trieb zur Wollust; so werden wir darin festgehalten durch die gewiß eben so illusorische Furcht vor dem Tode«, lehrt Arthur Schopenhauer in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung. Doch es hilft alles nichts: Die Fuga mortis, die Scheu vor dem Tode, ist stärker. Natürlich kann ich nicht behaupten, frei von dieser Scheu zu sein, niemand ist das. Durch meine Begegnungen mit dem Tod konnte ich sie zeitweise abmildern, aber sie kehrte stets mit umso größerer Macht zurück, und ich sah den Mann auf mich zumähen, den Vincent van Gogh in seinem Gemälde Le moissonneur verewigt hat. Das Bild zeigt einen Schnitter unter grüngelbem Himmel, der mit einer Sichel Getreide schneidet. In dieser Allegorie kommt der Tod an einem glutheißen Sommertag, im flimmernden Goldlicht, und stößt mitten hinein in die Wirrsal des Lebens. Wir können ihm nicht entfliehen, er begleitet uns wie unser Schatten, unser Spiegelbild, unser Herzschlag. Er ist der Bruder des fühllosen Schlafes.
*
In allen Zeitaltern und Kulturen wurde der Tod unterschiedlich wahrgenommen, man kann das nachlesen in der Geschichte des Todes von Philippe Ariès. Dieses monumentale Werk liefert einen gedanklichen Leitfaden, der von der Antike in die Gegenwart führt. Der französische Poststrukturalist beschreibt, wie sich unsere Seelenlandschaften, Sterberituale, Trauersitten, Todesbilder und Jenseitsvorstellungen gewandelt haben, wie die Moderne den Tod aus dem Alltagsleben eliminiert hat, wie er schließlich privatisiert und von der Medizin vereinnahmt wurde und sich im Lauf des 20. Jahrhunderts ein dumpfes Schweigen über ihn gebreitet hat. Der Mensch tue so, als gäbe es den Skandal des Todes gar nicht, und bringe »die Umgebung der Sterbenden und der Toten mitleidslos zum Verstummen«.
Doch seltsam: Am Beginn des 21. Jahrhunderts scheint das kulturelle Unbehagen an der »Inversion des Todes« zuzunehmen; je mehr wir ihn verdrängen, je mehr wir die Trauer pathologisieren, desto stärker verspüren wir offenbar den Wunsch, uns mit allerletzten Fragen zu beschäftigen. Dieses Paradoxon bestätigt eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Sommer 2012: 57 Prozent der Befragten erklärten, unsere Gesellschaft befasse sich zu wenig mit Sterben und Tod. Der Bundestag debattiert über Sterbehilfe, Palliativmedizin und Patientenverfügungen, Fernsehanstalten traktieren uns mit Talkshows und Themenabenden, auf den Bestsellerlisten stehen Bücher wie Gian Domenico Borasios Über das Sterben, Untertitel: Was wir wissen. Was wir tun können. Wie wir uns darauf einstellen. Gevatter Tod hat Konjunktur.
Letztlich spiegelt auch das vorliegende Buch das kollektive Bedürfnis, den verdrängten, verbannten und scheinbar gezähmten Tod wieder näher ans wirkliche Leben heranzuholen. Weil es aus einer sehr persönlichen Perspektive geschrieben ist, nimmt es in weiten Teilen autobiographische Züge an. Aus Respekt vor den Toten habe ich allerdings viele Namen geändert oder nur Initialen verwendet. Peter Weiss, der in seinem 1961 erschienenen Frühwerk Abschied von den Eltern eine bittere Abrechnung hinterlassen hat, nannte das Schreiben den Versuch, »mit all unseren Toten in uns, mit unserer Totenklage, unseren eigenen Tod vor Augen, zwischen den Lebenden dahin zu balancieren«. Kein Satz könnte meine Beweggründe trefflicher ausdrücken.
Durch Leid zur Herrlichkeit Die Todeskultur auf dem Bergbauernhof
»Opa, noch eine Geschichte vom Weltkrieg!« – »Na gut, alter Müdsack«, brummte der Großvater und erzählte. Von Sewastopol. Von den hinterhältigen russischen Partisanen. Von der Malaria, die er sich auf der Halbinsel Krim geholt hatte. Und natürlich von seinem tollkühnsten Einsatz. Eines Abends war seinem Bataillon das Wasser ausgegangen. In der Dämmerung musste er gemeinsam mit seinem besten Kameraden, dem Schorsch aus Hochstätt, zu einer Quelle unterhalb des Schützengrabens robben, um vier Blechkanister aufzufüllen. Mit der schwappenden Last auf dem Buckel krochen sie wieder zurück – und wurden vom Feind unter Feuer genommen. Als sie das rettende Ziel erreichten, sprudelte aus einem kugeldurchsiebten Kanister das Wasser. Die Gottesmutter Maria hatte die beiden Bauernsöhne beschützt.
An diesem Augustabend wollte ich die Heldengeschichte unbedingt ein zweites Mal hören. Draußen war es schwül, ich konnte partout nicht einschlafen und krähte von meiner Liege in der Ecke des Schlafzimmers immer wieder zum Doppelbett der Großeltern hinüber: »Opa, noch mal erzählen!« Ich bohrte so lange nach, bis der Großvater die Geduld verlor und mit Stentorstimme in die Dunkelheit hineinknurrte. »Jetz’ wenns d’ koa Ruah gibst und ned glei schlafst, dann kimm i da amoi, wenn i nimma leb!«
Dann kimm i da amoi, wenn i nimma leb! – Dann komme ich dir einmal, wenn ich nicht mehr lebe! Ich fiel augenblicklich in bleierne Angststarre und begann zu schreien wie ein Jochgeier. »Naaa, Opa! Naaa!« Es war die gruseligste Vorstellung, die ich mir in meinem Bubenhirn ausmalen konnte: Der geliebte Großvater stirbt und kehrt aus dem Reich der Toten zurück. Er steigt aus dem Grab, schwebt vom Friedhof in Oberaudorf herauf zum Bergbauernhof, fährt durch den Kamin ins Haus und sucht mich heim. Die folgende Nacht war voller Schrecken, ich träumte von der Epiphanie des Verstorbenen. Seine zaundürre, bleiche Gestalt stand neben meiner Bettstatt, aus der Finsternis leuchteten die gelben Augen der Partisanen, und drunten, in der Futterküche zwischen Hausgang und Stall, wütete der Tod: ein Hüne in Lumpenkleidern mit greifartigen Langfingern und einem von der Lepra zerfressenen Schädel. Er schwang einen Rübenschneider, keckerte diabolisch und brachte Rella tiefe Fleischwunden bei. Rella war eines unserer Zugpferde, ein Haflinger, Inbegriff der Stärke und des unverwüstlichen Lebens auf dem Hof. So stellte ich mir den Tod vor, und so schrieb er sich in mein kindliches Gedächtnis ein: als Pferdeschlächter, als ruchloser Folterer und Mörder.
Dann der erlösende Morgen nach dem Pavor nocturnus. Die goldenen Garben des Sonnenlichts fielen durch die Blumengalerie auf dem Balkon in meine Schlafecke, ich hörte den Gockel krähen und den Brunnen vor dem Obstkeller murmeln. Von der Remise wehte der blecherne Klang des Sensendengelns herüber. Die Großmutter stapfte mit schwerem Tritt die Holztreppe herauf – das vertraute Morgenritual. Beim Eintritt in die Kammer stimmte sie das Wecklied an.
Auf beim SpundDie Welt geht z’grundNimmer lang lebenSterbens gehn
So begann der Tag auf dem Bergbauernhof. Und wenn er endete, hatte ich wieder ein Stück Weges hin zur letzten Stunde zurückgelegt.
*
Meine Kindheit war umstellt von Sinnbildern des Todes, von gemarterten Heiligen, Reliquienschreinen, Votivtafeln, Kreuzwegen, Feldmarterln, Madonnengrotten, Lüftlmalereien und Wachsstöckeln. Allerwegen sah der leidende Herr Jesus von den Kruzifixen auf mich herab. Sie hingen im efeuumrankten Herrgottswinkel der Stube, in der Küche über dem Esstisch, in den Schlafräumen, im Kuhstall und in der Wagnerwerkstatt meines Onkels, sie standen an Feldrainen, Weggabelungen, Dorfplätzen, Aussichtspunkten und auf sämtlichen Berggipfeln ringsum. Ich wuchs in eine Welt hinein, in der das Memento mori allgegenwärtig war, die bildmächtige Erinnerung an unsere Endlichkeit.
Das Mittagsmahl und das Nachtessen durften nur nach einem Tischgebet beginnen, allerdings wurde es meist nur schlampig heruntergeleiert – aufgesagt war aufgesagt. Kein Brotlaib durfte angeschnitten werden, ehe die Großmutter ein Kreuzzeichen auf die Unterseite geschlagen hatte. Der Jahreskreis wurde durch die kirchlichen Feiertage und bäuerlichen Brauchtümer gegliedert, durch Dreikönig, Mariä Lichtmess, Aschermittwoch, Josefi, Palmsonntag und Karfreitag, durch die österliche Auferstehung, Christi Himmelfahrt und die Maiandachten, durch Pfingsten, Fronleichnam, Johanni, Kirchweih, Erntedank, Allerheiligen, Martini, Nikolaus, Weihnachten und Stefani, schließlich durch Silvester und die Neujahrsmesse.
Karfreitag war der dunkelste und geheimnisvollste Feiertag im Kirchenjahr, er lag schwer auf meinem Gemüt. Man konnte am Todestag des Herrn fatale Verfehlungen begehen, etwa indem man gedankenverloren ein Wurstrad oder eine Speckscheibe aß. Fleischgenuss vor der Auferstehung des Fleisches, das war eine schwere Sünde, und man musste damit rechnen, noch vor der Osternacht vom Gottseibeiuns bestraft zu werden. Das drohte jedenfalls Großmutter Therese an, die den Karfreitag mit höchster Inbrunst und geradezu inquisitorischer Sorgfalt beging. Trotz aller Unwägbarkeiten freute ich mich auf diesen Tag, denn er bot das spektakulärste Mysterienspiel des Kirchenjahres. Die hohen Spitzbogenfenster in der alten Heilig-Kreuz-Kirche zu Kiefersfelden waren abgedunkelt, ich sah zunächst nur Schemen, wenn ich aus der Frühlingssonne ins Kirchenschiff trat. Sobald sich die Augen an das Zwielicht gewöhnt hatten, erblickte ich in der Apsis das Heilige Grab. Über dem Altartisch lag der wachsbleiche Christus in einer Tuffgrotte, an den in die Tiefe des Raumes sich verjüngenden Altarbögen hingen sogenannte Schusterkugeln, mit gefärbtem Wasser gefüllte Glaskugeln, hundertfünfundzwanzig an der Zahl. Ich nahm sie als dünne Scheiben wahr, die im Wärmestrom der Kerzen zitterten und in den herrlichsten Farben schillerten, blutrot, lila, tiefblau und golden. Vor dem Grab hielt ein Pappkamerad Wache, ein römischer Legionär mit Schild und Speer. Unendliche Stille herrschte in der Kirche, die schwarz gekleideten, betenden Frauen, die lautlos ihre Lippen bewegten, wirkten wie Komparsen in einem Stummfilm. Die theatralische Inszenierung eines Glaubensgeheimnisses war einschüchternd, zugleich löste sie höchstes Entzücken aus. Mir war, als hätte sich der Tod aller Tode materialisiert, als schaute ich sein Urbild an. Wobei ich mich nicht gewundert hätte, wenn die Gipsfigur in der Grotte sich plötzlich erhoben hätte und durch die Kirche gewandelt wäre.
Das bunte Trauerschauspiel schenkte mir jedes Mal die Gewissheit, dass man das Ende seiner Tage nicht fürchten muss: Jesus hat für uns den Tod besiegt, das war die Kernbotschaft des Christentums, eine Lebensversicherung ohne Ablaufdatum. Die zusätzlichen Erläuterungen meiner Großmutter waren ebenfalls recht einleuchtend. Sobald die Seele aus dem Körper entweiche, würden Engel und Teufel um ihren Besitz ringen, erzählte sie. Wenn aus diesem Kampf kein Sieger hervorgehe, lande die Seele zunächst im Fegefeuer; von dort aus aber könne sie bei guter Führung und durch die Fürbitten der Lebenden immer noch in den Himmel kommen. »Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?«, verkündigte der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther. Ich zog aus der Sterbelehre den einfachen Schluss: Du kannst jederzeit von den Toten auferstehen – vorausgesetzt, du bist ein guter Katholik.
Ich war kein guter Katholik mehr, als ich anderthalb Jahrzehnte später, in meiner Sturm- und Drogenzeit, die alte Kirche zusammen mit einem Studienfreund besuchte, der seinerseits eine erzkatholische Sozialisation hinter sich hatte. Es war ein trüber Karfreitag, schwerer, nasser Schnee ging auf Kiefersfelden nieder. Ein paar Stunden vorher hatten wir einen LSD-Trip eingeworfen, Purple Haze, purpurner Dunst. Das schien uns dem Anlass angemessen. Wir schlichen in die Kirche und knieten uns in die letzte Reihe des Gestühls. Und sogleich befand ich mich auf einer Zeitreise zurück in die Kindheit und versank im Zauber der schillernden Schusterkugeln. Die Farben zitterten, schwammen, explodierten, lösten sich auf und flossen wieder zusammen, die betenden Frauen in ihren schwarzen Gewändern wirkten wie Klageweiber aus einem vergangenen Jahrhundert, und vorne lag der gipserne Jesus in seiner Tuffgrotte, schön wie ein schlafender Adonis. Zwischendurch war es, als würde er sein müdes Haupt zu uns drehen und vorzeitig vom Tode auferstehen. Was ich da sah, war mir unheimlich, und dennoch empfand ich keine Furcht. Nur die Möglichkeit, dass die Großmutter anwesend sein und uns entdecken könnte, versetzte mich in innere Unruhe. Und in gewisser Weise kam ich mir auch gotteslästerlich vor: Wir waren nur der ästhetischen Sensation wegen gekommen, das Glaubensmysterium selbst war uns ziemlich egal.
*
In den Kindertagen fühlte ich mich eingebettet in die präformierte Schöpfungsordnung. Den Himmel, in den ich nach dem Tod ganz bestimmt auffahren würde, stellte ich mir so ähnlich wie einen zünftigen Heimatabend vor. Man frohlockt unter lustigen Leuten, Zithern und Harfen erklingen, die Engel schuhplatteln, und der steinalte Mann mit dem Rübezahlbart verfolgt das Treiben mit Wohlgefallen im Kreise der Heiligen. Dort oben würde ich im kindlichen Bewusstsein meiner selbst fortexistieren und auf den Bergbauernhof hinunterschauen, der wie ein stolzes Schiff durch den Ozean der Zeit pflügt, unveränderlich, bis in alle Ewigkeit.
Auf dem fichtenhölzernen Blockbau ruht ein Satteldach mit fünf Pfetten, einundzwanzig Grad geneigt, klassisch streng, wie ein Artemistempel. Es kragt weit aus, um das Gebäude vor den Unbilden des Bergwetters zu schützen. Um das Obergeschoss läuft eine Laube mit feingliedrigen Balustern aus Tannenholz, das Giebeldreieck des Dachbodens mit dem Kruzifix ziert ein weiterer Balkon, den die sogenannten Katzenlauben einrahmen. Von der Brüstung wallt im Sommer die zinnoberrote, violette oder rosafarbene Geranienpracht. Die rätselhaften Zeichen an den Balkenzapfen neben der unteren Laubentür – Kreuz, Herz, Torbogen, Kirche, Breitbeil – sind die Signaturen der Zimmermänner, die den Urhof im 17. Jahrhundert gebaut hatten, irgendwann nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges.
Dieses Anwesen war meine Schutz- und Trutzburg, es konnte aber auch ein Hort der Ängste, des Unerklärlichen, des Übernatürlichen sein. Die Gute Kammer, das prächtigste Zimmer direkt über der Stube, in dem früher die Toten aufgebahrt wurden, habe ich, wenn überhaupt, nur mit Schaudern betreten. Weil darin die kalte Heiligkeit wohnte, Sankt Martin, der edle Samariter, und Sankt Georg, der Drachentöter. Sie waren zwar nur auf die Türflügel eines barocken Bauernkastens gemalt, aber ich bildete mir jedes Mal ein, dass sich ihre Augen bewegen. Auf dem zweiten Schrank blutete das von einem Stilett durchbohrte Herz Jesu, und auf der Stirntafel der Bettstatt versank der kleingläubige Petrus in den Fluten des Sees Genezareth. »Wer hier schläft, sündigt nicht und fällt nicht vom richtigen Glauben ab«, sagte die Oma.
Der richtige Glauben brachte aber auch die bösen Geister hervor, ja er brauchte die gefallenen Engel, die Dämonen der Versuchung, den Satan und den rächenden Tod, um überhaupt der richtige zu sein und jenes vielköpfige Pantheon von Heiligen zu schaffen, die einem gegen die Mächte der Finsternis beistanden. Sankt Florian schützte vor dem roten Hahn; den heiligen Antonius rief ich an, wenn etwas verloren gegangen war; der Segen des heiligen Blasius, das »Einblaseln« mit zwei überkreuzten Kerzen, bewahrte mich vor Halsschmerzen, Lungensucht und dem Verschlucken von Fischgräten. Am Aschermittwoch zeichnete der Geistliche ein Rußkreuz auf meine Stirn und sprach dazu: »Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zu Staub zurückkehren wirst.« An Ostern streuten wir geweihte Eierschalen an den Ecken der Äcker aus, damit die junge Saat gedeihe, und wenn im Hochsommer ein schweres Gewitter heraufdräute, wurde die pechschwarze Wetterkerze angezündet. Der Herr Pfarrer segnete die Kühe und Pferde und bei der Fahrzeugweihe sogar den Bulldog, einen hellblauen Eicher Tiger. Jede Form von Traurigkeit oder Verzagtheit verscheuchten die Trösterlein, grazile Paradiesgärtchen in gläserner Umwandung, in denen das Fatschenkindl lag, das fröhliche Jesulein.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen mussten in den Raunächten zwischen dem 21. Dezember und Dreikönig getroffen werden. Raunächte sind in der heidnischen Tradition Losnächte, sie entscheiden über Segen und Fluch im kommenden Jahr. Sie fallen in die gefährlichste Winterzeit, wenn die Tage kurz sind und der blutige Thomas die Kinder mit dem Hammer bedroht, wenn die Perchten ums Haus fauchen und die Wilde Jagd durch die Winternebel braust. In dieser Zeit wurde ein Abwehrzauber praktiziert, der seit Menschengedenken gleich abläuft: das Ausräuchern. Wir zogen am Heiligen Abend und an Silvester durch Haus und Hof, vorneweg der Großvater mit einer Kehrschaufel voller glühender Kohle, in der Weihrauch und Myrrhe verglommen, hinterdrein die Großmutter mit dem Rosenkranz, dazwischen die Familienmitglieder. Ich durfte den Kupferkessel tragen und mit einem Buchszweiglein Weihwasser sprenkeln. So gingen wir durch das Anwesen, durch sämtliche Wohnräume, hinaus in den Stall, um das Hofgebäude herum – jeder Winkel musste gegen das Böse immunisiert werden. Die Großmutter leierte beim Rundgang die Fürbitten herunter: »Treib aus die bösen Geister, o Herr, bewahre dieses Haus …« Der Exorzismus half immer gegen alles, Zahnweh inklusive.
Viele Jahre später, wenn ich irgendwo in Afrika einem Ritual beiwohnte oder Fetischpriestern, Medizinmännern und Wunderheilern begegnete, habe ich an diese heidnischen Brauchtümer des Alpenlandes gedacht. Die traditionellen Naturreligionen verfügen über eine Vielzahl von Abwehrmitteln gegen Hexen, Teufel, Krankheiten, gegen Seuchen, Dürren und all die biblischen Plagen. Und der weitverbreitete Aberglaube unterscheidet sich nicht von dem, der meine Kindheit begleitete.
*
Wildgrub. Rechenau. Ramsau. Laiming. Windhag. Trojer. Die Kirchlein und Kapellen ringsum empfand ich wie Planeten, die um mein Sonnensystem kreisten. Das Zentralgestirn war die Pfarrkirche Zu Unserer Lieben Frau in Oberaudorf, ein prunkvolles Gotteshaus, ursprünglich eine romanische Holzbasilika, die in der Spätgotik durch einen doppelschiffigen Bau ersetzt und im 17. Jahrhundert barockisiert wurde. In dieser Kirche wurde ich 1954 getauft, auf dem Friedhof, mit Blick auf den Brünnstein, befindet sich das Familiengrab der mütterlichen Linie. Über dem rechten Seiteneingang steht eine Statue, für deren Vergoldung der Großvater großzügig gespendet hat. Sie stellt den Bruder Konrad dar, den arbeitsscheuen Bauernsohn, der als Mönch zu einer Leitfigur der Caritas wurde. Neben dem Portal gegenüber hängt eine Votivtafel: »Zum Andenken an jene Krieger aus dem Vikariate Oberaudorf, welche in den Jahren 1812–1813 im fernen Rußlande ein Opfer der Schlachten und der Elemente wurden. Requiescat in pace.« Einer der namentlich genannten Krieger, die in Napoleons glorreicher Armee dienten und vermutlich in der Schlacht von Borodino kurz vor Moskau fielen oder beim Marsch durch Eis und Kälte elendiglich erfroren, war mein Vorfahr Paulus Kloo. Neben der Tafel befindet sich eine Inschrift, die eines weiteren Verwandten gedenkt: Simon Kloo, Soldat des Königlich Bairischen Infanterie-Regiments, gestorben im Franzosenkrieg am 9. September 1870 im Spital zu Lützelstein im Elsass, dem heutigen La Petite-Pierre.
Die Toten waren jeden Sonntag unter uns. Nach dem Hochamt zog es mich oft zu den Seitenaltären, dort konnte man in ihr Reich schauen. Rechter Hand, unter einem Bildnis Johannes des Täufers, lagen die Überreste von Sankt Innocenci, ein derangiertes Skelett, dessen Schädel zur Seite gekippt war. Viel mehr beeindruckte mich der Reliquienschrein im Sockel des linken Seitenaltars unter dem Wandgemälde, das den heiligen Antonius darstellte. Hinter den Glasscheiben eines Schreins ruhte Sankt Donatus, ein christlicher Heerführer der 12. Römischen Legion, dessen Truppe im 2. Jahrhundert bei einer Schlacht gegen die Markomannen eingekesselt und durch ein Wetterwunder gerettet wurde; Blitze zerstörten das Lager des Feindes. Donatus, »der Geschenkte«, gelobte zum Dank für seine Errettung die Ehelosigkeit. Als ihn Kaiser Marc Aurel in seine Leibgarde berief und er dessen Enkelin heiraten sollte, weigerte sich Donatus und wurde wegen Götterverachtung hingerichtet.
Ich fragte mich, wie die Gebeine des Märtyrers von Rom nach Oberaudorf gekommen waren, ausgerechnet zu uns, in das kleine Bergdorf. Die Wege von heiligen Dingen sind jedoch so unergründlich wie die Ratschlüsse des Herrn. Vermutlich schaffte der heilige Donatus den Sprung über die Alpen im Zuge des schwunghaften Reliquienhandels, der nach dem Konzil von Nicäa im Jahre 787 einsetzte: Die Kirchenfürsten hatten beschlossen, dass jedes Gotteshaus mit einer Reliquie ausgestattet sein müsse. Und so wurden die Leichname der Heiligen zerstückelt und die Gebeine, Knochensplitter oder Hautfetzen bis in die entferntesten Winkel der Christenheit geliefert. Besonders nachgefragt waren die echten oder gefälschten Körper- und Kontaktreliquien von Jesus Christus, Zähne, Fingernägel, Zehennägel, Haare, Kreuzsplitter, das Schweißtuch, das ihm die heilige Veronika dargereicht hatte, selbst die Nabelschnur und die Vorhaut des nach jüdischem Ritus beschnittenen Erlösers gehörten zum Sortiment.
Ubi est aliquid ibi totum est – Wo ein Teil ist, ist das Ganze, heißt es in der Reliquienlehre des Bischofs Victricius von Rouen: Jedes Teil entbirgt die »Realpräsenz«, die wirkliche Anwesenheit des Gottessohnes und der Heiligen. Die sterblichen Überreste sakrosankter Personen werden angebetet, besprenkelt, benetzt, berührt, geküsst, um ihre magische Heilsenergie aufzunehmen. Die Reliquienverehrung wird auch im Buddhismus, Shintoismus und schiitischen Islam gepflegt, ist aber in keinem Glauben so stark ausgeprägt wie im Christentum. Religionsfeinde spotten gern über die in diesem Kult ausgelebte Nekrophilie, über die sexuell besetzte Lust an Leichen und leblosen Dingen; Reliquien widern sie an. Selbst als Katholik kann einem flau im Magen werden, wenn man die Zunge des heiligen Antonius im Dom zu Padua betrachtet. Oder die silberne Urne in der Gnadenkapelle von Altötting, in der das einbalsamierte Herz des Märchenkönigs Ludwig II. vor sich hin schrumpft. Oder die Kristallampulle mit dem braunen Brei in der Krypta des Doms zu Amalfi. Nach kirchenamtlicher Definition handelt es sich um Manna, Himmelsbrot, das sich aus den Dünsten über dem Grab des heiligen Andreas kondensiert hat. Die Gläubigen aber halten es für das Blut des Apostels, das an seinem Namenstag infolge ekstatischer Gebete zu einer hellroten Flüssigkeit aufklaren soll.
Die Oberaudorfer Pfarrkirche hatte zwar kein Blutwunder zu bieten, immerhin aber das Gerippe des heiligen Donatus, das den Tod in prachtvoller Weise vergegenständlichte. Es war in ein mit Goldfäden durchwirktes und mit Perlengestecken verziertes Gewand aus Brokat und Seide gehüllt. Den Schädel zierte ein kronenartiges Gepränge mit smaragdgrünen Steinen, aus den Augen funkelten saphirblaue Kristalle, in der Nasenhöhle steckte ein rubinroter Klunker. Der Unterkiefer war mit einer Goldborte hochgebunden. So sah also das Leben in jenseitiger Herrlichkeit aus. Ziemlich eintönig, dachte ich, ein keinesfalls erstrebenswerter Zustand. Und die Geschichte, dass Heilige nicht verwesen und ihr Blut bis in alle Ewigkeit frisch bleibt, die stimmte auch nicht.
*
Der innerste Planet meines Sonnensystems lag oberhalb unseres Bergbauernhofes, versteckt in einem felsigen, dicht bewaldeten Höhenkamm: die Hauskapelle mit den vierzehn auf Holz gemalten Bildern. Ein Kreuzweg aus der Barockzeit, den ich von klein auf bestaunte, denn keiner war so martialisch wie dieser. Die Peiniger Christi trugen Turbane, Pluderhosen, Schnabelschuhe und Krummsäbel, sie droschen mit Geißeln, Peitschen und Knüppeln auf ihn ein. Den unbekannten Meister hatte die Türkenangst beflügelt, die damals, als die Horden der »Falschgläubigen« vor Wien standen, im christlichen Abendland umging. Es seien Mohammedaner, erklärte die Mutter. Sie hielt mich hoch, damit ich die Szenen genauer anschauen konnte, und ich plapperte den immer gleichen Kommentar: Die Bilder, die Leute, die Bilder … Die Gewalt, das Leid, der Tod – ein farbenfrohes Faszinosum in den Augen des Kindes.
Die steinerne Kapelle auf der Unterbergalm war der entfernteste Planet. Man muss dazu wissen, dass jeder Bergbauernhof eine Alm in der höher gelegenen Gebirgsregion bewirtschaftet, auf die im Frühjahr das Jungvieh getrieben wird. Zum Kreilhof gehört die Kreilhütte, und dort oben, 1350 Meter über null, steht eine kleine Kapelle. Der Großvater hatte bei der Renovierung geholfen, um, nachdem er unversehrt aus den Stahlgewittern des Krieges heimgekehrt war, ein Gelübde einzulösen. Vor der Kapelle werden allsommerlich Bittgottesdienste abgehalten, auf dass der Herrgott die Menschen und Tiere schützen und beim Almabtrieb kein Rind abkugeln möge. An den Kalkwänden des Kirchleins picken Sterbebildchen von Sennern und Bergbauern, eines davon ist meinem Onkel Hans gewidmet. Ich komme nur noch selten auf den Unterberg, aber bei jedem Besuch schmücke ich den Altar mit Latschenzweigen, Almröschen und Silberdisteln. Es ist mein Dank an die Vorfahren, meine katholische Totenverehrung, und auch die ist nicht weit entfernt vom Ahnenkult im traditionellen Afrika: Die Seelen der Verstorbenen sind unter uns, sie befinden sich im Zwischenreich der Erinnerung, dem Auge fern, dem Herzen ewig nah. Durch ihre auratische Präsenz verliert der Tod seine Macht.
In den Augen der Großmutter war der Tod ohnehin ein vollkommen nachgeordneter Himmelsfunktionär, ein Handlanger des Jenseits, der jeden Menschen nach dem unergründlichen Willen des Herrn zur rechten Zeit holt, der ihn abruft aus dem irdischen Jammertal. Im Glasaufsatz der Kommode, die in ihrer Schlafkammer stand, lag die Versehgarnitur stets griffbereit: ein Silbertablett, darauf ein Standkreuz, eine Kerze, eine Glasschale für das Weihwasser und ein Gefäß für Chrisam, das Salböl für den Sterbenden. Es waren die Utensilien für die Letzte Ölung, das ultimative Sakrament, empfangen in der Todesstunde.