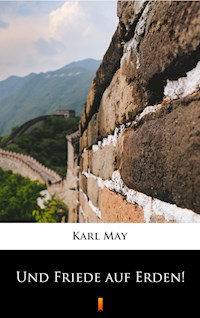
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ktoczyta.pl
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Und Friede auf Erden! ist Band 30 von Karl Mays „Gesammelten Werken”, ist eine Reiseerzählung. Das Buch entstand unter dem unmittelbaren Eindruck von Karl Mays großer Orientreise 1899 – 1900. „Und Friede auf Erden! „ gehört zu den interessantesten Werken von Karl May und spielt in China. In Kairo lernt der Erzähler seinen zukünftigen Diener Sejjid, den religiösen Fanatiker Waller und dessen Tochter, sowie zwei Chinesen kennen. Nach ersten Abenteuern in Gizeh beschliessen die fünf Reisenden, gemeinsam weiterzuziehen. Über Ceylon, die malaiische Halbinsel und Penang führt sie der Weg bis nach China.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Karl May
Und Friede auf Erden!
Warschau 2019
Inhalt
Erstes Kapitel. Ein Eiferer.
Zweites Kapitel. Civilisatoren.
Drittes Kapitel. Die „Shen“.
Viertes Kapitel. Wahnsinn.
Fünftes Kapitel. Der Shen-Ta-Shi.
Erstes Kapitel. Ein Eiferer.
„Ich bin Sejjid Omar!“
Wie stolz das klang, und wie beweiseskräftig die Gebärde war, mit welcher er diese Worte zu begleiten pflegte! „Ich bin Sejjid Omar,“ das sollte sagen: „Ich, Herr Omar, bin ein studierter, schriftkundiger Abkömmling des Propheten, welcher der Liebling Allahs ist. Mein Name wurde mit allen meinen persönlichen Vorzügen in die heilige Stammrolle zu Mekka eingetragen; darum habe ich das Recht, ein grünes Oberkleid und einen grünen Turban zu tragen. Wenn ich sterbe, wird die Kuppel meines Grabmals grün angestrichen und mir die Tür des obersten der Himmel gleich geöffnet sein. Respekt also vor mir!“
Was aber war dieser Sejjid Omar? Ein Eselsjunge! Er hatte seinen „Stand“ an der Esbekije in Kairo, dem Hotel Kontinental, in welchem ich wohnte, gegenüber. Ein schön und kräftig gebauter, junger Mann von wenig über zwanzig Jahren, war er mir durch seinen steten Ernst und die angeborne Würde seiner Bewegungen aufgefallen. Ich beobachtete ihn gern von meinem Balkon aus, und wenn ich unten auf dem prächtigen Vor- platze des Hotels meinen Kaffee trank, konnte ich ihn sprechen hören. Sein Gesicht zeigte zwar auch den Zug von Verschlagenheit, der allen Eseltreibern eigen ist, aber er war nicht aufdringlich und lag seinem Geschäfte in einer Weise ob, als werde Jedem, der sich seines Esels bediente, eine ganz besondere Gunst erwiesen. Er gab sich so wenig wie möglich mit Berufsgenossen ab, und wenn sie ihn für diese Zurückhaltung mit spöttischen Redensarten zu ärgern versuchten, bekamen sie nichts als ein verächtliches „Ich bin Sejjid Omar“ zu hören. Wollte ein Fremder mit ihm feilschen, oder wurde ihm irgend Etwas gesagt oder zugemutet, was er für gegen seine Ehre hielt, so wendete er sich mit einem geringschätzenden „Ich bin Sejjid Omar“ ab und war dann für den Betreffenden nicht mehr zu sprechen.
Die Folge war, daß ich ihm ein ganz besonderes Interesse schenkte, obgleich sich mir keine Gelegenheit bot, ihm dies in Beziehung auf sein Geschäft zu beweisen[.] Aber Blicke ziehen einander bekanntlich an. Ich bemerkte, daß auch er sehr oft zu mir herübersah. Er schien unruhig zu werden, wenn ich nach dem Mittag- und dem Abendessen mich nicht sofort auf der Terrasse sehen ließ, und sooft ich beim Ausgehen an ihm vorüberkam, trat er, obgleich ich ihn gar nicht zu beachten schien, einen Schritt zurück und legte, still grüßend, die Hände auf die Brust.
In dem erwähnten Hotel gibt es zu Seiten des Speisesaales zwischen den Säulen kleinere Tische für Gäste, welche es nicht lieben, an der Tafel enggepfercht zu sitzen. Ich hatte mir einen dieser Tische für mich allein reservieren lassen. Der links davon war nicht besetzt; an dem zu meiner rechten Hand gab es seit gestern zwei Fremde, welche nicht nur die allgemeine Aufmerksamkeit, sondern auch die meinige auf sich zogen, obgleich ich mir das nicht so wie die Andern merken ließ. Sie waren Chinesen, und zwar Vater und Sohn. Ich erriet das zunächst aus ihrer Aehnlichkeit und hörte es dann aus ihrem Gespräch, denn ihr Tisch stand dem meinen so nahe, daß ich jedes ihrer Worte verstehen konnte. Sie waren nicht in heimische Tracht gekleidet, sondern trugen weiße Reiseanzüge nach französischem Schnitte. Ihre Zöpfe wurden von den Tropenhelmen verborgen, die sie nur während der Tafel abzunehmen pflegten. Gleich als sie gestern den Speisesaal betraten, war mir die ebenso tiefe wie herzlich aufrichtige Ehrerbietung aufgefallen, welche der Sohn dem Vater entgegenbrachte. Das war eine geradezu rührende Aufmerksamkeit und Dienstfertigkeit, welche sogar dem servierenden Kellner jede Handreichung und jeden Griff abzunehmen strebte, um dem Vater Kindesdank und Kindesliebe zu erweisen. Und man sah deutlich, daß dies nichts Gemachtes, nichts Aeußerliches war, sondern als etwas frei und gern Gegebenes aus dem Innern kam. Der Vater trug Augengläser in schwer goldenem Gestell; der Sohn hatte keine Brille. Sie speisten genau nach unserer Art und taten dies so geläufig und so fehlerlos, so unhörbar und unauffällig, daß manche der übrigen Gäste sich an ihnen hätten ein Beispiel nehmen können. Der mich bedienende Garçon flüsterte mir in Hoffnung auf ein dafür gebotenes Extratrinkgeld zu:
„Monsieur Fu und Monsieur Tsi aus China. Kommen aus Paris. Sind wahrscheinlich verwandt miteinander.“
„Haben sie sich selbst so eingetragen?“ erkundigte ich mich.
„Nein, aber dem Portier so gesagt.“
Er sprach die beiden Worte nicht in der richtigen Weise aus; aber es war klar, daß Fu Vater und Tsi Sohn bedeutete. Im Chinesischen hat dasselbe Wort oft sehr verschiedenen Sinn. Die beiden Gäste hatten ihre Namen nicht genannt und sich einfach als Vater und Sohn bezeichnet. Da hier im Hause Niemand ihrer Sprache mächtig war, so hatte man sie als Monsieur „Vater“ und Monsieur „Sohn“ in das Fremdenbuch eingetragen und glaubte noch besonders pfiffig zu sein, indem man sie für Verwandte hielt. Sie aber ließen es sich lächelnd gefallen, daß ihr Verwandtschaftsgrad als Namen ausgesprochen wurde. Dem Personale gegenüber sprachen sie französisch, und zwar so vorzüglich, daß eine langjährige Uebung mit Gewißheit anzunehmen war.
Was ihre Gesichter betrifft, so trat der mongolische Schnitt derselben nur wenig hervor. Bei dem Sohne mochte diese Milderung eine Folge der Jugend sein; bei dem Vater aber war es ganz entschieden der Wirkung geistiger Tätigkeit zuzuschreiben, daß ihn fast nur der echt chinesisch gepflegte Bart als einen „Sohn der Mitte“ verriet. Man brauchte kein Menschenkenner zu sein, um diesem Manne anzusehen, daß sein Arbeitsfeld wohl kaum jemals ein materielles gewesen sei.
Nach Tische wurde draußen im Flur während des allgemeinen Speech die Tatsache festgestellt, daß die beiden Chinesen erstens aus Canton, zweitens Onkel und Neffe und drittens in Paris gewesen seien, um dort ein Geschäft für Chinawaren einzurichten, dessen Leitung der Neffe übernehmen werde. Er habe den Onkel nur nach Aegypten zurückbegleitet, um die Trennung zu verzögern, werde aber hier von ihm Abschied nehmen und dann, direkt nach Paris zurückkehren. Es war mir gleichgültig wer diese Entdeckung gemacht hatte. Ich konnte mir nicht denken, daß dieser so eigenartig, ich möchte sagen, geheimnisvoll geistreich aussehende „Monsieur Fu“ ein Kaufmann sei, dessen Bestreben darin bestehe, billige chinesische Fächer und Vasen in Paris teuer an den Mann zu bringen.
Der Zufall war so gütig, mich schon am nächsten Morgen einen heimlichen Blick in diese Verborgenheit tun zu lassen. Ich logierte, um möglichst viel Luft und Licht zu haben, zwei Treppen hoch und saß, mit Briefen beschäftigt, auf dem Balkon, als ich die Chinesen aus dem Hotel treten und hinüber zu Sejjid Omar gehen sah. Dieser besorgte ihnen zu seinem noch einen zweiten Esel, worauf er mit ihnen davontrabte. Dann hörte ich unter mir klopfen und bürsten. Das störte mich und wollte kein Ende nehmen. Ich bog mich über die Brüstung vor und schaute hinab. Es war nicht, wie ich vermutet hatte, das Zimmermädchen, sondern ein chinesischer Diener, welcher einen Koffer geöffnet hatte, um den Inhalt desselben einer Besichtigung resp. Säuberung zu unterwerfen. Die Chinesen wohnten also eine Treppe hoch grad unter mir. Ich ließ den Mann weiter klopfen und bürsten, ohne den Attentäter, was ich eigentlich beabsichtigt hatte, zur Ruhe zu verweisen.
Dann wurde es still unter mir, doch verriet mir wiederholtes Räuspern, daß der Diener noch da sei. Ich schaute wieder hinab. Er war jetzt mit einem andern, kleinen Koffer beschäftigt, den er geöffnet hatte. Er ordnete da verschiedene Gegenstände mit einer Behutsamkeit, die auf ungewöhnlichen Wert schließen ließ, und versicherte sich von Zeit zu Zeit durch einen Blick nach den benachbarten Balkonen, daß er nicht beobachtet werde. Der Inhalt dieses Koffers schien also Dinge zu enthalten, von denen nicht Jedermann wissen durfte. Eben jetzt hatte er einen Gürtel in der Hand, an welchem eine goldene, mit Rubinen besetzte Schnalle glänzte. Diese Art von Schnallen dürfen nur Mandarinen ersten und zweiten Ranges tragen! Dann sah ich ein Putsu erscheinen, dessen Stickerei einen Storch vorstellte. Nach einer Kugelkette, einer Pfauenfeder und verschiedenen anderen Gegenständen, welche ich wegen ihrer Kleinheit nicht deutlich erkennen konnte, kam einer jener Beamtenhüte zum Vorschein, welche nur im Sommer getragen und darum „warme“ Hüte genannt werden. Er hatte einen glatten, roten, ungeblümten Korallenknopf. Kugelketten dürfen nur von Mandarinen ersten bis fünften Grades um den Hals getragen werden. Pfauenfedern sind besondere Auszeichnungen; aber der Korallenknopf ist nur den Mandarinen ersten Ranges erlaubt. Diese sind entweder Zivil- oder Kriegsmandarinen. Die ersteren haben ein Putsu mit Storch, die letzteren ein dergleichen Schild mit dem Bild des Einhorns zu tragen. Die Zivilbeamten werden mehr als die militärischen geehrt. Ich hatte also erfahren, daß „Monsieur Fu“, denn nur auf ihn konnten sich diese Auszeichnungen beziehen, ein Zivilmandarin allerhöchsten Ranges war, und nahm mir selbstverständlich vor, dies keinem Menschen mitzuteilen. Mehr zu sehen, wurde mir durch meinen Bleistift unmöglich gemacht. Ich hatte ihn hinter das Ohr gesteckt; er verlor dadurch, daß ich den Kopf vor und nach unten gebeugt hatte, den Halt, fiel hinab und traf grad vor dem Diener auf das Balkongeländer auf. Der Chinese stieß einen Ruf des Schreckens aus, raffte Alles schnell zusammen und war im nächsten Augenblicke ver- schwunden. Auch dieser sein Schreck war ein Beweis, daß seine beiden Herren ihren Stand nicht zu verraten wünschten.
Wir befanden uns im Vorsommer, also in der Zeit, in welcher der Khamsin jährlich gegen fünfzig Tage lang der höchst ungern gesehene Gast Aegyptens ist. Dieser heiße, trockene Südwestwind, welcher den feinen Staub der Wüste mit sich führt, kann, wenn er stark auftritt, so erschlaffend wirken, daß sowohl der Einheimische als auch der Fremde Alles meidet, was mit einer körperlichen Anstrengung verbunden ist. Am Tage nach der soeben erzählten Entdeckung wehte er ganz besonders entkräftend von Gizeh und Aryahn herüber. Man mied die Straßen, und die sonst so gern besuchten Plätze vor den Kaffeehäusern waren noch um die Zeit des Asr, des täglichen Nachmittagsgebetes, unbesetzt. Dies veranlaßte mich, nach dem Dschebel Mokattam zu reiten. Ich war den Khamsin längst gewohnt; er konnte mich nicht belästigen und hielt im Gegenteile andere Leute ab, mich da oben in dem mir liebgewordenen Genuß zu stören. Der Blick vom Mokattam und dem Dschebel Giyuschi ist unbeschreiblich schön, mir aber doppelt wert, wenn beim Sonnenuntergange die Beleuchtung der Stadt und ihrer Umgegend durch den in der Luft schwebenden Khamsinstaub zu einer, fast mochte ich sagen, märchenhaften wird. Es sind dann alle Härten und Schärfen des Bildes abgemildert, und es liegt ein so undefinierbarer Farbenton rings ausgegossen, daß man meinen möchte, von einer jenseitigen Höhe auf eine ganz andere, un- oder überirdische Welt herabzuschauen.
Eben als ich mich aufmachte, brachte der Kommissioner des Hotels einige Wagen voller Reisende, welche mit dem Zuge angekommen waren. Ich hatte keinen Grund, sie zu beachten, doch fiel mir im Vorübergehen eine junge, blau verschleierte Dame auf, welche einfach in Grau und praktisch knöchelfrei gekleidet war und zu einem mit ihr ausgestiegenen Herrn einige englische Worte sprach. Ich hatte nur selten eine so tiefe, wohlklingende und sympathische Altstimme gehört.
Dann saß ich oben auf dem Berge, in stiller, zunächst ununterbrochener Einsamkeit. Mein Lieblingsplatz war ein Felsensitz in der Nähe der alten, verfallenen Giyuschi-Moschee. Die Sonne hielt sich hinter einem flimmernden, orangefarbenen Dufte halb verborgen. Wie ein im Einschlummern unvollendet gebliebenes Gebet lagen die Mamelukengräber tief zu meinen Füßen. Von der Alabastermoschee bis nach Kasr el Ain hinüber und von der ahnenhaften Amr Ibn el As bis zur früheren ez Zahir hinunter klangen die in Stein gedichteten tausend Strophen der Minarehs zu Allahs Thron empor. Durch Masr el Atika, das einstige Fostat, dampfte, einer Entheiligung gleich, ein Zug hinauf nach Heluan, und hinter den Lebbachbäumen der Dakrurstraße und dem Grün der Kanalfelder lagen am Wüstenrande die Pyramiden – – aus Angst vor der Ewigkeit erstarrte Todesgedanken der Pharaonen. Tod und Leben, Vergangenheit und Gegenwart um und in sich vereinigend, vom Wüstenwind überweht und doch so jugendschön und jugendwarm, so breitete sie sich vor meinen Augen aus, El Kahira, die Siegreiche, die mir nebst Bagdad und Damaskus so lieb geworden ist wie keine andere Stadt des Orientes.
Es kamen von da unten herauf, von den Königsgräbern da drüben und dem Sinai im Osten hinter mir Gedanken über mich, welche ich nicht verloren gehen lassen wollte; darum zog ich Papier und Blei hervor. Ich begann damals, an meinen „Himmelsgedanken“ zu dichten, deren erster Band inzwischen erschienen ist. Dieses Buch war auch einer der Gründe, welche mich zur gegenwärtigen Reise veranlaßt hatten. Wer Gedichte über und für die Menschheitsseele schreiben und den Völkern gerecht werden will, denen diese Seele ihre Jugendbegeisterung widmete, der darf nicht meinen, daß er die Gedanken dazu im kalten, selbstsüchtigen Abendlande finden werde, sondern er muß dorthin gehen, wo einst Gott selbst zur Erde kam und seine Engel sich den Menschen zeigen durften, ohne, wie es allerdings ein einziges Mal, und zwar zu Sodom und Gomorrhas Verderben geschah, für ihre Himmelsliebe schlimmen Erdendank zu ernten.
Da, wo die nackt gewordenen Steine Palästinas wieder zu Brot zu werden haben, wo Memnons Kolosse nicht nur leise erklingen, sondern deutlich sprechen sollen, wo zwischen Pison, Gihon, Phrat und Hidekel noch heut die beseligende Idee des Paradieses wieder auszugraben ist, da muß man sein, da muß man sehen und lauschen, äußerlich und innerlich, und dann, wenn in stiller Mondesnacht aus den Wogen des Niles ganz dieselbe Offenbarung wie aus den Fluten des Tigris steigt und um die Minarehs dasselbe linde Säuseln klingt, welches Elias einst auf dem Karmel hörte, dann wird es der Menschenseele klar, daß auch ganz dieselben Strophen wieder zu ertönen haben, welche der Orient einst zu dichten begonnen, der Occident aber als Hoheslied der Gottes- und der Nächstenliebe zu vollenden hat.
Es war mir eine Lust, diese und ähnliche Gedanken in Worte zu kleiden; aber ich brachte es zu keinem Schlusse, denn ich wurde unterbrochen. Vom Felsenwege her erklang das lebhafte Getrappel kleiner Eselshufe. Mich umschauend, sah ich die erwähnte, grau gekleidete Dame und den Herrn kommen, mit welchem sie gesprochen hatte. Als dritten Reiter bemerkte ich einen jener christlichen oder jüdischen Levantiner, welche jedes von ihnen gehörte, wenn auch gänzlich unverstandene, fremdsprachige Wort in dem Mehlwürmertopfe ihres Gedächtnisses sorgfältig aufbewahren, um sich dann, wenn sie mit diesen Würmern nicht mehr allein fertig werden können, für Dolmetscher auszugeben und sie gegen möglichst hohe Vergütung an den Mann zu bringen. Diese Dragomans sind eine Plage, welcher sich zu erwehren der gewöhnliche Tourist weder genug Erfahrung noch die nötigen Kenntnisse besitzt. Wenn sie sich einmal festgesogen haben, so lassen sie nur selten wieder los, und der von ihnen, den ich hier kommen sah, war eine Klette von der allerschlimmsten Sorte. Er hatte sich vor einigen Tagen auch an mich zu machen versucht, war aber, als nichts Anderes half, durch einen Wink mit der Reitpeitsche dann für immer abgewiesen worden. Diese Levantiner werden von dem ehrlichen, charaktervollen Araber verachtet, und da sie meist Christen sind und er durch sein eigenes Leben belehrt wird, welchen großen Einfluß der Glaube auf den moralischen Wert des Menschen ausübt, so ist er leicht geneigt, nicht bei der Person stehen zu bleiben, sondern seine Geringschätzung über die ganze Christenheit auszudehnen.
Die vierte Person war – – – Sejjid Omar, der Eseltreiber, welcher so gravitätisch, als ob er die Hauptperson der ganzen Truppe sei, neben den Dreien hergeschritten kam.
Als der Dolmetscher mich erblickte, kam er grad auf mich zugeritten, stieg bei mir ab und breitete eine mitgebrachte Decke neben mir aus. Er hatte, als er sich mir anbot, französisch mit mir gesprochen; warum, das wußte ich nicht, sollte es jetzt nun aber erfahren, denn er rief, sich umdrehend, Sejjid Omar zu:
„Dieser Kerl sitzt gerad an der besten Stelle! Er ist ein Franzose, denn er hat ein Bärtchen an der Unterlippe. Komm her, und jag ihn fort!“
„Nimm dich in Acht!“ warnte der Eseltreiber. „Wenn er arabisch sprechen kann, versteht er deine Worte!“
„Der? Arabisch sprechen? Siehst du denn nicht, daß ihm die Dummheit aus den Augen blickt? Der spricht nicht einmal seine Muttersprache richtig. Ich weiß das ganz genau, denn ich habe französisch mit ihm geredet. Er wollte mich als Dolmetscher haben; ich bin aber nicht darauf eingegangen, weil ich ihm sofort angesehen habe, daß er ein armer Schlucker und außerdem ein Geizhals ist. Jage ihn fort! Wir brauchen diesen Platz für unsere Leute!“
Da machte der Sejjid eine seiner unnachahmlichen, sprechenden Handbewegungen und antwortete:
„Ich bin nicht dein Diener, und Allah und mein Geschäft verbieten mir, unhöflich zu sein. Wenn du als Christ und Grieche grob sein darfst, so geht mich das nichts an. Ich heiße Sejjid Omar; das merke dir!“
Der Levantiner hätte es vielleicht gewagt, aus Rachsucht mit Hilfe des Eseltreibers mit mir anzubinden; aber es ohne diese Unterstützung zu tun, dazu war er, wie die meisten seinesgleichen, zu feig. Er hatte, nur um mich zu ärgern, die Fremden grad her zu mir geführt, obgleich ich vor ihnen der einzige Mensch war, der sich auf dem weiten Plateau des Dschebel Giyuschi befand, auf welchem Platz für ungezählte Tausende gewesen wäre. Ich aber tat, als ob mir diese Flegelhaftigkeit vollständig gleichgültig sei.
Der Hammahr half den Reisenden beim Absteigen. Dann setzten sie sich auf die ausgebreitete Decke, ohne mich zu grüßen oder auch nur mit einem Blicke zu beachten. Das beleidigte mich nicht. Ich kannte ja diese besonders jenseits des Kanales und des Atlantischen Meeres gepflogene Weise, nach welcher fremde Menschen als vollständig abwesend betrachtet werden. Selbstverständlich waren sie nun auch für mich nicht vorhanden, und ich rauchte die Zigarre, welche ich mir angebrannt hatte, ruhig weiter, obgleich ich sah, daß der Wind der Dame den Rauch zuweilen in das Gesicht trieb. Sie saß mir so nahe, daß ich sie mit der ausgestreckten Hand erreichen konnte.
Nun stellte sich der Dolmetscher in Positur und begann, den Fremden das vor ihnen liegende Panorama zu erklären. Er tat dies in einem Englisch, mit welchem ein Bauer, ohne die Hacke nötig zu haben, die stärksten Rüben hätte aus dem Felde ziehen können, und es war den beiden Zuhörern auch mehr als deutlich anzusehen, daß sie sich von dem, was sie anhören mußten, nichts weniger als erbaut fühlten. Eine Weile ließen sie es sich gefallen, dann aber gebot die Dame dem poliglott-schrecklichen Griechen, still zu sein, zog ein rotgebundenes Buch aus der Tasche und sagte zu dem Herrn, zu meiner Ueberraschung in deutscher Sprache:
„Verstehst du ihn, Vater? Ich nicht! Nehmen wir den Baedeker her! Die Karte wird uns mehr sagen, als wir von diesem Araber erfahren können. Und reden wir deutsch, denn das versteht er nicht!“
Der für einen Araber Gehaltene zog sich beleidigt zurück. Gerade diese unwissenden Menschen sind außerordentlich empfindlich, wenn man ihren vermeintlichen Kenntnissen nicht die erwartete Bewunderung zollt. Sejjid Omar stand, mit dem Ellbogen auf seinen Esel gestützt, unbeweglich wie eine Bildsäule seitwärts hinter uns. Der lange, weite Mantel, den er trug, war nicht imstande, die schöne Plastik seiner Figur ganz unbemerkbar zu machen.
Ich hatte also erfahren, daß die Fremden Vater und Tochter seien. Ich erfuhr noch mehr. Ob sie mir die Kenntnis der deutschen Sprache nicht zutrauten, oder ob ihnen meine Anwesenheit wirklich vollständig gleichgültig war, sie sprachen so ungeniert miteinander, als ob an meiner Stelle nichts als Luft vorhanden sei.
Der Vater war ein ziemlich langer, hagerer Herr mit einem glattrasierten, etwas mehr als nötig in die Länge gezogenen Gesicht. Der Stehkragen seines Rockes paßte zu der salbungsvollen, dabei aber harten und schnellen Weise, in welcher er sprach. Er hatte einen seiner Handschuhe ausgezogen, was mir Gelegenheit gab, seine auch sehr lange, doch weiße und sichtbar wohlgepflegte Hand zu sehen. Nicht angenehm berührte der rücksichtslose, schnarrende Ton, in welchen er fiel, so oft es seine Absicht war, eine bestimmte Meinung auszusprechen. Ich pflege über andere Menschen nicht vorschnell zu urteilen, doch war ich, obgleich ich diesen Mann heut zum ersten Male sah und ihn also noch gar nicht kannte, zu der Behauptung geneigt, daß er von einer einmal gefaßten, wenn auch noch so falschen Ansicht nicht leicht abzubringen sei. Vielleicht war er sonst ein ganz vorzüglicher Mann, aber er machte den Eindruck auf mich, als ob er sich für unfehlbar halte, und mit solchen Leuten ist schwer umzugehen.
Die Tochter wurde von ihm Mary genannt. Sie hatte, um besser Umschau halten zu können, den Schleier zurückgeschlagen. Ich hütete mich natürlich, meine Beobachtungen merken zu lassen, doch genügte ein kurzer Blick, mich ein liebes, rosig angehauchtes Gesicht sehen zu lassen, in welchem ein Paar helle, klare, sehr verständige Augen glänzten. Ihre tiefe, schöne Altstimme habe ich schon erwähnt. Wenn sie sprach, so war ihr anzuhören, daß sie es nicht mit dem Munde, sondern mit der Seele tat. Es klang ganz so, als ob über diese Lippen nie ein liebloses Wort gekommen sei oder kommen könne. Vom Vater hatte sie das nicht geerbt; es konnte nur die Gabe einer vortrefflichen, an Herzensbildung reichen Mutter sein.
Der Vater war Amerikaner, und zwar Missionar, nach China bestimmt, wohin die Tochter ihn begleitete; die Mutter war tot, eine Deutsche gewesen, wie es schien. Sie waren über London, Köln, Wien und Triest nach Aegypten gekommen, um einige Zeit hier zu bleiben und sich dann zunächst Indien anzusehen. Große Eile schienen sie nicht zu haben.
Sie kannten die Wirkung des Khamsin noch nicht und waren trotz desselben gleich nach ihrer Ankunft hier herauf geritten, weil Mary gewünscht hatte, zunächst das Gesamtbild von Kairo vor sich zu sehen. Und der Eindruck desselben war, wenigstens bei der Tochter, ein so tiefer, daß der ermattende Wind auf sie ohne sichtbare Wirkung blieb.
Sie hatte die entfaltete Karte auf ihrem Schoße liegen, ohne aber zunächst nach speziellen Punkten zu suchen. Es schien ihr vor allen Dingen um den Totaleindruck zu tun zu sein. Dabei machte sie dann und wann eine Bemerkung, die mich aufhorchen ließ. In diesem Mädchen schien ein seltsames, ungewöhnlich reiches Seelenleben zu pulsieren! Einmal hätte ich beinahe verraten, daß ich ihr aufmerksam zuhörte. Sie nannte nämlich meinen Namen.
„Weißt du, Vater, an wen ich jetzt denke?“ sagte sie. „An Karl May. Ich habe seine drei Bände ‚Im Lande des Mahdi“ gelesen, und – – – “
„Lies nicht das dumme Zeug von diesem May!“ unterbrach er sie rasch und schnarrend. „Dieser Schriftsteller hat nichts als Phantasie, und du weißt, daß mir seine weichliche Frömmigkeit widerwärtig ist! Wie kommst du dazu, grad jetzt an ihn zu denken?“
„Er nennt Kairo ‚Bauwaabe el bilad esch schark, das Tor des Orientes", und sagt, dieses Tor sei altersschwach geworden und könne dem Einflusse des Abendlandes kaum mehr widerstehen. Es wird mir schwer, das zu glauben. Ich habe den Orient noch nicht gesehen, aber ich liebe ihn und wünsche, daß er sich stärker erweisen möge, als zum Beispiel du, Vater, mit so vielen Anderen denkst. Er ist für mich ein schlafender Prinz im stehengebliebenen Saale einer eingefallenen, morgenländischen Königsburg. Seine Bestimmung ist, von einer abendländischen Jungfrau aufgeweckt zu werden. Wenn dann durch Beide der Osten mit dem Westen in selbstloser Liebe vereinigt ist, werden alle Völker der Erde glücklich sein.“
„Du bist eine Träumerin, ganz wie deine Mutter war! Die Wirklichkeit aber sieht ganz anders aus als so ein Märchentraum. Das Morgenland hat uns um das Paradies gebracht; es hat den Erlöser gekreuzigt und bis auf den heutigen Tag niemals erkennen wollen, was zu seinem Frieden dient. Nun kommen wir, die Himmelsboten, ihm diesen Frieden zu bringen. Nimmt es ihn an, so soll es ihn haben; stößt es ihn aber von sich, so wird es trotz aller unserer Mühe nicht zu retten sein. Schau doch hinab und sieh, was zu deinen Füßen liegt! Alles, was da noch orientalischen Ursprungs ist, steht im Begriff, im Schmutze zu versinken. Alles Neue, Praktische und Gute aber hat diese Stadt vom Abendlande bekommen. Dein Karl May, von dem ich sonst nichts wissen will, hat also in diesem einen Falle ausnahmsweise einmal das Richtige gesagt. Ist der Orient der Märchenprinz, von dem du sprachst, so ist es nur uns Sendboten möglich, ihn aus dem Schlafe aufzuwecken. Nur wir allein können ihn erlösen; wir fußen in und auf der Wirklichkeit; deine abendländische Jungfrau aber gehört ins Reich der Phantasie.“
„Phantasie! Das ist vielleicht das richtige Wort,“ lächelte sie. „Es gibt Leute, welche behaupten, daß die Phantasie hellere und schärfere Augen habe als der alterssichtig gewordene Verstand.“
„Willst du mich belehren?“
„Nein. Dazu bist du mir ja viel, viel zu gelehrt. Aber weißt du, wir klopfen heut beide an das Tor des Orientes, und wenn man irgendwo anklopft, soll man sich nicht nur fragen ‚Was willst du hier?“ sondern auch ‚Was bringst du mit?“. Denn ob man das, was man will, erreichen wird, das ist wahrscheinlich sehr von dem abhängig, was man mitbringt. Und mitbringen muß und wird Jeder Etwas, und wenn es nichts weiter als seine Persönlichkeit wäre. Fragen wir uns also heut, indem wir an diese Pforte klopfen, was wir für die, welche hinter ihr wohnen, mitbringen!“
„Well, mein Kind! Ich bringe ihnen meinen Glauben. Das ist mehr als genug!“
„Und ich bringe ihnen meine Liebe, meine ganze, ganze, volle Liebe! Ob das genug ist, weiß ich nicht; aber ich besitze ja nichts weiter, was ich geben kann. Und diese Liebe gebe ich so gern, so unendlich gern. Was habe ich gewünscht! Wie habe ich geträumt, gehofft, geschwärmt! Mein Herz ist mir nach hier vorausgeflogen. Es ist mir, als sei mein bisheriges Leben eine Weissagung gewesen, welche von heute an beginne, in Er- füllung zu gehen. Der Orient ist die Heimat des Menschengeschlechtes. Fühlst du nicht auch, was es heißt, am Tore unserer Heimat zu stehen? Im Osten geht der Welt die Sonne auf. Ist es nur dein Glaube, welcher ihr entgegen geht? Bringst du ihr gar, gar nichts anderes mit?“
„Schwärmereien!“ antwortete er überlegen. „Das sind nun die Folgen meiner Schwäche, deine Lektüre nicht strenger zu überwachen. Die Gestalten aus ‚Tausend und eine Nacht“ und anderen Büchern spuken in dir; du bist noch ein Kind; ich aber bin ein Mann; ich darf nicht schwärmen wie du, denn ich habe ernste Pflichten zu erfüllen. Denke an meine Wette mit Reverend Burton in London, im Laufe des ersten Jahres fünfzig erwachsene Chinesen zu bekehren und ihm die Beweise darüber vorzulegen!“
„Was diese Wette betrifft, Vater, so wünschte ich, du wärst sie nicht eingegangen. Ich habe das Gefühl, daß es eine Entheiligung ist, die Seligkeit Anderer zum Gegenstande einer Wette zu machen.“
„Nicht über diese Seligkeit, sondern über meinen Erfolg haben wir gewettet, Kind! Und ich werde gewinnen, weil mir die Gabe der überzeugenden Rede verliehen ist. Ich begreife nicht, wie ein Mensch einen anderen Glauben haben kann als den meinigen, welcher doch der einzig richtige, der einzig wahre ist. Schau dir da den Eselsjungen an! Sein Allah ist ein falscher Gott und sein Muhammed ein Lügner. So viele Türme da unten ragen, in so viele Moscheen möchte ich treten, um laut auszurufen, daß es kein anderes Heil als das unsere gibt. Warum werden so wenig Heiden bekehrt? Weil uns der Mut fehlt. Ich werde in China keinen Tempel betreten, ohne mich offen hinzustellen und den Ungläubigen zu sagen, daß sie Heiden sind, denen die ewige Verdammnis sicher ist, wenn sie sich nicht bekehren. Ich werde – – – doch, sieh hin! Was tut dieser Mensch?“
Er hatte sich mitten in der Rede unterbrochen und zeigte auf Sejjid Omar, welcher jetzt Etwas tat, was die Aufmerksamkeit des Amerikaners auf sich zog, weil er es noch nie gesehen hatte. Der Eseltreiber schickte sich nämlich an, sein muhammedanisches Gebet zu verrichten.
Es war zwar jetzt nicht eigentlich Betenszeit, denn das Asr war schon vorüber, und das Moghreb soll erst beim Untergang der Sonne gebetet werden; da aber die Zeit des einen Gebetes bis zum Beginn des nächsten reicht, so kann man die vorgeschriebene Pflicht, wenn man an ihrer Erfüllung verhindert wurde, bis zum Anfang der nächsten Periode nachholen. Sejjid Omar hatte aus irgend einem Grunde das Asr nicht beten können, und da sich ihm hier oben die Gelegenheit bot, seinen religiösen Verpflichtungen völlig ungestört nachzukommen, so tat er dies, ohne sich um den Glauben und die Meinung der Anwesenden zu kümmern.
Er nahm seinen Zeuggürtel ab, faltete ihn auseinander und breitete ihn als Gebetsteppich auf die Erde aus. Nachdem er sich gegen Osten, mit dem Gesicht nach Mekka, gerichtet hatte, hob er die offenen Hände zu beiden Seiten des Gesichts empor, berührte mit den Spitzen der Daumen die Ohrläppchen und sagte:
„Allahu akbar – Gott ist sehr groß!“
Dieser Ruf war es, welcher die Aufmerksamkeit des Amerikaners auf ihn gelenkt hatte. Hierauf ließ er die Hände sinken, legte die linke in die rechte, richtete den Blick auf die Stelle des Teppichs, wo sein Kopf beim späteren Niederwerfen ihn berühren sollte, und fuhr fort: „Lob und Preis sei Gott, dem Weltenherrn, dem Allerbarmer, der da herrscht am Tage des Gerichts. Dir wollen wir dienen, und zu dir wollen wir flehen, auf daß du uns führest den rechten Weg, den Weg derer, die deiner Gnade sich erfreuen, nicht aber den derer, über welche du zürnest, und nicht den Weg der Irrenden.“
Das war die heilige Fatcha, das erste Kapitel des Korans, welches jedem Gebete vorauszugehen hat. Dann folgte das kurze 112. Kapitel, welches lautet:
„Sprich: Gott ist der einzige und ewige Gott. Er zeugt nicht und ist nicht erzeugt, und kein Wesen ist ihm gleich!“
Hierauf legte er die Hände auf die Knie, neigte den Kopf, verbeugte sich dreimal und sagte:
„Allahu akbar! Ich preise die Vollkommenheit meines Herrn, des Großen. Gott erhöre den, der zu ihm betete. Preis sei dir, o Herr!“
Nachdem er Kopf und Körper wieder aufgerichtet hatte, kniete er langsam nieder, legte seine Hände vor den Knieen auf den Boden und berührte mit Nase und Stirn die zwischen den Händen liegende Stelle. Dann hob er den Körper wieder empor, wobei aber die Knie sich nicht vom Boden trennten, sank rückwärts auf die Fersen und legte die Hände auf die Schenkel. Während dieser streng und genau vorgeschriebenen Bewegungen betete er:
„Allahu akbar! Ich preise die Vollkommenheiten meines Herrn, welcher der Allerhöchste ist. Gott ist sehr groß.“
Nun erhob er sich ganz, um stehend fortzufahren, kam aber nicht dazu, denn der Amerikaner sprang jetzt auf und zu ihm hin, zog ihn beim Arme vom Teppich zurück und rief dem Dolmetscher fragend zu:
„Dieser Mensch betet wohl?“
„Ja,“ antwortete der Gefragte.
„Muhammedanisch?“
„Ja.“
„Sagen Sie ihm, daß ich das nicht dulde! Sagen Sie ihm, daß ich ein Christ bin, ein Missionar, welcher zu den Heiden geht, um sie zu bekehren. Ich kann und darf nicht dulden, daß in meiner Gegenwart anders als christlich gebetet wird. Er hat sofort aufzuhören, sofort!“
Es gilt bei den Muhammedanern schon für eine Sünde, an einem Betenden nahe vorüber zu gehen. Ihn mit Worten zu unterbrechen, ist gar nicht denkbar. Ihn aber in der Weise zu stören, wie der Yankee es tat, das würde man nur einem Wahnsinnigen oder einem Todfeinde zutrauen, welcher eine Beleidigung plant, die nur mit Blut abzuwischen ist. Dabei ist es ganz gleich, wes Standes der Betende ist. Beim Besuche der Moschee und auch während der Gebete außerhalb derselben wird der niedrigste dem höchsten und umgekehrt dieser jenem vollständig gleich geachtet. Sejjid Omar war zunächst starr vor Erstaunen, doch seine Augen blitzten. Dann fragte er den Dolmetscher, was der Fremde ihm gesagt habe. Der Levantiner berichtete es ihm mit hämischer Genauigkeit. Da hob Omar die Arme, um den Beleidiger anzufassen, beherrschte sich aber schnell, ließ sie wieder sinken, trat einen Schritt zurück, maß den Amerikaner mit einem unaussprechlichen, halb verächtlichen, halb mitleidigen Blick, warf die Hand leer in die Luft, was ein Zeichen der größten Geringschätzung ist, und richtete an den Dolmetscher die Worte:
„Ich wollte ihn hier vom Felsen hinunterwerfen, und sein Widerstand wäre gegen die Kraft meiner Arme nichts gewesen; aber ich bin Sejjid Omar und will mich nicht durch die Berührung mit einem so großen Schmutz besudeln. Jeder Heide hat mehr Verstand als dieser Nasrani; sage ihm das. Wehe jedem, der zu dem Glauben und zu den Sitten eines so rücksichtslosen Verächters und Störers des Gebetes übertritt! Ich habe nichts mehr mit ihm zu schaffen. Das Geld für meinen Esel schenke ich ihm. Ich mag es nicht berühren!“
Er hob den Teppichgürtel auf, schwang sich auf sein Grautier und ritt im Trabe davon, indem er den Gürtel in vielsagender Weise hinter sich her ausschüttelte. Dem Levantiner war es ein Vergnügen, die Worte Omars in einer Weise zu übersetzen, welche an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Als die Tochter, welche von ihrem Platze aufgestanden war, das hörte, rief sie dem Vater vorwurfsvoll zu:
„Was hast du getan! Ich wollte dich zurückhalten; du warst mir aber zu schnell. Dieser Araber gefiel mir so sehr! Er war so ernst, so still und so bescheiden. Sein Gebet rührte mich. Hieltest du dich wirklich für verpflichtet, es zu unterbrechen?“
„Natürlich!“ antwortete er. „Du sollst keine andern Götter haben neben mir, gebietet die heilige Schrift. Elias hat die Pfaffen Baals geschlachtet. Sein Eifer soll ein Vorbild sein für jeden, der als Glaubensbote zu den Heiden geht!“
„Meinst du nicht, daß unser Gott und Allah ganz derselbe sei?“
„Wer einen anderen Glauben hat, hat auch einen andern Gott! Und andere Götter zu haben ist verboten; das hast du ja gehört!“
„Aber die Liebe, von welcher ihr predigen sollt, macht es euch doch – – – “
„Sei still mit dieser Liebe, von der du nichts verstehst!“ unterbrach er sie schnarrend. „Erst glaube ich; dann liebe ich. Wir haben hinaus in alle Welt zu gehen und alle Völker zu belehren. Von dem Worte aber, welches wir verkünden, sagt die Bibel, daß es ein Hammer sei, der Felsen zerschmettert. Nur dadurch, daß wir diese Macht des Wortes zeigen, können wir den Heiden imponieren. Und dann, wenn sie die Unseren geworden sind, werden wir ihnen unsere Liebe schenken. Wir haben endlich eingesehen, wie weit man mit der Liebe allein kommt. Es ist erwiesen, daß in neuerer Zeit der Islam mehr Fortschritte macht als das Christentum. Das Heidentum wird dem gehören, der es zum Gehorsam zwingt!“
Das klang so entschieden und so hart, daß sie es vorzog, still zu sein. Sie setzte sich wieder nieder, schien sich aber vergeblich zu bemühen, die frühere Stimmung zurückzurufen. Das, was sie vorher begeistert hatte, war ihr gleichgültig geworden, und da der Vater sich übel gelaunt und wortkarg zeigte, so bat sie ihn schließlich, aufzubrechen.
„Sehr gern!“ stimmte er ihr bei. „Es ist eine drückende Hitze hier oben, und wie du es neben der qualmenden Zigarre dieses ungebildeten, rücksichtslosen Menschen aushalten konntest, habe ich mir nicht erklären können.“
„Es ist freilich nichts so widerwärtig wie der Tabaksgeruch; für ihn aber scheint es ein Genuß zu sein; ich habe nicht darauf geachtet.“
Dieser Ausdruck der Herzensgüte und Selbstüberwindung ließ es mich bereuen, daß ich mich nicht so verhalten hatte, wie ich nun wünschte, es getan zu haben. Später fand ich eine erfreuliche Veranlassung, mich an diese ihre jetzigen Worte lebhaft zu erinnern.
Sie ritten fort, wie sie gekommen waren: ohne mir irgendeine Beachtung zu schenken. Der Levantiner mußte laufen, da nun nur noch die beiden Esel da waren, die er besorgt hatte. Es tat mir um der Dame willen leid, daß sie nicht länger blieben, denn die Sonne stand bereits dem Horizonte nahe, und ich hätte den Anblick ihres heutigen Unterganges dem lieben, freundlichen Wesen herzlich gern gegönnt.
Ich war seinetwegen hierher gekommen, hatte mich auf ihn gefreut und machte aber dann, als er eintrat, die Bemerkung, daß ich heut nicht fähig sei, ihn so, wie früher stets, auf mich wirken zu lassen. Die häßliche Szene, deren Zuschauer ich gewesen war, hatte mein Inneres auch überschattet. Das Vorgefallene machte es mir unmöglich, mich dem Eindrucke des herrlichen Naturschauspieles frei und gänzlich hinzugeben. Der Amerikaner hatte einige Aeußerungen getan, welche geistig unterzubringen oder zu überwinden ich mir erfolglos Mühe gab.
So oft ich mich hier auf dieser Höhe befand, sah ich zwei Welten vor mir liegen, die aber in ihrem Zusammenhang doch nur eine einzige waren, und ebenso sah ich zwei Zeiten, welche durch Jahrtausende getrennt zu sein scheinen, im jetzigen Augenblick zu einer wunderbaren, ergreifenden Vereinigung zusammenfließen. Die Gegenwart ist unsere Vergangenheit gewesen und wird auch unsere Zukunft sein. Wer das begreift, der hat nicht nötig, das Innere der Pyramiden zu durchforschen, und braucht auch nicht vor den Rätseln der Sphinx zu bangen, deren Lösung er klar und deutlich in seinem Herzen trägt. Die Menschheit gleicht der Zeit. Beide schreiten unaufhaltsam vorwärts, und wie keiner einzelnen Stunde ein besonderer Vorzug gegeben worden ist, so kann auch kein Mensch, kein Stand, kein Volk sich rühmen, von Gott mit irgend einer speziellen Auszeichnung begnadet worden zu sein. Eine hervorragende Periode ist nur das Produkt vorangegangener Zeiten, und es gibt in der Entwicklung des Menschengeschlechtes keine Geistesrichtung oder Geistestat, welche aus sich selbst heraus entstanden wäre und der Vergangenheit nicht Dank zu zollen hätte. Die Weltgeschichte, welche wir ja das Weltgericht nennen, hat bisher noch jedes Kapitel der Selbstüberhebung mit einem bestrafenden Schluß versehen und diesen Akt der Gerechtigkeit zur Warnung für spätere Generationen in der ernsten, eindringlichen Sprache der Ruinen aufbewahrt. Und diese sprechenden, ja predigenden Ruinen haben uns die Lehre zu erteilen, daß, was im Oriente für uns gestorben ist, im Abendlande für ihn wieder auferstehen soll.
Das war ganz derselbe Gedanke, dem die Tochter des Amerikaners nur einen andern Ausdruck gegeben hatte, als sie von dem schlafenden Prinzen sprach, welchen eine abendländische Jungfrau aufzuwecken habe. Und wie einverstanden war ich mit ihrer Frage: „Was bringe ich mit?“ Wollen wir ehrlich sein, so müssen wir zugestehen: Wer nach dem Morgenlande kommt, der will ihm nicht etwa dankbar sein, sondern noch mehr, immer mehr von ihm haben, als er schon von ihm bekommen hat. Der Osten hat gegeben, so lange und so viel er geben konnte. Wir haben uns an ihm bereichert fort und fort; er ist der Vater, der für und an uns arm geworden ist. Denken wir doch endlich nun an unsere Pflicht!
Wir ahnen gar nicht, welche geistigen Summen wir ihm schuldig sind. Wir werden sie ihm, und zwar mit Zinsen, zurückzahlen müssen, gleichviel, ob wir wollen oder nicht. Die Vorsehung ist gerecht. Sie gibt Kredit, doch nicht für ungezählte Generationen oder gar für Ewigkeiten, und wird weder die Backschischgaben zudringlicher Touristenströme noch die Kurspapiere europäischer Geldgeschäfte, am allerwenigsten aber die aus unseren sogenannten Interessensphären erhofften materiellen Werte als gültige Zahlung anerkennen.
Was haben wir dem Orient bis heute gebracht? Was für Schätze glauben wir überhaupt ihm bringen zu können? „Ich bringe ihm meine Liebe, meine ganze, ganze, volle Liebe,“ hatte die Amerikanerin gesagt, ohne sich dabei bewußt zu sein, daß nur und grad diese Liebe die erlösende Jungfrau ist, welche den schlafenden Prinzen zu neuem Leben zu erwecken hat. – –
Die Sonne war untergegangen; es drohte, schnell dunkel zu werden, und der Weg nach dem Bab el Karafe hinab ist kein angenehmer zu nennen. Darum trat ich nun auch den Heimweg an, der mich durch die Scharia Mohammed Ali und die Tahir-Straße nach dem Hotel führte.
Die öffentlichen Laternen brannten; die Hitze begann, sich zu mildern, und so hatten die Straßen sich belebt. Auf dem Platz Ibrahim Pascha erklang schrille, arabische Musik. Von der Wallfahrt nach Mekka zurückgekehrte Pilger hielten einen Umzug durch die Stadt. Je weiter entfernt von Kairo die Heimat dieser Leute ist, desto lieber geht man ihnen aus dem Weg. Sie haben sich, oder werden auch, in eine fanatische Erregung hineingearbeitet, durch welche sie für Andersgläubige gefährlich werden können. Ich hütete mich also, mich quer durch diesen Zug zu drängen, und wartete lieber, bis er vorüber war. Später am Abend war zu hören, daß am Meidan Abdin einige nicht so vorsichtige Europäer von diesen Leuten halb totgeschlagen worden seien. Ich erwähne das, weil ich noch Weiteres von ihnen zu berichten habe.
Als der Gong die Gäste des Hotels zum Abendessen rief, fand ich den bisher leer stehenden Tisch zu meiner linken Hand besetzt. Der Amerikaner hatte mit seiner Tochter daran Platz genommen. Als ich mich setzte, hörte ich ihn in deutscher Sprache sagen:
„Da ist der unangenehme Mensch ja wieder! Glücklicherweise darf hier nicht geraucht werden!“
„Aber, Vater, ist es nicht möglich, daß er deutsch versteht?“ warnte Mary.
„Das fällt ihm gar nicht ein. Der Dolmetscher sagte doch, als wir vom Mokkatam herunterritten, daß der Fremde, der da oben saß, ein Franzose sei, und einem Franzosen kommt es bekanntlich gar nicht in den Sinn, deutsch zu lernen.“
„Ich würde mich aber doch lieber bei dem Kellner erkundigen. Du weißt ja, wie wenig man sich auf das, was dieser Dolmetscher sagt, verlassen kann. Ich möchte nicht, daß der Fremde von uns beleidigt wird.“
„Hast du eine Schwachheit für ihn?“
„Nein; aber man hat überhaupt mit jedem Menschen möglichst gut zu sein, und dieser hier im besonderen hat ein so – so – so – ich finde den passenden Ausdruck nicht und will daher sagen, er hat ein so loyales Aussehen, daß es mir leid tun würde, wenn er sich durch uns gekränkt fühlen sollte.“
„Ich finde, daß du heut ungewöhnlich zart und ängstlich bist. Daran ist vielleicht der Khamsin schuld, auf den wir leider zu spät aufmerksam geworden sind. Doch, da ist die Suppe!“
Es wurde ihnen serviert und dann auch mir. Während ich das Menu studierte und also auf die Karte sah, hörte ich, daß der Missionar einen Ausruf des Erstaunens ausstieß:
„Heavens! Ein Chinese! Noch einer! Zwei Chinesen, zwei ächte, wirkliche Chinesen, hier in Kairo, in Aegypten! Wer hätte das gedacht! Wo werden sie Platz nehmen?“
„Monsieur Fu“ und „Monsieur Tsi“ kamen langsam durch den Saal gegangen und schritten ihrem Tisch zu. Zwei Kellner eilten herbei, um ihnen die Stühle bequem zu rücken; der eine von ihnen ging dann nach dem Tische der Amerikaner, um dort die leer gewordenen Suppenteller wegzunehmen. Das benutzte der Missionar zu der Erkundigung:
„Sind das dort Chinesen oder vielleicht nur Japaner?“
„Chinesen,“ lautete die Antwort.
„Woher?“
„Aus China.“
„Das ist nicht sehr geistreich von Ihnen. Ich meine natürlich, aus welcher Stadt.“
„Aus Canton.“
„Sind Ihnen vielleicht die Namen bekannt?[„]
„Monsieur Fu und Monsieur Tsi.“
„Fu heißt Mann, auch Mensch, auch Vater. Tsi ist Abkömmling, auch die Folge von Etwas. Sonderbar! Kennen Sie den Stand?“
„Kaufleute. Onkel und Neffe. Sind in Paris gewesen. Machen in Chinawaren.“
„Es ist dort Platz für vier Personen. Wir werden uns zu ihnen hinübersetzen. Hier ist meine Karte, die Sie ihnen hinübertragen!“
„Hm! Ich weiß nicht, ob ich darf!“
„Darf? Warum nicht?“
„Sie wollen allein sein, ganz ungestört speisen.“
„Das geht mich nichts an! Ich bin Missionar, gehe nach China und werde die Gelegenheit natürlich sofort ergreifen, diese für mich hochinteressante Bekanntschaft zu machen. Also ich bitte, geben Sie meine Karte ab!“
Der Kellner bewegte den Kopf bedenklich hin und her, überlegte ein Weilchen und entschied dann:
„Ich kann das nicht auf mich nehmen und werde Ihnen also den Herrn Direktor schicken.“
Als er sich entfernt hatte, hörte ich, daß die Tochter im Tone der Besorgnis fragte:
„Aber, Vater, ist das nicht vielleicht ein gesellschaftlicher faux-pas von dir?[“]
„Wieso faux-pas?“ erwiderte er. „Ist es ein Fehler, Jemand kennen lernen zu wollen?“
„Aber auf diese ungewöhnliche Weise! Das ist schon bei uns und in Europa verboten, und in China soll man in Beziehung auf neue Bekanntschaften noch viel strenger sein!“
„Du vergissest, daß wir nicht in China, sondern in Kairo sind. Hier gelten die Regeln aller und also eigentlich keiner Welt. Ferner bin ich Missionar, und sie sind Heiden. Ich denke an meine Wette mit Reverend Burton. Welch ein Erfolg, ihm schon von hier aus berichten zu können, daß ich zwei Chinesen bekehrt habe, noch ehe ich in China angekommen bin!“
„Aber, wir sitzen hier so gut, so allein, so ungestört. Ich bitte dich!“
„Die Unterhaltung mit ihnen steht mir höher als unser Alleinsein!“
„Aber ich, was werde ich sagen, die ich kaum hundert Worte chinesisch kenne?“
„Du wirst schweigen, was für euch Damen bekanntlich das Allerbeste ist.“
„Ich befürchte doch, daß wir zudringlich sind!“
„Zudringlich? Pshaw! Sie sind Kaufleute, handeln mit Chinawaren. Es ist also eine Ehre für sie, wenn wir uns zu ihnen setzen.“
Der Direktor kam. Das Verlangen des Amerikaners schien auch ihm ungelegen zu kommen, doch nahm er schließlich die Karte, um sie dem älteren Chinesen zu geben. Dieser las den Namen, hörte das, was der Direktor ihm sagte, an, ohne eine Miene zu verziehen, und gab dann seine Einwilligung durch ein kurzes Neigen seines Kopfes zu erkennen. Das hatte ich nicht erwartet. Doch als er hierauf seine beiden kleinen, feinen Hände an den tief herabhängenden Spitzen seines Bartes herniedergleiten ließ, leuchtete aus seinen Augen ein kurzer, fast unbemerkbarer Blick zu seinem Sohne hinüber, den dieser mit einer leisen, zitternden Bewegung seines Fächers erwiderte. Ostasien kam dem Wunsch der Vereinigten Staaten jovial entgegen.
Der Direktor überbrachte die Antwort. Mary erhob sich, wie sie nicht verbergen konnte, nur höchst ungern von ihrem Platze; ihr Vater aber schritt einem Sieger gleich mit ihr an meinem Tisch vorüber, den Chinesen zu, welche langsam und feierlich aufstanden und ohne irgend eine Bewegung der Höflichkeit ihnen stumm entgegenblickten. Der Missionar verbeugte sich vor ihnen und redete sie in einer Sprache an, welche er wahrscheinlich für gutes Chinesisch hielt. So sehr ich aufpaßte, so verstand ich nur den Namen Waller, welcher jedenfalls der seinige war, und dann noch das Wort tschui, welches „sich an Jemand anschließen“ bedeutet. Als er geendet hatte, schienen die Chinesen grad auch so viel oder so wenig verstanden zu haben, denn sie gaben zunächst keine Antwort, sondern Fu deutete an Stelle derselben auf die beiden Stühle, welche Vater und Tochter einnehmen sollten. Sie setzen sich, Mary in außerordentlicher Verlegenheit. Da die Chinesen beharrlich schwiegen und unbeweglich wie Statuen saßen, so begann der Missionar, eine zweite Rede zu halten, deren Wirkung keine andere als die der ersten war, denn als er mit ihr zu Ende war, fragte Fu in einem weit besseren als dem gewöhnlichen Canton-Englisch:
„Bitte, mir zu sagen, in welcher Sprache Sie soeben zu uns gesprochen haben!“
„Es ist ja chinesisch!“ antwortete der Gefragte, ganz erstaunt über diesen unvermuteten Erfolg seiner Sprachfertigkeit. „Ich habe gehört, daß Sie Chinesen sind, und hoffe sehr, daß man mir nicht falsch berichtet hat!“
„Ja, wir sind aus China; aber dieses Land ist ungeheuer groß. Wir haben es noch nicht in allen seinen Teilen bereist und sind also wohl noch nicht in der Gegend gewesen, wo man den Dialekt spricht, den Sie sich angeeignet haben. Darf ich fragen, in welchem Teil des Landes diese Gegend liegt?“
Im ersten Teile dieser Rede war Fu so rücksichtsvoll gewesen, für die Unkenntnis des Amerikaners nach einem Grunde der Entschuldigung zu suchen. Aus seiner letzten Frage aber sprach der Schalk. Ohne dies zu bemerken, antwortete der Missionar:
„Ich bin noch nicht in China gewesen und reise jetzt zum ersten Male hin.“
„So haben Sie sich diesen Dialekt auf einer Universität der Vereinigten Staaten angeeignet?“
„Nein, sondern auf eine viel leichtere und bequemere Art. Sie wissen wahrscheinlich wohl, daß wir Amerikaner praktisch sind, und es ist Ihnen auch nicht unbekannt, daß sehr viele Chinesen, fast mehr, als uns lieb ist, in unseren Staaten wohnen. In meinem Hause waren zwei beschäftigt, der eine als Wäscher und der andere als Barbier. Der Wäscher stammte aus Nord- und der Barbier aus Südchina, und da ich nicht wünschte, in Beziehung auf die Sprache einseitig ausgebildet zu sein, habe ich von Beiden Unterricht genommen.“
Hierauf trat eine momentane Stille, ja, eine Mäuschenstille ein. Die Gesichtszüge der Chinesen blieben vollständig unbewegt; aber Mary errötete bis an die Stirn hinauf. Sie ahnte wohl, wie unsterblich sich ihr Vater soeben blamiert hatte; dieser aber wendete sich ganz heiter und unbefangen dem Kellner zu, welcher ihm jetzt den nach der Suppe folgenden Gang servierte.
„Sie sind also Missionar, wie ich auf Ihrer Karte gelesen habe?“ fragte Fu nach einer Weile.
„Allerdings,“ antwortete der Gefragte. „Ich hoffe, daß Sie wissen, was das heißt!“
„Das heißt, Sie kommen zu uns, um unsere Religion zu studieren und sie dann in den Vereinigten Staaten zu verbreiten?“
Da legte Waller – denn dies war allerdings der Name des Missionars – schnell das Messer und die Gabel weg, warf einen Blick der Ueberraschung auf den Sprecher und antwortete:
„Ich gestehe, daß ich noch nie in meinem Leben eine so unbegreifliche Frage gehört habe! Ich bin ein Christ und habe also denjenigen Glauben, welcher der einzig wahre und richtige ist. Sie aber, der Sie sehr wahrscheinlich Confucianer sind, sollten dem Ihrigen, der ein falscher ist, entsagen und sich entschließen, ein Christ zu werden!“
„Ich bin ja Christ,“ antwortete der Chinese, indem über sein Gesicht ein ungemein höfliches, ja verbindliches Lächeln glitt.
„Sie – – sind – – – Christ – – –?!“ wiederholte der Amerikaner die Worte des Andern mit dem Ausdrucke des Erstaunens. „So sind Sie also schon bekehrt?“
„Bekehrt? O nein! Wozu das? Eine Aenderung des Glaubens würde vollständig überflüssig sein. Wer etwas tut, was gar nicht nötig ist, der verdient, ein Tor genannt zu werden.“
„Ich verstehe Sie nicht. Sie sind nicht bekehrt, also noch Confucianer, und behaupten doch, ein Christ zu sein. Wollen sie mir dieses Rätsel lösen!“
„Es ist kein Rätsel, sondern eine Sache, welche in China Jedermann schon längst begriffen hat. Ich bitte Sie, mir die Summe des christlichen Glaubens zu nennen!“
Mr. Waller setzte sich auf seinem Stuhle zurecht und begann zunächst, vom Sündenfalle zu sprechen. Während dessen brachte der Kellner den Chinesen die Suppe. Fu wies sie mit der kurzen Bemerkung zurück, daß er mit seinem Begleiter später oben im Zimmer speisen würde. Dann wendete er seine Aufmerksamkeit dem Yankee wieder zu. Er ließ ihn eine lange, lange Zeit sprechen, ohne ihn zu unterbrechen, und erst dann, als sich nach der Verheißung Abrahams eine Pause einstellte, sagte er:
„Ich bat Sie nicht um eine ausführliche Geschichte, sondern um die kurze Summierung Ihres Glaubens!“
„Aber Sie kennen doch unseren Glauben nicht; Sie würden mich also nicht verstehen, wenn ich Ihnen anstatt seiner ganzen Entwicklung nur eine kurze Aphorisme brächte!“
„O bitte! Was deutlich ist, kann vielleicht auch wohl von einem Chinesen begriffen werden. Christus ist der Gründer Ihres Glaubens, und Petrus wurde mir als derjenige Apostel bezeichnet, welchem die größte Macht des Christentums, das Amt der Schlüssel, übergeben wurde; Sie werden also das, was diese Beiden sagen, anerkennen. Christus gibt uns die Summe im Evangelium Johannes, wo er sagt, daß das ganze Gesetz und die Propheten in dem Gebote enthalten seien: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten! Und Petrus befiehlt in seinem ersten Briefe: „Fürchtet Gott; habt die Brüder lieb, und ehret alle Menschen!“ Das ist es, was ich von Ihnen hören wollte.“
Es war interessant, jetzt das Gesicht Wallers zu sehen. Das Erstaunen über die unerwartete Belesenheit des Chinesen lag nicht nur in seinen Zügen, sondern auch in seiner ganzen Haltung deutlich ausgedrückt. Er öffnete zwar den Mund, antwortete aber nicht. Fu tat, als ob er diesen Eindruck seiner Worte gar nicht bemerke, und fuhr fort:
„Das war also die Summe Ihres Glaubens nach den Worten Christi und seines obersten Apostels. Die Summe unseres Glaubens aber lautet: „Die wahre Glückseligkeit kommt uns vom Himmel hernieder, und die Menschen sollen sie neidlos und friedlich unter sich verteilen.“ Das ist doch genau dasselbe. Ihr Glaube und unser Glaube sind einander also gleich. Wenn ich dem meinigen gehorche, handle ich, wie ein Christ zu handeln hat, und wenn Sie tun, was der Ihrige gebietet, so sind Sie das, was Sie vorhin einen Confucianer genannt haben.“
Diese Art der Auffassung brachte dem Amerikaner die Sprache wieder.
„Bitte sehr!“ rief er aus. „Ich, ein Confucianer! Welch eine Logik! Zwar scheint Ihnen unsere Bibel nicht unbekannt zu sein, aber Sie können unmöglich eine Ahnung von den zahllosen Verschiedenheiten haben, welche zwischen Ihrem Glauben und dem christlichen vorhanden sind!“
„Das tut nichts!“ lächelte Fu. „Diese Verschiedenheiten müssen vorhanden sein, weil die Menschen verschieden sind. Ihr Christen liegt ja untereinander selbst im Streit! Es kommt nur auf den Ertrag, auf das Ende, auf den Abschluß, auf die Summe an. Wenn zwei Rechnungen genau dieselbe Summe ergeben, so ist das ein Beweis, daß beide richtig sind. Vielleicht sind einzelne Posten anders benannt; einige hier zusammengezogen, dort aber auseinander gehalten worden; die eine ist mit lateinischer Schrift, die andere in chinesischen Zeichen geschrieben; man hat die eine von links nach rechts, die andere aber umgekehrt zu lesen. Das ist Alles, Alles zwar nicht gleichgültig, aber doch nur Nebensache. Die Hauptsache ist, daß die Summen stimmen. Und wenn sie gleich sind, so ist die eine Rechnung genau so viel wie die andere wert, und keiner von Denen, die sie geschrieben haben und dem Himmel präsentieren, darf behaupten, daß die Buchführung des Anderen eine falsche sei. Sie haben gesehen, daß unsere Religionen ganz genau dieselbe Summe ergeben. Daß die einzelnen Posten geschichtliche oder nationale Verschiedenheiten zeigen, gibt der Berechnung Leben und Interesse, und es darf nicht außer Acht gelassen werden, daß die Richtigkeit der einen Rechnung gar nicht ohne die Richtigkeit der anderen zu beweisen wäre. Indem Ihr Glaube ganz dieselben Früchte wie der unsere bringt, beweisen Sie uns, daß er auf keinem Irrtume beruht, und wir würden ebenso unhöflich wie unklug handeln, wenn wir behaupteten, daß es für Sie notwendig sei, ihm zu entsagen und sich zu dem unsern zu bekehren.“
Der Missionar war den Worten des Chinesen mit einer Aufmerksamkeit gefolgt, welche sich nach und nach immer mehr in Verwunderung verwandelte. Er hatte nicht für möglich gehalten, daß der Spieß auf eine solche Weise herumgedreht werden könne, und da es ihm an Gedanken und also auch an Worten zu einer Entgegnung fehlte, so wandte er sich in seiner Verlegenheit an seine Tochter:
„Hast du es gehört, Mary? Man ist so höflich und so klug, mich nicht bekehren zu wollen! Diese ‚Summe“ der Religionen kommt mir ungemein verdächtig vor. Man hat darüber nachzudenken!“
„Das können Sie sich ersparen“, bemerkte der Chinese. „Christus sagt im Matthäus zweimal kurz hintereinander: ‚An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen!“ Die Früchte aber ergeben doch die Summe von des Baumes Tätigkeit und Wert. Sie hören, daß ich als Christ zu Ihnen spreche!“
„Aber woher kommt Ihnen denn diese Kenntnis unserer heiligen Schrift?“
„Aus dem Gehorsam gegen unsere heiligen Schriften, welche es mir zur Pflicht machen, alle Wege kennen zu lernen, die zum Heile führen. Ueberall, wo ein Tempel oder eine Kirche steht, ist ein solcher Weg geöffnet. Der Eine geht ihn von dem Tempel, der Andere von der Kirche aus; Beide aber wandern nach derselben Stelle, wo die Ernte abzuliefern und die Rechnung vorzulegen ist.“
„Sie meinen den Tod? Aber das ewige Leben nach demselben? Die Seligkeit? Was wissen Sie von dieser?“
„Wir wissen, daß unsere Ahnen sich dort befinden, und wir verehren sie. Sie glauben, daß Ihre Seligen, Ihre Heiligen dort wohnen, und senden ihnen Ihre Gebete zu. Ist das nicht ganz dasselbe?“
„Was das betrifft, so werden Sie auf diese Ihre Ahnen wohl verzichten müssen, denn – – – “
„Müssen? Müssen?“ fiel ihm da Fu schnell in die Rede.
Er sah aus, als ob er zornig aufspringen wolle. Es war gewiß, daß der Amerikaner gar nicht ahnte, wie viele Fehler er gemacht hatte. Waren ihm denn die Sitten der Chinesen wirklich so unbekannt, wie man aus seinem Verhalten schließen mußte? Dann hätte er zu Hause bleiben sollen! Oder fühlte er sich von seinem Berufe in der Weise begeistert, daß es außer seinen Bekehrungswünschen keine anderen Rücksichten für ihn gab? Oder gehörte er zu der gar nicht seltenen Sorte von Kaukasiern, welche meinen, daß die Angehörigen anderer Rassen nicht nur gegen körperliche, sondern auch gegen seelische Mißhandlungen weniger empfindlich sind als wir? Daß er in dieser Weise über die Ahnen sprach, war eine Rücksichtslosigkeit, die gar nicht größer sein konnte, und ich war überzeugt, daß die Chinesen entweder ihn von ihrem Tisch weisen oder sich selbst entfernen würden, zumal sie von ihm infolge ihrer Gebräuche gezwungen worden waren, auf das Essen zu verzichten, was er aber gar nicht beachtet zu haben schien. Doch geschah nicht, was ich vermutet hatte. Fu beherrschte sich. Er fuhr in demselben freundlichen Tone, in welchem er früher gesprochen hatte, fort:
„Wer auf seine Verstorbenen verzichtet, der ist nicht wert, daß sie für ihn gelebt haben. Er würde ja dadurch auf sich selbst verzichten, weil er sein Dasein nur dem ihrigen verdankt.“
Da traf ihn ein warmer Blick aus Marys Augen. Es war ihr wahrscheinlich nicht entgangen, daß es ihm Ueberwindung gekostet hatte, ruhig zu bleiben, und es drängte sie, ihm ein zustimmendes Wort zu sagen:
„Wer könnte einen solchen Verzicht verlangen! Wie wäre es mir möglich, der verstorbenen Mutter zu vergessen, deren Liebe mir eine ganze Welt gegeben hat! Ich kann sie mir nicht tot denken. Ich weiß, sie ist noch heut bei mir, wie sie stets bei mir gewesen ist. Der Unterschied ist nur, daß ich sie früher sah, jetzt aber nicht mehr sehen kann. Aber ich fühle sie. Seit ihrem Scheiden wohnt und wirkt in mir Etwas, was vorher nicht vorhanden war. Die, welche der Sprachgebrauch so fälschlich Tote nennt, haben vielleicht größere Macht über uns, als wir uns denken können.“
„Mary, du sprichst sehr sonderbar!“ antwortete ihr Vater in verweisendem Tone.
Tsi, welcher aus Hochachtung vor seinem Vater bisher noch kein Wort gesprochen hatte, hielt die Augenlider halb gesenkt und den Kopf ihr leise zugeneigt, als ob er wünsche, daß sie weitersprechen möge. War es nur der tiefe Wohllaut ihrer Stimme oder auch der Inhalt ihrer Worte, der dies bewirkte? Fu, welcher sie nur einmal mit einem flüchtigen Blick gestreift, dann aber nicht mehr beachtet hatte, wendete ihr jetzt sein Gesicht voll zu, betrachtete das ihrige mit offenem Interesse und sagte dann in einer Weise, mit welcher er wohl noch kein chinesisches Mädchen ausgezeichnet hatte:
„Ich danke Ihnen, Miß Waller! Nichts kann so falsch sein, wie die Vorstellungen, welche man sich bei Ihnen über unsern „Ahnenkultus“ macht, der aber gar kein „Kultus“ ist. Man legt dabei die abergläubischen Gepflogenheiten unserer untersten Volksklasse zu Grunde, doch ist das grad und genau so falsch, als wenn wir Ihre Seligen und Heiligen mit den Augen des Gespensterglaubens betrachten wollten, der in den niederen Kreisen Ihrer Bevölkerung vorhanden ist. Es kann uns nicht einfallen, an Sie die Forderung zu stellen, auf den Himmel dieser Seligen zu verzichten; aber ebensowenig wird uns eine Macht der Erde dazu bringen, der beglückenden Ueberzeugung abtrünnig zu werden, daß auch unsere Abgeschiedenen nicht gestorben sind. Was Sie von ihrer [Ihrer] Mutter sagen, das klingt in meinem Herzen freudig wieder. Auch wir Chinesen haben Mütter, die in unserer Liebe noch nach dem Tode weiterleben, und ein Volk, welches seine Mütter, seine Väter, seine Ahnen nicht vergißt, wie der Europäer sie vergißt, der oft die Vornamen des Großvaters seines Vaters oder seiner Mutter nicht mehr kennt, ein solches Volk schlägt seine Wurzeln so tief in die Vergangenheit, aus der es Kraft und Nahrung zieht, daß es um seine Zukunft nicht zu bangen braucht. Nur der, welcher den geistigen Boden nicht kennt, auf dem wir leben, kann von der „Greisenhaftigkeit des gelben Mannes“ sprechen. Sie sehen, der Ruf, in dem wir stehen, ist mir nicht unbekannt. Aber wer die Vergangenheit nicht achtet, der hat für die Zukunft keinen Wert. Die Stammbäume auch Ihrer alten Geschlechter sind nicht nur von genealogischer Bedeutung, sondern es steigt ein sich stets verjüngendes Leben in ihren Zellen auf und nieder, und in ihrem Schatten können sich alle Jene sammeln, welche ihren inneren Zusammenhang mit der Nation verloren haben, weil sie ihre Zugehörigkeit zum Stamm nicht pflegten und nun nur verwehte Blätter längst entlaubter Bäume sind, Völkerhumus, in welchem das Gedächtnis so manches edlen Geistes und so mancher schönen Tat den Erstickungstod gefunden hat. Eines solchen Todes haben wir Chinesen das Andenken Derer, von denen wir stammen und deren geistige Hinterlassenschaft wir zu pflegen und zu wahren haben, nicht sterben lassen. Wir sind uns des Zusammenhanges mit ihnen bewußt; wir gedenken ihrer; wir feiern ihre Erinnerungstage, und wenn dies von dem gewöhnlichen Manne, der für geistige Opfer und Liebesgaben kein Verständnis hat, in mehr materieller Weise geschieht, als es eigentlich im Sinne dieser Ehrung der Vorfahren liegt, so wird doch nur Jemand, dem es an Einsicht fehlt, behaupten können, daß es sich um eine abergläubische Verirrung oder gar um eine Abgötterei handele, durch welche unsere Intelligenz sich bis auf unter Null herabgesunken zeige. Sie sind eine Dame, Miß Waller, und halten das Andenken Ihrer Mutter heilig; ich bin ein Mann und sage, wir bleiben dem Gedächtnisse unserer Väter treu. Ist das nicht ganz dasselbe? Wollten Sie mich verurteilen, so müßte ich auch Ihnen Unrecht geben, und ich denke doch, daß weder Sie noch ich eine Ursache haben, uns in dieser Weise wehe zu tun!“





























