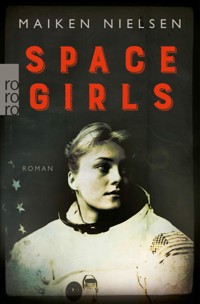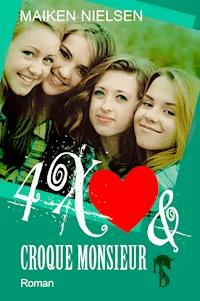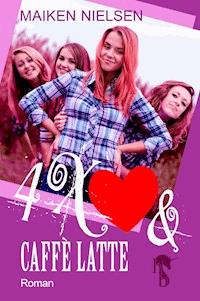9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon als kleiner Junge auf Sylt will Christian Nielsen nur eins: fliegen lernen. Aber die Nielsens sind arme Inselbewohner, und als sein Vater im Ersten Weltkrieg fällt, ist der Traum vom Fliegen vollends unerreichbar. Immerhin kann er auf der Yacht eines amerikanischen Millionärs anheuern und mit ihm auf Weltreise gehen. Die junge Lil Kimming will in New York Karriere als Journalistin machen und über die erste Weltumrundung mit dem Luftschiff schreiben. Die Amerikaner sind begeistert von der Erfindung des deutschen Zeppelins. Also klappert sie die Redaktionen der großen New Yorker Zeitungen ab. Auf der Straße stolpert sie und wird gerade noch von einem jungen, fremden Matrosen aufgefangen. Sie haben keine Zeit, sich miteinander bekannt zu machen, aber Lil kann ihn nicht vergessen. Dann bricht die Börse an der Wall Street zusammen, die größte Wirtschaftskrise der Geschichte beginnt, und es scheint, als hätten sich Christian und Lil für immer verloren. Aber Christians Traum geht doch noch in Erfüllung: Er wird Luftschiff-Offizier – und kann wieder nach Amerika reisen. Im Mai 1937 bricht er als Navigator auf der «Hindenburg» nach Lakehurst bei New York auf, um seine Lil wiederzusehen. Doch dann geht der Zeppelin in Flammen auf ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Maiken Nielsen
Und unter uns die Welt
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Schon als kleiner Junge auf Sylt will Christian Nielsen nur eins: fliegen lernen. Aber die Nielsens sind arme Inselbewohner, und als sein Vater im Ersten Weltkrieg fällt, ist der Traum vom Fliegen vollends unerreichbar. Immerhin kann er auf der Yacht eines amerikanischen Millionärs anheuern und mit ihm auf Weltreise gehen.
Die junge Lil Kimming will in New York Karriere als Journalistin machen und über die erste Weltumrundung mit dem Luftschiff schreiben. Die Amerikaner sind begeistert von der Erfindung des deutschen Zeppelins. Also klappert sie die Redaktionen der großen New Yorker Zeitungen ab. Auf der Straße stolpert sie und wird gerade noch von einem jungen, fremden Matrosen aufgefangen. Sie haben keine Zeit, sich miteinander bekannt zu machen, aber Lil kann ihn nicht vergessen.
Dann bricht die Börse an der Wall Street zusammen, die größte Wirtschaftskrise der Geschichte beginnt, und es scheint, als hätten sich Christian und Lil für immer verloren. Aber Christians Traum geht doch noch in Erfüllung: Er wird Luftschiff-Offizier – und kann wieder nach Amerika reisen. Im Mai 1937 bricht er als Navigator auf der «Hindenburg» nach Lakehurst bei New York auf, um seine Lil wiederzusehen. Doch dann geht der Zeppelin in Flammen auf ...
Über Maiken Nielsen
Maiken Nielsen wurde 1965 in Hamburg geboren. Einen Teil ihrer Kindheit und Jugend verbrachte sie auf Frachtschiffen und wurde dort von ihren Eltern unterrichtet. Sie absolvierte ihr Abitur in Hamburg und reiste danach ein Jahr lang per Anhalter durch Europa. Im Anschluss an diese Reise studierte sie u.a. Linguistik in Aix-en-Provence. Sie liest und spricht sechs Sprachen.
Seit 1996 arbeitet Maiken Nielsen als Autorin, Reporterin und Rundfunksprecherin für das NDR-Fernsehen. Für die Geschichte ihres Großvaters Christian Nielsen, der als einer der wenigen das «Hindenburg»-Unglück überlebte, recherchierte sie sieben Jahre lang.
Und wenn vielleicht in hundert Jahren
Ein Luftschiff hoch mit Griechenwein
Durchs Morgenrot käm’ hergefahren,
Wer möchte da nicht Fährmann sein?
Dann bög’ ich mich, ein sel’ger Zecher,
Wohl über Bord von Kränzen schwer,
Und gösse langsam meinen Becher
Hinab in das verlassne Meer.
Gottfried Keller
Prolog
Es sah wie ein riesiger Fisch aus, nur dass es in dem Luftmeer über ihm schwamm. Silbergrau schob es sich durch die Wolkenströmung, Grau in Grau strudelte es dort oben, aber der Fisch trieb ganz ruhig hindurch.
Christian legte den Kopf in den Nacken und wackelte an seinem Milchzahn. Ein solches Wesen hatte er noch nie gesehen, nicht, wenn er mit dem Vater auf die Nordsee hinausfuhr, nicht beim Angeln mit Onkel Per. Nicht auf der Hauptstraße, auf der die Karren zuckelten. Kein Haus, nicht einmal das Gehöft, auf dem die kleine Robbe wohnte, war so mächtig wie das Wesen, das über ihn hinwegglitt und nun, da die Sonne durchbrach, einen gewaltigen Schatten auf die Inselerde warf. Christian konnte den Fisch jetzt deutlich hören, wie er über ihm durch den Wind sirrte, und er konnte sogar seine Flossen sehen, so dicht schwebte er über seinem Kopf.
Plötzlich kippte der Zahn nach vorne, an dem Christian gewackelt hatte. Mit der Zungenspitze konnte er die Kuhle ertasten, in der der Zahn eben noch gesessen hatte.
Noch Jahre später sollte er sich an alles erinnern: den Silberfisch im Himmel, das Loch in seinem Mund. Die Mutter weinend zu Hause, der Vater mit einem Brief in der Hand. Obwohl niemand in der Stube redete, konnte Christian gar nichts sagen – nichts über den Fisch im Himmel und nichts über seinen ersten verlorenen Zahn. Die Großen schwiegen auch, als Onkel Per aus Keitum kam, der seine Tasche schon gepackt hatte. In ihr Schweigen passte kein Wort hinein.
Was Krieg war, konnte Christian nicht begreifen an diesem 20. November 1914. Aber etwas war anders, das spürte er. So, als habe der Himmelsfisch die Zeit in zwei Hälften zerteilt.
Etwas hatte sich verändert. Lil spürte es. Ihr Kopf fühlte sich wie eines dieser Bücher aus der Bibliothek an, mit Zeichnungen von Dingen, die es jenseits des großen Wassers gab, und mit Buchstaben, die sie auf einen Bogen Papier kopierte, obwohl sie noch immer nicht zur Schule ging, A, B und C. Ihr Kopf war voll, Wörter und Fragen schwirrten darin. Ob sie die Stadt denn nie wiedersehen würden, wollte sie vom Vater wissen, der die Luft in Kringeln ausblies, und dann sah sie auch zur Mutter hinüber, die noch auf ihrem Klavierschemel saß. Natürlich würden sie zurückkehren, sagte der Vater. Eines Tages. Aber dort, wo sie jetzt hinzögen, gebe es auch ein Meer, ein viel schöneres sogar.
Pearl Harbor, Perlenhafen. Ob sie Freundinnen in diesem Pearl Harbor haben würde, wollte sie wissen, und ob die Mädchen dort auch mit Reifen trudelten. Der Vater sah zur Mutter hinüber, aber die begann auf einmal Klavier zu spielen, so schnell, dass ihre Finger über die Tasten tanzten, und so laut, dass das, was der Vater sagte, jetzt darin unterging.
Lil wurde der Kopf noch schwerer. Die Ohren taten ihr weh. Draußen klapperte eine Pferdekutsche über das Pflaster, der Sturm brüllte gegen die Fenster, und hier drinnen donnerte die Mutter am Klavier. Sie dachte an all das, was sie nicht mehr sehen würde, wenn sie in diesen Perlenhafen zögen mit dem schöneren Meer: an Myra mit der Zahnlücke und den Sommersprossen, an ihre Spiele im Schatten der hohen Häuser am Broadway, die Kirche mit dem abgemagerten Jesuskind darin.
«Wir fahren in einer Woche», sagte der Vater. «Du hast also noch genug Zeit, dich von allen zu verabschieden.»
Lil griff nach einem Buch, dessen Wörter sie fast alle kannte. Bilder formten sich in ihrem Kopf, wenn sie in dem Band las, sie sah den Zyklon vor sich, der ein Mädchen namens Dorothy davonwirbelte, in ein Land namens Oz. Die Welt draußen wurde dann leise, und sie selbst ganz ruhig.
Sechstausend Kilometer trennten Lil und Christian, zwei Vierjährige, die eine in New York, der andere auf Sylt. Aber die Welt begann, kleiner zu werden. Immer mehr Sylter beantragten, aus dem preußischen Untertanenverband entlassen zu werden, jeden Monat machte sich wieder jemand auf den Weg in die Neue Welt. Unablässig legten Auswandererschiffe von Hamburg und Bremerhaven ab, dampften zwei Wochen lang über den Atlantik und erreichten schließlich Amerika.
Immer wieder sah Christian die Männer mit Koffern und Seesäcken beladen Abschied nehmen von der Insel. Und Lil sah sie ankommen: die Menschen, vielleicht von einem Zyklon vertrieben, vielleicht auf der Suche nach einem Land namens Oz. Genau konnte sie das nicht sagen. Sie redeten in Sprachen, die sie nicht verstand.
Und dann rückten die Kontinente noch enger zusammen. Einen Weltkrieg und ein weiteres Jahr später gelang es zwei Briten, den Ozean ohne Zwischenstopp zu überfliegen.
Das Zeitalter der Menschen, die den Himmel beherrschten, begann.
1
Der Sturm drückte die Pinnas in eine Talfahrt. Christian klammerte sich an den Kreuzmast, während das Schiff immer tiefer rauschte. Er rutschte ab und wäre in die See gespült worden, wenn der Koch ihn nicht am Arm gepackt hätte. Dann wieder ein Gipfel, den sie erklimmen mussten. Und noch mal hinab in ein strudelndes Loch. Stunde um Stunde wühlte sich der Dreimaster durch das lärmende Wassergebirge. So wankte er aus der Nacht ins Morgenlicht. Wie Onkel Per aus Keitum, der im Schützengraben verrückt geworden war, dachte Christian. Wie ein Mensch, den man nicht halten kann.
Eine Wand aus Wasser wuchs vor ihnen in die Höhe, größer als jede andere, die Christian bislang gesehen hatte. So hoch ragte die Wand auf, dass alles dahinter verschwand. Christian spürte, wie es ihn nach hinten drückte. So steil war die Wand, dass die Pinnas sich aufrichtete. Mit der Bugspitze nach oben schob sie sich das senkrechte Wasser hinauf.
Das Schiff hatte die Spitze erklommen. Alles konnte er jetzt erkennen: die See, die wie ein Berg war, und den ganzen geballten Himmel und Fietes Fluch, den man nicht hören konnte, so laut brach der Berg. Das Wasser donnerte ihm eiskalt entgegen, aber etwas anderes war noch lauter, und das war Holz, das brach. Das Schiff wurde in die Tiefe geschleudert, in ein strudelndes Tal. Christian fühlte, wie es ihn mitriss, wie der Fall in den Abgrund nicht enden wollte und wie ihm ein Schmerz in den Kopf schoss, dass es nicht mehr zum Aushalten war. Das Tosen und Prasseln verstummte. Finsternis hüllte ihn ein.
Er sah die Augen der Mutter beim Abschied, hörte ihre zärtliche Stimme, konnte ihre Angst in der Umarmung fühlen. Wie fest sie ihn an sich gepresst hatte. Das neue Hemd war ganz knittrig davon geworden. Er sah sich selbst lachen und sagen, sie solle sich keine Sorgen machen. Und dann war die kleine Robbe aufgetaucht, das Mädchen, mit dem er gespielt hatte, solange er denken konnte, und hatte ihm einen Kuss auf die Wange gedrückt. Die Sonne hatte geschienen, als er von Sylt losgefahren war, Wind hatte die Baumhecken gezaust. Bald würde der Herbst kommen und mit ihm die Äpfel, hatte er gedacht. Die kleine Robbe war auf ihrem Fahrrad ein Stück neben dem Zug hergefahren. Mit ihrem ganzen Gewicht hatte sie sich in die Pedale gestemmt, und ihre langen Zöpfe waren im Wind geflogen, so schnell war sie gefahren, um mit dem Zug mithalten zu können, bis sie schließlich zurückgefallen, kleiner geworden und ihre Silhouette aus seinem Blickfeld verschwunden war. So hatte er sie in den letzten Tagen immer vor sich gesehen, wenn seine Sehnsucht nach zu Hause groß geworden war. Und so würde sie ihn begrüßen, wenn er den Fall und den Schmerz überlebte, das wusste er.
Er erwachte vom Krächzen der Neuweltgeier. Jemand hatte ihn an einem Mast festgebunden. Noch immer gleißte der Schmerz in seinem Kopf. Ein grünliches Licht zuckte über den Himmel, und es fing an zu regnen. Nadeltropfen stachen ihm in die Haut. Als er an sich hinabsah, bemerkte er, dass seine Leinenhose zerfetzt war. Er wollte den anderen zurufen, sie mögen ihn losbinden, aber zu seinem Entsetzen konnte er den Mund nicht bewegen. Etwas schien sich in seinem Gesicht verkantet zu haben, so als passe oben und unten nicht mehr zusammen. An Backbord sah er aus einem Wellental Mastspitzen ragen, und er erinnerte sich daran, was der Kapitän gesagt hatte, als sie auf die Südspitze Amerikas zugesegelt waren: Kap Hoorn war der Schiffsfriedhof der Welt.
Erneut begann das Schiff zu rollen, und er musste seine ganze Kraft aufbieten, damit er mit dem schmerzenden Kopf nicht auf das Holz aufschlug.
«Vor- und Großmast sind gebrochen», erklärte der Koch, als er sah, dass Christian wieder bei Sinnen war. «Der Mannschaftswohnraum ist eingeschlagen, alles überflutet, deshalb haben wir dich hier festgemacht. Der nächste Orkan zieht schon auf. Kannst du wieder stehen?»
Christian deutete auf sein Gesicht, um Fiete anzuzeigen, dass etwas darin kaputt sei, und der Koch betastete die Knochen in seinen Wangen und in seinem Kinn.
«Kiefer gebrochen», befand er schließlich. «Tut mir leid.»
Im nächsten Augenblick packte Fiete sein Gesicht, als wolle er es auseinanderreißen, und dann knackte etwas, und der Schrei, der sich aus ihm löste, klang in seinen Ohren noch lauter als das Tosen der See. Aber das Gefühl, dass oben nicht auf unten passte, war verschwunden, und er wollte sich bei Fiete bedanken, aber der Koch verbot ihm zu sprechen und wankte fort. Aus den Augenwinkeln sah Christian, dass er zur geborstenen Takelage schlitterte und ein Stück Holz herunterschlug.
«Der Kiefer muss geschient werden.» Fiete legte das Stück Holz an Christians Gesicht, um Maß zu nehmen, doch in diesem Moment holte das Schiff stark über, und Fiete rutschte über die nassen Planken fast bis zur Verschanzung.
«Wo sind wir?», fragte Christian mühsam, als Fiete sich wieder gefangen hatte. Der Koch war von oben bis unten durchnässt, die Hände waren blau von der Kälte, aber es war etwas Beruhigendes an ihm, etwas, das Christian an seinen Vater erinnerte. Vielleicht lag es an Fietes Geruch, einer Mischung aus Teer und Schweiß und Eisen. Ein Geruch, den man bekommt, wenn man wochenlang auf einem Walfänger unterwegs ist, und den man immer behält, sogar, wenn man im Schützengraben liegt und verblutet und nie mehr nach Hause kommt.
«Wir haben Kap Hoorn hinter uns gelassen.» Mit einem Tampen befestigte Fiete das Holzstück an Christians Kiefer. «Und nu nich mehr reden, Kische. Darfst den Kiefer nicht bewegen. Warte, ich mach dich los. Gibt leider keine Kojen mehr. Das Schiff is in ’nem ziemlich schlimmen Zustand. Der Großmast ist dicht über Deck abgebrochen, und die Kreuzmarsstenge hängt mit der ganzen Takelage außenbords. So müsste es gehen.» Fiete zurrte das Seil, das er um Christians Kopf geschlungen hat, fest und machte sich daran, ihn vom Vormast loszubinden, oder vielmehr von dem, was vom Vormast übrig geblieben war.
«Danke», brachte Christian hervor.
«Nich reden, Kleiner.»
«Wir müssen SOS senden!», hörte Christian die Stimme des Kapitäns.
Die Wolken rasten über den Himmel. Weiß und grün türmte sich das Meer. Vom Sturm getrieben kamen jetzt die Vögel näher: weiße Möwen, Neuweltgeier und mittendrin die Albatrosse mit ihren schwarzgeränderten Schwingen, mächtig und elegant. So weit oben sein zu können, dachte Christian, während er gemeinsam mit den anderen Matrosen daran arbeitete, die Trümmer des Kreuzmastes wegzuschlagen, die immer noch an einer Seite des Schiffes hingen und bei jeder Bewegung gegen die Bordwand schlugen. So weit im Himmel, erhaben über Schmerz und Angst.
«Wir können kein SOS mehr senden.» Der Funker brüllte gegen den Sturm an. «Der Motor läuft nicht mehr!»
«Notantenne an der Back anbringen! Wir müssen SOS senden! Es muss doch hier irgendwo noch ein anderes gottverdammtes Schiff sein!»
«Notantenne an der Back anbringen», wiederholte der Funker den Befehl.
Kurz bevor der Orkan erneut losbrach, waren die Geräusche draußen so gedämpft, dass Christian in der geborstenen Kombüse, wo er mit Fiete lag, die Augen zufielen. Sein gebrochener Kiefer schmerzte, und das Stück Holz, das Fiete an seinem Gesicht befestigt hatte, verhinderte, dass er sich auf die Seite legen konnte. Auf einmal musste er sich zusammenreißen, um nicht zu weinen. Ihn fror. Er hatte solche Schmerzen. Und es war möglich, dass die Notantenne nie mehr funken würde, dass sie alle sterben würden hier draußen im Meer. Am schlimmsten aber war die Sehnsucht nach seiner Mutter, die er in diesem Moment empfand. Er dachte an ihren warmen Kachelofen und den Apfelkuchen, den sie im Herbst immer buk. Wir Sylter sind stark, hatte seine Mutter oft nach einem Abend am Ofen festgestellt, um dann, wie zum Beweis, den überbordenden Wäschekorb hochzuheben und ins Nebenzimmer zu tragen. Stärker noch als die von Amrum. Und noch stärker als die von Föhr. Wieder sah er ihre Augen vor sich und die Angst, die er beim Abschied in ihnen hatte lesen können, so als hätte sie all das Schreckliche geahnt, das er jetzt erlebte.
Ein Ruck fuhr durch die Pinnas, und Christian wurde gegen die Wand geschleudert. Von draußen drangen Geräusche, die er zunächst nicht einordnen konnte. Er hörte Fiete neben sich fluchen und versuchte aufzustehen, doch das Schiff holte über zur anderen Seite, sodass er gegen den Herd stürzte.
Die Männer an Deck begannen zu schreien. Vor der Küste Feuerlands brach die Hölle los.
Lil Kimming hatte alles aufgeschrieben: Wie die Haut duftete, wenn man lange genug am Strand lag. Wie Tessi Ketten aus Hibiskus und Ilima wand. Was die Menschen in Pearl Harbor umtrieb.
Sie liebte Oahu, obwohl sie als Tochter eines Armeelieferanten von der Ostküste keine Hawaiianerin war. Dreizehn Jahre lang, seit der ersten Klasse, hatte sie das Leben auf der Insel beobachtet. Notizbuch um Notizbuch hatte sie gefüllt.
Sie griff nach ihrem Führerschein, schnappte sich die Autoschlüssel aus dem schimmernden Seeohr in der Diele und ließ beides in ihre Rocktasche gleiten. Heute musste es einfach klappen, es musste! Ein Kleidervogel fuhr singend von seinem Ast auf, als Lil hinaus in den Garten stürmte. Auf der Bank unter dem Ingwerbaum saß Dave und aß Fisch.
«Aloha, Dave!»
«Aloha, Lil! Möchtest du was abhaben?» Der Gärtner klaubte ein Stück rötliches Fleisch von den Gräten und hielt es ihr hin. Er aß seinen Fisch immer roh, vom Kopf über das Rückgrat bis zur Schwanzflosse.
Lil ließ sich neben ihm nieder und wurde sofort ruhiger. Solange sie zurückdenken konnte, hatte Dave diese Wirkung auf sie. «Nein, danke. Ich esse noch immer nichts Lebendiges.»
Dave musterte seinen Fisch, als sähe er ihn zum ersten Mal. «Er ist eindeutig tot.»
«Dave.» Sie krampfte die Finger um die Kaurimuschel, die sie eingesteckt hatte, weil sie heute Glück brauchte. Und weil sie manchmal etwas abergläubisch war. «Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, alles hinter dir zu lassen und mit Tessi irgendwo ein neues Leben anzufangen?»
Dave sah sie entsetzt an. «Warum sollte ich das denn tun?»
«Ich weiß nicht, weil es vielleicht langweilig sein könnte? Immer nur am selben Ort zu sein?»
Dave kaute bedächtig, dann legte er das Fischskelett beiseite. Wieder einmal frage sich Lil, wie alt er wohl sein mochte. Soweit sie wusste, hatten er und Tessi sich schon um das Haus am Palmgrove Beach gekümmert, als hier noch die alte Missus Jones mit ihren Bienen gewohnt hatte.
«Ich finde es gar nicht langweilig. Es gibt Tausende von Blumen. Tausende von Fischen. Das Meer ist auf Tausende Weisen blau.»
«Aber denkst du nicht, dass hinter diesem Blau noch etwas anderes Schönes und Interessantes sein könnte?» Lil deutete auf das Meer. «Etwas, das du unbedingt noch sehen musst?»
Dave schenkte ihr ein Lächeln. «Die Menschen, die dahinter wohnen, die haben kein Aloha. Ich bleibe lieber hier.»
Lil biss sich auf die Lippen. Sie wünschte, sie könnte ebenfalls so fühlen. Aber sie hatte die Unruhe-Krankheit, wie die Mutter es nannte. Die Mutter, die stundenlang auf einem Klavierhocker sitzen und spielen konnte und darüber das Sprechen mit ihrer Tochter vergaß. Der Kleidervogel flatterte dicht vor ihrem Gesicht vorbei in die Höhe.
«Ich will das machen, was er macht», seufzte Lil.
«Zwitschern?», fragte Dave erstaunt.
Lil lachte. «Nein, nicht zwitschern. Durch die Luft sausen. Frei sein. Fliegen.»
«Das sollten aber eigentlich nur die Vögel tun.»
«Oh, aber Menschen können auch fliegen, sehr gut können sie das sogar! So wie der Freimaurer Lindbergh, der über den Atlantik flog, oder der deutsche Mann mit seinem Luftschiff oder Ruth Elder, die Filmschauspielerin!»
Dave bewegte seine Zehen. «Ich schaue keine Filme.» Und mit einem Blick hinauf in den Ingwerbaum fügte er hinzu: «Man muss nur die Pflanzen betrachten, dann erkennt man die Welt.»
«Es gibt aber doch auch noch andere Lebewesen, die das Auge beglücken.»
Dave runzelte die Stirn. «Fische meinst du.»
Lil lachte. «Fische bestimmt auch.»
Aus dem Haus wehten ein paar Takte Klaviermusik zu ihnen herüber. Lil sprang mit einem Satz auf die Füße. «Ich muss gehen. Übrigens, es kann ziemlich spät werden heute. Sagst du Mutter und Vater Bescheid, wenn du sie siehst?»
Dave bedachte sie mit einem langen Blick. Schließlich nickte er, nahm das Fischskelett und stand auf.
Eine Mappe mit ausgewählten Texten, fein säuberlich auf der Remington abgetippt. Ihr Schulzeugnis. Ein Lippenstift. Mehr brauchte sie nicht für ihr Vorstellungsgespräch beim Honolulu Star-Bulletin. Und los.
Sie liebte die Tin Lizzy, mit der die Familie gelegentlich zu Wochenendausflügen in die Berge fuhr. Soweit sie sich erinnern konnte, hatten sie den grün lackierten Ford nie anders als mit offenem Verdeck gefahren. Der Wind zerrte an ihren Haaren, sie spürte, wie ihr Herz klopfte. Niemand wusste, dass sie sich als Reporterin beim Honolulu Star-Bulletin vorstellen wollte, nicht einmal der Chef der Zeitung selbst. Reine Vorsichtsmaßnahme. Sie hatte nämlich keine Lust, dass er wie der Chef des Honolulu Advertiser reagierte, der ihr durch seine Sekretärin hatte ausrichten lassen, sie solle ihn nie wieder belästigen. Er halte nichts von Frauen, die über Fischfang berichteten, und diese spezielle hawaiianische Einkommensquelle bilde nun mal den thematischen Schwerpunkt seiner Druckerzeugnisse; und zweitens halte er nichts von Leuten, die immer wieder anriefen, auch wenn man ihnen schon mal gesagt hatte, dass man nichts von ihnen wolle.
Sie parkte den Wagen in der Nähe des Hafenbeckens und ging den Weg bis zur 125 Merchant Street zu Fuß. Die Zeitungsredaktion lag im Parterre eines zweigeschossigen Gebäudes.
Noch bevor sie den Eingang erreichte, hörte sie den Lärm von drinnen. Ein Rattern und Klacken mehrerer Maschinen erfüllte die Luft, dazwischen brüllten sich Männer Befehle und Flüche zu. Lil durchquerte einen Raum, in dem Schriftsetzer Manuskriptseiten in Spalten aus Blei übertrugen. Im hinteren Teil des Raums liefen Papierstreifen von Zylindern in Pressen, die wiederum bedruckte Seiten ausspuckten. Bürojungen hasteten zwischen den Männern hindurch. Bei Lils Anblick hielten einige Männer kurz inne und kratzten sich mit zurückgeschobenem Hut den Kopf. Frauen waren hier ein Anblick mit Seltenheitswert.
Mit Ausnahme einer Sekretärin. Lil kannte sie flüchtig, sie war mit dem Sohn ihrer Nachbarn verheiratet gewesen. Ihren Mann, einen Marinesoldaten, hatte sie im Vorjahr verloren. Jetzt musste sie sich allein durchbringen.
Der Chefredakteur sei nicht zu sprechen, erklärte sie bestimmt. Lil, die mit diesem Satz gerechnet hatte, ließ sich auf einem Stuhl nieder und entgegnete der konsternierten Frau, dass sie in der Lage sei zu warten. In der Tat machte es Spaß, das Treiben im Raum zu beobachten. Hier war es fast ebenso laut wie im Raum mit den Pressen. Ein riesiger Ventilator kreiste unter der Decke. Männer schrien sich an, und Journalisten hämmerten auf die Tasten ihrer Schreibmaschinen in einer Geschwindigkeit, dass es wie Trommelfeuer von den Wänden hallte. Es klang so, wie Lil sich Krieg vorstellte, und von diesem Erlebnis hatte sich der alte Waffenhersteller Remington sicherlich auch inspirieren lassen, als er das mechanische Schreibgerät entwickelte. Genauso treffsicher wollte auch sie hier sitzen und formulieren dürfen, genauso schlagfertig hoffte sie gleich in ihrem Gespräch mit dem Chef zu sein.
Nachdem eine Stunde vergangen war, hielt Lil die Untätigkeit nicht mehr aus. Sie beschloss, ein wenig im Raum spazieren zu gehen. Besonders interessierte sie ein Vorhang im hinteren Teil: Immer wieder verschwanden Männer dahinter. Aber niemand kam wieder hervor. So vorsichtig wie möglich näherte sie sich und schob den Vorhang beiseite. Fünf Künstler saßen hier an Tischen und zeichneten mit Tinte und Stahlfeder Menschen. Auf einem Papier konnte Lil eine Figur ausmachen, die eine andere mit einem Messer bedrohte. Auf der nächsten Zeichnung waren ein Mann und eine Frau mit Pistolen zu sehen. An einem der Tische stand ein Reporter. Eine Zigarette baumelte ihm im Mundwinkel, und er sagte: «Nein, nein, das musst du völlig anders zeichnen! Der hat die Villa abgefackelt, kein Barbecue gemacht!»
Lil zog sich wieder zurück. Um ihre Nervosität zu dämpfen, schlug sie die Zeitung vom Vortag auf. Da war es wieder, das Luftschiff, das sie in den vergangenen Wochen so oft betrachtet hatte. Fast die Hälfte der Seite war von seinem Bild ausgefüllt. Darüber stand in riesigen Lettern: Zeppelin bereit für seine Weltfahrt. Start am 7. August 1929 in New York.
Fünf Stunden später ließ sich der Chef endlich dazu herab, sie zu empfangen. Allerdings nur, um ihr klarzumachen, dass er keine weiblichen Reporter beschäftigen könne. Sie schrieben nicht so schnell wie Männer, und außerdem sei bei ihnen das Risiko zu groß, überfallen zu werden. Er brauche Journalisten, die auch mal ein Geländer herunterrutschen konnten. Lil stellte ihr Tempo unter Beweis, indem sie geschwind einwarf, dass sie an der Schule in Leichtathletik geglänzt habe, und – sie wedelte mit ihren Arbeitsproben – schreiben könne sie nicht nur schnell, sondern auch viel.
Hier entstand eine Pause im Gespräch, die der Chef schließlich mit der Feststellung beendete, dass in einer Woche Hawaiis erster nationaler Feiertag stattfinde. Ein Reporter seiner Zeitung habe den Lei Day erfunden, den Tag, an dem die Hawaiianer einander von nun an Blumenketten schenkten. Er blickte Lil müde an und sagte: «Ich nehme an, dass sie als Frau was von Blumen verstehen.»
Lil ballte die Fäuste, aber sie zwang sich zu einem Lächeln. «Blumen, aber sicher», sagte sie. «Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir.»
Am Nachmittag des 22. April 1929 fingen die Männer an, Wetten über ihre Todesart abzuschließen, leise zunächst, ohne dass der Kapitän es hörte. Einer der Steuerleute meinte, er werde verdursten, das Trinkwasser rieche schon so komisch. Fiete ging von Ertrinken aus, was der Steuermann ziemlich phantasielos fand. Der Funker sagte gar nichts. Er hatte sich die Lippen blutig gebissen bei seiner Arbeit an der Notantenne. Immerhin schien sie jetzt zu funktionieren. Er morste unablässig SOS.
Die Masten und Rahen hingen wie ein entwurzelter Wald über der Bordwand. Bei jeder Welle, die heranrollte, krachte die Takelage gegen das Schiff. Alle packten mit an, um die Masten endlich vom Schiffsrumpf zu trennen, sogar Kapitän Lehmann. Sie mussten sich beeilen, bevor das Gestänge ein Leck in den Rumpf schlug, das Wasser eindrang und sie allesamt untergingen. Christian zitterte vor Kälte, obwohl seine Haut glühend heiß war. Der Sturm hatte abgenommen, doch noch immer brandete die See über Deck, und die Pinnas torkelte durch die Dünung, der Nacht entgegen. Sie lag jetzt so tief im Wasser, dass nur noch die Verschanzung aus dem Wasser ragte. Die Zementladung hatte sich mit Wasser vollgesogen und zog den Dreimaster in die Tiefe. Kein anderes Schiff, keine Küste. Sie waren vollkommen allein auf dem Meer.
Vielleicht würde er aber überhaupt nicht sterben, dachte Christian, als er irgendwann wieder auf dem Boden der Kombüse lag. Weder ertrinken noch verdursten. Vielleicht war er wie Onkel Per aus Keitum, den der Tod nicht finden konnte und der darüber im Schützengraben verrückt geworden war.
Christian schloss die Augen und träumte sich wieder nach Sylt, zu seiner Mutter und zu den Geschichten, die sie der kleinen Schwester und ihm erzählt hatte, wenn es draußen dunkel geworden war. Die Geschichten rund um Onkel Per hatten Christian immer am besten gefallen, auch wenn er schon als Kind nicht glauben konnte, dass Per unsterblich war. Auf Sylt erzählte man sich, dass er als Vierzehnjähriger versucht hatte, sich auf dem Dachboden zu erhängen. Aber dann riss das Seil. Also lebte der Onkel einfach weiter. Er trank sich mit friesischen Bieren regelmäßig in die Flaute, probierte Eistauchen und diverse Raufereien, nahm aber keinen Schaden. Als er eines Morgens am Westerländer Strand mit einer blutenden Kopfwunde aufwachte, die von einem Arzt als «normalerweise tödlich» diagnostiziert wurde, befand Pers Vater, Christians Großonkel, dass es für Per an der Zeit sei, etwas zu lernen. Eingedenk der Geschehnisse im heimischen Dachstuhl kamen Tätigkeiten wie Knoten und Spleißen nicht in die engere Berufswahl.
Also beschloss Per, seine Fähigkeit, todbringende Situationen zu überleben, noch ein bisschen weiter auf die Probe zu stellen, und wurde Soldat. Der Krieg erschien ihm als das letzte große Abenteuer, das ein Mann seiner Zeit erleben konnte, und passenderweise brach dann auch einer aus. Als Onkel Per 1918 mit wenig mehr als einer Schramme von Verdun nach Sylt heimkehrte, hatte er keinen Zweifel mehr: Er war ein Auserwählter. Obwohl Onkel Per nach seiner Kriegsheimkehr allgemein als verrückt galt, durfte er der Feuerwehr beitreten, denn Brände gab es auf Sylt viele und Feuerwehrleute nicht genug. Und so kletterte der Onkel in verrauchte Schlafzimmer, brennende Treppenhäuser und erwies sich selbst im Funkenregen als wetterfest. Wie er sich selbst stets aufs Neue dem Tod entriss, so rettete er andere ins Leben. Nur Christians Vater hatte er nicht retten können. Der war neben ihm im Schützengraben gestorben, und wenn Onkel Per betrunken genug war, klopfte er bei Christians Mutter an die Tür und entschuldigte sich weinend dafür.
Ja, vielleicht war Christian ein bisschen wie Onkel Per aus Keitum, wenngleich natürlich nicht so verrückt. Aber von einem brechenden Mast niedergestreckt zu werden und sich dabei nur den Kiefer zu verletzen, dann noch auf einem Schiff zu überleben, das entmastet im Sturm trieb, das war bestimmt nicht normal.
Ja, wir Sylter sind stark, dachte Christian. Einigen von uns kann der Tod nichts anhaben. Trotz der eisigen Kälte schlief er in dieser Nacht durch.
Am Morgen des 24. April 1929 gelang es dem Funker endlich, Verbindung zu einem chilenischen Küstendampfer aufzunehmen. Die Alfonso war unterwegs nach Punta Arenas, um dort Fahrgäste abzusetzen. Zwei Tage später traf das Schiff bei der Pinnas ein, gleichzeitig mit dem nächsten Sturm. An Schleppversuche war nicht zu denken.
Die Quecksilbersäule des Barometers fiel auf 718 Millimeter. Schwere Brechseen schlugen über die Decks. Mittlerweile war das Trinkwasser brack geworden. Christian bekam Fieber, und er litt entsetzlichen Durst. Wann die Pinnas begonnen hatte zu weinen, konnte er nicht mehr sagen. Er hörte das Wimmern trotz des Sturms. Langgezogene hohe Töne drangen aus den Ritzen, dort, wo die Decksnähte rissen und das Schiff zu lecken begann.
Nun gab es nichts mehr, was sie tun konnten. Das Weinen kam aus allen Ecken, aus jeder Planke. Draußen brüllte der Sturm. Schwere Brecher brandeten über das Deck und die Aufbauten. Fiete hockte auf dem Boden der Kombüse und zählte etwas an seinen Fingern ab. Er roch jetzt nicht mehr nur nach Teer und Schweiß und Eisen, sondern auch nach Angst. So verging die zweiundzwanzigste Nacht im Sturm. Keiner der Männer konnte vor Durst noch sprechen. Christians Zunge war angeschwollen. Mit letzter Kraft presste er sich die Hände auf die Ohren, weil er das Heulen nicht mehr ertrug.
Als der Morgen heraufdämmerte, lag er in einer eiskalten Lache Wasser. Irgendetwas krächzte im Raum. Vielleicht die Neuweltgeier, dachte Christian. Das Schiff ist überall undicht, jetzt kommen die Geier herein. Auf einmal geschah etwas, das er sich nicht erklären konnte: Er sah sich selbst, wie er auf dem Boden der Kombüse lag. Um ihn herum wuchs das Wasser, es bedeckte seine Beine, seine Arme und die Schiene an seinem Gesicht. Jetzt sah er Fiete durch all das Wasser waten und ihn emporwuchten. Er packte ihn sich auf eine Schulter, als ob er nicht mehr als eine Feder wöge. Das Wasser spritzte in alle Richtungen. Jemand stützte Fiete, als das Schiff schlingerte.
Christian war der Erste, der vom Klüverbaum heruntergefiert wurde, um auf das Rettungsboot der Alfonso zu gelangen, das in den Wellen bei der Pinnas tanzte. Als Letzter verließ der Kapitän das Schiff.
Die Pinnas war mittlerweile vollgelaufen. Als Christian in Decken gehüllt zu sich kam und durch das Bullauge in seiner Kammer hinausblickte, war von dem Flying P-Liner der Hamburger Reederei F. Laeisz nichts mehr zu sehen. Drei Tage lang hatte Kapitän Jorge Jensen mit der Besatzung der Alfonso bei dem entmasteten Segelschiff ausgeharrt. Es war der 28. April 1929, als er die Männer endlich retten konnte, aber das erfuhr Christian erst später. Während des Sturms hatte er aufgehört, die Tage zu zählen.
Und so wurde ihm erst in seinem Krankenhausbett in Punta Arenas klar, dass der Tag seiner Rettung auch sein Geburtstag war. Eine Krankenschwester schenkte ihm etwas, das dunkel war und süß schmeckte. Noch nie in seinem Leben hatte er als Junge von der Insel etwas so Köstliches gegessen. Als er sie nach dem Namen der Medizin fragte, lächelte sie ihn an.
«Chocolate», erklärte sie.
Die Chocolate brachte ihn schnell wieder auf die Beine. Die Krankenschwester, der es gefiel, wie er sich freute, brachte ihm von nun an jeden Tag ein paar Stücke mit. Christian stellte fest, dass die dunkle Masse nicht immer gleich schmeckte, und offenbar in unterschiedlichen Brauntönen zu haben war. Da er immer noch nicht beißen konnte, ließ er sich die Chocolate im Mund zergehen. Dann schloss er die Augen und träumte sich in den Himmel. Er war jetzt neunzehn Jahre alt, und er würde weiterleben. Bis an sein Lebensende würde er der Besatzung der Alfonso und der Chocolate-Krankenschwester dankbar dafür sein.
Nach zwei Wochen im Krankenhaus von Punta Arenas fuhr er gemeinsam mit Fiete und dem Rest der Mannschaft nach Hamburg zurück, ziemlich luxuriös auf einem Frachtdampfer. Die Aussicht, bald wieder auf einem Segler anzuheuern, erfüllte ihn nicht mit unbändiger Freude, zudem hatte er einen Plan gefasst. Aber um diesen Plan in die Tat umzusetzen, würde er Geld brauchen. Und so musste er wohl oder übel das tun, was alle Männer in seiner Familie taten, seit sein Ururgroßvater, der Norweger Peter Nikolai Lassen, 1809 vor Sylt Schiffbruch erlitten hatte und mit der Rantumerin Merret einundzwanzig Kinder zeugte: weiterhin zur See fahren.
Das Telegramm, das er kurz vor seiner Abfahrt in Punta Arenas erhielt, machte seine Entscheidung leichter. Seine Mutter hatte ihm geschrieben: Lieber Sohn melde dich bei Germania Krupp in Kiel STOP Suchen Matrosen für Weltumsegelung auf Motoryacht.
2
Julius Forstmann legte die Kieler Neuesten Nachrichten beiseite und blickte hinaus in den hellblauen Himmel über Norddeutschland. Es sah ganz so aus, als ob man kugelsichere Westen bräuchte, um das Jahr zu überstehen.
Ausgerechnet am Valentinstag hatte in Chicago ein gewisser Al Capone alles niedergemäht, was nicht bei drei im Blumengeschäft war. Und in Italien wütete ein Mann namens Benito Mussolini. Seine zornig gebellten Befehle konnte man mittlerweile in Wochenschauen auf der ganzen Welt hören – vorausgesetzt, man besuchte Lichtspielhäuser für Filme mit Ton. Auch in Palästina sah es nicht gut aus. Aschkenasische Juden waren dort allem Anschein nach nicht wohlgelitten, und wenn man der Zeitung glaubte, würde es dort demnächst zu Kämpfen kommen.
Julius Forstmann bedauerte das außerordentlich. Er hätte Jerusalem auf der geplanten Weltreise mit seiner Familie gerne besucht, wollte aber auch niemanden unnötig in Gefahr bringen. Ferdinand Magellan, der vierhundert Jahre vor ihm die Welt auf einem Schiff hatte umrunden wollen, war auf der Reise getötet worden – ein Schicksal, das zu imitieren nicht in Forstmanns Sinne war.
Das alles beherrschende Thema der Zeitungen aber war das Luftschiff. Ein Schleswig-Holsteiner namens Hugo Eckener plante, mit einem Zeppelin von New York aus um den Globus zu fahren. Das stellte Julius Forstmanns eigenes Unterfangen, die Welt mit seiner Motoryacht Orion zu umrunden, natürlich in den Schatten, aber der New Yorker Textilkaufmann deutscher Herkunft war so großzügig, diesem Luftschiffer den Ruhm nicht zu neiden. Er konnte sich auch nicht beklagen. Schließlich besaß er ein wunderschönes Haus im nördlichen Teil Manhattans, einen großenteils gut geratenen Nachwuchs und ein Vermögen von über 50 Millionen US-Dollar. Das hatte einen selbstbewussten Mann aus ihm gemacht.
Innerhalb der nächsten Tage, so hatte ihm der Chef der Werft versichert, hätten sie die Männer beisammen, die sie für die Orion benötigten – erfahrene Seeleute, von denen keiner zu viel Alkohol trank. Die Männer, die für seine Reise in Frage kamen, sollten möglichst schon Kap Hoorn umsegelt haben, das war Forstmann wichtig. Nur wer die Knochenarbeit in der Takelage eines Chile-Seglers überstanden hatte, war in der Lage, seine Orion sicher um die Welt zu lenken.
Es war schließlich nicht irgendein Schiff. Die Orion war die größte und luxuriöseste Yacht, die jemals gebaut worden war. Ein Triumph deutscher Ingenieurskunst über das nasse Element. Mit einer Inneneinrichtung, die lässig mit jener auf der Titanic mithalten konnte – nur dass die Orion tatsächlich als unsinkbar galt. Jeder einzelne Raum war mit Teppichen ausgelegt, die Wände beschlagen mit poliertem Holz. Gepolsterte Möbel, Kristalllüster und perlenbehangene Lampen schmückten die Zimmer, und jede der Gästekammern hatte ein eigenes Bad. Herzstück des Wohnbereichs war eine Suite auf dem Oberdeck, die ein Musikzimmer, ein Esszimmer und eine Lounge beherbergte. Alles in den Räumen wirkte harmonisch: Polsterstoffe, Gemälde und Lichtstimmung waren perfekt aufeinander abgestimmt. In dem überdachten Schwimmbad funkelten die Wände beim Baden dank der eingebauten Strahler im Wasserbecken. Selbst ein gut ausgestattetes Krankenzimmer gab es.
Er konnte die Reise kaum erwarten. So viele Jahre hatte er auf diesen Augenblick hingearbeitet. Es würde das Abenteuer seines Lebens sein.
Christian erwachte davon, dass ihn eine kleine Hand im Nacken kitzelte. Dann hörte er ein Kichern.
«Du bist so eine Schlafmütze, Kische!»
Er warf sich auf die andere Seite und zog sich die Decke über den Kopf. Die Hand krabbelte unter den Stoff und kitzelte weiter.
«Wir sind die Ameisen», hörte er Erikas Stimme. «Und unsere Straße führt hier leider vorbei!»
«Können die Ameisen heute nicht mal die Umgehungsstraße benutzen?»
«Nein», kicherte Erika. «Das können die Ameisen leider nicht.»
«Na gut, ihr nichtigen kleinen Tiere. Macht, was ihr wollt. Ich schlafe weiter.»
Eine zweite Hand landete auf seinem Kopf. «Auch, wenn wir über deine Haare spazieren?»
Christian drehte sich blitzschnell um und packte Erikas Handgelenke. «Das könnt ihr ja mal ausprobieren!»
Erika lachte. «Lass die Ameisen los, Kische! Das ist gemein! Die können sich doch gar nicht wehren!»
«Guten Morgen, kleine Schwester! Freue mich, dich so wohlauf zu sehen!»
Erika versuchte, sich aus Christians eisernem Griff herauszuwinden. «Lass mich los, Kische! Ich verspreche dir, dass ich die Ameisen verschwinden lasse!»
«Schwörst du auf Ekke Nekkepenn?»
«Ich schwöre auf Ekke Nekkepenn, seine Frau Rahn und alle anderen Götter im Meer!»
«Schön, kleine Schwester, nur dass Ekke Nekkepenn kein Gott ist. Nur so ein kleines Meermenschlein wie du.» Er ließ sie los, um sie gleich darauf durchzukitzeln.
«Aufhören!», stieß Erika hervor. «Hör sofort auf, Kische, du bist so gemein!»
«Sehr gut, ich sehe, die Ameisen haben ihre Lektion gelernt!» Christian richtete sich auf. «Lass uns frühstücken. Oder sind die anderen noch nicht wach?»
Erika rollte mit den Augen. «Alle sind wach. Schon seit Stunden! Nur die alte Schlafmütze Kische liegt hier rum.» Sie wackelte mit allen zehn Fingern. «Aber wozu sind die Ameisen da?»
Etwas hatte sich in Christian verändert. Als wäre da plötzlich ein Licht in ihm. Er konnte es an den Blicken der Mädchen sehen, als er später mit Erika hinunter an den Strand ging. An der Art, wie sie ihm zulächelten, und wie nahe sie ihm jetzt kamen. Am Kontor der Germania Werft in Kiel hatte man seine Bewerbung auf die Orion angenommen. Seitdem kam es ihm so vor, als schare sich das gesamte weibliche Sylt um ihn. Nur eine fehlte: Die kleine Robbe konnte er nirgendwo sehen. Nicht auf den Wiesen vor ihrem Haus, auf dem die schwarzbunten Kühe standen, nicht auf den Westerländer Straßen und auch nicht am Strand beim Krabbenpulen. Als er seine Mutter nach ihr fragte, hob sie bloß die Schultern. «Tut mir leid, Junge. Die hat eine Anstellung auf dem Festland bekommen.»
Auf Sylt waren die ersten Badegäste eingetrudelt, und das, obwohl die Sommerferien noch gar nicht begonnen hatten. Aber seitdem ein Damm mit Eisenbahnschienen zum Festland hinüberführte, reisten die Kurgäste auch mal fürs Wochenende an. Christian beobachtete, wie sie in ihren gestreiften Strandanzügen Kniebeugen machten und sich ihre Strandkörbe zurechtrückten, um die Sonne auf der Haut zu spüren. Von ihrem erhöhten Platz in den Dünen aus konnten er und Erika den Sandburgenbauern zusehen, die am Wasser eine Welt errichteten, eine Welt, die aus Burgen, prächtigen Villen und sogar einem Zeppelin bestand.
Erika deutete mit ihrem Geigenbogen auf eine Gruppe von Männern mit hochgezwirbelten Schnurrbärten, die entschlossen ins Wasser marschierten.
Christian schüttelte sich. Es gab immer noch Momente, in denen er die Wasserwände vor Feuerland sah, in denen er die Kälte auf seiner Haut spürte, den Schmerz in seinem Kiefer, die Angst, für immer unterzugehen. Etwas kreischte neben ihm, aber es war keine Möwe, sondern Erika, die mit dem Bogen über ihre Geige glitt.
Niemand konnte sagen, wie die Geige auf die Insel gelangt war. Die Mutter behauptete, ein Schriftsteller namens Hase oder Hesse (man konnte ihn nicht so gut verstehen, da er ein eigentümlich gefärbtes Deutsch gesprochen hatte) habe sie in einem Lokal liegen gelassen, aber Genaues wusste man nicht.
Christian schloss die Augen, wie immer, wenn der Augenblick vollkommen war. Die Sonne wärmte seine Haut, eine Brise fuhr ihm durch die Haare, und neben ihm lag seine Lieblingsschwester, die er so sehr vermisst hatte und die in diesem Jahr so groß geworden war.
«Hast du gehört, Kische, dass sie jetzt auch einen Strand für Nackte eröffnen wollen?»
Christian lachte. «Unsinn, wer hat dir das denn erzählt?»
«Nein, im Ernst.» Erika ließ die Geige sinken. «Das stand in der Zeitung!»
«Sie sind schon sehr amüsant, die Buntmenschen», lächelte Christian und strich sich die Haare aus der Stirn.
Erika beobachtete, wie der Zeppelin-Erbauer eine Gondel aus Sand zurechtklopfte. «Manchmal denke ich darüber nach, wie es wohl ist, dort, wo die Buntmenschen wohnen. Und wie sie es schaffen, so zu leben. So bunt.»
«So, wie der da?», lachte Christian und deutete auf einen missgelaunt aussehenden Mann, der vor ihnen durch den Sand stapfte und dabei die Heckflosse des Zeppelins zertrampelte. Ein Rudel Buntkinder, einige von ihnen schon recht groß, folgte ihm durch den aufgewühlten Sand.
«Das ist ein Schriftsteller aus Lübeck, der mit seiner Familie oben in Kampen die Sommerferien verbringt.» Erika ließ den Bogen wieder über die Saiten sausen. Vom Himmel kreischten die Möwen zurück.
Christian sah ihnen zu, wie sie durch das Blau flogen. «Das möchte ich auch gern können.»
«Fliegen? So richtig? Mit einem Flugzeug? Aber wie willst du das anstellen? Kostet das nicht furchtbar viel Geld?»
«Ja, das tut es, und darum wird es damit wohl erst einmal nichts werden. Aber von meiner Heuer auf der Motoryacht werde ich ein bisschen was sparen. Und dann, wer weiß …»
«Dann nimmst du mich mit?»
Christian lachte. «Dich kleine Möwe nehme ich überall hin mit!»
«Auch auf die Weltreise?»
«In Gedanken.»
Erika ließ den Bogen über eine Saite fahren, dass es weh klang. «In Gedanken ist ja nicht echt.»
«Darf ich die auch mal haben?», fragte Christian und streckte die Hand nach dem Instrument aus.
«Ja, natürlich. Du musst mit den Fingern auf den Saiten herumdrücken. Und dann mit dem Bogen drüberwischen. Und die Geige so ans Gesicht halten. Aber vielleicht tut dir das weh am Kiefer?»
Die Sonne strahlte Erika so ins Gesicht, dass er alles darin sehen konnte, auch dass die Kindheit allmählich daraus schwand. Vielleicht war dies der letzte Sommer, in dem sie morgens Ameisen spielen würde.
Christian legte sich das Instrument auf die Schulter und stimmte seine ersten Geigentöne an.
Die Leute waren gekommen, um mit Christian Abschied zu feiern. Als er auf den Strand vor der Westerländer Sandstraße zulief, erkannte er sie alle, die mit ihm in Westerland zur Schule gegangen waren. Arfst, Haulk und Brork waren damit beschäftigt, ein Feuer zu entfachen, der Menge an Zweigen und Ästen nach zu schließen, ein ziemlich großes.
Brork klopfte ihm auf die Schulter. «Wir haben uns gedacht, dass dieses Feuer die bösen Geister vertreiben muss. Jene Geister, die dich immerzu in den Untergang zwingen!»
«Sie haben es ja nur ein Mal versucht. Und schon verloren.» Christian lachte und drückte Brork kurz an sich. Dann schlug er ihm ebenfalls auf die Schulter. «Danke, dass ihr das hier für mich tut.»
«Fährt ja nicht jeden Tag ein Sylter auf Weltreise. Und dann auch noch mit so einer Yacht!»
«Ich weiß, ich kann es selbst noch nicht fassen, dass es geklappt hat. Warum hast du eigentlich nicht angemustert auf der Orion?»
«Kann ich nicht machen, Mann.» Brork blickte hinüber zu seiner kleinen Familie. Er war als Erster der Freunde Vater geworden.
Seine Geeske saß mit dem Baby etwas weiter abseits, um die Kleine vor dem Funkenflug zu schützen. Christian ging zu ihr hinüber, um sie zu begrüßen. Sie war mit mehreren Buntmenschen im Gespräch, einer hellblonden Frau und ein paar Männern. Die Gruppe hatte sogar ein Grammophon dabei.
«Moin, ich bin Käthe!» Die Hellblonde sprang aus dem Sand auf und ergriff seine Hand. «Sehr erfreut, dich kennenzulernen! Bist ja wohl so was wie eine Berühmtheit hier!»
Christian spürte, wie er errötete, was bei dem Dämmerlicht hoffentlich niemandem auffiel. «Nein, ich …»
«Hoffe, es stört dich nicht, dass wir mitfeiern! Wo wir doch schon älter sind als ihr!» Die Hellblonde blitzte ihn an. Sie hatte sehr helle Augen, die im Schein des Feuers strahlten wie die Lichter eines Schiffs. «Ich werde demnächst dreißig. Ein interessantes Alter, nicht wahr? Und wer hat nicht schon alles darüber geschrieben! Mit dreißig bringt man sich entweder um, oder man beschließt, sein Liebesleben aufzuforsten. Ich persönlich tendiere zu Letzterem.» Sie zwinkerte Christian zu.
Er spürte, wie er jetzt richtig rot wurde. Eine fast dreißigjährige Frau! «Es ist sicherlich schön, mit Hoffnungsfreude in die Zukunft zu blicken.» Er entriss der Hellblonden hastig seine Hand.
«Du musst Käthe entschuldigen», mischte sich einer ihrer Begleiter in das Gespräch ein. «Sie beherrscht die Umgangsformen nur auf dem Tanzparkett. Wilhelm aus Altona. Freut mich, dich kennenzulernen.»
«Wilhelm ist Bankdirektor», erklärte Käthe. «Er hat das Stadium des Tellerwäschers großzügig übersprungen, um direkt Millionär zu werden.»
«Darf ich dich fragen, wie du das angestellt hast?», platzte Christian heraus, nur um sich gleich darauf für seine Frage zu entschuldigen.
Wilhelm lachte. «Keine Ursache. Ich habe in meiner Jugend eine Bank gegründet. Während der Inflation.»
Christian überlegte. Er war noch zur Schule gegangen während der Zeit der Geldentwertung, aber er konnte sich gut daran erinnern, wie verzweifelt die Mutter gewesen war, als sie zwei Milliarden Reichsmark für ein Stück Butter hatte bezahlen sollen. Onkel Per hatte geflucht, dass er jetzt doch lieber tot wäre – nur einen Tag, nachdem man ihm seinen Lohn ausgezahlt hatte, war das Geld nichts mehr wert gewesen. Es war die Stunde der Zauberer gewesen, die Geld verschwinden lassen konnten und dann wieder vervielfältigen, und die Stunde all jener, die einen Hof mit Tieren hatten, so wie die Eltern der kleinen Robbe.
«Das Geheimnis hieß damals Aktiengeschäft, jetzt ist es das wieder. Zumindest in Amerika. Da müsste man jetzt sein, in New York an der Wall Street. Da wirst du im Handumdrehen reich.»
Auf einmal spürte Christian sein Herz bis zum Hals klopfen. New York – den Hafen würden sie in wenigen Wochen anlaufen! Vielleicht würde er dort das Geld für seine Flugstunden auftreiben können? Aber wie genau sollte er das anstellen mit dieser Wall Street? Ging man da einfach hin?
Wilhelm kniete sich in den Sand, um die Nadel auf die Platte abzusenken. Christian setzte sich neben ihn.
«Ich bin jetzt übrigens kein Millionär mehr», sagte Wilhelm, als die ersten Takte aus dem Trichter strömten, so wild und lebendig, dass Christian gleich wieder aufstehen wollte, um zu tanzen. «So geht das eben auch mit den Aktien. Hab das meiste wieder verloren.»
Die Hellblonde sah, dass Christian mit dem Fuß wippte. «Hab das Gleiche gedacht, Schätzchen», sagte sie und zog ihn hoch. «Komm, swing mit mir!»
Noch Wochen später würde Christian an diesen Abend am Strand denken. Wie er mit dieser Käthe tanzte. Und wie Geeske ihm ihr Baby reichte und wie er dann über den Strand lief mit diesem kleinen Stück Mensch, an den Wellen entlang, die auf den Strand schäumten. Wie die Kleine lachte, als er sie über seinen Kopf in den Himmel hob, hoch wie ein Zeppelin. Und wie er später, trunken von Bier und Glück, an all das dachte, was noch kommen würde. Wie unglaublich weit und offen das Leben war, das vor ihm lag!
Später, als die Nacht schon schwarz war und das Feuer noch hell, setzte sich Onkel Per zu ihnen. Er hatte getrunken, wie stets zu dieser Stunde, und wedelte mit seiner Hand durch die Flammen, um festzustellen, ob seine Haut immer noch feuerfest war.
«Und dann, als wir im Schützengraben lagen …», hörte Christian ihn durch den Nebel in seinem Kopf sagen. Im Schein des Feuers verglich er seine Züge mit denen des Onkels. Sie sahen sich eigentlich nicht besonders ähnlich, fand er. Onkel Per war klein und stämmig und dunkel. Aber vielleicht sind wir beide unsterblich, flüsterte eine kleine, glückliche Stimme in seinen Gedanken.
Am Tag seiner Abfahrt brachte ihn die Mutter zum Bahnsteig. «Ich bin sehr stolz auf dich, Junge», sagte sie. «Mach aber keinen Unsinn unterwegs und präg dir alles genau ein! Wer weiß, wann du wieder die Gelegenheit haben wirst, all diese Länder zu bereisen!»
Christian wollte einwenden, dass er New York und Rio de Janeiro schon gesehen und Kap Hoorn umsegelt hatte, also kein Neuling in Sachen Welterkundung war, aber in diesem Moment kam Erika mit dem Geigenkasten angelaufen.
«Nimm du sie, Kische!», brüllte sie gegen den Lärm der Dampflok an. «Sie soll dein Glücksbringer sein!»
Christian drückte seine kleine Schwester an sich und ließ die vielen Küsse seiner Mutter über sich ergehen. Dann, als der Zug hinausrollte, stand er am offenen Fenster und wartete darauf, dass ein kleines Stück Glück schon jetzt auftauchen würde. Aber die kleine Robbe auf ihrem Fahrrad war bis zum Schluss nicht zu sehen.
Lil hatte über jeden einzelnen Blumenmarkt berichtet, der auf Oahu sein Geschäft betrieb, als Nächstes blühten ihr die Frauenvereine. Es war nicht so, dass sie sich ihre Anfangszeit als Reporterin beim Honolulu Star-Bulletin irgendwie aufregender vorgestellt hätte. Sie fand nur, dass diese Art von Langeweile allmählich unerträglich war.
«Ich hab den Chef gefragt, ob ich auch mal etwas über die Beziehungen zwischen Hawaii und den USA schreiben könnte, und da hat er mich angesehen, als ob ich das achte Weltwunder wäre.»
«Das neunte, meinst du.» Dave kaute genüsslich auf einem Stück Ananas herum.
«Das neunte, bist du sicher?» Lil runzelte die Brauen.
«Ja, das achte liegt direkt vor dir.»
«Du, Dave?», kicherte Lil.
«Nein, ich sitze. Das achte ist das.» Er deutete über den Rasen mit seinen Beeten voller Ilima und Orchideen hinunter zum Meer. «Oahu. Der schönste Ort der Welt. Und du darfst hier sein. Nimm das als Geschenk.»
Lil stampfte so heftig auf, dass die Erde erzitterte und mit ihr der Ingwerbaum. Ein Blatt segelte auf ihren Kopf hinunter und blieb dort hängen. «Aber ich will über wichtigere Dinge schreiben als über Blumen und Feste und Mode! Ich will begreifen … und verständlich machen», sie deutete ebenfalls in den Garten, «was das da zusammenhält!»
«Gute Arbeit hält das zusammen. Mit viel Aloha gemacht.»
Lil schüttelte den Kopf. «Nein, Dave, mit Verlaub, das glaube ich nicht. Die Welt da draußen ist aus Wettstreit entstanden. Es geht immer darum, wer am größten, schönsten, erfolgreichsten ist. Und egal, was man von Wettbewerben halten mag, ich will da mitmachen! Ich will die beste Story schreiben! Ich will zeigen, dass ich besser bin als Jack und Albie und all die anderen Wichtigtuer mit ihren Kontakten in die Regierung und ihren Autos und Zigarren und Frauen!»
«Du bist ganz bestimmt besser als Jack und Albie. Und ihre Autos und Frauen.»
Lil ballte die Fäuste. «Nicht, solange ich über Blumenmärkte und das Fest des Frauenvereins schreibe. Außerdem kennst du Jack und Albie überhaupt nicht! Entschuldige bitte, es ist natürlich trotzdem sehr nett, dass du das zu mir sagst.»
Dave legte die abgenagte Ananasscheibe vorsichtig beiseite. «Du hast einen Samen gepflanzt», sagte er. «Nun warte ab, was für eine Blume daraus erwächst.»
Ein dunkles Musikzimmer, das auch als Lesezimmer dient. Eine Mutter, die nicht von ihrem Klavierhocker aufsteht, die nicht spricht, auch nicht, als sie sieht, dass Mann und Tochter sich in den Sesseln am Fenster niederlassen. Chopin, immer nur Chopin, schon seit Wochen.
Lil wippte ungeduldig mit dem Fuß. Sie sah, wie sich der Vater Scotch in ein Glas schenkte. Weiß der Teufel, woher er das Zeug hatte, mitten in der Prohibition, aber ihr Vater hatte Freunde auf Oahu, so viel stand fest. Die Flakons auf dem Tablett glitzerten im Schein der Petroleumleuchten. Tessi hatte sie auf Hochglanz poliert. Wie sehr etwas leuchten konnte in einem Haus, in dem es sonst so dunkel war! Sie nahm das Glas Saft, das der Vater ihr reichte.
«Du wolltest uns sprechen, Lil», sagte er.
Sie sah ihm in die Augen. Auch ihrer Mutter hätte sie gern ins Gesicht geblickt, aber die hatte sich auf ihrem Klavierschemel nicht umgedreht. «Ich möchte nach New York reisen.»
Der Vater nickte, als überrasche ihn diese Ankündigung nicht im Geringsten. «Und da willst du bei Tante Abigail wohnen.»
«Wenn das ginge. Das wäre sehr schön.»
«Ich muss gestehen, ich bin überrascht, dass du diesen Wunsch nicht schon früher geäußert hast.» Endlich hatte sich die Mutter ihnen zugewandt. «Du wirst bald zwanzig Jahre alt. Höchste Zeit, dass du in die New Yorker Gesellschaft eingeführt wirst.» Und mit einem vorwurfsvollen Blick zum Vater fügte sie hinzu: «Ich weiß allerdings nicht, ob die Schwester deines Vaters in der Lage ist, dich mit den richtigen Leuten bekannt zu machen.»
Der Vater nahm einen Schluck aus seinem Glas.
«Oh, darum geht es gar nicht!», wehrte Lil rasch ab. «Ich möchte meinem Chef vorschlagen, als New Yorker Korrespondentin für den Honolulu Star-Bulletin zu arbeiten.»
«Das darf doch wohl nicht wahr sein!» Die Mutter erhob sich abrupt vom Klavierhocker und durchwanderte das Zimmer bis zum Bücherschrank. «Sag mir bitte nicht, dass du diesen Zeitungsunsinn noch weitertreiben willst! Das ist doch deiner nicht würdig!»
«Ach ja?», fuhr Lil auf. «Was ist meiner denn würdig? Auf dem New Yorker Heiratsmarkt verscherbelt zu werden wie ein Stück Fleisch?»
«Mäßige deinen Ton!», herrschte die Mutter sie an. «Ich wusste, dass die vulgären Manieren dieser Zeitungsleute auf dich abfärben würden! Warum musst du denn überhaupt arbeiten? Geben wir dir nicht ausreichend Taschengeld?»
Lil schloss die Augen. Die Wut bleichte ihren Kopf aus, bis kein Gedanke mehr Farbe hatte. Nichts existierte mehr in diesen Bleichwutmomenten, nur Leere und allumfassendes Weiß.
«Vielleicht könntest du mir antworten», hörte sie die kühle Stimme ihrer Mutter. «Wo du Worte doch so magst.»
«Ich habe nur gedacht», brachte Lil endlich hervor, «dass du selbst doch auch arbeiten gehst.»
Die Mutter lächelte. «Ich bin ausgebildete Konzertpianistin.»
«Die jetzt Stummfilme auf dem Klavier begleitet!»
«Weil ich keine andere Wahl habe.» Die Mutter warf einen anklagenden Blick in Richtung des Vaters. Der Scotch kreiste in seinem Glas. «Oder kennst du ein anständiges Konzerthaus auf Hawaii?»
«Ich werde meine Schwester Abigail fragen.» Der Vater blickte auf einen Punkt zwischen seiner Frau und seiner Tochter. «Lil soll zu ihr nach New York gehen, wenn sie das will.»
Auf einmal hatte Lil das Gefühl, im Musikzimmer zu ersticken. Sie sprang auf und lief zum geöffneten Fenster hinüber, hin zum Duft von Salz und Weite. Alles, was dort draußen lebte, tanzte im Abendwind: die Ilimablumen und Orchideen, die Blätter am Ingwerbaum, die Wellen auf dem Meer. Am Ende des Gartens konnte sie Tessi und Dave erkennen, die auf einer Bank saßen und sich an den Händen hielten. Eine Sehnsucht durchströmte sie, vielleicht nach Wärme, aber auch danach, weit fort zu sein. Zitronengelbes und orangefarbenes Licht ergoss sich über den Himmel. Die Wolken quollen auf. Und dann, plötzlich, fühlte sie sich getröstet. Wie glanzvoll die Welt da draußen war! Und sie würde sie in all ihrer Pracht sehen! Zuerst diesen deutschen Zeppelin, dann alles andere.
«Ich werde Tante Abigail gleich schreiben», sagte sie.
Vielleicht war sie die Schönste. Mit Sicherheit aber die Eleganteste, die er je gesehen hatte. Und natürlich die Größte. Das Wasser umspülte ihre Kurven. Die Orion aber lag einfach majestätisch da, einhundert Meter lang und mit 3600 PS die größte und stärkste Motoryacht der Welt. Von den Aufbauten wehte die amerikanische Flagge. Ein leichter Wind blies von der Ostsee, gerade kräftig genug, dass man die Streifen und die Sterne am oberen linken Rand erkennen konnte.
Christian schulterte seinen Seesack und bahnte sich den Weg durch die Menge. Im Hafen von Kiel herrschte ein Treiben, als ob es ein Volksfesttag wäre. Die Menschen waren zu Hunderten gekommen, um die Orion zu bestaunen, die größte und luxuriöseste Yacht der Welt. Auf der Pier drängten sich Männer in Fischerhemden, Kaufleute in dunklen Anzügen, Damen in gerade geschnittenen Kleidern mit enganliegenden Kappen auf dem Kopf. Dazwischen standen die vom Krieg Versehrten, Männer mit Augenklappen, denen ein Arm fehlte oder ein Bein. Blasmusik schepperte ohrenbetäubend.
«Was für eine Yacht!», brüllte ein Mann neben ihm auf der Pier. Ebenso wie Christian trug er einen Seesack über der Schulter. «Moin, ich bin Jan Katzenmeyer, Vollmatrose. Du gehörst auch zur Besatzung, nehme ich an.»
Christian strahlte. «Ja, moin! Christian, auch Vollmatrose. Freut mich, dich kennenzulernen!»
Ein Mann mit Falten, die ihm die Wetterlagen ins Gesicht gegerbt hatten, stieß sie von hinten an. «Nu man nich stehen bleiben, Jungs! Ick bün übrigens de Bootsmann un werd euch von nu an tüchtig rumkommandieren! Kümmt ihr nu an Bord, oder wüllt je noch’n beten inne Gegend kieken?»
Christian musste lachen. Das waren die Augenblicke, die er so liebte: Wenn er das Schiff, auf dem er fahren sollte, zum ersten Mal anschaute. Wenn er seinen Kameraden das erste Mal begegnete. Wenn alles noch so frisch war. Alles schien möglich in diesem ersten Moment. Freundschaft, die ein Leben halten sollte. Jeden Tag ein Meer mit anderen Launen, neue Dinge, die man tun musste, neue Häfen zu sehen. Gemeinsam mit Katzenmeyer und dem Bootsmann quetschte er sich durch die Menge hin zur Gangway, an der ein Wachmann stand und ihre Ausweise kontrollierte. Er schien Christian eine Ewigkeit zu mustern, als vergleiche er sein leuchtendes Gesicht mit der Passfotografie, und fragte ihn etwas, das Christian nicht hören konnte, so laut blies die Kapelle, so sehr lärmte die Begeisterung auf der Pier hinter ihm.
«In dem Kasten befindet sich eine Geige», erklärte er, als er die Frage endlich verstand.
Der Wachmann schaute ihm erneut in die Augen. Spätestens jetzt wurde Christian klar, was der von ihm denken musste: Dieser Vollmatrose hat nicht mehr alle Fahnen am Mast. Endlich durfte Christian über die Gangway die Planken der Yacht betreten, die still wie eine Villa im Wasser lag.
Gemeinsam mit Katzenmeyer und dem Bootsmann ging er zum Achterdeck, wo sie bereits der Erste Offizier erwartete, einer der Amerikaner an Bord. Er begrüßte die Deckscrew so begeistert, wie es alle Amerikaner taten, die Christian kennengelernt hatte, mit Händen, die immer genau zu wissen schienen, wo sie hingehörten, und einem festen, breitbeinigen Stand. Auf Englisch wies er den Bootsmann an, den Matrosen die Mannschaftsquartiere zu zeigen. Geschlossen gingen die Männer zu den Aufbauten, und der Bootsmann, der vorwegschritt, öffnete die Tür ins Innere des Schiffes.
Christian betrat eine andere Welt. Er hatte gewusst, dass Reiche oft exzentrisch waren. Der Eigner der Orion war indes so reich – und so exzentrisch –, dass er kurzerhand die gute Schiffssitte, Bullaugen rund anfertigen zu lassen, über Bord geworfen hatte, um stattdessen Bullaugen einzusetzen, die eckig und verschnörkelt wie Hausfenster waren. Zu Forstmanns Verteidigung ließ sich zumindest anführen, dass er sein Vermögen nicht geerbt hatte, sondern in Jahrzehnten harter Arbeit selbst aufgebaut. Das wusste Matrose Katzenmeyer zu berichten, nachdem sie bei den Rettungsbooten erste Sicherheitsinstruktionen empfangen hatten.
Die nachfolgende halbe Stunde, die sie zu ihrer freien Verfügung hatten, nutzten die beiden gewinnbringend, indem sie die Räume der Herrschaften inspizierten, von außen leider nur. Durch die merkwürdigen Fenster.
«Man hört, dass er mit einer Textilmanufaktur im Rheinland angefangen hat», fuhr Katzenmeyer fort. «Dann ist er nach Amerika ausgewandert.»
«Um dort auch in kaufmännischer Hinsicht Neuland zu betreten, nehme ich an.» Christian blieb vor einem Bullauge stehen, hinter dessen Scheibe ein Raum lag, der bis auf ein paar Geräte vollkommen leer war.
Katzenmeyer drehte sich um und spuckte in die Ostsee. «Ja, und weniger fein ausgedrückt, könnte man sagen, dass er in Amerika so viel Kohle gescheffelt hat, dass er sich die ganze Kieler Förde davon kaufen könnte. Mitsamt den Schiffen drauf. Ja, und dann hat der Mistkerl das Geld auch noch in Aktien angelegt.»
«Darüber habe ich auch mal nachgedacht», erklärte Christian.
«Über Aktien?» Katzenmeyer musterte ihn interessiert. «Hast du denn Geld?»
«Nein. Aber nach dieser Fahrt werde ich welches haben. Ich werde meine Heuer sparen.»
«Ja, bist du denn wahnsinnig? Da machst du ’ne Weltreise und willst unterwegs gar keinen Spaß haben? Nicht mal mit Mädchen und so?»
Christian schüttelte entschlossen den Kopf. Ein Mädchen mit Zöpfen, das sich in die Pedale stemmte, kam ihm in den Sinn.
«Aber wozu willst du das Geld anlegen? Was willst du denn damit machen nachher?»
Christian überlegte. Er kannte diesen Matrosen noch nicht. Er machte einen netten Eindruck, aber ob er sein Freund werden würde, so wie Fiete, der alles getan hatte, um ihm das Leben zu retten, ob das einer war, der einem den Kiefer schiente und bei dem man sogar weinen konnte, obwohl man ein Mann war, das wusste er noch nicht. Er beschloss, lieber das Thema zu wechseln. Es musste hier an Bord vielleicht keiner wissen, dass er vorhatte, fliegen zu lernen. «Also, dieser Eigner – Forstmann? Schlau von ihm, dass er nicht die Kieler Förde gekauft hat, sondern nur ein einzelnes, sehr schönes Schiff. Manchmal muss man sich eben auf das Wesentliche beschränken.»
Katzenmeyer klebte jetzt mit dem Gesicht an einem Bullauge. «Guck mal, Christian, was, glaubst du, sind das für Geräte dadrinnen? Sieht nach Folterwerkzeugen aus. Die werden doch wohl nicht komische Sachen mit uns machen, oder? Ich meine, nicht, dass das so ’ne neue Sache bei den Reichen ist – statt Kielholen oder so.»
«Kielholen!» Christian musste lachen. «Also ich glaube nicht, dass das noch jemand macht. Du?»
Katzenmeyer wiegte nachdenklich den Kopf hin und her. «Man weiß das nie. So, jetzt geht da einer rein! Ist das nicht der Sohn vom Forstmann? Was der da wohl macht?»