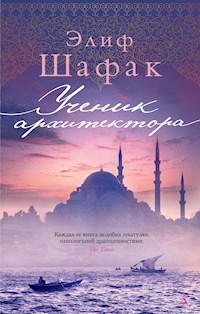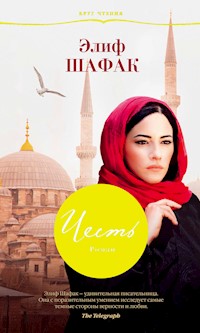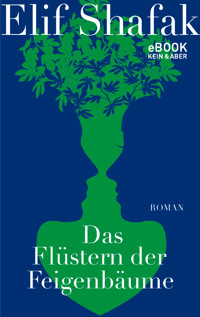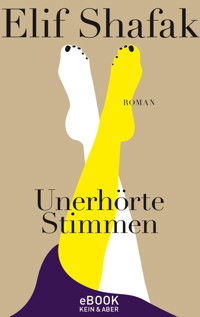
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
So sehr Leila es auch dreht und wendet: Sie wurde ermordet.Wie konnte es zu dieser Tat kommen? Fieberhaft denkt sie zurück an die Schlüsselmomente ihres aufreibenden Lebens, an den Geschmack von gewürztem Ziegeneintopf aus ihrer Kindheit, an den Gestank der Straße der Bordelle, wo sie arbeitete, und den Geruch von Kardamomkaffee, den sie mit einem jungen Mann teilte, der zu ihrer großen Liebe wurde.
Elif Shafak erzählt in ihrem neuen Roman von einer Frau, die am Rand der Gesellschaft Halt sucht, wo die Freundschaften tief ist, aber das Glück flüchtig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Elif Shafak, in Straßburg geboren, gehört zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen der Gegenwart. Ihre Werke wurden in über fünfzig Sprachen übersetzt. Die preisgekrönte Autorin von siebzehn Büchern, darunter Die vierzig Geheimnisse der Liebe (2013), Ehre (2014) und Der Geruch des Paradieses (2016), schreibt auf Türkisch und Englisch. Mit ihren Artikeln und Auftritten wurde sie zum viel beachteten Sprachrohr für Gleichberechtigung und freiheitliche Werte zunächst in der Türkei, später in ganz Europa. Elif Shafak lebt in London.
www.elifshafak.com
ÜBER DAS BUCH
So sehr Leila es auch dreht und wendet: Sie wurde ermordet. Wie konnte es zu dieser Tat kommen? Fieberhaft denkt sie zurück an die Schlüsselmomente ihres aufreibenden Lebens, an den Geschmack von gewürztem Ziegeneintopf aus ihrer Kindheit, an den Gestank der Straße der Bordelle, wo sie arbeitete, und den Geruch von Kardamomkaffee, den sie mit einem jungen Mann teilte, der zu ihrer großen Liebe wurde.
Elif Shafak erzählt in ihrem neuen Roman von einer Frau, die am Rand der Gesellschaft Halt sucht, wo Freundschaften tief sind, aber das Glück flüchtig.
Für die Frauen Istanbuls und für die Stadt Istanbul, die eine weibliche Stadt ist und immer war
»Nun ist er mir auch mit dem Abschied von dieser sonderbaren Welt ein wenig vorausgegangen. Das bedeutet nichts. Für uns gläubige Physiker hat die Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen, Illusion.«
Albert Einstein nach dem Tod seines engen Freundes Michele Besso
Das Ende
Ihr Name war Leila.
Tequila Leila, so kannten sie ihre Freunde und Kunden. Tequila Leila, so hieß sie daheim und bei der Arbeit in dem rosenholzfarbenen Haus in der Kopfsteinpflastergasse unten am Kai zwischen Kirche und Synagoge, zwischen Lampenläden und Kebabbuden – in der Straße mit Istanbuls ältesten amtlich zugelassenen Bordellen.
Nur hätte sie diese Beschreibung wahrscheinlich als Beleidigung empfunden und den, der sie geäußert hatte, neckisch mit einem Schuh beworfen – einem High Heel natürlich.
»Ist, Schätzchen, nicht war … Mein Name ist Tequila Leila!«
Niemals hätte sie geduldet, dass man von ihr als etwas Vergangenem sprach. Schon bei dem Gedanken fühlte sie sich klein und wertlos, und nichts war ihr mehr zuwider als dieses Gefühl. Nein, sie bestand auf der Gegenwartsform, obwohl sie gerade entsetzt feststellen musste, dass ihr Herz nicht mehr schlug und sie von einer Sekunde zur anderen aufgehört hatte zu atmen. So sehr sie es auch drehte und wendete – sie war tot.
Ihre Freunde wussten es noch nicht. Die schliefen so früh am Morgen noch tief und suchten den Ausgang aus ihrem Traumlabyrinth. Leila wäre jetzt auch lieber zu Hause im warmen Bett gewesen, auf ihren Füßen den dösenden, zufrieden schnurrenden Kater. Er war stocktaub und schwarz; nur auf einer Pfote saß ein weißer Fleck. Leila hatte ihm den Namen Mr Chaplin gegeben, denn er lebte wie die Helden der frühen Kinofilme in seiner eigenen stummen Welt.
Tequila Leila hätte alles dafür gegeben, jetzt in ihrer Wohnung zu sein. Stattdessen war sie hier am Stadtrand von Istanbul gleich gegenüber einem dunklen, feuchten Fußballplatz in einer metallenen Mülltonne mit rostigen Griffen und geplatztem Lack. Die Tonne hatte Räder, war mindestens einen Meter zwanzig hoch und etwa halb so breit, während Leila selbst einen Meter siebzig maß – die fünfzehn Zentimeter hohen lila Sling-back-Stilettos, die sie noch trug, nicht eingerechnet.
Sie hatte so viele Fragen. Wieder und wieder ließ sie die letzten Augenblicke ihres Lebens Revue passieren und überlegte, an welchem Punkt das Ganze schiefgegangen war – ein müßiges Unterfangen, weil sich die Zeit nun mal nicht zurückdrehen ließ. Zwar hatte sich ihre Haut bereits grau verfärbt, doch ihre Zellen waren quicklebendig. Sie spürte, dass sich in ihren Organen und Gliedmaßen ziemlich viel tat. Alle dachten, Leichen wären leblos wie gefällte Bäume oder hohle Stümpfe, ohne Bewusstsein. Hätte man ihr die Gelegenheit gegeben, hätte Leila bezeugt, dass Leichen ganz im Gegenteil nur so strotzten vor Leben.
Es machte sie fassungslos, dass es mit ihrem irdischen Dasein aus und vorbei war. Erst in der Nacht zuvor waren sie und ihr Schatten durch Pera gehuscht, durch Straßen, die nach hohen Militärs und Nationalhelden benannt waren – allesamt Männer natürlich. Noch in dieser Woche hatte ihr Lachen durch die geduckten Tavernen in Galata und Kurtuluş und die kleinen, stickigen Spelunken in Tophane gehallt, die man in keinem Reiseführer und auf keinem Stadtplan fand. Leilas Istanbul war nicht das Istanbul des Fremdenverkehrsamts.
In der Nacht zuvor waren ihre Fingerabdrücke auf einem Whiskyglas und ein Hauch ihres Parfüms – Paloma Picasso, ein Geburtstagsgeschenk ihrer Freunde – auf dem Seidentuch zurückgeblieben, das sie auf das Bett eines Fremden in der Penthouse-Suite eines Luxushotels geworfen hatte. Hoch oben am Himmel stand noch die zarte Sichel des Monds, hell und unerreichbar wie das letzte Überbleibsel einer glücklichen Erinnerung. Wie konnte sie tot sein, wenn sie doch noch zu dieser Welt gehörte und Leben in sich spürte? Wie war es möglich, dass sie nicht mehr existierte, plötzlich nicht mehr war als ein Traum, der mit dem ersten Tageslicht verblasste? Nur wenige Stunden zuvor hatte sie gesungen, geraucht, geflucht und gedacht … und ihre Gedanken setzten sich ja auch jetzt fort. Erstaunlich, wie gut ihr Gehirn funktionierte – nur, wie lange noch? Am liebsten wäre sie zurückgegangen, um allen zu erzählen, dass keiner auf der Stelle starb, dass auch Tote noch nachdenken konnten, zum Beispiel über das eigene Lebensende. Das würde die Leute wahrscheinlich erschrecken. Sie jedenfalls wäre darüber erschrocken, wenn sie noch am Leben wäre. Aber sie hielt es für wichtig, dass man die Menschen informierte.
Leilas Meinung nach waren die meisten Leute an den Wendepunkten ihres Daseins viel zu ungeduldig. Sie nahmen automatisch an, dass man in dem Moment, in dem man »Ja« sagte, zack!, Ehefrau oder Ehemann war. Dabei dauerte es Jahre, das Verheiratetsein zu erlernen. Ganz ähnlich erwartete die Gesellschaft, dass man sich nach der Geburt eines Kindes sofort in eine Mutter oder einen Vater verwandelte, obwohl man in Wahrheit erst nach einiger Zeit den Dreh raushatte und wusste, wie Elternsein ging – oder Großelternsein. Das Gleiche galt für den Ruhestand. Man legte doch nach dem letzten Arbeitstag in dem Büro, in dem das halbe Leben stattgefunden und so ziemlich jeder Traum geendet hatte, nicht einfach einen Schalter um. Leila kannte pensionierte Lehrer, die nach wie vor um sieben aufwachten, duschten und schicke Sachen anzogen, um sich am Frühstückstisch erschrocken daran zu erinnern, dass sie keinen Job mehr hatten. Auch daran musste man sich erst gewöhnen.
Vielleicht war das beim Sterben nicht anders. Kaum hatte man seine Seele ausgehaucht, galt man als mausetot. Doch so eindeutig lagen die Dinge nicht. So wie es tausend Nuancen zwischen Pechschwarz und Strahlendweiß gab, war die »ewige Ruhe« mehr als nur eine einzige Phase. Die Grenze zwischen Leben und Tod, falls sie denn existierte, musste porös sein wie Sandstein.
Leila wartete auf den Morgen. Bestimmt würde sie jemand finden und aus dieser Dreckstonne befreien. Es würde der Polizei nicht schwerfallen, ihre Identität zu ermitteln. Man musste nur ihre Akte finden. Leila war im Laufe der Jahre häufiger durchsucht, fotografiert und inhaftiert worden, als sie zugeben wollte, und ihre Fingerabdrücke hatten sie auch. In diesen Hinterhofrevieren hing ein ganz bestimmter Mief, der von den Aschenbechern mit den Zigaretten des Vortags stammte, vom Kaffeesatz in angeschlagenen Tassen, vom Mundgeruch, von nassen Scheuerlappen und dem beißenden Gestank der Urinale, der sich mit noch so viel Putzmittel nicht überdecken ließ. Beamte und Verbrecher, gemeinsam auf engstem Raum. Es hatte sie stets fasziniert, dass die abgestorbenen Hautzellen von Polizisten und Kriminellen auf ein und demselben Boden landeten und von Staubmilben unterschiedslos gefressen wurden. Auf einer Ebene, die dem menschlichen Auge verschlossen blieb, vermischten sich die Gegensätze in ungeahnter Weise.
Sobald die Behörden ihre Identität kannten, würden sie die Familie verständigen. Allerdings hatten die Eltern – sie lebten anderthalbtausend Kilometer entfernt in der alten Stadt Van – ihre Tochter vor langer Zeit verstoßen und würden Leilas Leiche garantiert nicht holen kommen.
Du hast Schande über uns gebracht. Alle tuscheln hinter unserem Rücken.
Deshalb würde sich die Polizei an ihre fünf Freunde wenden müssen: an Sabotage Sinan, Nostalgie Nalan, Jamila, Zaynab122 und Hollywood Humeyra.
Tequila Leila zweifelte keine Sekunde daran, dass ihre Freunde kämen, so schnell sie konnten. Sie sah sie vor sich, wie sie mit gleichzeitig drängenden und zögerlichen Schritten näher traten, die Augen geweitet vor Schreck, vor allmählich einsetzender Trauer und grässlichem Schmerz, der noch nicht recht spürbar war. Es tat ihr von Herzen leid, sie dieser Tortur auszusetzen. Aber wie wohltuend zu wissen, dass sie ihr eine Wahnsinnsbeerdigung schmeißen würden! Kampfer und Weihrauch, Musik und Blumen – vor allem flammend rote, knallgelbe und burgunderfarbene Rosen. Zeitlos, klassisch, einfach unschlagbar. Tulpen wären zu protzig, Narzissen zu zart, und von Lilien musste sie niesen. Rosen dagegen boten die perfekte Mischung aus heißblütigem Glamour und wehrhaften Dornen.
Allmählich wurde es Tag. Die Farben der Streifen, die sich von Ost nach West über den Horizont zogen, erinnerten Leila an Bellinis, Martinis Orange, Erdbeer-Margaritas und Frozen Negronis. Bald ertönten die Gebetsrufe von den Moscheen ringsum, keiner im Gleichklang mit den anderen. In der Ferne erwachte der Bosporus aus seinem türkisblauen Schlaf und gähnte herzhaft. Ein Fischerboot kehrte mit knatterndem, qualmendem Motor zum Hafen zurück. Eine schwere Welle rollte träge der Küste entgegen. Früher hatten in dieser Gegend schöne Oliven- und Feigenbäume gestanden, doch man hatte sie niedergewalzt, um noch mehr Häuser und Hochgaragen bauen zu können. Irgendwo im Zwielicht bellte ein Hund, eher aus Pflichtgefühl als aus Empörung. Ganz in der Nähe zwitscherte laut und unbekümmert ein Vogel, und ein anderer trällerte etwas weniger fröhlich zurück. Der Chor des frühen Morgens. Ein Lieferwagen krachte auf seiner holprigen Fahrt über die pockennarbige Straße von einem Schlagloch ins nächste. Schon bald würde der Lärm des morgendlichen Berufsverkehrs dröhnen. Das Leben würde zu voller Kraft erwachen.
Leute, die ständig über das Ende der Welt spekulierten, hatten Tequila Leila schon zu Lebzeiten immer erstaunt, ja geradezu aufgeregt. Wie konnte ein vernünftig wirkender Mensch von all den verrückten Szenarien besessen sein, in denen Asteroiden, Feuerbälle oder Kometen den Planeten zerstörten? Die Möglichkeit, dass die Zivilisation mit einem Schlag ausgelöscht wurde, war doch nicht halb so schrecklich wie die simple Erkenntnis, dass der Tod des Einzelnen am Lauf der Dinge nicht das Geringste änderte und das Leben ohne uns unverändert weiterging. Das hatte ihr immer Angst eingejagt.
Als der Wind drehte und über den Fußballplatz pfiff, sah sie die vier Jungen. Müllsammler, die in aller Früh den Abfall durchsuchten. Zwei schoben einen mit Plastikflaschen und zerdrückten Dosen beladenen Karren vor sich her. Der dritte trottete mit hängenden Schultern und krummen Knien hinterdrein. Er hatte einen schmutzigen Sack geschultert, dessen Gewicht ihm zu schaffen machte. An der Spitze stolzierte der vierte daher, eindeutig der Anführer, die knochige Brust geschwellt wie ein Gockel beim Hahnenkampf. Lachend und flachsend kamen sie auf Leila zu.
Hier drüben bin ich!
Vor einem Müllcontainer auf der anderen Straßenseite blieben sie stehen und begannen darin herumzuwühlen. Shampooflaschen, Saftbehälter, Joghurtbecher, Eierkartons – jedes Fundstück wurde einzeln herausgezogen und auf den Karren geworfen. Sie waren geschickt, sehr routiniert. Einer entdeckte einen alten Lederhut, setzte ihn sich grinsend auf, schob die Hände in die Gesäßtaschen und schlenderte wie ein Cowboy, den er wohl in irgendeinem Film gesehen hatte, übertrieben cool hin und her. Sofort schnappte ihm der Anführer das Ding vom Kopf und setzte es sich selbst auf. Keiner protestierte. Als der Container ausgeschlachtet war, zogen sie weiter. Allerdings sah es zu Leilas Bestürzung so aus, als würden sie sich wieder entfernen, ohne sie zu bemerken.
Hey, hier bin ich!
Als hätte er den flehentlichen Ruf gehört, hob der Anführer langsam das Kinn, blinzelte in die aufgehende Sonne und suchte den Horizont ab. Da traf sein Blick auf Leila. Er riss die Augen auf, und seine Lippen begannen leicht zu zittern.
Bitte nicht weglaufen!
Er lief nicht weg, sondern zischte den anderen etwas Unverständliches zu, und schon starrten sie Leila ebenso fassungslos an. Erst jetzt wurde ihr klar, wie jung sie waren. Kinder, kleine Knirpse, die so taten, als wären sie Männer.
Der Anführer machte einen vorsichtigen Schritt nach vorn. Dann noch einen. Wie eine Maus an einem abgefallenen Apfel knabberte, so tastete er sich vor, scheu und wachsam und entschlossen. Als er im Näherkommen erkannte, wie Leila zugerichtet war, verdüsterte sich seine Miene.
Nur keine Angst!
Jetzt stand er so dicht vor ihr, dass sie seine blutunterlaufenen Augen sah. Ihr war klar, dass dieser Junge, nicht älter als fünfzehn, Klebstoff geschnüffelt hatte. Istanbul würde ihn heuchlerisch willkommen heißen, würde ihn aufnehmen und, wenn er am wenigsten damit rechnete, wie eine alte Stoffpuppe in die Ecke schmeißen.
Ruf die Polizei, Junge! Ruf die Polizei, damit meine Freunde benachrichtigt werden!
Ein hastiger Blick nach rechts und links, um auszuschließen, dass es Zeugen oder Überwachungskameras gab – dann griff er unvermittelt nach ihrer Kette mit dem Medaillon, in dessen Mitte ein kleiner Smaragd steckte. So behutsam, als könnte er in seiner Hand explodieren, berührte er das angenehm kalte Metall des Anhängers. Er öffnete das Medaillon, nahm das Foto heraus und betrachtete es. Er erkannte auf dem Bild eine jüngere Version der Frau vor ihm neben einem sanft lächelnden Mann mit grünen Augen und langem, altmodisch frisiertem Haar. Die beiden wirkten glücklich, verliebt.
Auf der Rückseite des Fotos stand: D/Ali und ich … Frühling 1976.
Kurz entschlossen riss er den Anhänger ab und stopfte sich die Beute in die Tasche. Die anderen drei, die schweigend hinter ihm standen, ignorierten es, falls sie es überhaupt mitbekamen. Sie waren noch Kinder, aber stadterfahren genug, um zu wissen, wann man besser wegsah.
Nur einer trat einen Schritt vor und traute sich flüsternd zu fragen: »Ist die … Lebt die noch?«
»Bist du blöd, oder was?«, erwiderte der Anführer. »Die Alte ist voll hinüber.«
»Die Arme. Wer das wohl ist?«
Der Anführer neigte den Kopf zur Seite und beäugte Leila, als sähe er sie zum ersten Mal. Während er sie von oben bis unten musterte, breitete sich auf seinem Gesicht ein Grinsen aus wie verschüttete Tinte auf einem Blatt Papier. »Siehst du nicht, dass das ne Hure ist, Schwachkopf?«
»Echt?«, fragte der andere Junge sehr ernst, zu schüchtern und unschuldig, um das Wort selbst in den Mund zu nehmen.
»Klar, du Idiot.« Der Anführer wandte sich halb zu den anderen um und rief triumphierend: »Das bringen alle Zeitungen, und im Fernsehen senden sie das auch! Wir werden berühmt! Aber wenn die Reporter kommen, überlasst ihr mir das Reden!«
Ein Stück entfernt heulte auf der Straße ein Motor auf. Dann schlitterte ein Wagen um die Kurve und fuhr röhrend Richtung Autobahn davon. In den scharfen Salzgeruch des Winds mischten sich Abgase. Trotz der frühen Stunde, in der die Sonne erst die Spitzen der Minarette, die Häuserdächer und die Wipfel der Judasbäume beschien, strömten die Menschen in die Stadt, hastig, um bereits verlorene Zeit aufzuholen.
teil eins
Geist
Eine Minute
In der ersten Minute nach ihrem Tod verebbte langsam, aber stetig Tequila Leilas Bewusstsein, wie das Wasser, das von der Küste zurückwich. Doch obwohl ihre Gehirnzellen nun nicht mehr durchblutet waren und keinen Sauerstoff bekamen, starben sie nicht ab. Zumindest nicht sofort. Ein letzter Rest Energie aktivierte zahllose Neuronen und verknüpfte sie wie zum ersten Mal miteinander. Zwar schlug Tequila Leilas Herz nicht mehr, doch ihr Hirn wehrte sich und kämpfte, bis es in einen Zustand erhöhten Wahrnehmungsvermögens gelangte, in dem es den Tod des Körpers miterlebte, aber sein eigenes Ende noch nicht zu akzeptieren bereit war. Geschäftig drängte sich Leilas Gedächtnis vor und sammelte Bruchstücke eines Lebens, das auf sein Ende zuraste. Leila dachte an Dinge, die sie für immer verloren geglaubt hatte. Die Zeit verflüssigte sich. Ein Erinnerungsschwall folgte dem nächsten, bis Vergangenheit und Gegenwart nicht mehr zu trennen waren.
Das Erste, was ihr in den Sinn kam, war Salz – das Gefühl von Salz auf der Haut und der Geschmack von Salz auf der Zunge.
Sie sah sich als nacktes, glitschiges, knallrot angelaufenes Baby. Gerade hatte sie sich, erfüllt von nie gekannter Angst, durch eine nasse, glatte Passage geschoben und den Mutterschoß verlassen. Jetzt lag sie in einem Raum voller neuer Geräusche, Farben und Gegenstände. Das Sonnenlicht, das durch die bunten Glasfenster schien, malte trotz des kalten Januartags wärmende Tupfen auf die Bettdecke und spiegelte sich im Wasser einer Porzellanschüssel. In dieses Wasser tauchte gerade eine ältere Frau in einem herbstlaubfarbenen Kleid – die Hebamme – ein Handtuch, und als sie es auswrang, rann an ihrem Unterarm Blut hinunter.
»Maschallah, maschallah, es ist ein Mädchen!«
Mit einem Stück Feuerstein, das sie aus ihrem Büstenhalter gezogen hatte, durchtrennte sie die Nabelschnur. Das tat sie nie mit Messer oder Schere; kalte Werkzeuge waren untauglich für die schwierige Aufgabe, ein Kind auf der Welt zu begrüßen. Die Alte genoss hohes Ansehen in der Gegend, galt jedoch wegen ihrer Verschrobenheit als etwas unheimlich – als eine Frau mit zwei Seiten, einer weltzugewandten und einer weltabgewandten, und wie bei einer in die Luft geworfenen Münze kam einmal diese, einmal jene zum Vorschein.
»Ein Mädchen«, murmelte die junge Mutter in ihrem schmiedeeisernen Himmelbett. Ihr hellbraunes Haar war schweißnass und ihr Mund staubtrocken.
Sie hatte es schon befürchtet. Anfang des Monats hatte sie im Garten ein zwischen zwei Ästen gespanntes Spinnennetz behutsam mit dem Finger durchbohrt und in den folgenden Tagen oft nachgesehen. Hätte die Spinne das Loch geflickt, würde es ein Junge werden. Doch das Netz blieb zerrissen.
Die junge Frau hieß Binnaz, »Tausend Liebkosungen«, und war neunzehn. Seit diesem Jahr fühlte sie sich allerdings wesentlich älter. Sie hatte volle Lippen, eine niedliche Stupsnase, wie sie in diesem Landesteil nur selten vorkam, ein längliches Gesicht mit spitzem Kinn und große, dunkle Augen, die wie Stareneier blau gesprenkelt waren. In dem rehbraunen Leinennachthemd wirkte ihr seit jeher schlanker Körper noch zarter. Die blassen Pockennarben an ihren Wangen hatte ihre Mutter einmal als Spuren des Mondlichts bezeichnet, das Binnaz im Schlaf gestreichelt habe. Binnaz vermisste ihre Eltern und ihre neun Geschwister, die einige Stunden entfernt in einem Dorf lebten. Dass ihre Familie arm war, hatte man sie oft spüren lassen, seit sie als frischgebackene Ehefrau in das Haus gekommen war.
Du solltest dankbar sein! Bei deiner Ankunft hier hattest du gar nichts!
Aber sie hatte auch jetzt nichts, dachte sie insgeheim oft. Was sie besaß, war so vergänglich, so flüchtig wie die Samen der Pusteblume. Eine einzige Bö, ein einziger Regenschauer hätte es hinweggefegt. Es quälte sie, dass man sie jederzeit hinauswerfen konnte. Wohin sollte sie dann gehen? Ihr Vater hatte genug Mäuler zu stopfen und würde sie niemals wieder bei sich aufnehmen. Sie würde noch einmal heiraten müssen, ohne zu wissen, ob die zweite Ehe glücklicher oder der neue Mann mehr nach ihrem Geschmack wäre. Aber wer nähme sie dann überhaupt, als geschiedene, gebrauchte Frau? Von solchen Gedanken gepeinigt, war sie wie ein unerwünschter Gast durch das Haus, durch ihr Schlafzimmer und um den eigenen Kopf herum gewandert. Bis jetzt. Denn mit der Geburt dieses Kindes würde sich alles ändern. Von nun an, sagte sie sich, war es vorbei mit dem Unbehagen, der Unsicherheit.
Fast widerstrebend blickte sie zur Tür hinüber, wo eine kräftige Frau mit kantigem Kinn stand. Sie hatte eine Hand in die Hüfte gestemmt und umfasste mit der anderen den Knauf, als wäre sie unschlüssig, ob sie bleiben oder gehen sollte. Sie war zwar erst Anfang vierzig, wirkte mit ihren altersfleckigen Händen und den Falten rings um den strichschmalen Mund jedoch sehr viel älter. Ihre Stirn war wie ein gepflügtes Feld von tiefen, ungleichmäßigen Furchen durchzogen, die vom Stirnrunzeln und vom Rauchen herrührten. Ununterbrochen qualmte sie aus dem Iran geschmuggelten Tabak und trank aus Syrien geschmuggelten Tee. Ihr Haar, das sie mit viel ägyptischem Henna ziegelrot färbte, war in der Mitte gescheitelt und zu einem glatten Zopf geflochten, der ihr fast an die Hüfte reichte. Die haselnussbraunen Augen hatte sie sorgsam mit schwarzem Kajal umrandet. Das war Suzan, die andere, die erste Frau ihres Mannes.
Einen Moment lang trafen sich ihre Blicke. Die Luft war stickig und roch schwer wie treibender Teig. Zwölf Stunden hatten sie sich in ein und demselben Raum aufgehalten und lebten nun plötzlich in zwei verschiedenen Welten. Beide wussten, dass sich ihre jeweilige Stellung seit der Geburt des Kindes für immer verändert hatte. Trotz ihres jugendlichen Alters und ihrer kurzen Zugehörigkeit zur Familie war die Zweite nun an die erste Stelle gerückt.
Suzan wandte den Blick ab, aber nur kurz. Als sie wieder zu Binnaz hinsah, war er härter als zuvor. Mit einer Kopfbewegung in Richtung des Kindes sagte sie: »Es schreit nicht.«
Binnaz wurde kreidebleich. »Ja. Stimmt was nicht mit ihm?«
»Es ist alles in Ordnung«, versicherte ihr die Hebamme und musterte Suzan kühl. »Nur Geduld!«
Die Hebamme wusch das Baby mit heiligem Wasser aus dem Zamzam-Brunnen – das Geschenk eines Pilgers, der vor Kurzem vom Hadsch zurückgekehrt war – und entfernte Blut, Schleim und Käseschmiere. Auch nach der Reinigung hörte das Neugeborene nicht auf, sich vor Unbehagen zu winden, als kämpfte es mit sich selbst, mit seinen ganzen dreieinhalb Kilo.
»Darf ich sie halten?«, fragte Binnaz, ohne von ihrem Haar abzulassen, das sie immerfort zwirbelte – ein nervöser Tic, der sich im Laufe des vergangenen Jahres entwickelt hatte. »Sie … sie schreit einfach nicht.«
»Sie wird schreien, glaub mir«, erwiderte die Hebamme resolut, biss sich jedoch sofort auf die Zunge. Ihre Behauptung hing in der Luft wie ein düsteres Omen. Sie spuckte hastig drei Mal auf den Boden und trat mit dem rechten Fuß auf den linken, um die Vorahnung, falls es denn eine war, abzufangen.
In quälendem Schweigen und voller Ungeduld starrten die erste Frau, die zweite Frau, die Hebamme und zwei Nachbarinnen auf das Kind.
»Was ist los? Ich will die Wahrheit wissen!«, murmelte Binnaz vor sich hin. Ihre Stimme war dünner als Luft.
Nach sechs Fehlgeburten innerhalb weniger Jahre, eine schlimmer und schwerer zu vergessen als die andere, war sie während dieser Schwangerschaft besonders vorsichtig gewesen. Sie hatte nie einen Pfirsich berührt, damit das Baby nicht mit Flaum bedeckt zur Welt kam, hatte ganz ohne Gewürze und Kräuter gekocht, damit es ohne Sommersprossen oder Leberflecken geboren wurde, hatte nie an Rosen gerochen, um Feuermale zu verhindern. Nie hatte sie ihr Haar gekürzt, denn dann wäre auch ihr Glück beschnitten worden, hatte keinen Nagel in die Wand geschlagen, damit ja kein schlafender Ghul etwas abbekam. Weil bekannt war, dass die Dschinn in den Toiletten Hochzeit feierten, war sie nach Einbruch der Dunkelheit in ihrem Zimmer geblieben und hatte sich mit dem Nachttopf beholfen. Und sie hatte sich vor dem Anblick von Kaninchen, Ratten, Katzen, Geiern, Stachelschweinen und streunenden Hunden gehütet. Als ein Wandermusiker mit einem Tanzbären in der Straße aufgetaucht war und alle Anwohner aus den Häusern liefen, um sich das Spektakel anzusehen, hatte sie sich aus Furcht, ihr Kind könnte über und über behaart zur Welt kommen, nicht aus dem Haus getraut. Bei Begegnungen mit Bettlern, Leprakranken oder einem Leichenwagen war sie umgekehrt und in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Jeden Morgen hatte sie eine ganze Quitte gegessen, damit das Baby Grübchen bekam, und abends ein Messer unter das Kissen gelegt, um böse Geister zu bannen. Und um den Einfluss der ersten Frau ihres Mannes zu mindern, hatte sie nach jedem Sonnenuntergang heimlich Haare aus Suzans Bürste gezupft und im Kamin verbrannt.
Zu Beginn der ersten Wehe hatte Binnaz in einen süßen, sonnenweichen roten Apfel gebissen, der jetzt auf dem Nachttisch lag und sich allmählich braun verfärbte. Den Apfel würde man später in Stücke schneiden und an die Nachbarinnen verteilen, die vergeblich versuchten, schwanger zu werden, damit auch sie eines Tages ein Kind bekamen. Außerdem hatte Binnaz Granatapfel-Scherbett aus dem rechten Schuh ihres Mannes getrunken, hatte Fenchelsamen in den vier Ecken des Zimmers verstreut und war über einen Besen gesprungen, der als Abwehr gegen Schaitan vor der Tür auf dem Boden lag. Als die Wehen stärker wurden, hatten die anderen Frauen alle Tiere im Haus freigelassen, um die Schmerzen zu lindern – die Kanarienvögel, die Finken und zuletzt den stolzen, einsamen Kampffisch in seinem Glas. Der schwamm jetzt wohl mit seinen langen, saphirblau wallenden Flossen in einem Bach ganz in der Nähe. Sollte der kleine Fisch in den Natronsee gelangen, für den die ostanatolische Stadt berühmt war, würde er im salzigen, kohlensäurehaltigen Wasser kaum überleben. Schlug er jedoch die andere Richtung ein, würde er den Großen Zab erreichen und auf seiner weiteren Reise womöglich sogar den Tigris, den legendenumwobenen Fluss, der im Garten Eden entsprang.
Das alles war geschehen, damit das Kind gesund und wohlbehalten auf die Welt kam.
»Ich will sie sehen. Bitte gebt mir meine Tochter!«
Kaum hatte Binnaz gesprochen, öffnete Suzan leise wie ein flüchtiger Gedanke die Tür und schlich hinaus – bestimmt um ihrem Ehemann, ihrer beider Ehemann, die Nachricht zu überbringen. Binnaz erstarrte.
Harun war ein widersprüchlicher Mensch. An einem Tag freundlich und großzügig, am nächsten nur mit sich selbst beschäftigt und bis zur Herzlosigkeit unaufmerksam. Als ältester von drei Brüdern hatte er seine Geschwister allein großgezogen, nachdem die Eltern durch einen Autounfall ums Leben gekommen waren. Die Tragödie hatte die Welt der Kinder zerstört und Harun geprägt. Im Umgang mit seiner Familie war er überbehütend, im Umgang mit der Außenwelt misstrauisch geworden. Manchmal spürte er, dass etwas in ihm zerbrochen war, und wünschte sich sehnlich, es würde heilen. Doch solche Gedanken führten zu nichts. So sehr er den Alkohol liebte, so sehr fürchtete er die Religion. Ein Glas Raki nach dem anderen kippend, versprach er seinen Zechkumpanen das Blaue vom Himmel; war er dann wieder nüchtern, tat er vor Allah noch heißere Schwüre. Es fiel ihm schon schwer, den Mund zu halten, aber seinen Körper hatte er noch weniger im Griff. Bei jeder Schwangerschaft von Binnaz war auch sein Bauch dicker geworden – nicht viel, doch genug, als dass die Nachbarn hinter seinem Rücken über ihn lachten.
»Jetzt ist er wieder guter Hoffnung«, sagten sie und verdrehten die Augen. »Nur schade, dass er die Kinder nicht selbst auf die Welt bringen kann!«
Mehr als alles andere wünschte sich Harun einen Sohn. Und nicht nur einen. Allen, ob sie es hören wollten oder nicht, erzählte er, er werde einmal vier Söhne haben, die Tarkan, Tolga, Tufan und Tarik heißen sollten. Weil seine lange Ehe mit Suzan kinderlos geblieben war, hatten die Familienältesten die damals kaum sechzehnjährige Binnaz ausgesucht und nach mehrwöchigen Verhandlungen zwischen beiden Familien in einer religiösen Zeremonie mit Harun verheiratet. Das kleine Detail, dass es sich dabei um eine inoffizielle Ehe handelte, die im Fall des Scheiterns von keinem weltlichen Gericht anerkannt würde, war niemandem eine Erwähnung wert. Braut und Bräutigam hatten vor den Trauzeugen auf dem Boden gesessen und dem schielenden Imam gelauscht, der die türkischen Passagen mit dünner, die arabischen mit voller Stimme vortrug. Binnaz hatte die ganze Zeit auf den Teppich geblickt, dabei jedoch ab und zu verstohlen zu den Füßen des Imams hinübergespäht, dessen lehmbraune Socken alt und so verschlissen waren, dass der große Zeh bei jeder Bewegung die fadenscheinige Wolle zu durchstoßen drohte, als wollte er fliehen.
Kurz nach der Hochzeit war Binnaz schwanger geworden, und die folgende Fehlgeburt brachte sie beinahe um. Nächtliche Panik, brennender Schmerz, eine kalte Hand an ihrer Hüfte, Blutgeruch und der Drang, sich festzuhalten, als würde sie fallen, immer nur fallen. Dasselbe geschah während der weiteren Schwangerschaften, nur wurde es jedes Mal schlimmer. Sie konnte es niemandem sagen, doch mit jedem verlorenen Kind riss ein Teil der Hängebrücke, die sie mit der übrigen Welt verband, bis sich zwischen ihnen nur noch ein hauchdünner Faden befand, der Binnaz weiter bei Verstand bleiben ließ.
Nach drei Jahren bedrängten die Familienältesten Harun erneut. Sie erinnerten ihn daran, dass der Koran einem Mann bis zu vier Frauen gestatte, solange sie gut behandelt würden, was in Haruns Fall nicht zu bezweifeln sei, und forderten ihn auf, sich diesmal eine Bäuerin zu nehmen, selbst wenn sie eine Witwe mit eigenen Kindern war. Auch diese Ehe wäre nicht offiziell, aber mit einer weiteren religiösen Zeremonie schnell und diskret geschlossen gewesen. Selbst die Scheidung von der untauglichen jungen Frau erschien ihnen möglich. Bisher hatte Harun beide Vorschläge abgelehnt. Es sei schwer genug, zwei Frauen zu ernähren, erklärte er; eine dritte bedeute den finanziellen Ruin. Außerdem wollte er weder Suzan noch Binnaz verlassen, denn er hatte sie beide lieb gewonnen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
Binnaz lehnte sich in die Kissen zurück und überlegte, was Harun wohl gerade machte. Bestimmt lag er im Nebenzimmer auf dem Sofa, eine Hand an der Stirn, die andere auf dem Bauch, und sehnte den gellenden Schrei eines Säuglings herbei. Sie malte sich aus, wie Suzan gemessenen Schrittes auf ihn zuging. Sie sah es vor sich, wie die beiden miteinander flüsterten und ihre Worte mit den runden, eingeübten Bewegungen von Menschen unterstrichen, die jahrelang dasselbe Haus, wenn auch nicht dasselbe Bett geteilt hatten. Von den eigenen Gedanken aufgeschreckt murmelte sie wie zu sich selbst: »Jetzt sagt sie es ihm.«
»Schon gut, schon gut«, murmelte eine der Nachbarinnen besänftigend.
In der Floskel schwang so viel mit. Lass sie die Nachricht von dem Kind überbringen, das sie selbst ihm nicht schenken konnte! Zwischen den Frauen der Stadt gab es so viel Unausgesprochenes wie Wäscheleinen zwischen den Häusern.
Binnaz nickte, obwohl eine dunkle Wut in ihr aufstieg, die sie noch nie herausgelassen hatte. Sie hob den Blick zur Hebamme und sagte: »Warum schreit mein Kind nicht?«
Die Alte gab keine Antwort. Ihr war beklommen zumute. Das Baby hatte etwas Merkwürdiges an sich, und das lag nicht nur an seinem verstörenden Stummsein. Sie beugte sich vor, schnupperte an dem Kind und roch, was sie erwartet hatte: einen pudrigen Moschusduft, nicht von dieser Welt.
Sie legte sich den Säugling bäuchlings über die Knie und versetzte ihm zwei Klapse auf den Po. Das Kind verzog vor Schreck und Schmerz das kleine Gesicht, ballte die Händchen und zog eine Schnute, doch es blieb stumm.
»Was ist mit ihr?«
Die Hebamme seufzte. »Nichts, gar nichts. Ich glaube, sie ist einfach noch bei ihnen.«
»Bei wem ist sie?«, fragte Binnaz und fügte, ohne die Antwort abzuwarten, hastig hinzu: »Dann tu etwas!«
Die alte Frau dachte nach. Am besten ließ man dem Kind die Zeit, die es brauchte. Die meisten Babys gewöhnten sich sofort an die neue Umgebung, aber es gab auch welche, die lieber abwarteten und sich nur zögerlich zum Rest der Menschheit gesellten – wer konnte es ihnen verdenken? Im Laufe der Jahre hatte die alte Frau viele Babys erlebt, die sich kurz vor oder gleich nach der Geburt so bedroht fühlten durch die von allen Seiten auf sie einwirkende Lebenskraft, dass sie den Mut verloren und die Welt in aller Stille verließen. Kader – Schicksal – sagte man dazu, und kein Wort mehr, denn die Menschen gaben komplizierten, Furcht einflößenden Dingen immer einfache Namen. Doch die Hebamme glaubte, dass manche Kinder dem Leben einfach keine Chance geben wollten, vielleicht weil sie wussten, was sie erwartete. Waren diese Kinder nun feige oder eher so klug wie der große Salomon?
»Bringt mir Salz«, rief die Hebamme den Nachbarsfrauen zu.
Es hätte auch Schnee sein können, wenn draußen genug davon gelegen hätte. Früher hatte sie so manches Neugeborene in unberührten Schnee gedrückt und im richtigen Moment herausgezogen. Durch den Kälteschock entfaltete sich die Lunge, der Blutkreislauf wurde angekurbelt und das Immunsystem gestärkt. Alle diese Kinder waren kräftige Erwachsene geworden.
Kurz darauf brachten die Nachbarinnen eine große Plastikschüssel und eine Tüte Steinsalz. Die Hebamme legte das kleine Mädchen liebevoll in die Mitte der Schüssel und rieb seine Haut mit den Salzkörnchen ab. Sobald das Kind nicht mehr wie einer von ihnen roch, würden die Engel es freigeben müssen. Hoch oben in der Pappel vor dem Haus trällerte ein Vogel, der Stimme nach ein Häher, und eine einzelne Krähe flog krächzend der Sonne entgegen. Alles hatte seine eigene Sprache, der Wind, das Gras. Alles, nur dieses Kind nicht.
»Vielleicht ist sie stumm«, sagte Binnaz.
»Nur Geduld!«, mahnte die Hebamme.
Wie auf ein Stichwort begann das Baby heiser und rasselnd zu husten. Wahrscheinlich hatte es etwas von dem Salz verschluckt und war überrascht von dem intensiven Geschmack. Es lief dunkelrot an und verzog schmatzend das Gesicht, doch es schrie nicht. So stur war es, so gefährlich widerspenstig seine Seele! Abreiben allein half hier nicht. Die Hebamme beschloss, es auf anderem Weg zu versuchen.
»Ich brauche mehr Salz!«
Weil kein Steinsalz mehr im Haus war, mussten sie mit Speisesalz vorliebnehmen. Die Alte drückte eine Mulde in den Haufen, bettete das Kind hinein und bedeckte es vollständig mit den Kristallen, zuerst den Körper, dann den Kopf.
»Sie erstickt ja!«, rief Binnaz.
»Keine Sorge, Babys können die Luft länger anhalten als wir.«
»Aber woher weißt du, wann du sie rausholen musst?«
»Pst! Horch nur!« Die Hebamme legte den Finger an die rissigen Lippen.
Das Mädchen unter der Salzhülle öffnete die Augen und starrte ins milchige Nichts. Sie fühlte sich einsam, doch Einsamkeit war sie gewohnt. Eingerollt wie in den Monaten zuvor wartete sie den rechten Augenblick ab.
Ihr Bauchgefühl sagte: Eigentlich ist es ganz schön hier. Von hier gehe ich nicht mehr weg.
Ihr Herz widersprach. So ein Unsinn! Warum willst du an einem Ort bleiben, an dem nichts passiert? Das ist öde.
Warum soll ich einen Ort verlassen, an dem nichts passiert? Da ist es sicher, entgegnete der Bauch.
Verdutzt verfolgte der Säugling den Disput und wartete ab. Eine weitere Minute verging. Rings um ihn wirbelte und platschte die Leere, umspülte seine Zehen und Fingerspitzen.
Dass du dich hier sicher fühlst, heißt nicht, dass du hier richtig bist, wandte das Herz ein. Dort, wo man sich am sichersten fühlt, gehört man manchmal am wenigsten hin.
Nach einer Weile fasste das Kind einen Entschluss. Es würde seinem Herzen folgen – das sich später noch als großer Störenfried entpuppen sollte. Weil es trotz aller Gefahren und Schwierigkeiten begierig war, in die Welt hinauszugehen und sie für sich zu entdecken, öffnete es den Mund, um einen Laut von sich zu geben. Sofort rieselte ihm Salz in die Kehle und verstopfte seine Nase.
Blitzschnell stieß die Hebamme ihre Hände in die Schüssel und zog das Baby heraus, worauf ein lauter Schrei des Entsetzens ertönte. Erleichtert lachten die Frauen auf.
»So ists brav«, sagte die Hebamme. »Warum hast du uns so lange warten lassen? Ja, schrei nur, mein Kleines. Du sollst dich nie für deine Tränen schämen! Wenn du schreist, wissen alle, dass du lebst.«
Sie hüllte das Kind in ein Tuch und schnupperte noch einmal. Der betörende, überirdische Duft war fast verschwunden, und auch der letzte Rest würde sich mit der Zeit verflüchtigen – obwohl sie Leute kannte, die noch im hohen Alter einen Hauch vom Paradies verströmten. Doch das behielt sie für sich. Sie richtete sich auf und legte den Säugling neben seine Mutter aufs Bett.
Binnaz strahlte, und ihr Herz pochte wie wild. Sie berührte die Zehen ihrer Tochter durch den Seidenstoff hindurch – perfekte, wunderschöne und beängstigend zarte Zehen. Dann umfasste sie den Kopf des Kindes so vorsichtig, als hielte sie heiliges Wasser in den Händen. Einen Augenblick lang war sie glücklich; sie fühlte sich vollkommen. »Keine Grübchen«, murmelte sie leise kichernd.
»Sollen wir deinen Mann rufen?«, fragte eine Nachbarin.
Auch in dieser Frage steckte viel Unausgesprochenes. Suzan hatte Harun sicherlich längst von der Geburt erzählt. Warum war er nicht sofort zu ihr geeilt? Doch bestimmt nur, um in Ruhe mit seiner ersten Frau zu sprechen und sie zu beruhigen. Das war ihm also wichtiger gewesen.
Binnaz’ Miene verdüsterte sich. »Ja, holt ihn her.«
Aber das war gar nicht nötig, denn Harun schlurfte bereits mit hängenden Schultern ins Zimmer und trat aus dem Schatten ins Sonnenlicht. Er hatte grau meliertes Haar, das ihn wie einen zerstreuten Gelehrten aussehen ließ, und eine herrisch wirkende Nase mit schmalen Löchern. Sein breites, glatt rasiertes Gesicht und seine dunkelbraunen Augen mit den leicht hängenden Augenwinkeln strahlten vor Stolz. Lächelnd ging er zum Bett, warf einen Blick auf das Kind, dann nacheinander auf die zweite Frau, die Hebamme, die erste Frau und schließlich zum Himmel.
»Allah, ich danke dir. Du hast meine Gebete erhört.«
»Es ist ein Mädchen«, warf Binnaz leise ein, denn möglicherweise hatte es ihm noch niemand gesagt.
»Ich weiß. Das nächste wird ein Junge, und er wird Tarkan heißen.« Er strich dem Baby mit dem Zeigefinger über die Stirn, die so glatt und warm war wie ein zu oft geriebenes Lieblingsamulett. »Sie ist gesund, alles andere zählt nicht. Ich habe ständig gebetet. Ich habe dem Allmächtigen gesagt, dass ich nicht mehr trinken werde, wenn das Kind lebt, keinen einzigen Tropfen! Allah hat meine Bitte erhört. Er ist barmherzig. Dieses Kind ist weder dein noch mein Besitz.«
Binnaz starrte ihn verwirrt an. Plötzlich ahnte sie etwas – wie ein Tier, das die Falle spürte, in die es im nächsten Augenblick tappen würde. Sie schielte zur Tür, wo Suzan die Lippen so fest zusammenpresste, dass sie fast weiß wurden. Schweigend stand sie da und völlig reglos, bis auf den einen, vor Ungeduld wippenden Fuß. Sie wirkte aufgeregt, ja außer sich vor Freude.
»Dieses Kind gehört Gott«, sagte Harun.
»Das gilt für alle Kinder«, murmelte die Hebamme.
Harun, der die Worte der Alten nicht gehört hatte, nahm die Hand seiner jüngeren Ehefrau und sah ihr in die Augen. »Wir schenken es Suzan.«
»Was redest du da?« Binnaz erkannte ihre eigene Stimme nicht, so fremd klang sie, so dumpf und fern.
»Suzan soll das Mädchen großziehen. Sie wird das hervorragend machen. Und wir beide bekommen noch mehr Kinder.«
»Nein!«
»Du willst keine Kinder mehr?«
»Ich lasse mir von dieser Frau nicht meine Tochter wegnehmen!«
Harun sog scharf die Luft ein und ließ sie langsam ausströmen. »Sei nicht so egoistisch, das missfällt Allah. Schließlich hat er dir das Kind geschenkt. Als du in dieses Haus gekommen bist, hattest du gar nichts.«
Binnaz schüttelte ununterbrochen den Kopf. Ob sie schlicht nicht aufhören konnte oder nur noch zu dieser Bewegung fähig war, ließ sich nicht sagen. Erst als Harun sich vorbeugte, sie an den Schultern packte und zu sich zog, hörte sie auf. Ihr Blick wurde leer.
»Sei vernünftig! Du wirst deine Tochter jeden Tag sehen, schließlich leben wir alle zusammen. Mein Gott, sie verschwindet ja nicht!«
Falls seine Worte tröstlich gemeint waren, verfehlten sie ihren Zweck vollkommen. Binnaz bedeckte ihr Gesicht mit den Händen, um den Schmerz in ihrer Brust zurückzuhalten. »Und wen wird meine Tochter ›Mama‹ nennen?«
»Das ist völlig egal. Dann ist Suzan eben ihre ›Mama‹ und du bist die ›Tante‹. Wenn sie älter ist, erfährt sie die Wahrheit, aber vorerst sollten wir das kleine Köpfchen nicht verwirren. Und alle unsere zukünftigen Kinder sind ihre Geschwister. Dann wird was los sein im Haus! Da wirst du gar nicht mehr unterscheiden können, welches wem gehört. Dann sind wir eine einzige große Familie!«
»Und wer stillt sie?«, fragte die Hebamme. »Die Mama oder die Tante?«
Harun warf der alten Frau einen wütenden Blick zu und spannte jeden Muskel seines Körpers an. In seinen Augen rangen Ehrerbietung und Hass miteinander. Er schob die Hand in die Tasche und zog mehrere Gegenstände hervor: eine verbeulte Packung Zigaretten, in der ein Feuerzeug steckte, zerknitterte Geldscheine, das Stückchen Kreide, mit dem er die Schnitte auf Kleidungsstücken markierte, und eine Magentablette. Das Geld gab er der Hebamme. »Für dich – als Zeichen unserer Dankbarkeit.«
Schmallippig nahm die Alte ihren Lohn entgegen. Sie wusste: Um möglichst unbeschadet durchs Leben zu kommen, musste man stets darauf achten, im rechten Augenblick zu erscheinen und im rechten Augenblick wieder zu gehen.
Während die Nachbarinnen ihre Sachen zusammenpackten und die blutigen Laken und Handtücher einsammelten, füllte sich der Raum mit einer seltsamen Stille, die wie Wasser in alle Ecken drang.
»Wir verschwinden«, erklärte die Hebamme ruhig, aber entschieden. Die beiden Nachbarinnen standen mit ernsten Gesichtern neben ihr. »Den Mutterkuchen vergraben wir unter einem Rosenstrauch. Und das da« – sie deutete mit ihrem knochigen Finger auf die Nabelschnur, die sie auf einen Stuhl gelegt hatte – »können wir aufs Dach der Schule werfen, wenn du willst. Dann wird deine Tochter später einmal Lehrerin. Oder wir bringen es ins Krankenhaus – dann wird sie Krankenschwester oder, wer weiß, vielleicht sogar Ärztin.«
Harun dachte kurz nach. »Lieber aufs Schuldach.«
Als die Frauen gegangen waren, wandte Binnaz das Gesicht von ihrem Mann ab und betrachtete den Apfel auf dem Nachttisch. Er war schon faulig geworden. Seine bräunliche Farbe erinnerte sie an die Socken des Imams, der ihren Mann und sie getraut hatte, und sie dachte an die Stunden nach der Zeremonie, als sie mit einem glänzenden Schleier vor dem Gesicht allein auf diesem Bett gesessen hatte, während ihr Mann und die Gäste im Nebenzimmer das Gelage feierten. Von ihrer Mutter war sie mit keinem Wort auf den Verlauf der Hochzeitsnacht vorbereitet worden, aber eine mitfühlende Tante hatte ihr eine Tablette gegeben, die sie sich unter die Zunge legen sollte. Wenn du die nimmst, spürst du nichts, und alles geht ganz schnell vorbei. Binnaz hatte die Tablette im Trubel des Tages verloren, hielt sie jedoch ohnehin für wirkungslos. Nicht einmal auf Fotos hatte sie je einen nackten Mann gesehen. Sie hatte zwar ihre jüngeren Brüder oft gebadet, vermutete aber einen Unterschied zwischen dem Körper eines Jungen und dem eines ausgewachsenen Mannes. Je länger sie auf ihren Bräutigam wartete, umso größer wurde die Angst, und als sie endlich seine Schritte vor der Tür hörte, fiel sie in Ohnmacht und sank zu Boden. Als sie die Augen wieder aufschlug, war sie von den Frauen aus der Nachbarschaft umringt, die ihr hektisch die Handgelenke rieben, die Stirn befeuchteten und die Füße massierten. Im Zimmer roch es scharf nach Essig und Kölnisch Wasser und nach etwas Unbekanntem, Aufdringlichem, das, wie ihr später klar wurde, aus einer Gleitgeltube stammte.
Als Harun und sie endlich allein waren, schenkte er ihr eine Kette, ein rotes Band mit drei Goldmünzen, eine für jede Eigenschaft, die mit ihr Einzug in das Haus halten würde: Jugend, Fügsamkeit und Fruchtbarkeit. Sanft sprach er auf sie ein, bis sich seine Stimme im Dunkel verlor. Er behandelte sie liebevoll, aber ohne auch nur eine Sekunde lang die vor der Tür wartenden Leute zu vergessen. Vielleicht aus Angst, sie könnte wieder ohnmächtig werden, entkleidete er sie hastig. Binnaz hielt die Augen die ganze Zeit über geschlossen. Schweißperlen traten ihr auf die Stirn. Sie begann laut zu zählen – eins, zwei, drei … fünfzehn, sechzehn, siebzehn – und machte auch dann weiter, als er sie anfuhr, sie solle mit dem Unsinn aufhören.
Binnaz konnte weder lesen noch schreiben und kannte nur die Zahlen bis neunzehn. Sobald diese unüberwindliche Grenze erreicht war, holte sie Luft und begann von vorn. Nach sehr vielen Neunzehns verließ Harun das Bett, ging aus dem Zimmer und ließ die Tür offen stehen. Sofort stürmte Suzan herein, obwohl Binnaz nackt war und der Raum nach Schweiß und Sex roch. Haruns erste Frau riss das Laken vom Bett, nahm es sichtlich zufrieden in Augenschein und verschwand wortlos. Den restlichen Abend verbrachte Binnaz allein, und eine dünne Schicht Schwermut legte sich auf ihre Seele wie zarter Schnee. Als sie jetzt daran dachte, entfuhr ihr ein seltsamer Laut, den man als Lachen hätte missverstehen können, hätte darin nicht so viel Schmerz gelegen.
»Nun komm schon«, sagte Harun. »Es ist doch nicht –«
Binnaz schnitt ihm zum ersten Mal in ihrer Ehe das Wort ab. »Das war ihre Idee, nicht wahr? Ist ihr das eben erst eingefallen, oder habt ihr diesen Plan schon vor Monaten hinter meinem Rücken ausgeheckt?«
»Das ist nicht dein Ernst.« Ihn schien weniger der Inhalt ihrer Worte zu verblüffen als vielmehr der Ton, den Binnaz anschlug. Er strich mit der linken über die Härchen auf dem Rücken der rechten Hand und stierte mit glasigem Blick vor sich hin. »Du bist noch jung, aber Suzan wird allmählich alt. Sie wird nie eigene Kinder haben. Mach ihr dieses Geschenk!«
»Und mir? Wer macht mir ein Geschenk?«
»Allah. Er hat es schon getan. Siehst du das nicht? Sei nicht so undankbar!«
»Dafür soll ich dankbar sein?«, sagte Binnaz und machte eine vage Geste mit der Hand, die sich auf alles Mögliche beziehen konnte – auf die Situation genauso wie auf die Stadt Van, die ihr nun wie irgendein Kaff auf einer alten Landkarte erschien.
»Du bist müde.«
Binnaz begann zu weinen. Die Tränen kamen ihr weder aus Zorn noch aus Verbitterung, sondern aus Resignation, aus dem Gefühl der Niederlage, das entsteht, wenn Vertrauen aufgebraucht ist. Die Luft in ihrer Lunge fühlte sich bleiern an. Als Kind war sie in das Haus gekommen, und jetzt, nach der Geburt ihres eigenen Kindes, durfte sie ihre Tochter nicht großziehen und nicht gemeinsam mit ihr erwachsen werden. Sie schlang die Arme um die Knie und verfiel in langes Schweigen. Das Thema war ein für alle Male beendet, doch die Wunde, die das Leben dieser drei Menschen von nun an durchzog, würde niemals verheilen.
Draußen vor dem Fenster schob ein Händler seinen Karren durch die Straße, räusperte sich und begann seine reifen, saftigen Aprikosen anzupreisen. Wie merkwürdig, dachte Binnaz, denn es war nicht die Zeit für süße Aprikosen, sondern für eiskalten Wind. Ein Schauder befiel sie, als wäre die Kälte, die der Händler nicht bemerkte, durch die Hauswand hindurch in sie gekrochen. Binnaz schloss die Augen, doch die Dunkelheit linderte nichts. Sie sah Schneebälle vor sich, die zu bedrohlichen Pyramiden gestapelt waren und plötzlich auf sie niederprasselten, nass und hart, im Inneren mit Kieseln bestückt. Einer flog gegen ihre Nase, und schon kamen die nächsten, ein wahres Trommelfeuer, ein weiterer traf ihre Lippe und spaltete sie. Sie riss die Augen auf und rang nach Luft. War das Wirklichkeit oder ein Traum? Vorsichtig betastete sie ihr Gesicht und spürte Blut. Wie merkwürdig, dachte sie noch einmal. Sah denn keiner, dass sie grauenhafte Schmerzen hatte? Und wenn es keiner sah, war dann alles nur in ihrem Kopf, war es nur Einbildung?
Es war nicht ihre erste Begegnung mit dem Wahnsinn, doch sie sollte die eindrücklichste bleiben. Wann immer sie noch Jahre später darüber nachdachte, aus welchem Grund sich ihr Verstand davongeschlichen hatte wie ein Dieb, der in der Dunkelheit aus einem Fenster stieg, fiel ihr dieser eine Moment ein, der ihr sämtliche Kraft geraubt hatte.
Am Nachmittag nach der Entbindung hob Harun das Kind in die Höhe, wandte sich gen Mekka und sprach dem Säugling den Adhan, den Gebetsruf, ins rechte Ohr.
»Dir, meine Tochter, die du, so Allah will, das erste von vielen Kindern unter diesem Dach sein wirst, gebe ich wegen deiner nachtschwarzen Augen den Namen Leyla. Aber du wirst nicht irgendeine Leyla sein, sondern auch die Namen meiner Mutter erhalten. Deine nine war eine ehrbare Frau, so fromm, wie auch du einmal sein wirst. Deshalb gebe ich dir zusätzlich den Namen Afife – die Sittsame, Unverdorbene – und den Namen Kamile – die Vollkommene. Bescheiden wirst du sein, anständig und rein wie Wasser …«
Als ihm einfiel, dass nicht jedes Wasser rein war, unterbrach er sich und fügte, um jede mögliche himmlische Verwechslung, jedes denkbare Missverständnis aufseiten Gottes zu verhindern, lauter als beabsichtigt hinzu: »Wie Quellwasser, so klar und sauber! Alle Mütter in Van werden zu ihren Töchtern sagen: ›Warum bist du nicht wie Leyla?‹ Und die Männer werden ihre Frauen fragen: ›Warum hast du kein Mädchen wie Leyla zur Welt gebracht?‹«
Das Kind versuchte sich währenddessen die Faust in den Mund zu stopfen und verzog jedes Mal den Mund, wenn es misslang.
»Du wirst mich so stolz machen!«, fuhr Harun fort. »Du wirst treu zu deiner Religion stehen, zu deiner Nation und zu deinem Vater!«
Nachdem Leyla endlich bemerkt hatte, dass ihre geballte Hand schlicht zu groß für ihren Mund war, schrie sie frustriert los, als wollte sie ihr früheres Schweigen wettmachen. Harun reichte sie rasch an Binnaz weiter, die sie sofort zu stillen begann. Um ihre Brustwarzen kreiste wie ein Raubvogel ein glühender Schmerz.
Als Leyla eingeschlafen war, trat Suzan, die ein wenig abseits gestanden hatte, leise an Binnaz’ Bett und nahm der Mutter, ohne ihr dabei in die Augen zu schauen, ihr Kind ab.
»Wenn sie schreit, bringe ich sie dir wieder.« Sie schluckte. »Keine Angst, ich kümmere mich gut um sie.«
Binnaz erwiderte nichts. Ihr Gesicht war so weiß und matt wie ein alter Teller. Außer den schwachen Atemzügen hörte man keinen Laut von ihr. Ihr Schoß, ihr Verstand, das Haus und sogar der alte See, in dem sich, wie es hieß, schon viele Liebende ertränkt hatten – alles wirkte hohl und vertrocknet. Nur ihre wunden, geschwollenen Brüste nicht; aus denen tropfte die Milch.
Sie war nun allein mit ihrem Mann und wartete, ob er etwas sagen würde. Es ging ihr nicht um eine Entschuldigung, sondern um die Anerkennung der Ungerechtigkeit und des unfassbaren Schmerzes, die ihr zugefügt wurden. Doch Harun schwieg. Und so erhielt das kleine Mädchen, das am 6. Januar 1947 in eine Familie mit einem Mann und zwei Frauen in der Stadt Van, der »Perle des Ostens«, hineingeboren worden war, den selbstbewussten, klaren, hochtrabenden Namen Leyla Afife Kamile. Er würde sich als ein großer Fehler erweisen. Denn so sehr ihr erster Name, Leyla, zu ihr passte, weil sie die Nacht in den Augen trug, so wenig taugten der zweite und dritte.
Erstens war sie nicht vollkommen; ihre vielen Unzulänglichkeiten durchzogen ihr Leben wie unterirdische Flüsse. Genau genommen war sie, zumindest sobald sie gehen konnte, die wandelnde Unvollkommenheit. Und dass ihr auch die Sittsamkeit nicht lag – was allerdings nicht ihre Schuld war –, würde sich mit der Zeit ebenfalls zeigen.
Leyla Afife Kamile sollte sie sein, die Tugendhafte, die Rühmenswerte. Doch als sie Jahre später einsam und mittellos in Istanbul angekommen war und zum ersten Mal das Meer gesehen und das grenzenlose, an den Horizont reichende Blau bewundert hatte, als ihr Haar in der feuchten Luft kraus geworden und sie eines Morgens in einem fremden Bett neben einem unbekannten Mann aufgewacht und ihr Herz so schwer geworden war, dass sie meinte, nie wieder atmen zu können, und nachdem man sie an ein Bordell verkauft hatte und dazu zwang, in einem Zimmer mit einem grünen Plastikeimer, der das herabtropfende Regenwasser auffing, Tag für Tag mit zehn, fünfzehn Männern zu schlafen – da war sie für ihre fünf Freunde, für die Liebe ihres Lebens und für viele Freier schlicht Tequila Leila.
Wenn ein Mann fragte – und es fragten viele –, warum sie sich nicht »Leyla«, sondern »Leila« schreibe, ob sie sich damit einen westlichen oder exotischen Anstrich geben wolle, lachte sie und sagte nur, sie sei eines Tages auf den Basar gegangen und habe das gespaltene »Y« gegen das unversehrte »I« eingetauscht.
Den Zeitungen, die über den Mord an ihr berichteten, war das alles egal. Die meisten hielten es nicht für nötig, Leilas Namen zu nennen, sondern begnügten sich mit den Initialen. Fast jeder Artikel wurde durch das gleiche Foto ergänzt, einen alten Schnappschuss aus der Schulzeit, auf dem sie nicht wiederzuerkennen war. Die Redakteure hätten auch ein neueres nehmen können – selbst auf ein Polizeifoto aus dem Archiv hatten sie Zugriff –, doch sie befürchteten, Leilas stark geschminktes Gesicht und der sagenhaft tiefe Ausschnitt könnten die Nation in ihrer Empfindsamkeit verletzen.
Auch die Fernsehsender meldeten am Abend des 29. November 1990 ihren Tod. Zunächst aber beschäftigten sich längere Berichte mit der Resolution des UN-Sicherheitsrats, durch die ein militärisches Eingreifen im Irak genehmigt wurde, mit den Nachwirkungen des tränenreichen Rücktritts der Eisernen Lady in Großbritannien, mit den anhaltenden Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei nach gewalttätigen Ausschreitungen in Westthrakien, mit der Plünderung von Geschäften ethnischer Türken sowie der Ausweisung des türkischen Konsuls in Komotini beziehungsweise des griechischen Konsuls in Istanbul, mit der Zusammenlegung der westdeutschen mit der ostdeutschen Fußballnationalmannschaft nach der Wiedervereinigung beider Länder, mit der Aufhebung des Gesetzes, wonach verheiratete Frauen nur mit Erlaubnis ihres Ehemanns außer Haus arbeiten durften, und mit dem Rauchverbot auf Turkish-Airlines-Flügen, das im ganzen Land zu heftigen Protesten führte.
Erst kurz vor dem Ende der Nachrichtensendung hieß es auf einem knallgelben Kriechtitel am unteren Bildschirmrand: Ermordete Prostituierte in Mülltonne aufgefunden. Viertes Opfer in diesem Monat. Unter Istanbuls Sexarbeiterinnen breitet sich Panik aus.
Zwei Minuten
Zwei Minuten nachdem ihr Herzschlag ausgesetzt hatte, rief sich Leilas Gehirn zwei Gegensätze in Erinnerung: den Geschmack von Zitrone und jenen von Zucker.
Juni 1953. Sie sah sich als Sechsjährige: Dicke kastanienbraune Locken rahmten ihr zartes, blasses Gesicht. Trotz ihres bemerkenswerten Appetits, vor allem auf Baklava mit Pistazien und auf Sesamkrokant, aber auch auf alles Pikante, war sie dünn wie eine Bohnenstange. Ein Einzelkind. Ein einsames Kind. Unruhig und zappelig und immer ein bisschen zerstreut wirbelte sie durch den Tag wie eine Schachfigur, die auf den Boden gerollt war. Um sich zu beschäftigen, dachte sie sich komplizierte Spiele aus, die sie alleine spielen konnte.
Ihr Elternhaus in Van war so groß, dass selbst ein Flüstern darin widerhallte, und an den Wänden tanzten Schatten wie im Inneren einer Höhle. Vom Wohnzimmer führte eine hölzerne Wendeltreppe in den ersten Stock. Der Eingang war mit bebilderten Fliesen geschmückt, auf denen Pfauen ihr Rad schlugen, Käselaibe und Brotzöpfe neben Weinkelchen lagen, Granatapfelhälften rubinrot lächelten und Sonnenblumen auf einem Feld ihre Stängel der wandernden Sonne so sehnsüchtig entgegenreckten wie Liebende, die um die Vergeblichkeit ihrer Hingabe wussten. Die Darstellungen faszinierten Leila. Einige Fliesen waren rissig oder angeschlagen, einige zum Teil mit grobem Putz bedeckt. Das Kind glaubte, die Bilder ergäben eine alte Geschichte, die sie, so sehr sie sich auch mühte, nicht erkennen konnte.