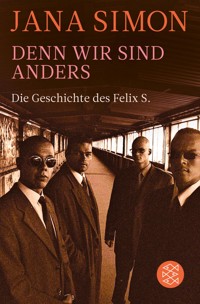9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die deutsche Wirtschaft wächst, die Welt bewundert Deutschland für seine Kraft, Stabilität und Weltoffenheit. Zugleich schrumpft die Mittelschicht, der Reichtum ist ungleicher verteilt als noch vor zwei Jahrzehnten. Jeder sechste Deutsche ist armutsgefährdet, die sozialen Aufstiegschancen sind so gering wie in kaum einem anderen westlichen Land. Die rechtspopulistische AfD erzielt bei Wahlen zweistellige Ergebnisse und sitzt nun im Bundestag. Ein großer Teil der Deutschen steht unter erheblichem Druck. Was bedeutet das für das Leben Einzelner und für das ganze Land? Anhand verschiedener Lebensgeschichten zeichnet die Journalistin Jana Simon ein differenziertes Bild Deutschlands, das die politische, soziale und wirtschaftliche Wucht der Veränderungen eindrücklich wiedergibt. Einige Protagonisten sind: der frühere EZB-Direktor Jörg Asmussen, der heute Investmentbanker ist; ein Polizist aus Thüringen; eine alleinerziehende Krankenschwester; eine »Influencerin« und der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jana Simon
Unter Druck
Wie Deutschland sich verändert
Über dieses Buch
Lange Zeit bewunderte die Welt Deutschland für seine Kraft, Stabilität und Weltoffenheit. Aber die Mittelschicht schrumpft, die sozialen Aufstiegschancen sind gering. Die rechtspopulistische AfD sitzt im Bundestag, das Land ist gespalten. Ein großer Teil der Deutschen steht unter erheblichem Druck. Was bedeutet das für den Einzelnen und für das ganze Land, wenn das bundesrepublikanische Versprechen vom Wohlstand für alle nicht mehr gilt? Anhand verschiedener Lebensgeschichten zeichnet die Journalistin Jana Simon ein differenziertes Bild Deutschlands von 2013 bis heute, das die politische, soziale und gesellschaftliche Wucht der Veränderungen eindrücklich wiedergibt.
Nahaufnahmen einer verunsicherten Nation: Ein Polizist aus Thüringen, eine alleinerziehende Krankenschwester, der frühere EZB-Direktor Jörg Asmussen, der heute Investmentbanker ist, eine junge »Influencerin« aus Berlin, eine Familie, die mit dem Dieselskandal kämpft und der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Vorwort
2013. Kapitel
Jörg Asmussen
Alexander Gauland
Thomas Matczak
Bożena Block
Jörn und Katrin Reichenbach
2015/2016
Alexander Gauland
Thomas Matczak
Alexander Gauland
Bożena Block
Jörg Asmussen
Alexander Gauland
2017. Kapitel
Alexander Gauland
Jörg Asmussen
Jörn und Katrin Reichenbach
Bożena Block
Alexander Gauland
Jörn und Katrin Reichenbach
Thomas Matczak
Alexander Gauland
Lisa Banholzer
Alexander Gauland
Jörg Asmussen
2018/2019
Lisa Banholzer
Alexander Gauland
Jörg Asmussen
Bożena Block
Lisa Banholzer
Jörn und Katrin Reichenbach
Alexander Gauland
Lisa Banholzer
Jörg Asmussen
Jörn und Katrin Reichenbach
Thomas Matczak
Alexander Gauland
Lisa Banholzer
Nachwort zur Taschenbuchausgabe
Dank
Vorwort
In der Biographie jedes Einzelnen spiegelt sich die Welt. Und in jeder Biographie spiegelt sich die Wirklichkeit eines Landes. »Dieser Maßstab hat mich schon immer fasziniert – der Mensch, der einzelne Mensch. Denn im Grunde passiert alles dort«, schreibt die weißrussische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch in ihrem Buch »Secondhand-Time«.
Anhand von Lebensgeschichten zeichne ich ein Bild Deutschlands der Gegenwart und der Entwicklung der vergangenen Jahre. Ein Biographiengewebe, in dessen Mittelpunkt sechs Menschen stehen, die an sehr verschiedenen, aber aus meiner Sicht entscheidenden Stellen der deutschen Gesellschaft wirken. Es sind Porträts von Frauen und Männern: die alleinerziehende Krankenschwester Bożena Block, die junge Influencerin Lisa Banholzer, der einstige EZB-Direktor und heutige Investmentbanker Jörg Asmussen, der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland, der Polizist Thomas Matczak und die Familie Reichenbach, die mit der Last des Eigenheims, der Erhaltung ihres Mittelklassestatus und den Auswirkungen des Dieselskandals kämpft. Es sind Beschreibungen von Einzelschicksalen. Subjektive Beobachtungen, die keinen Anspruch darauf erheben, repräsentativ zu sein. Trotzdem kann man meiner Meinung nach Übertragbares aus ihnen herauslesen. Wie in einem Brennglas verdeutlichen diese Biographien die Veränderungen in Deutschland, versinnbildlichen die Umbrüche in gemeinhin wichtigen Bereichen wie Gesundheit, Rente, Bildung, Europa, Migration, Geldpolitik, Rechts- und Linksextremismus, Populismus, Wirtschaft, Globalisierung, Terror, Innere Sicherheit, Islamismus, und Digitalisierung, und wie diese sich im Alltag eines jeden Einzelnen und in der gesamten Gesellschaft auswirken. Nahaufnahmen einer verunsicherten Nation.
Manche Gesprächspartner, wie Thomas Matczak, Jörg Asmussen und Alexander Gauland, kenne ich schon länger und habe immer wieder über sie geschrieben. Bożena Block, Lisa Banholzer und Familie Reichenbach kamen später hinzu, sie alle stammen aus verschiedenen sozialen Schichten, Milieus, Berufen und Generationen. Einige habe ich über viele Jahre hinweg immer wieder gesprochen, andere kürzer, aber dennoch sehr intensiv.
Etwas eint alle meine Gesprächspartner in diesem Buch, sie empfinden Druck, auf vielfältige und unterschiedlich ausgeprägte Weise. Manche erwähnen ihn in fast jedem Satz, bei anderen ergibt er sich eher aus der Gesamtbetrachtung. Und Alexander Gauland tritt in einer Zwitterrolle auf, er selbst ringt darum, in die erste Reihe der Politik zu gelangen, zugleich setzen er und seine Partei ein ganzes Land unter Druck.
Es gibt keinen Tag, an dem ich oder meine Gesprächspartner festmachen könnten, wann diese schleichende Veränderung Deutschlands begann, der steigende Druck, die allmähliche Zersetzung der Gemeinschaft. Wann habe ich den Druck selbst zum ersten Mal gespürt? Vielleicht in der Finanzkrise 2008/2009? Ganz sicher jedoch 2010 und 2011 in den USA, als ich für sieben Monate mit meiner Familie in Los Angeles lebte. Die Vereinigten Staaten erschienen damals von der Finanz- und Immobilienkrise ausgezehrt, in Downtown Los Angeles erhoben sich jeden Morgen hinter unserem Haus hunderte Obdachlose vom Asphalt, die in Zelten auf der Straße hausten. Aber von meinen amerikanischen Freunden und Bekannten nahm sie kaum einer wahr, und vor allem mochte niemand über sie sprechen. Als würden sie allein durch das Verschweigen verschwinden.
Im Januar 2011 berichtete ich für die Zeit aus Tucson, Arizona, über das Attentat auf die demokratische Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords. Es war der erste Anschlag auf einen US-Bundespolitiker nach dem Angriff auf Ronald Reagan 1981. Zuvor war Giffords bedroht worden, sie hatte sich für eine Reform des Gesundheitswesens ausgesprochen. Ich sprach mit einem der Gründer der Tucsoner Tea Party. Er hielt Demokraten schlicht für verrückt. Sein demokratischer Gegenspieler machte die Tea-Party-Anhänger für das Attentat verantwortlich. Beide Seiten standen sich vollkommen unversöhnlich gegenüber. Im Prinzip nahmen sie das vorweg, was heute tägliche Normalität ist in den Nachrichten und in der Wirklichkeit.
Damals hatte ich das Gefühl, dass in den Vereinigten Staaten, eine Gemeinschaft wie ich sie kannte, nicht mehr existierte. Eine Gesellschaft in Auflösung.
Als ich im Sommer 2011 nach Deutschland zurückkehrte, wirkte das Leben in Berlin im Vergleich zu Los Angeles geradezu harmonisch entspannt. Ich dachte, wenn es stimmt, dass Entwicklungen aus den Vereinigten Staaten mit ein wenig Zeitverzögerung nach Europa kommen, kann man sich nur fürchten.
Und sie kamen. Sichtbar wurden die Verschiebungen in Deutschland aber erst nach und nach. Ein Jahr ist mir dabei besonders im Gedächtnis geblieben – 2013, das Ausgangsjahr dieses Buches, dem die Griechenlandrettung, die Eurokrise, der Kriegsausbruch in Syrien und die Entdeckung des rechtsextremen NSU-Terror-Trios vorausgegangen waren. Das Jahr, in dem der Ukraine-Konflikt eskaliert, der NSU-Prozess anfängt und sich die AfD gründet.
In diesem Jahr treffe ich den fast achtzigjährigen Horst Wilde in seiner Berliner Wohnung, aus der er nach 41 Jahren ausziehen muss, weil die Miete nach einer »energetischen Sanierung« und den Modernisierungsmaßnahmen das Fünffache kostet. Ich spreche mit den Angehörigen eines NSU-Opfers, die jahrelang als Täter verdächtigt wurden. Polizeibeamte hatten sich bei den Befragungen der Familien als Journalisten und Privatdetektive ausgegeben. Erstmals ziehen deutsche Islamisten in den Syrienkrieg.
Ende 2014/Anfang 2015 beginnen die Menschen in Dresden, auf die Straße zu gehen und gegen eine »Islamisierung des Abendlandes« zu demonstrieren und Journalisten wie mich als Vertreter einer »Lügenpresse« zu beschimpfen. Wie tief Journalisten verabscheut werden, erfahre ich zum ersten Mal leibhaftig im Frühjahr 2015 in Montabaur. Ich bin von der Zeit-Redaktion zum Wohnort des Todespiloten der Germanwings-Maschine geschickt worden. Als ich dort ankomme, ist die Stimmung bereits aggressiv. Reden mag fast niemand mehr. Die Straße zum Elternhaus des Kopiloten ist gesperrt, weil zu viele Übertragungswagen und Reporter dorthin drängen. Kollegen rufen jeden einzelnen der ehemaligen Mitschüler des Piloten an.
Ich besuche den ehemaligen Grundschullehrer des Kopiloten in seinem Wohnzimmer. Ein niederländisches TV-Team ist auch schon da. Es bittet den Gastgeber darum, mit ihnen gemeinsam eine Bild-Zeitung kaufen zu gehen: Die Fernsehleute brauchen Schnittbilder, und Bild hat das aussagekräftigste Titelblatt, das erklären sie ihm aber nicht. Die Beobachtung der Szene bereitet Unbehagen. Der Lehrer schaut ein wenig verunsichert zu seiner Frau. Die ist nicht begeistert. Sie sagt: »Wir lesen die Bild-Zeitung nicht. Das ist für uns die Lügenpresse.« Sie meint es nicht böse, aber es klingt so. Noch vor kurzem hätte in einem Gespräch wie diesem keiner eine »Lügenpresse« erwähnt.
Heute vergeht kaum ein Interview, bei dem ich nicht gefragt werde, wer mich bezahlt und wer eigentlich bestimmt, was ich schreibe und was gedruckt wird. Journalisten als Lakaien der Mächtigen, die sich von der Wirklichkeit und der Suche nach Wahrheit verabschiedet haben? Leider tragen Journalisten auch ihrerseits einiges zu diesem Bild bei. Das Misstrauen zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten und beschränkt sich nicht nur auf Ostdeutschland.
Seitdem ist der Druck stetig gestiegen. Die Ankunft der Flüchtlinge 2015, eine weitere Zäsur, führt zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft. Und durch den Aufstieg der AfD verschieben sich die Grenzen des Sagbaren, die Gräben reichen nun immer tiefer.
Gegenüber von meiner Berliner Wohnung ziehen 2016 mehrere osteuropäische Obdachlose unter das U-Bahn-Viadukt. Jeden Morgen kann ich ihnen Auge in Auge beim Kochen, Essen und Verrichten ihrer Notdurft zuschauen. Ab und zu entfachen sie auch ein Feuer. Es ist fast wie in Los Angeles. Über den Umgang mit ihnen zerstreiten sich die Mieter des Hauses. Die einen halten das Elend nicht mehr aus und wollen die Obdachlosen möglichst in ihre Heimatländer vertreiben, die anderen wollen am liebsten Decken und Matratzen spenden. Kommuniziert wird irgendwann nur noch über Aushänge im Hausflur.
Im Herbst 2017 werde ich schließlich bei einer Kunstaktion des Zentrums für politische Schönheit, das im dörflichen Nachbargarten des thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke das Holocaust-Mahnmal in Miniaturformat aufstellt, von einer sehr aufgebrachten Menge aus zornigen Anwohnern und AfD-Anhängern fast verprügelt. Die Wütenden gehen auf die Künstler los. Die hatten sich zuvor monatelang als harmlose Mieter und Nachbarn ausgegeben. Die Künstler provozieren und die, die sich angesprochen und getäuscht fühlen, reagieren.
Es ist das erste Mal, dass ich abgesehen von Handgemengen bei Demonstrationen im vereinten Deutschland leibhaftige Gewalt erlebe – aus politischen Gründen. Szenen aus einem gespaltenen Land: Keine Seite findet für die andere noch Worte, so bleiben nur Taten. Und zwischen die Fronten zu geraten ist gefährlich.
An welchen Stellen ist der zunehmende Druck noch spürbar? Vielleicht daran, dass Heimat nicht mehr unbedingt dort ist, wo man geboren und aufgewachsen ist oder sich wohl und zu Hause fühlt, sondern dort, wo man sich Wohnraum leisten kann. Im Februar 2019 lese ich in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über Hans-Jochen Vogel, ehemaliger Kanzlerkandidat und SPD-Vorsitzender. Er ist inzwischen 93 Jahre alt und lebt in einem Münchner Seniorenheim. Von da aus führt er einen Kampf gegen die exorbitant steigenden Bodenpreise, er erkennt darin ein Problem, das Deutschland in seinen Grundfesten bedroht: Wo und wie man wohnt und lebt. Vogel sitzt im Rollstuhl und diktiert Briefe. Er wirkt wie der Vertreter einer aussterbenden Spezies, wie einer der Letzten, die noch Zeit und Muße haben, sich so eines wichtigen Themas anzunehmen.
Hans-Jochen Vogel kämpft gegen etwas, das in den Gesprächen mit fast allen Menschen für dieses Buch eine existentielle Rolle spielt – gestiegene Mieten und Eigentumspreise, unsicherer Wohnraum. Gefährdete Lebensorte.
Und noch etwas kommt in allen Gesprächen sehr häufig vor: Angst, Angst vor der Zukunft, vor Verlust, Abstieg, Armut, Alter, Krankheit, politischer Spaltung und Instabilität der Welt. Der Abschied von Gewissheiten zeigt sich zuweilen in Kleinigkeiten wie einer misslungenen Vertragskündigung. Manchmal wird die Furcht auch sehr konkret: Alle Gesprächspartner haben ihre wörtlichen Zitate autorisiert. Ein schwieriger Prozess. Bei Familie Reichenbach etwa musste ich die Namen und Details aus ihrem Leben ändern. Jörg Asmussen durfte ich trotz seiner Zusage später fast nicht mehr bei seiner Arbeit begleiten oder beobachten. Die Gespräche in Cafés, die noch möglich waren, verdichtete ich zu Wortlautprotokollen, aber am Ende waren auch sie zu viel und zu nah. Jörg Asmussen und sein Arbeitgeber, die US-amerikanische Investmentbank Lazard, haben sie nicht freigegeben, deshalb stehen an ihrer Stelle nun Gespräche, deren Veröffentlichung sie schließlich zugestimmt haben. So gut wie angstfrei erscheint nur Alexander Gauland, vielleicht, weil er nichts mehr zu verlieren hat.
Ich habe mich bemüht, allen meinen Gesprächspartnern offen zu begegnen. Bei Alexander Gauland brachte mich das ab und zu an meine Grenzen. Nach seiner Aussage, dass wir das Recht hätten, auf die Leistungen der deutschen Soldaten in zwei Weltkriegen stolz zu sein, erschien ich bei einem Treffen mit ihm in seinem Potsdamer Lieblingslokal derart aufgewühlt, dass ich sogleich den gesamten Wein auf mich und meine Aufzeichnungen verschüttete. Als wollte ich seine Worte buchstäblich aufweichen. Immer wieder zweifelte ich daran, ob ich ihm mit meiner Beschreibung zu viel Raum, eine zu große Plattform biete. Andererseits reiben sich alle anderen Gesprächspartner in diesem Buch an ihm und der AfD, es gibt niemanden, der nicht auf Gauland reagiert. Kaum jemand hat Deutschland in den vergangenen Jahren so verändert und in Atem gehalten wie er und seine Partei. Ich kann nicht so tun, als würde es einen inzwischen ziemlich großen Teil der deutschen Bevölkerung nicht geben. Es sind meine Mitbürger, Mitmenschen. Wir.
Denn was bleibt, wenn kein Gespräch mehr möglich ist, wenn die Berührungspunkte schwinden, wenn der Dialog endet?
2013
Jörg Asmussen
Manchmal in dieser Sommernacht Ende August 2013 bekommt Jörg Asmussen einen leeren Blick, als würde er gern kurz ausrasten, wenigstens ein bisschen stänkern, aber dann ist der Augenblick wieder vorüber. Asmussen sitzt in einem Athener Restaurant, eingeklemmt zwischen schwergewichtigen älteren Herren: dem Direktor des größten griechischen Kreditinstituts, der National Bank of Greece (NBG), und den Chefs der wichtigsten Wirtschaftskonzerne des Landes – Telekommunikation, Energie, Schifffahrt und Tourismus. Die verbliebene Macht der Griechen. Ein warmer Wind weht über die Bucht, auf dem Tisch vor Asmussen wartet der erste Gang, ein riesiger Teller Orzo, griechische Nudeln.
Der Direktor der NBG, im vergangenen Jahr war er noch Finanzminister, erhebt die Stimme, er begrüßt seinen »Freund Jörg«, mit dem er schon viele schwierige Nächte durchgestanden habe. Dann ergreifen die Männer nacheinander das Wort, manche haben Zettel mit Stichpunkten vorbereitet, die sie abarbeiten. Sie reden gegen das Zirpen der Grillen an, werden immer lauter, immer intensiver. Sie reden, als sei dieser Deutsche, der aussieht, als nehme er nach 15 Uhr keine Kohlenhydrate mehr zu sich, ihre letzte Chance. Die Rettung ihres Landes, ihrer Posten vielleicht. Sie wissen, Jörg Asmussen ist nicht nur Notenbanker, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), er ist auch eng mit der Kanzlerin.
In diesem Sommer sieht es so aus, als könnte Asmussen der nächste Finanzminister werden, und dieser Tisch mutet an wie das Sinnbild der zu dem Zeitpunkt etablierten Machtverhältnisse in Europa – auf der einen Seite der fitte, junge Deutsche, auf der anderen die alt und ratlos wirkenden Griechen.
Seit Ende 2009 ist Griechenland in der Krise, hat ein überhöhtes Haushaltsdefizit und kann seine Schulden nicht mehr bezahlen. 2001 war das Land nur dank gefälschter Defizitzahlen in die Eurozone gelangt. Um nun einen Staatsbankrott zu verhindern, beantragt die griechische Regierung Hilfe von der EU und dem Internationalen Währungsfonds (IWF). 2010 und 2012 folgen Rettungspakete von Eurostaaten und IWF in dreistelliger Milliardenhöhe. Im Gegenzug sollen die Griechen sparen und reformieren.
Die Reise von Asmussen war seit Wochen geplant, um die nächste Mission der Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds vorzubereiten, die prüfen soll, ob Griechenland sich an die Vorgaben hält. Dann kündigt der Finanzminister Wolfgang Schäuble auf einer Wahlkampfveranstaltung ein drittes Hilfspaket für Griechenland an und Frau Heyne, Asmussens Assistentin, kann dabei zusehen, wie sich der Terminkalender ihres Chefs füllt: Nun wollen sich auch der griechische Premier- und der Vizepremierminister mit ihm treffen.
Jörg Asmussen trägt Glatze. Er wird in diesem Jahr 47, der typische deutsche Beamte hat es in diesem Alter vielleicht zum Unterabteilungsleiter gebracht, Asmussen war Staatssekretär im Finanzministerium und sitzt heute, 2013, im Direktorium der EZB – einer der wichtigsten Posten der Finanzwelt. Er ist einer der Herren des Euro, wacht über die Sparprogramme der Krisenländer. Wenn in den vergangenen Jahren etwas gerettet werden musste – Opel, Quelle, Banken, der Euro oder Griechenland –, stets verhandelte er im Hintergrund. In gewisser Weise ist er ein Gewinner der Krise, sie beschleunigte seinen Aufstieg. Asmussen wurde nie gewählt, er ist ein Spitzenbeamter, ein Bescheidwisser ohne offensichtliche eigene politische Agenda. Gleichwohl nennen ihn fast alle seiner Gesprächspartner einen der mächtigsten Männer Deutschlands.
In Athen wird der Hauptgang serviert, gegrillter Fisch. Auch davon nimmt Asmussen nur wenig. Die Griechen reden weiter, die Steuern seien zu hoch, die Sparmaßnahmen zu hart, mehr gehe nicht. Die einzige Frau, eine Parlamentarierin, sagt: »Wir brauchen etwas Luft.« Sie meint ihr Land. Es klingt wie ein Hilferuf. Alle am Tisch wenden sich an Asmussen, es ist, als rückten sie immer näher an ihn heran. Man merkt ihm keine Veränderung an, er schwitzt nicht, regt sich nicht auf, hört nur zu. Im Zuhören ist er phantastisch. Er scheint nur etwas tiefer in seinen Stuhl gesunken zu sein. Am anderen Ende des Tisches macht sich Frau Heyne Sorgen um ihren Chef, sollte sie ihn retten? Es ist ihre erste Reise mit ihm, sie weiß noch nicht, wie er tickt. Unter dem Tisch behält sie mit dem Blackberry den Überblick über seine Nachrichten. Während des Abendessens gehen hundert Mails ein. In zwei Stunden. Für Athen hat Asmussen 24 Stunden Zeit.
Am Mittag ist er gelandet, hat im VIP-Bereich des Flughafens seine Jeans ausgezogen und seinen Anzug wie einen Panzer angelegt. In einer Wagenkolonne ist er durch die leeren Straßen Athens gerast. Normalerweise reist er ohne Personenschutz, aber Griechenland gilt für seine Sicherheitsleute als »Risiko-Location«. Die Deutschen und die Troika sind derzeit nicht sehr beliebt. Eine erste Station ist das Finanzministerium. Es sieht aus, als habe Griechenland dort bereits alles eingespart, was möglich ist: Trinkwasser gibt es nur in der Mitarbeiterküche, Seife auf den Toiletten fehlt, und auch an Möbeln scheint nur noch das Nötigste vorhanden zu sein. Giannis Stournaras, der Finanzminister, beruft eilig eine Pressekonferenz ein. Asmussen stellt sich neben ihn, er weiß, der Minister muss etwas nach außen melden. Irgendwas Positives. Asmussen redet frei, seine linke Hand steckt in der Hosentasche, die rechte schnellt immer wieder hervor, sticht in die Luft. Zack, zack, zack. So redet er immer – egal, ob in Schwerin, in Hessen oder in Athen, egal, vor welchem Publikum. Es ist die Haltung eines Mannes, der sich um sein Auftreten nicht sorgen muss, der weiß, dass man ihm zuhören wird.
Asmussen sagt, er habe Riesenrespekt vor dem, was Griechenland geleistet habe, aber der Reformprozess müsse weitergehen. Er klingt verständnisvoll. Aber seine Botschaft bleibt: Es reicht noch nicht.
Auf dem Weg hinaus umarmt Asmussen einen Bekannten. Asmussen trifft andauernd Bekannte. Auf internationalen Konferenzen ist er stets derjenige, der schon zum Frühstück verabredet, fortwährend ins Gespräch vertieft ist, der auch die Teilnehmer aus den afrikanischen Ländern kennt. Er webt Netzwerke, die ihn wie ein Kokon umgeben. Sie schützen, sie tragen ihn. Er weiß meistens, was in Paris, Washington oder London gerade geplant ist. Fünf verschiedenen Finanzministern hat er gedient und allen wurde er unverzichtbar: Waigel, Lafontaine, Eichel, Steinbrück, Schäuble. Informationen machen mächtig. Wenn man sich mit Asmussen über Menschen unterhält, sagt er gern: »Den kenne ich schon ewig.« Das trifft auf seinen Chef Mario Draghi ebenso zu wie auf den ehemaligen US-Finanzminister Tim Geithner und den Direktor der National Bank of Greece. Jemanden lange zu kennen ist ein Wert für Asmussen. Er behält gern die Kontrolle. Kommunikation ist dabei sein Mittel, sein Werkzeug.
Beim griechischen Premierminister verschwindet Asmussen sogleich in dessen Empfangssaal. Der Amtssitz liegt mitten in Athen, kein Geräusch dringt ins Innere. Draußen sind 65 Prozent der Jugend arbeitslos, die Sparvorgaben der Troika sind brutal. Das Land muss in drei Jahren Reformen umsetzen, für die man normalerweise zehn Jahre bräuchte. »Griechenland war faktisch zahlungsunfähig. Da gab es wenig Alternativen«, hat Asmussen vor Antritt seiner Reise gesagt. Als er nach einer Stunde wieder erscheint, sagt er nichts. Er kommuniziert auch durch Stille. Wenn er schweigt, ist es wichtig. Er schweigt zum Thema Macht, zu seiner Zukunft in der Politik und zu seinem Verhältnis zur Kanzlerin. Es heißt, Merkel habe sich dafür eingesetzt, dass er auch unter Schäuble Staatssekretär blieb, obwohl er in der SPD ist. Sie schreiben sich häufig SMS. Er sagt: »Sie kennt sich gut aus in den Details.« Asmussen ist einer der Männer, die sie ihr erklären.
In den Krisenmonaten nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehmann Brothers 2008 bildete Asmussen gemeinsam mit dem damaligen Bundesbankchef Axel Weber und dem damaligen Leiter der Finanzabteilung im Kanzleramt, Jens Weidmann, eine Art Ersatzregierung. Auch diese beiden Männer kennt Asmussen lange. Weber war sein Professor, Weidmann sein Kommilitone an der Universität Bonn. Sie bemühten sich eine »Kernschmelze« des Finanzsystems, wie Asmussen es nennt, zu verhindern. Als die Politik den Überblick verliert, übernehmen die Beamten, die Bescheidwisser, die Macht.
Asmussen und Weidmann sind Pragmatiker, die Probleme wie Ingenieure lösen: probieren, sezieren, analysieren. Auf den ersten Blick ist nicht erkennbar, wofür sie stehen. Von außen betrachtet wirkt es, als könnten sie Mitglied fast jeder Partei sein. Sie sind ein wenig wie Angela Merkel selbst. Sie sind die Antwort auf eine komplexer gewordene Welt, in der Zahlen Karriere machen und diejenigen, die sie lesen können, immer mächtiger werden. Sie verkörpern ein Phänomen, das der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch in seinem Buch »Postdemokratie« beschreibt. Darin skizziert er eine Gesellschaft, die von PR-Teams und Experten kontrolliert wird. Eine Gesellschaft, aus der sich die Bevölkerung in die Gleichgültigkeit verabschiedet hat. So gesehen ist Asmussen ein Postdemokrat.
Asmussen hat »Postdemokratie« von Otto Fricke, dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP, geschenkt bekommen. Auch ihn kennt Asmussen seit Jahren, er ist Teil seines Netzwerks. Bis 2009 war Fricke Vorsitzender des Haushaltsausschusses, Asmussen arbeitete damals im Finanzministerium. Asmussen ist für Fricke immer erreichbar. Manchmal treffen sie sich auch privat. Wenn man ihn fragt, wie er zu Asmussen stehe, ob er mit ihm befreundet sei, muss er nachdenken. »Freundschaftlich verbunden«, sagt er schließlich.
Asmussen hat das Buch von Crouch gelesen. »Hochinteressant, ich teile aber nicht alles«, sagt er. Das ist einer seiner liebsten Sätze. Er legt sich nicht fest, stimmt nicht zu, lehnt aber auch nicht ab. »Postdemokratie« hat er an Wolfgang Schäuble weitergegeben, der habe gefragt, warum Asmussen ihm ein sozialdemokratisches Buch schenke. Asmussen lacht. Dabei hält er den Mund geschlossen, zieht Luft durch die Nase ein, als dürfe seinen Lippen kein Laut entweichen. Asmussen redet gern, in der Öffentlichkeit muss er sich stets beherrschen. Seine Mimik spiegelt diesen Zwiespalt wider: Lachen mit zugepresstem Mund.
Er hat eine Position, in der ein falscher Nebensatz Milliarden bedeuten, Kurse ins Wanken bringen kann. Wie etwa am Morgen des 9. Juli 2013 in London: Asmussen gibt der Nachrichtenagentur Reuters ein Fernsehinterview. Wenige Tage zuvor hat Notenbankpräsident Mario Draghi versprochen, die Zinsen für längere Zeit nicht mehr zu erhöhen. Der Reuters-Journalist fragt, was darunter zu verstehen sei. Draghi habe sich doch deutlich ausgedrückt, sagt Asmussen, es gehe nicht um sechs Monate, auch nicht um zwölf Monate, sondern um mehr. Er hat den Satz kaum beendet, da bricht an den Finanzmärkten Hektik aus, der Euro stürzt ab. Noch am selben Tag veröffentlicht die EZB eine Erklärung, in der es heißt, Asmussen habe es nicht so gemeint. Tatsächlich hatte Draghi nur gesagt, es gehe weder um sechs noch um zwölf Monate. Sonst nichts. Asmussens kleine Unachtsamkeit hat den Eindruck erweckt, die zweitwichtigste Zentralbank der Welt habe innerhalb weniger Tage ihren Kurs korrigiert.
Dieses Interview treibt Asmussen auch noch Monate später um. »Es war mein Fehler«, sagt er. »Nur drei falsche Wörter, dennoch mein Fehler.« Und Fehler sind im System Asmussen nicht vorgesehen. In Krisenzeiten arbeitet er 18 Stunden am Tag. Er ist der ideale Mitarbeiter, Traum eines jeden Vorgesetzten. Einer seiner Kritiker, Gerhard Schick, finanzpolitischer Sprecher der Grünen, der ihn inhaltlich scharf angreift, ihm vorwirft, die Finanzkrise nicht vorhergesehen zu haben, der bei der Rettung der Hypo Real Estate sogar seinen Rücktritt als Staatssekretär forderte, sagt dennoch auch: Er würde Asmussen sofort einstellen.
Wenn man Asmussen fragt, ob ihm sein Beruf Spaß mache, blickt er einen an, als sei man nicht bei Sinnen. »Spaß ist privat«, sagt er dann. Als er bei einem Musikfestival in Schleswig-Holstein eine Rede halten soll, was seinen Sonntag ruiniert, ist die Autobahn wegen eines Unfalls gesperrt. Er steckt im Auto fest und kann nichts tun. Mehrmals meldet er sich beim Veranstalter, um sich zu entschuldigen. Es ist kein wichtiger Auftritt, aber er kann eine Zusage nicht einhalten. Asmussen treibt die Pflicht, eine Art protestantischer Härte gegen sich selbst. »Wenn die Institutionen nicht funktionieren, funktioniert die Gesellschaft nicht.« Schon seine Eltern waren Beamte, der Vater Feuerwehrmann, die Mutter Lehrerin. Auch sie haben funktioniert.
In Athen stoppt Asmussens Wagen in einer schmalen Gasse. Es stinkt nach Urin. Asmussen drängt sich in einen engen Fahrstuhl, fährt hinauf zum Büro von Imagine the City, einem kleinen Sozialprojekt. Zwei junge Frauen erzählen ihm, wie sie die griechische Zivilgesellschaft wiederbeleben wollen. Asmussen sitzt da, es sieht aus, als entspanne er sich. Die Frauen sind klug und haben gute Ideen. Und keine fragt Asmussen nach einer Lösung. Seit seiner Ankunft war er beim Präsidenten der griechischen Notenbank, beim Finanzminister, beim Premierminister, nun hier. Danach wird er einer Zeitung ein Interview geben, darauf folgt das Dinner mit den Wirtschafts-Schwergewichten. Und so geht es am nächsten Tag weiter und am übernächsten. Eigentlich sieht jeder Tag so aus. Asmussen jagt von Termin zu Termin. Wenn er aus dem Wagen steigt, schiebt er Kopf und Hüfte ein wenig nach vorn, als gelte es, demnächst als Erster in ein imaginäres Ziel einzulaufen. Er geht nicht, er rennt. Stillstand bedeutet Zeitverlust. Woher bekommt er noch Anregungen, Ideen, wann hat er Muße, innezuhalten? »Eigentlich denkt man zu wenig strategisch nach. Das ist zeitlich nicht möglich«, sagt er selbstkritisch. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn diejenigen, die Länder und Banken retten sollen, kaum einen Gedanken fassen können, ob es sinnvoll und richtig ist, was sie beschließen? Asmussen schwärmt von einem Workshop in Lappland. Das Beste sei gewesen, dass niemand Handyempfang hatte. Endlich schwiegen die Blackberrys.
Wieso hat ein Experte wie er die Anzeichen der Finanzkrise nicht gesehen? »Das hat keiner gesehen. Die Deregulierung der Finanzmärkte war damals der Zeitgeist, auch bei Journalisten«, sagt er. Es ging um den Finanzstandort Deutschland, der sollte wettbewerbsfähig bleiben. »Viele Dinge wusste man zu der Zeit einfach nicht«, schiebt er nach. Hätte er sie wissen können, sie wissen müssen? Die Bank IKB, in deren Aufsichtsrat Asmussen saß, hatte sich in den USA verspekuliert und konnte nur mit Geld des Bundes gerettet werden. Bei diesem Thema wird Asmussen still, er hat keine Lust, darüber zu reden. Er sagt, er habe damals nachgefragt, ob die Bank direkt oder indirekt die gefährlichen Wertpapiere aus den USA besitze, die sie später in den Untergang führten. Der Vorstandschef habe verneint.
Es gibt einen Aufsatz Verbriefungen aus der Sicht des Finanzministeriums, er ist 2006 in einer Fachzeitschrift erschienen. Asmussen war damals Ministerialdirektor, er steht als Autor darüber. Vier Jahre später erscheint auf der ersten Seite der Süddeutschen Zeitung ein Artikel über den Aufsatz. Asmussen habe sich darin für eine »weitreichende Liberalisierung der Finanzmärkte« ausgesprochen. Er sei für die Krise mitverantwortlich. Asmussen gilt seither vor allem in linken Kreisen als Agent des Finanzkapitals. Asmussen hat den Aufsatz nicht geschrieben. Er sagt, er habe ihn zuvor noch nicht einmal gelesen. Wie oft in solchen Fällen wurde er von der Fachabteilung im Ministerium verfasst. Das Dokument, das seine wahre Gesinnung offenbaren soll, stammt nicht von ihm. Diese Geschichte ist bezeichnend für Asmussen. Wenn man ihn festlegen will, entgleitet er einem. Egal, wie oft man ihn trifft, wie oft man mit ihm redet, das Bild von ihm bleibt leicht unscharf.
Asmussen hat die Deregulierung vorangetrieben, weil es damals die vorherrschende Meinung war, dass freie Märkte Wohlstand und Wachstum versprechen. Und Asmussen ist keiner, der sich abseits stellt.
Ein Vorfall wie die Pleite von Lehman Brothers war in diesem System aus scheinbaren Gewissheiten nicht vorgesehen. »Die Wahrscheinlichkeit, dass eine globale Investmentbank über Nacht verschwindet, war gleich null.« Danach war die Welt eine andere, sagt er. Es ist eine Zeit, an die er sich nicht gern zurückerinnert. »Man hat Demut gelernt, was man weiß und was nicht.« Dann kam die Rettung der Hypo Real Estate. Und wieder gab es Kritik an ihm persönlich, er habe als Staatssekretär, als Vertreter des Bundes, zu spät auf Warnhinweise reagiert, er habe seine Sorgfaltspflicht verletzt. Asmussen musste in einem Untersuchungsausschuss auftreten, die Opposition forderte seinen Rücktritt. Es war ein Versagen der gesamten Finanzwelt. Die Bescheidwisser wirkten auf einmal ahnungslos. Zugleich wurden sie als Retter gebraucht. Sie schalteten um. Auch Asmussen. Jetzt setzt er sich für eine strenge Regulierung der Banken ein, jetzt ist er sogar für eine Finanztransaktionssteuer. »Die Deregulierung ist zu weit gegangen«, sagt er heute, fünf Jahre nach der Rettung der Hypo Real Estate.
Schon in diesem Sommer spricht er bei seinen Auftritten nicht nur über den Euro (stabil), über Europa (die Integration muss vorangehen), die Krise (schon besser), sondern auch über den Ausbau der Infrastruktur, die Integration von Migranten, Demographie, Bildung, die wachsende Einkommensungleichheit. Irgendwie scheint er über alles Bescheid zu wissen. Und er muss es zeigen. Sein Scharfsinn, seine Lockerheit können demütigen. Er formuliert auch, dass die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion Europas als Ziel benannt werden müsse. Schnell fügt er hinzu: »Das ist nicht die Aufgabe von Notenbankern, sondern der Politik.«
Asmussen ist in Flensburg aufgewachsen, die Grenze zu Dänemark ist nah. Er spricht Dänisch, Französisch, Englisch, Italienisch. Für ihn ist Europa, ist der Euro selbstverständlich. Er bekommt Drohungen von Rechtsextremen. Asmussen scheint stets zwischen allen Lagern zu stehen: Den Linken ist er zu rechts, den Rechten zu links. Den Politikern zu unpolitisch, den Bankern zu politisch. Er steht damit für viele in seiner Generation. Polyglott und postideologisch. Eine Generation, deren Überzeugungen und Absichten stets ein wenig unscharf bleiben, weil sie keine absoluten Gewissheiten in sich trägt. Es geht nicht mehr um ideologische Kämpfe. Es geht darum, ob etwas funktioniert.
Während seiner Athenreise trifft Asmussen auch den griechischen Vizepremierminister. Sie reden über die sich abzeichnende griechische Haushaltslücke. Nach dem Gespräch flüchtet Asmussen fast aus dem Amtssitz. Er ist fassungslos. Der Vizepremierminister hat ihn gefragt, ob man nicht die Zahlen verändern könne, so dass die Lücke kleiner wird oder verschwindet. Reorganise the figures. Für Asmussen charakterisieren diese Worte das »alte Griechenland«. Und für überholte, ineffiziente Systeme hat er grundsätzlich kein Verständnis.
Beim Abendessen in Athen dauert es bis zum vierten Gang, dem süßen Kuchen, dann schlägt Asmussen zu. Er hat den ganzen Abend stillgehalten, zugehört, jetzt ist es fast Mitternacht. Die griechischen Banker und Unternehmer erwarten, dass Asmussen spricht. Sein Rücken strafft sich, seine rechte Hand schnellt hervor. Er sehe, dass vieles geschafft worden sei, aber, nun kommt sein Zeigefinger zum Einsatz, es müsse noch mehr getan werden. Asmussen redet eine Viertelstunde. Er stänkert. Danach ist Stille. Ende. Aus.
Am Restaurantausgang verabschiedet der Direktor der NBG noch die Gäste. Er deutet auf die andere Seite der Bucht, auf die Lichter eines Ferienresorts. Es gehört seiner Bank, nun steht es zum Verkauf. Aber das hört Asmussen schon nicht mehr, er ist weitergelaufen.
Und noch etwas geschieht 2013, das nicht aufhaltbar zu sein scheint: Vor allem aus Protest gegen die Griechenland-Rettung und den Euro gründet sich im hessischen Oberursel die AfD.
Alexander Gauland
An dem Tag, an dem alles beginnt, ist Alexander Gauland gar nicht dabei. Am 6. Februar 2013 versammeln sich unter einer überlebensgroßen Jesusfigur aus Holz 18 ältere Herren an weißen Tischen, um eine Partei zu gründen. Eine Partei, bei deren Kundgebungen die Pfarrer in einigen deutschen Städten später die Glocken läuten oder das Domlicht ausschalten werden, um gegen sie zu protestieren.
Aber davon ahnt noch keiner der Männer etwas, die sich an jenem Mittwoch im Gemeindesaal der Christuskirche von Oberursel im Taunus treffen. Draußen auf der Wiese vor dem Panoramafenster liegt Schnee. Es ist ein grauer Tag, um die null Grad. Die meisten der Männer, die an diesem Tag zusammenkommen, sind sich bisher kaum begegnet. Was sie eint, ist ihre Wut auf den Euro und die Griechenland-Politik der Parteien im Bundestag. Sie finden, Deutschland brauche eine neue politische Bewegung. Viele beschäftigen sich hauptberuflich mit Finanzen oder sind Wirtschaftswissenschaftler. Neben Bernd Lucke, Professor für Makroökonomie, der die Gründung initiiert hat, sind dabei: Gaulands Freund Konrad Adam – ein Publizist – sowie ein Jurist; ein Unternehmer; ein Unternehmensberater; ein Chemiker und Betriebswirt; ein Mitarbeiter einer Krankenversicherung; ein Leiter einer Finanzberatungsfirma; ein Steuerberater, der heute Karaoke-Partys organisiert; ein IT-Experte; ein Ex-Polizist; ein Immobilienmakler; ein Leiter einer Firma für künstliche Intelligenz; zwei Betriebswirte; ein Rentner; ein Wirtschaftsberater; ein Wirtschaftswissenschaftler. Alexander Gauland kennt nur wenige von ihnen. Die meisten werden einige Jahre später nicht mehr in der Partei sein.
Wenn man mit Alexander Gauland über die Anfänge seiner Partei spricht und seinen Abschied von der CDU, in der er jahrzehntelang Mitglied war und es am Ende wie Jörg Asmussen bis zum Staatssekretär geschafft hatte, hebt sich seine Stimme. Er ist noch immer wütend. Es ist eine Geschichte der allmählichen Enttäuschung und Entfremdung.
Die Merkelsche Energiewende, die Abschaffung der Wehrpflicht ohne größere Erklärungen und schließlich die Euro-Rettung, die Hilfskredite für Griechenland. Für Gauland bedeutet das: ein Abschied nach dem anderen von »Heiligtümern« des CDU-Programmes, die Hilfspakete erscheinen ihm als das Ende des Rechtsstaates, als ein Vertragsbruch. Besonders die Nacht vom 29. Juni 2012 ist ihm im Gedächtnis geblieben. Kurz vor Mitternacht stimmt nach dem Bundestag auch der Bundesrat der Einrichtung eines Euro-Rettungsschirms zu. Viele, die sich später in der AfD wiederfinden werden, werten dies als eine Entscheidung dafür, dass Deutschland seine Hoheit über den Haushalt aufgeben und Zahlungen jeder Höhe zulassen wird, um Griechenland zu retten.
»Diejenigen, die diesen Schwenk in der CDU nicht mitmachen wollten, wurden hingestellt, als wären sie von Gott verlassen«, sagt Gauland. »Dieser Spruch der Kanzlerin – zu meiner Politik gibt es keine Alternative – geht mir wahnsinnig auf die Nerven.«
Die endgültige Trennung von seiner Partei vollzieht er 2012 bei einem Treffen des konservativen Berliner Kreises mit dem CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe. Nicht nur das Essen sei schlecht gewesen, erinnert sich Gauland. Gröhe machte ihm und seinen Mitstreitern deutlich, sie könnten in ihrer Partei nur in den Kreisverbänden wirken. »Das Entscheidende war die Euro-Rettung, diese Aushöhlung des Rechtsstaates. Nach dem Treffen war klar, wir hatten keine Chance, innerhalb der CDU-Strukturen anerkannt zu werden. Wir sollten nicht so viel meckern.«
Anders formuliert: Ihre Meinung interessierte niemanden. Es war eine Demütigung, ein Hinweis auf die völlige Bedeutungslosigkeit ihrer Ansichten und Anregungen.
Gauland reagierte. Er schrieb einen Brief und verließ 2013 nach vierzig Jahren die CDU. Es kann sein, dass es heute gar keine AfD gäbe, wenn seine Parteiführung sich damals anders verhalten hätte.
Kurz darauf rief Gaulands Freund Konrad Adam an. Die beiden kennen sich seit dreißig Jahren. Adam arbeitete früher für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Er habe da einen Professor kennengelernt, sagte Adam zu Gauland. Gemeint war Bernd Lucke. »Wir wollten doch noch einmal was anderes machen, mit dem ginge das«, habe Adam gesagt, erinnert sich Gauland. Schließlich traf auch Gauland Bernd Lucke und war von dessen Tatkraft und Energie begeistert. »Das musste man bewundern.« Zuvor hatten Gauland und Adam gefürchtet, eine neue politische Bewegung könnte schnell in die falsche Richtung gehen. Schon damals hatte er die möglichen Konsequenzen seines Handelns ziemlich genau im Blick. »Wenn Sie eine neue Partei gründen, ziehen Sie immer Menschen an, die in keiner anderen Partei existieren könnten.« Im Fall der AfD waren das von Beginn an Rechtsextreme.
Weil er bei der Gründung nicht dabei sein kann, reist Gauland zur ersten öffentlichen AfD-Veranstaltung 2013 in die Oberurseler Bürgerhalle. 1200 Menschen sind gekommen, so viele, dass Wände herausgenommen und verschobenen werden müssen. Das ist das erste Mal, dass Alexander Gauland denkt, diese neue Partei könnte tatsächlich erfolgreich sein.
Beim Gründungsparteitag im April 2013 in Berlin will Gauland zunächst nur für den Beisitzer des Vorstands kandidieren, wird aber zum stellvertretenden Sprecher gewählt. Und so wird es die folgenden Jahre weitergehen, immer bekommt er Posten, die er scheinbar zuvor nicht angestrebt hat. Nach kurzer Zeit fragen AfD-Mitglieder aus Brandenburg, ob er dort nicht als ihr Spitzenkandidat antreten wolle. Und Gauland will. Endlich wird ihm zugehört, endlich wird er ernst genommen. Eine neue Partei muss wie eine politische Wiedergeburt auf den 72-jährigen Alexander Gauland wirken. Noch deutet jedoch nichts darauf hin, dass er schon bald der mächtigste Mann dieser Bewegung werden wird.
In der Zeit des Neuaufbruchs, in der Gauland eine Partei mitgründet, die sich rechts von der CDU verortet, beginnt im Mai 2013 in München einer der größten Prozesse der deutschen Nachkriegszeit – gegen die rechtsextreme Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU).
Thomas Matczak
Nur eine schmale Straße trennt Thomas Matczak am 26. Januar 1998 in Jena von Uwe Böhnhardt. Er könnte hinübergehen und ihn festnehmen. Aber Matczak geht nicht hinüber, keiner seiner Kollegen geht hinüber an jenem Montagmorgen. Es ist kalt. Die Polizisten durchsuchen zwei Garagen nach Sprengstoff. Böhnhardt wird verdächtigt, Bomben zu bauen, als er gegenüber seinem Elternhaus eine Sporttasche in den Kofferraum seines Wagens legt und davonfährt. Thomas Matczak ist einer der letzten Polizisten, die ihn sehen, bevor Böhnhardt gemeinsam mit Uwe Mundlos und Beate Zschäpe verschwindet. Erst 13 Jahre später werden sie wieder auftauchen. Als NSU-Terrortrio. Da ist Böhnhardt tot, und Matczak hat ein Problem. Sein Gewissen. Er erinnert sich an jenen Morgen im Januar, aber er erinnert sich anders daran als seine Kollegen.
Im Mai 2013 steht Thomas Matczak noch einmal in derselben Straße, die Garagen gibt es noch immer, nur die Plattenbauten rundherum wurden renoviert und schimmern pastellfarben. Seit damals war er nie wieder an diesem Ort. Matczak läuft zum Haus Nummer 11, steigt die Treppen zum Eingang hinauf, sieht auf die Klingelschilder. Böhnhardt steht da. Die Eltern wohnen weiter dort. Matczak weicht zurück, das hat er nicht gedacht. »Komisches Gefühl, oder?«, sagt er leise wie zu sich selbst. Er hat vermutet, dass sie weg sind, umgezogen, versunken in der Vergangenheit. Das ist einer dieser Augenblicke, in denen Matczak die damaligen Ereignisse sehr nah erscheinen, allzu gegenwärtig.
Er schaut zu den Fenstern hinauf, überlegt, wo die Wohnung liegt, in der er 15 Jahre zuvor war. Sein Brustkorb bebt. Matczak ist zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt, Kriminalhauptkommissar beim Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Jena, und er ist es nicht gewohnt, über seine Arbeit zu reden. Seine Antworten sind meist nach wenigen Sätzen zu Ende. Zwischendurch ist er lange still, muss durchatmen, bevor er weitersprechen kann. »Ich bin zufrieden, dass endlich die Wahrheit herauskommt«, sagt er. Er sagt »zufrieden«. Es klingt reserviert und emotional zugleich, als könne er sich nicht richtig entscheiden, welches Gefühl das angebrachte ist.
Damals, nach der Garagendurchsuchung, bittet Matczak um seine Versetzung, Gründe dafür sind sein Frust und sein Unverständnis über den Verlauf der Durchsuchung, über die Flucht Böhnhardts. Er wird erst im Bereich Innere Ermittlungen, dann bei der Drogenfahndung arbeiten. Der Einsatz, der so anders ist als alle davor und danach, wirkt heute wie ein Mahnmal in seiner Polizeilaufbahn.
Matczak ist entsetzt über die Ereignisse am 26. Januar 1998. Die Durchsuchung ist das Trauma vieler Polizisten, Matczak spürt die Auswirkungen bis heute. Bis heute denkt er darüber nach, warum es damals schiefging. Und bis heute treibt ihn ein Gedanke um: Wäre der 26. Januar 1998 anders verlaufen, vielleicht hätte es den NSU nie gegeben. Vielleicht wären zehn Menschen noch am Leben.
Am Freitag vor dem 26. Januar erfährt Thomas Matczak, dass er am Montag das Landeskriminalamt (LKA) bei einer Durchsuchung unterstützen soll. Worum es geht, weiß er nicht. Montagfrüh um sechs trifft er sich mit seinen Kollegen in Raum 202, im früheren Parteikabinett, der Kriminalpolizeiinspektion Jena. Matczak kann sich nicht mehr daran erinnern, wer die Besprechung damals führte. Der damalige Leiter der Einsatzgruppe Terrorismus/Extremismus (EG Tex) vom LKA Thüringen, Jürgen Dressler, ist an jenem Morgen jedenfalls nicht dabei. Zuständiger Einsatzleiter ist somit sein Vertreter. Dressler sagt am 11. April 2013 vor dem Thüringer Untersuchungsausschuss, er sei seinerzeit bei einer Fortbildung gewesen. Matczak wundert sich noch immer darüber: Der Ermittlungsführer lernt am Tag der wichtigsten Durchsuchung von Rechtsextremen den Umgang mit Computerprogrammen? Gewöhnlich würde ein Ermittlungsführer die Fortbildung absagen oder die Durchsuchung verschieben.
Thomas Matczak weiß 1998 wenig über den Fall. Uwe Böhnhardt, den Namen, der auf dem Durchsuchungsbeschluss steht, hat er schon einmal gehört, in Zusammenhang mit mehreren Bombenattrappen und einer Bombe in Jena. Matczak wird erklärt, dass es auch diesmal um Sprengstoff geht. Zwei Teams werden gebildet. Er soll mit mehreren Kollegen zwei nebeneinanderliegende Garagen in Jena-Lobeda durchsuchen. Wie viele Beamte es genau sind, daran entsinnt er sich nicht mehr. Das zweite Team fährt zu einer weiteren Garage an einer Kläranlage. Gegen halb sieben bricht Matczaks Team auf. Matczak denkt nicht weiter über den Einsatz nach, für ihn ist es Routine. Er kennt keine Hintergründe oder Absprachen mit der Staatsanwaltschaft. Gegen sieben, halb acht treffen sie im Neubaugebiet Jena-Lobeda ein und klingeln an der Tür der Familie Böhnhardt.
Nach dem Mauerfall hatte sich in Thüringen eine starke rechte Szene gebildet. Tino Brandt hat die Kameradschaft Jena mit aufgebaut. Gründungsmitglieder waren unter anderem Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Auch Beate Zschäpe gehörte bald dazu.
Ein Kollege von Matczak vom LKA Thüringen sagt, er habe seit 1996 aus Vernehmungen gewusst, dass Tino Brandt V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes war. Die Öffentlichkeit erfuhr davon erst 2001. Brandt galt als der Kopf des Kameradschaftsnetzwerkes Thüringer Heimatschutz, als die Schlüsselfigur der rechten Szene in Thüringen. Viele fragen sich bis heute, ob es diese ohne Brandt und dessen finanzielle Unterstützung durch den Verfassungsschutz in der Form überhaupt gegeben hätte. Der Thüringer Verfassungsschutz wird in dieser Geschichte eine fragwürdige Rolle spielen. Nach dem Ende des Kalten Krieges musste sich der Verfassungsschutz neu definieren. Fast entsteht der Eindruck, als habe er sich in Thüringen seine Existenzberechtigung selbst mitgeschaffen.
Matczak weiß nicht mehr genau, wer an jenem 26. Januar 1998 die Tür der Böhnhardts öffnet. Er ist sich sicher, dass Böhnhardts Eltern da waren, Uwe Böhnhardt ist nicht da. Damit weicht er vom Durchsuchungsbericht und von den Aussagen seiner Kollegen ab, die sagen, Uwe Böhnhardt sei in der Wohnung gewesen und habe die Garage aufgeschlossen. Matczak erinnert sich, dass Böhnhardts Mutter laut wird und immer wieder »mein Uwe!« ruft. Er entsinnt sich, wie er in Uwe Böhnhardts Zimmer schaut und sein Blick auf eine blaue Tagesdecke auf dem Bett fällt. Es sieht nicht aus, als hätte Böhnhardt dort übernachtet. Böhnhardts Mutter weist den Vater an: »Geh mit runter, und guck genau hin, nicht dass die etwas finden, was vorher nicht da war!« Matczak denkt: »Was für eine Pute!« In seiner Erinnerung begleitet nicht Uwe Böhnhardt, sondern dessen Vater die Beamten hinab und schließt seine Garage auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf. Die zweite, daneben liegende Garage wird kurz darauf von einem Schlüsseldienst aufgesperrt. Auf dem Durchsuchungsbeschluss sind alle drei Garagen – auch die an der Kläranlage – untereinander aufgelistet, spätestens jetzt weiß Böhnhardt oder wissen dessen Eltern – je nach Version –, wo durchsucht werden soll.
Unterdessen versucht das zweite Team der Polizei die Garage an der Kläranlage zu öffnen. Diese Garage gehört einem Jenaer Polizeibeamten, der sie an Beate Zschäpe vermietet hat. Dort hängt ein Schloss vor dem Tor, die Polizei muss die Feuerwehr rufen, um ins Innere zu gelangen. Wertvolle Zeit verstreicht. Dann sieht Matczak, wie Uwe Böhnhardt heimkehrt und im Haus seiner Eltern verschwindet. »Ich möchte meinen, er ist mit dem Auto gekommen.« Er erinnert sich, dass, während er und seine Kollegen suchen, bekannt wird, dass die Kollegen in der anderen Garage »fündig geworden sind«, also wie vermutet Sprengstoff entdeckt haben. Später wird sich herausstellen, dass sie 1,4 Kilogramm TNT gefunden haben. Matczak weiß nicht mehr genau, ob diese Nachricht seinen Teamleiter über Funk oder Handy erreicht hat. Sicher ist er sich hingegen, dass ihn sein Gedächtnis nicht trügt und der Teamleiter die Nachricht erhalten hat. Matczak entsinnt sich, dass nach etwa zehn Minuten Böhnhardt wieder auf der Straße erscheint und eine Reisetasche in den Kofferraum seines Wagens legt. Matczak sagt zu seinem Teamleiter: »Es sieht aus, als ob er packt.« Und fügt hinzu: »Er ist weg, wenn wir ihn jetzt fahren lassen.« Matczak wundert sich, es wird Sprengstoff gefunden, und der Beschuldigte kann vor seinen Augen, vor den Augen der Polizei, unbehelligt davonfahren.
Thomas Matczak und seine Kollegen finden in den Garagen nichts. Auf dem Rückweg halten sie an der Kläranlage. Es gibt Diskussionen mit dem Einsatzleiter vom LKA, dabei hört Matczak zum ersten Mal, dass der Hinweis über den Sprengstoff in der Garage auf Erkenntnissen des Thüringer Verfassungsschutzes beruhe und eine Festnahme nur nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt möglich sei. Der LKA-Einsatzleiter versucht immer wieder, mit seinem Mobiltelefon den Staatsanwalt zu erreichen, es gelingt ihm aber nicht. Ein Kollege schlägt vor, rasch bei Beate Zschäpe vorbeizufahren, um zu schauen, ob Böhnhardt dort sei. Der Einsatzleiter besteht darauf, zuerst mit dem Staatsanwalt zu reden. Das ist Matczaks Version. Es ist die Version, bei der die Polizei am schlechtesten aussieht, bei der sie Böhnhardt flüchten lässt.
Diese Version hat Thomas Matczak im Kern mehrmals wiederholt, zuerst im Thüringer Innenministerium, kurz nach der Entdeckung der Terrorzelle 2011, dann vor der Schäfer-Kommission, jenem Gremium, das unter Vorsitz des ehemaligen BGH-Richters Gerhard Schäfer Behördenfehler im Umfeld der rechtsextremen Terrorgruppe NSU ermitteln soll, und zuletzt im Thüringer Untersuchungsausschuss. Inzwischen hat Matczak allerdings bemerkt, dass er der Einzige ist, der sich so erinnert. Mit jeder neuen Befragung wird er unsicherer.
Im Thüringer Untersuchungsausschuss in Erfurt sitzt Thomas Matczak am 15. April 2013 in einem beigefarbenen Anzug. Er zittert, knetet nervös seine Hände. Ein Polizist unter Druck. Auch hier wiederholt er seine Version, aber nun fügt er oft hinzu, er könne nicht beschwören, dass es tatsächlich so gewesen sei. Eine Abgeordnete fragt ihn, ob er Angst habe. »Wenn man der Einzige ist, der einen anderen Ablauf darstellt, dann fragt man sich doch: Mensch, ist das wirklich so, wie du es in Erinnerung hast, oder kann es auch anders gewesen sein?« Die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses ermuntert Matczak: »Ich glaube Ihnen mehr als vielen anderen!«
Matczaks Kollegen können sich nicht erinnern oder sagen aus, Uwe Böhnhardt sei abgefahren, bevor die Bombenwerkstatt in der Garage an der Kläranlage gefunden wurde. So steht es auch in den Akten. Oft haben die Beamten ebendiese Akten kurz vor ihrer Befragung gelesen. Allerdings steht dort auch, dass die Feuerwehr gegen neun Uhr die Garage an der Kläranlage öffnet. Matczak und seine Kollegen durchsuchen ihre Objekte laut Bericht bis 10.15 Uhr. Zeitlich ist Matczaks Version möglich.
Vor dem Untersuchungsausschuss fühlt sich Thomas Matczak wie bei einem Tribunal. In dieser Umgebung wird ihm die ganze Tragweite seiner Aussage bewusst, er zieht sich zurück. »Viele bei der Polizei fragen sich, was damals schiefgegangen ist. Aber ob man das öffentlich wiederholt, ist die Frage.« Nun, im Mai 2013, steht Matczak auf dem Gehweg vor den Garagen in Jena, die er damals durchsucht hat. Im Block der Böhnhardts hängt eine Reggae-Fahne im Fenster. »Letzten Endes ist klar, keiner wird sich hinstellen und sagen, das ist blöd gelaufen!«, sagt Matczak. Warum macht er es? Matczak schweigt lange, atmet schneller, wieder sagt er: »Ich bin zufrieden, dass so eine Geschichte im Nachhinein bekannt wird.« Sie habe ihm »schwer im Magen« gelegen.
Für Matczak ist der Einsatz am 26. Januar 1998 gegen 11 Uhr beendet, er fährt ins Präsidium. 15 Jahre später liest er im Durchsuchungsbericht, er habe von 11 Uhr an die Garage an der Kläranlage, die Bombenwerkstatt, durchsucht. Das Problem: Matczak kann sich nicht erinnern, sie jemals betreten zu haben. Er schaut sich die Lichtbildmappe an, überlegt, ob er sich irren könnte. Es hilft nichts. »Ich war nicht in dieser Garage.« In den vergangenen Monaten hat sich Matczak immer wieder gefragt, ob er vielleicht einem Trugschluss erliege. Aber er ist sich sicher, dass die Bombenwerkstatt schon gefunden worden war, als Uwe Böhnhardt wegfährt. Warum also lassen die Polizisten Böhnhardt an jenem Morgen laufen?
Festzustehen scheint, dass Jürgen Dressler, der damalige EG-Tex-Leiter des LKA, den Thüringer Verfassungsschutz schon lange vor der Durchsuchung um Hilfe bittet. Vom 24. November bis zum 1. Dezember 1997 observiert ein Team des Thüringer Verfassungsschutzes Böhnhardt. Schon am zweiten Observationstag beobachtet es, wie Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zwei Liter Brennspiritus und Gummiringe kaufen und in die Garage an der Kläranlage bringen, dabei blicken sie sich immer wieder auffällig um. In den darauffolgenden Tagen werden die beiden auch bei Beate Zschäpe gesehen. Der Verfassungsschutz schickt laut Akten am 8. Januar 1998, also mehr als einen Monat später, ein Schreiben mit den Observationsergebnissen an das LKA. Dieses Schreiben ist als »VS-vertraulich« eingestuft, damit ist es für das LKA nicht einfach verwertbar, weil es wegen der Geheimhaltung nicht öffentlich in der Gerichtsakte auftauchen und nicht an Dritte weitergegeben werden darf, ohne dass in diesem Fall der Thüringer Verfassungsschutz zustimmt. Die Ermittler bemühen sich beim zuständigen Staatsanwalt Gerd Michael Schultz um einen Durchsuchungsbeschluss. Der stimmt zu, hält das Schreiben wegen seiner Vertraulichkeit aber für nicht gerichtsverwertbar und legt fest, dass eine Festnahme erst nach dem Auffinden von Beweismitteln und auch dann erst nach einer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgen soll.
Ein paar Tage vor der Durchsuchung wird Schultz krank und muss ins Krankenhaus. Deshalb kann ihn der Einsatzleiter am 26. Januar 1998 nicht erreichen, worüber wiederum der Staatsanwalt 2013 sehr verwundert ist: Im Thüringer Untersuchungsausschuss sagt Schultz, die Polizei könne bei Gefahr im Verzug natürlich selbstständig handeln und festnehmen. »Das sind keine Dorfpolizisten.« Und dass es Stunden dauert, bis die Polizei seinen Vertreter erreicht, kann er nicht glauben. Ein Staatsanwalt habe immer Bereitschaft, eine »Nichterreichbarkeit« schließt er aus.
Am 26. Januar um die Mittagszeit ordnet Schultz’ Vertreter schließlich die vorläufige Festnahme des Trios an.
Die Durchsuchung stützt sich auf einen Bericht des Verfassungsschutzes, von dem offenbar alle der Meinung sind, dass er nicht verwendet werden dürfe. Einen Tag nachdem die Polizisten 1,4 Kilogramm TNT gefunden haben, am 27. Januar, nimmt Schultz’ Vertreter die Anordnung zur vorläufigen Festnahme wieder zurück. Er sieht keinen dringenden Tatverdacht. Im Thüringer Untersuchungsausschuss erinnert er sich, warum: Er habe zu den LKA-Beamten gesagt, sie sollten Belege bringen, Spuren, damit er einen Bezug zwischen Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe und dem, was in der Garage gefunden wurde, herstellen könne. »Das Hauptproblem war, dass auf dem Bericht vom Verfassungsschutz noch immer ›vertraulich‹ stand und ich ihn so nicht verwenden konnte. Wenn ich ihn nicht in die Akte hängen kann, hilft er mir nicht.« Es sieht aus, als bemühten sich alle Beteiligten aus Furcht oder Unsicherheit um höchste formale Korrektheit.
Erst zwei Tage nachdem das Trio verschwunden ist, wird der Bericht des Verfassungsschutzes herabgestuft – »nur für den Dienstgebrauch«, nun ist er verwendbar. Und der Verfassungsschutz gibt den Ermittlern noch einen zusätzlichen Hinweis: Die drei wollten sich über Belgien in die USA absetzen. Danach werden eilig Haftbefehle erlassen. Nun sind Böhnhardt, Zschäpe und Mundlos fort, viele Fragen bleiben. Ist das eine unglaubliche Aneinanderreihung unglücklicher Umstände, Gerangel verschiedener Behörden – oder wollte man die drei gar nicht fassen? »Diesen Verdacht kann man schon haben«, sagt Matczak. Auch er kommt mit seinen Fragen nicht weiter: Musste die Durchsuchung unbedingt an jenem Tag stattfinden, sollte sie gar diesen Verlauf nehmen? Warum war Jürgen Dressler nicht dabei? »So etwas ist das Salz in der Suppe für einen Ermittlungsführer, da muss er als Ansprechpartner für sein Team da sein.«