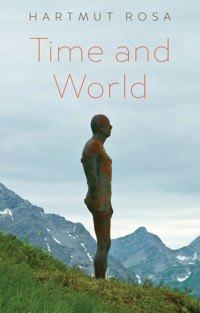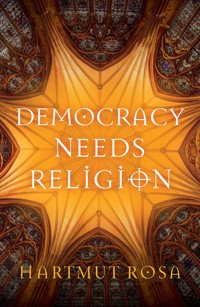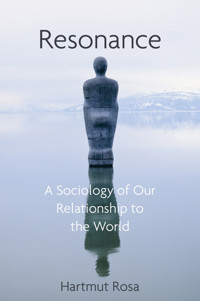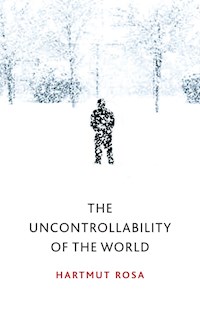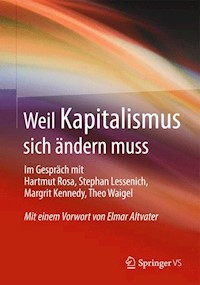Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein fundiertes Plädoyer für eine Gesellschaft, die der Verfügbarkeit der Welt Grenzen setzt. Das zentrale Bestreben der Moderne gilt der Vergrößerung der eigenen Reichweite, des Zugriffs auf die Welt: Diese verfügbare Welt ist jedoch, so Hartmut Rosas brisante These, eine verstummte, mit ihr gibt es keinen Dialog mehr. Gegen diese fortschreitende Entfremdung zwischen Mensch und Welt setzt Rosa die "Resonanz", als klingende, unberechenbare Beziehung mit einer nicht-verfügbaren Welt. Zur Resonanz kommt es, wenn wir uns auf Fremdes, Irritierendes einlassen, auf all das, was sich außerhalb unserer kontrollierenden Reichweite befindet. Das Ergebnis dieses Prozesses lässt sich nicht vorhersagen oder planen, daher eignet dem Ereignis der Resonanz immer auch ein Moment der Unverfügbarkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hartmut Rosa
Unverfügbarkeit
Aus der Reihe »UNRUHE BEWAHREN«
Unruhe bewahren – Frühlingsvorlesung & Herbstvorlesung.Eine Veranstaltung der Akademie Graz in Kooperation mit demLiteraturhaus Graz und DIE PRESSE.
Die Frühjahrsvorlesung zum Thema »Die Welt in Reichweite. Kritische Reflexionen zum Verhältnis von Resonanz und Verfügbarkeit« fand am 22. und 23. März 2018 im Literaturhaus Graz statt.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2018 Residenz Verlag GmbHWien – Salzburg
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucksund das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Redaktion: Harald Klauhs, Astrid KuryWissenschaftliche Beratung: Thomas Macho, Peter StrasserUmschlaggestaltung: Kurt DornigLektorat: Jessica Beer
ISBN e-Book 978-3-7017-4587-6ISBN Print 978-3-7017-3446-7
Inhalt
Einleitung: Vom Schnee
IDie Welt als Aggressionspunkt
IIVier Dimensionen der Verfügbarkeit
IIIDie paradoxe Kehrseite: Das rätselhafte Zurückweichen der Welt
IVDie Welt als Resonanzpunkt
VFünf Thesen zur Verfügbarkeit der Dinge und zur Unverfügbarkeit der Erfahrung
VIVerfügbarmachen oder Geschehenlassen? Der Grundkonflikt an sechs Stationen des Lebenslaufs
VIIVerfügbarmachung als institutionelle Notwendigkeit: Die strukturelle Dimension des Grundkonflikts
VIIIDie Unverfügbarkeit des Begehrens und das Begehren des Unverfügbaren
IXDie Rückkehr des Unverfügbaren als Monster
Schluss
Einleitung: Vom Schnee
Erinnern Sie sich noch an den ersten Schneefall in einem Spätherbst oder Winter Ihrer Kindheit? Es war wie der Einbruch einer anderen Realität. Etwas Scheues, Seltenes, das uns besuchen kommt, das sich herabsenkt und die Welt um uns herum verwandelt, ohne unser Zutun, als unerwartetes Geschenk. Der Schneefall ist geradezu die Reinform einer Manifestation des Unverfügbaren: Wir können ihn nicht herstellen, nicht erzwingen, nicht einmal sicher vorherplanen, jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum hinweg. Und mehr noch: Wir können des Schnees nicht habhaft werden, ihn uns nicht aneignen: Wenn wir ihn in die Hand nehmen, zerrinnt er uns zwischen den Fingern, wenn wir ihn ins Haus holen, fließt er davon, und wenn wir ihn in die Tiefkühltruhe packen, hört er auf, Schnee zu sein. Vielleicht sehnen sich eben deshalb so viele Menschen – nicht nur die Kinder – nach ihm, vor allem an Weihnachten. Viele Wochen im Voraus werden die Meteorologen bestürmt und bekniet: Wird es dieses Jahr weiß? Wie stehen die Chancen? Und natürlich fehlt es nicht an Versuchen, Schnee verfügbar zu machen: Wintersportorte werben mit Schneegarantie und präsentieren sich als »schneesicher«; sie helfen mit Schneekanonen nach und entwickeln Kunstschnee, der auch bei 15 Grad plus noch durchhält.
In unserem Verhältnis zum Schnee spiegelt sich das Drama des modernen Weltverhältnisses wie in einer Kristallkugel: Das kulturelle Antriebsmoment jener Lebensform, die wir modern nennen, ist die Vorstellung, der Wunsch und das Begehren, Welt verfügbar zu machen. Lebendigkeit, Berührung und wirkliche Erfahrung aber entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Eine Welt, die vollständig gewusst, geplant und beherrscht wäre, wäre eine tote Welt. Das ist keine metaphysische Einsicht, sondern eine Alltagserfahrung: Das Leben vollzieht sich als Wechselspiel zwischen dem, was uns verfügbar ist, und dem, was uns unverfügbar bleibt, uns aber dennoch »etwas angeht«; es ereignet sich gleichsam an der Grenzlinie. Nehmen wir ein Massenphänomen wie den Fußball. Warum gehen die Menschen ins Stadion? »Weil sie nicht wissen, wie es ausgeht«, soll der Bundestrainer von 1954, Sepp Herberger, in einem viel zitierten Bonmot einst gesagt haben. Entgegen der stetig geäußerten Klage, im Fußball gehe es »nur noch ums Geld«, macht es die Attraktivität des Spiels aus, dass sich Siege und Niederlagen eben doch nicht erzwingen und erkaufen, eben doch nicht verfügbar machen lassen. Fußball bleibt für viele Menschen so spannend, dass er die ganze Woche lang den zentralen Fokus ihres libidinösen Sehnens bis zu den nächsten Ligaspielen bildet, weil konstitutive Unverfügbarkeit seinen Charakter ausmacht. Allerdings nicht schlechthinnige Unverfügbarkeit: Natürlich kann man mit Geld, aber auch mit Training Einfluss nehmen auf das Spielgeschehen, und das weiß auch jeder Amateursportler, nicht nur im Fußball, sondern auch im Tennis, im Basketball, bei allen Spielsportarten: Ja, man kann, z. B. auf dem Tennisplatz, seine Chancen erhöhen durch gute Vorbereitung, durch Mentaltraining, durch Entspannung, aber man kann den Sieg, den nächsten Punkt niemals erzwingen. Mehr als das, durch Steigerung der Anstrengung alleine lässt sich gar nichts erreichen: Je mehr man das Tor oder den nächsten Punkt verfügbar machen, das heißt erzwingen will, umso weniger gelingt es. Deshalb vollführen viele Hobbysportler allerhand obskur anmutende Riten, etwa vor dem Aufschlag, die magischen Praktiken ähneln, um das Unverfügbare verfügbar zu machen; und es sind der Kampf und die Spannung an dieser Grenzlinie, welche die Faszination des Sports aufrechterhalten.1
Das Wechselspiel von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit ist aber nicht nur für viele Sportarten konstitutiv, sondern für Spiele überhaupt: Für das Kartenspiel wie für das Schachspiel, das Brettspiel oder das Glücksspiel. Das Verhältnis zwischen Verfügbarem und Unverfügbarem ist dabei sehr variabel: Im Schach lassen sich Sieger und Verlierer recht sicher vorhersagen, beim Mensch-ärgere-Dich-nicht oder im Glücksspiel eher nicht. Doch nicht nur beim Spielen verhält es sich so. Die Begegnung mit dem Unverfügbaren und der Wunsch oder der Kampf, es verfügbar zu machen, durchziehen alle Lebensbereiche wie ein roter Faden. Nehmen wir das Einschlafen: Je mehr wir es wollen, umso weniger lässt es sich erzwingen. Dennoch können wir etwas tun – zum Beispiel spazieren gehen oder regelmäßige Vorbereitungsroutinen entwickeln –, um sein Eintreten zu erleichtern. Oder die Liebe. Hold the line, love isn’t always on time, singt die Band Toto treffend. Oder die Gesundheit: Ja, wir können versuchen, unser Erkältungsrisiko zu senken, uns gesund zu ernähren, aber ob wir uns erkälten, ob wir Krebs bekommen oder einen Bandscheibenvorfall – das gehört zu den Unverfügbarkeiten – oder sollen wir sagen: Teilverfügbarkeiten? – des Lebens. Vom Spiel zur Liebe und vom Schnee zum Tod: Unverfügbarkeit konstituiert menschliches Leben und menschliche Grunderfahrung, und fragt man nach der Weltbeziehung der Moderne, das heißt nach der Art und Weise, wie die Institutionen und kulturellen Praktiken der Gegenwartsgesellschaft auf Welt Bezug nehmen und wie wir infolgedessen als moderne Subjekte in die Welt gestellt sind, dann scheint die Art und Weise, wie wir individuell, kulturell, institutionell und strukturell zum Unverfügbaren in Beziehung treten, einen kardinalen Analysefokus zu bilden. Ich will auf den folgenden Seiten versuchen, diesen Fokus konsequent auf die Alltagspraktiken und die sozialen Konflikte der spätmodernen Gegenwartsgesellschaften anzuwenden, um zu prüfen, was man aus dieser Perspektive erkennen kann. Meine Ausgangshypothese dabei lautet: Indem wir Spätmodernen auf allen genannten Ebenen – individuell, kulturell, institutionell und strukturell – auf die Verfügbarmachung von Welt zielen, begegnet uns die Welt stets als »Aggressionspunkt« oder als Serie von Aggressionspunkten, das heißt von Objekten, die es zu wissen, zu erreichen, zu erobern, zu beherrschen oder zu nutzen gilt, und genau dadurch scheint sich uns das »Leben«, das, was die Erfahrung von Lebendigkeit und von Begegnung ausmacht – das, was Resonanz ermöglicht –, zu entziehen, was wiederum zu Angst, Frust, Wut, ja Verzweiflung führt, die sich dann unter anderem in ohnmächtigem politischem Aggressionsverhalten niederschlagen.
Anmerkungen
1Diesen Hinweis verdanke ich Anton Röhr, der zu den rituellen Praktiken von Tennisspielern ein beeindruckendes Manuskript mit dem Titel »Ready? Play! Ein Versuch zum Zusammenhang von Ritual und Resonanz im Tennis« (Erfurt: Max Weber Kolleg 2018) verfasst hat.
IDie Welt als Aggressionspunkt
Den Ausgangspunkt meiner Überlegungen bildet die Einsicht, dass Menschen immer schon in eine Welt hineingestellt sind, dass sie, wie der französische Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty sagt, »zur Welt sind«. Der erste Bewusstseinsfunke beim Aufwachen am Morgen oder nach einer Narkose, vermutlich der erste Bewusstseinseindruck auch eines Neugeborenen ist der einer Gegenwart: Etwas ist da, etwas ist gegenwärtig.1 Man kann diese Gegenwart als die Urform dessen verstehen, was wir nach und nach als Welt erfahren, erkunden und begreifen; im Grunde geht sie aber der Trennung von Subjekt und Welt voraus. Ich habe aus dieser Urform eines »Etwas ist da, etwas ist gegenwärtig« versucht, eine Soziologie der Weltbeziehung zu entwickeln, die davon ausgeht, dass Subjekt und Welt nicht die Voraussetzung, sondern schon das Ergebnis unserer Bezogenheit auf jene Gegenwart sind: Nach und nach, im Prozess unserer Entwicklung, lernen wir, an jenem »etwas« zwischen uns als erfahrendem Subjekt und der Welt als das, was uns begegnet, zu unterscheiden. Die Art und Weise der Bezogenheit wird damit konstitutiv für das, was wir als Menschen sind, ebenso wie für das, was uns als Welt begegnet. Wenn daher im Folgenden immer wieder von (erfahrenden) Subjekten und (begegnenden) Objekten die Rede ist, dann sind Subjekt und Objekt hier zu verstehen als die beiden Pole – gleichsam als Selbstpol und als Weltpol – einer sie konstituierenden Beziehung.
Die Grundfrage der Soziologie der Weltbeziehung lautet dann: Wie ist dieses Etwas, das da gegenwärtig ist, beschaffen? Ist es gütig und bergend, ist es verlockend und verheißend, gleichgültig und kalt oder gar bedrohlich und gefährlich? Anders als Philosophen und Psychologen oder auch Theologen, die sich professionellerweise mit dieser Frage nach der Stellung des Menschen im Kosmos oder nach unserer Beziehung zum Universum oder zur Natur etc. herumschlagen,2 gehe ich dabei davon aus, dass die Art und Weise unserer Bezogenheit zur Welt eben nicht einfach mit unserem Menschsein schon festgelegt ist, sondern dass sie abhängig ist von den sozialen und kulturellen Bedingungen, in die wir hineinsozialisiert werden. Wir erlernen und habitualisieren eine bestimmte Stellungnahme zur Welt, eine praktische Welthaltung, die weit über unser kognitives »Weltbild«, unsere bewussten Annahmen und Überzeugungen über das, was es in der Welt gibt und worauf es ankommt, hinausgeht. Und eine erste Leitthese, die ich in diesem Essay entfalten möchte, lautet, dass für spätmoderne Subjekte die Welt schlechterdings zum Aggressionspunkt geworden ist.3 Alles, was erscheint, muss gewusst, beherrscht, erobert, nutzbar gemacht werden. Das klingt, abstrakt formuliert, erst einmal banal. Aber das ist es nicht. Dahinter verbirgt sich ein schleichender Umbau unseres Weltverhältnisses, der historisch-kulturell und ökonomisch-institutionell weit zurückreicht, im 21. Jahrhundert aber nicht zuletzt durch die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung und durch die polit-ökonomischen Steigerungs- und Optimierungszwänge des Finanzmarktkapitalismus und des entfesselten Wettbewerbs eine neue Radikalität erreicht.
Ich werde das im Folgenden näher ausführen, möchte es aber schon an dieser Stelle an ein paar wenigen Beispielen illustrieren. Nehmen wir das Verhältnis zu unserem eigenen Körper. Alles, was wir an ihm wahrnehmen, steht tendenziell unter Optimierungsdruck. Wir steigen auf die Waage: Das Gewicht sollte reduziert werden. Wir sehen in den Spiegel: Der Pickel muss weg, die Falte raus. Wir messen den Blutdruck: Der wäre zu senken. Die Schrittzahl: Sollten wir steigern. Der Insulinspiegel, der Brustumfang usw.: sie begegnen uns stets als Aufforderung, sie zu verbessern, auch wenn wir diese Aufforderung ignorieren oder zurückweisen können. Wir müssten außerdem auch gelassener sein und entspannter und achtsamer und umweltbewusster etc. Und auch das, was uns außerhalb unserer selbst begegnet, trägt diesen Aufforderungscharakter: Berge sind zu besteigen, Prüfungen zu bestehen, Karrierestufen zu nehmen, Liebhaber zu erobern, Orte zu besuchen und zu fotografieren (»das muss man mal gesehen haben«), Bücher zu lesen, Filme zu sehen etc. Sogar dort, wo wir ganz und gar nicht auf »Eroberung« aus scheinen, lässt sich diese Haltung erkennen, gar nicht nur latent, sondern sogar manifest: Auf Ballermann sind die Alkoholstrecken oder -eimer »zu vernichten« oder »wegzuhauen«, und im Chor gilt es, etwa »den schwierigen Mendelssohn« (fehlerlos) »zu meistern«. Das Alltagsleben durchschnittlicher spätmoderner Subjekte in den Zonen, die der sogenannten »entwickelten westlichen« Welt zugerechnet werden, konzentriert sich und erschöpft sich mehr und mehr in der Abarbeitung von explodierenden To-do-Listen, und die Einträge auf dieser Liste bilden die Aggressionspunkte, als die uns die Welt begegnet: der Einkauf, der Anruf bei der pflegebedürftigen Tante, der Arztbesuch, die Arbeit, die Geburtstagsfeier, der Yogakurs: erledigen, besorgen, wegschaffen, meistern, lösen, absolvieren.
Gewiss sind wir an dieser Stelle geneigt zu fragen: Ist das nicht normal? War das nicht immer so? Erscheinen uns Menschen Welt und Wirklichkeit nicht immer als Widerstand?4 Diese Normalisierung und Naturalisierung eines aggressiven Weltverhältnisses ist, so meine These, das Ergebnis einer sich über drei Jahrhunderte hinweg entwickelnden gesellschaftlichen Formierung, die strukturell auf dem Prinzip dynamischer Stabilisierung und kulturell auf dem Prinzip der unablässigen Reichweitenvergrößerung basiert. Das klingt kompliziert, doch sind die Grundüberlegungen ganz einfach. Nach meiner Überzeugung lassen sich die Gestalt und die Dynamik einer gesellschaftlichen Formation nur aus dem Zusammenspiel zwischen ihrer institutionellen oder strukturellen Verfasstheit und ihren kulturellen Antriebsmomenten, das heißt ihren Ängsten, Verheißungen und Begehrungen verstehen. Die strukturelle Dimension lässt sich dabei mit den Mitteln empirischer wissenschaftlicher Beobachtung, das heißt aus der Perspektive der dritten Person, beschreiben, aus der wir etwa auch die Kreisbahnen der Planeten beobachten und beschreiben. Was sich damit aber nicht erfassen lässt, ist das dynamische und energetische Moment der Gesellschaft: Soziales Leben und soziale Veränderung vollziehen sich nur auf der Basis der Ängste und Hoffnungen der Menschen, die in einer Formation leben, und diese Antriebsmomente, die Verheißungen und Befürchtungen, lassen sich nur aus der Perspektive der ersten Person, hermeneutisch, kulturwissenschaftlich rekonstruieren. Weil ich meine strukturelle ebenso wie meine kulturelle Analyse der Moderne in mehreren Büchern bereits eher langatmig entwickelt habe,5 möchte ich mich hier ganz kurz fassen:
Seit dem 18. Jahrhundert vollzieht sich auf allen Ebenen des institutionellen Lebens der westlich geprägten Moderne ein Strukturwandel, in dessen Folge die institutionelle Grundstruktur nur noch durch stetige Steigerung aufrechterhalten werden kann. Eine Gesellschaft ist modern, wenn sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag, das heißt, wenn sie zur Aufrechterhaltung ihres institutionellen Status quo des stetigen (ökonomischen) Wachstums, der (technischen) Beschleunigung und der (kulturellen) Innovierung bedarf, so lautet meine Definition einer modernen Gesellschaft. Dabei verkehrt sich in der kulturellen Wahrnehmung die Steigerungsperspektive nach und nach von einer Verheißung in eine Bedrohung: Wachstum, Beschleunigung und Innovierung erscheinen nicht mehr als Versprechen, das Leben immer besser zu machen, sondern als apokalyptischklaustrophobische Drohung: Wenn wir nicht besser, schneller, kreativer, effizienter etc. werden, verlieren wir Arbeitsplätze, kommt es zu Firmenschließungen, sinken unsere Steuereinnahmen, während die -ausgaben steigen, kommt es zur Haushaltskrise, können wir unser Gesundheitssystem, unser Rentenniveau, unsere kulturellen Einrichtungen nicht mehr aufrechterhalten, werden die politischen Spielräume immer enger, sodass am Ende auch das politische System delegitimiert erscheint. Alles das lässt sich im frühen 21. Jahrhundert etwa an der anhaltenden Rezessionskrise in Griechenland instruktiv studieren. Der Wille zur Steigerung wird dabei weder individuell noch kollektiv durch das Versprechen eines Fortschritts an Lebensqualität erzeugt, sondern durch die Drohung des (schrankenlosen) Verlusts des bereits Erreichten. Wer deshalb behauptet, die Moderne werde vom Verlangen nach dem Höher, Schneller, Weiter, getrieben, verkennt ihre strukturelle Realität: Es ist nicht die Gier nach mehr, sondern die Angst vor dem Immer-weniger, die das Steigerungsspiel aufrechterhält. Es ist nie genug, nicht, weil wir unersättlich sind, sondern weil wir immer und überall wie auf Rolltreppen nach unten stehen: Wann und wo immer wir anhalten oder innehalten, verlieren wir an Grund gegenüber einer hochdynamischen Umwelt, mit der wir überall in Konkurrenz stehen. Es gibt keine Nischen oder Plateaus mehr, die es uns erlaubten, innezuhalten oder gar zu sagen: »Es ist genug.« Dies zeigt sich empirisch etwa in dem Faktum, dass die Mehrzahl der Eltern in den sogenannten entwickelten Gesellschaften nach ihrer eigenen Auskunft nicht mehr von der Hoffnung motiviert wird, dass es die Kinder einmal besser haben mögen als sie selbst, sondern von dem Verlangen, alles zu tun, was sie irgend können, damit es ihnen nicht schlechter geht.
Weil sich moderne Gesellschaften also nur im Modus der Steigerung, das heißt: dynamisch, zu stabilisieren vermögen, sind sie strukturell und institutionell dazu gezwungen, immer mehr Welt verfügbar zu machen, sie technisch, ökonomisch und politisch in Reichweite zu bringen: Rohstoffe nutzbar zu machen, Märkte zu erschließen, soziale und psychische Potenziale zu aktivieren, technische Möglichkeiten zu vergrößern, die Wissensbasis zu vertiefen, Steuerungsund Kontrollmöglichkeiten zu verbessern etc.
Indessen wäre es ein gravierendes Missverständnis, als motivationale Ressource für diesen Expansionsdrang der Moderne nur die Angst (vor dem Zurückfallen) auszumachen. Keine soziale Formation kann über längere Zeit hinweg bestehen (und noch dazu auf derart resiliente und robuste Weise, wie es die kapitalistische Moderne tut), wenn sie nur auf Angst basiert. Als zweites Antriebsmoment muss daher eine positive, attraktive Kraft im Spiel sein, und diese lässt sich in der Verheißung der Weltreichweitenvergrößerung identifizieren.6 Als kulturelles Korrelat zur strukturellen Logik dynamischer Stabilisierung hat sich im Selbstverständnis der Moderne die bis in die feinsten Poren unseres psychischen und emotionalen Lebens hinein ungeheuer wirkmächtige Vorstellung entwickelt, dass in der Vergrößerung unserer Weltreichweite der Schlüssel zu einem guten, zu einem besseren Leben liegt. Unser Leben wird besser, wenn es uns gelingt, (mehr) Welt in Reichweite zu bringen, so lautet das unausgesprochene, aber im Handeln unablässig reiterierte und reifizierte Mantra des modernen Lebens. Handle jederzeit so, dass deine Weltreichweite größer wird: Dieser kategorische Imperativ ist, wie ich in diesem Essay zeigen möchte, in der Spätmoderne zum dominanten Entscheidungsprinzip in allen Lebensbereichen und über alle Lebensalter hinweg, vom Kleinkind bis zum Greis geworden. Er erklärt zunächst die Attraktivität des Geldes: Wie viel Welt wir in Reichweite haben, lässt sich unmittelbar an unserem Kontostand ablesen. Ist er hoch, dann liegen die Kreuzfahrt in die Südsee, das Wochenendhäuschen in den Alpen, die Luxuswohnung in Hamburg-Winterhude, der Ferrari, die Diamantenkette, der Steinway-Flügel, auch die Ayurveda-Kur in Südindien oder eine geführte und gesicherte Tour auf den Mount Everest in unserer Reichweite; sind wir Milliardäre, kommen sogar ein Flug zum Mond oder zum Mars in Betracht. Sind wir dagegen tief im Soll, können wir uns vielleicht den Bus nach Hause, das belegte Brötchen und die Kellerwohnung nicht mehr leisten: Sie liegen außerhalb unserer finanziellen Reichweite.
Die Verheißung der Vergrößerung unseres Radius des Sichtbaren, Zugänglichen und Erreichbaren vermag darüber hinaus verblüffenderweise die Motivationsenergie hinter der gesamten Technikgeschichte zu erklären. Unmittelbar nachvollziehen können wir dies an der Geschichte der individuellen Radiusvergrößerung durch Transportmittel. Für die meisten Kinder sind das Fahrradfahrenlernen und das erste Fahrrad prägende Momente für die Entwicklung ihrer Weltbeziehung. Warum? Weil sich mit dem ersten Fahrrad der Horizont dessen, was wir eigentätig, aus eigenem Antrieb, erreichen können, deutlich erweitert: Jetzt kann ich bis zum Badesee, bis zum Wäldchen am Rand des Dorfes fahren – »meine« Welt vergrößert sich spürbar. Für Kinder auf dem Land zumindest wiederholt sich diese Erfahrung dann Stück für Stück mit dem Mofa – damit kommt das Nachbardorf in Reichweite –, mit dem Moped und dann natürlich mit dem Führerschein und dem eigenen Auto, das die nächste Großstadt mit all ihren Verlockungen und Verheißungen in alltagspraktische individuelle Reichweite bringt. Das Flugzeug schließlich lässt London, Rio und Tokio am Horizont des Erreichbaren erscheinen, die Rakete den Mond, wenngleich das nun natürlich keine Alltagserfahrung ist. Nicht anders verläuft die Geschichte der Rundfunkmedien: Das Radio bringt die »Stimme Berlins« in akustische, das Fernsehen Tokio in visuelle Reichweite; sie machen Welt sichtbar und hörbar; und während das Telefon dieselbe Reichweitenvergrößerung wie das Radiogerät, wenngleich auf der individuellen Ebene vollbringt, vollendet das Smartphone diese Bewegung dadurch, dass es alle unsere Freunde und Bekannten, alle unsere Lieben und weniger Lieben stets nur noch einen »Klick« entfernt sein lässt. Das ist eine unerhörte Explosion unserer Weltreichweite: Auch alles Weltwissen, alle Lieder, alle Filme, alle Bilder, alle Daten, soweit sie digitalisiert sind, haben wir nun stets in nächster Nähe, wir tragen sie geradezu am Leib. Die Welt rückt uns auf historisch beispiellose Weise zu Leibe.7 Die Vorstellung, nein: die in unsere Körper und unsere psychischen und emotionalen Dispositionen eingeschriebene Überzeugung, die mit diesen Prozessen korreliert, lautet: