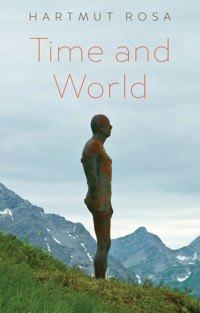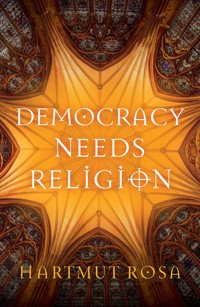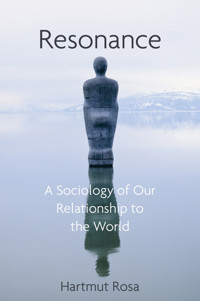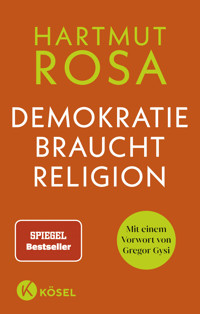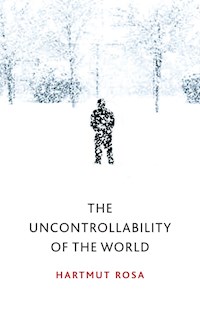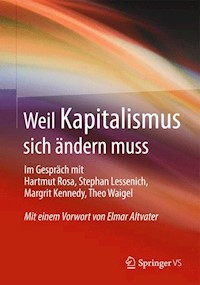21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit der Beschleunigung des sozialen Lebens in der Moderne ändert sich auch die Art und Weise, in der der Mensch »in die Welt gestellt« ist. Hartmut Rosa analysiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Veränderungen in der Welterfahrung, der Weltbeziehung und der Weltbearbeitung moderner Subjekte. Dabei entsteht umrißhaft das Programm einer kritischen Soziologie, in deren Zentrum die Bestimmung derjenigen sozialen Bedingungen und Voraussetzungen steht, die eine gelingende individuelle und kollektive Weltaneignung möglich machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mit der Beschleunigung des sozialen Lebens in der Moderne ändert sich auch die Art und Weise, in der der Mensch »in die Welt gestellt« ist. Hartmut Rosa analysiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Veränderungen in der Welterfahrung, der Weltbeziehung und der Weltbearbeitung moderner Subjekte. Dabei entsteht umrisshaft das Programm einer kritischen Soziologie, in deren Zentrum die Bestimmung derjenigen sozialen Bedingungen und Voraussetzungen steht, die eine gelingende individuelle und kollektive Weltaneignung möglich machen.
Hartmut Rosa ist Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie und Sprecher der Kolleg-Forschergruppe »Landnahme, Beschleunigung, Aktivierung. Dynamik und (De-)Stabilisierung moderner Wachstumsgesellschaften« an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Im Suhrkamp Verlag sind erschienen: Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne (stw 1760) sowie Soziologie – Kapitalismus – Kritik (stw 1923, mit Klaus Dörre und Stephan Lessenich).
Hartmut Rosa
Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung
Umrisse einer neuen Gesellschaftskritik
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Interne über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-78250-7
www.suhrkamp.de
5Inhalt
Einleitung
I. Konzeptuelle Grundlegungen
1. Lebensformen vergleichen und verstehen
Eine Theorie der dimensionalen Kommensurabilität von Kontexten und Kulturen
2. Gerechtigkeit und starke politische Wertungen
Die prozedurale Gesellschaft und die Idee starker politischer Wertungen. Zur moralischen Landkarte der Gerechtigkeit
3. Das Ausgangsmodell
Vier Ebenen der Selbstinterpretation. Entwurf einer hermeneutischen Sozialwissenschaft und Gesellschaftskritik
II. Die Analyse der modernen Gesellschaft
4. Kapitalismus und Lebensführung
Perspektiven einer ethischen Kritik der liberalen Marktwirtschaft
5. Modernisierung als soziale Beschleunigung
Kontinuierliche Steigerungsdynamik und kulturelle Diskontinuität
6. Situative Identität
Zwischen Selbstthematisierungszwang und Artikulationsnot? Situative Identität als Fluchtpunkt von Individualisierung und Beschleunigung
III. Eine Kritische Theorie der sozialen Beschleunigung
7. Umrisse einer Kritischen Theorie der Geschwindigkeit
8. Wettbewerb als Interaktionsmodus
Kulturelle und sozialstrukturelle Konsequenzen der Konkurrenzgesellschaft
6IV. Schlussfolgerungen: Auf dem Weg zu einer Soziologie der Weltbeziehung
9. Politische Weltbeziehungen unter den Bedingungen sozialer Beschleunigung
Die Krise der Demokratie
10. Geworfen oder getragen?
Subjektive Weltbeziehungen und moralische Landkarten
Danksagung
Textnachweise
Literaturverzeichnis
Namen- und Sachregister
7Einleitung
Ist es möglich, mit den Mitteln der modernen Sozialwissenschaften und auf der Basis der Einsichten der Sozialphilosophie eine Soziologie des guten Lebens zu entwerfen? Deren Aufgabe bestünde nicht darin, anzugeben, was die Ziele, die Werte oder die Inhalte eines gelingenden Lebens sind – diese zu bestimmen ist ein Anliegen der Philosophie des guten Lebens, doch sprechen gute Gründe für die Annahme, dass sich solche Ziele, Werte und Inhalte allenfalls formal bestimmen lassen –, sondern in der Identifizierung der sozialen Voraussetzungen und Bedingungen eines solchen Lebens.1 In dem vorliegenden Band möchte ich die Umrisse, Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Soziologie aus verschiedenen Blickwinkeln versuchsweise ausloten. Als Ausgangspunkt für die Organisation des Materials dient mir dabei die Vorstellung, dass sich die Frage nach dem gelingenden Leben als eine Frage nach dem Weltverhältnis oder der Weltbeziehung des Menschen reformulieren lässt und dass diese Weltbeziehung stets sozial, kulturell und historisch vermittelt ist. Der Begriff der ›Weltbeziehung‹ meint dabei die Art und Weise, wie Menschen in die Welt gestellt sind oder, besser: in der sie sich als in die Welt gestellt erfahren. Diese Stellung oder auch Haltung der Welt gegenüber umfasst sowohl die eher passive Seite der Welterfahrung als auch die aktive Weise des menschlichen Eingreifens in die Welt; mithin also sowohl die Beziehung zu dem, was den handelnden Subjekten ›entgegenkommt‹, als auch zu dem, was es ›zu tun gibt‹. In dieser (in der Grundintuition durchaus phänomenologisch inspirierten) Perspektive erscheint ›die Welt‹ dabei zunächst als alles, was ›begegnet‹, also als objektive, soziale und subjektive Welt zugleich. Anders als in Philosophie und Anthropologie üblich, geht es mir bei der Entwicklung dieser Fragestellung nicht um die ›allgemein menschliche‹ Weltbeziehung, weniger um die Conditio humana per se, als vielmehr um die Frage nach den kultur- und gesellschaftsspezifischen, den milieu-, alters- und 8geschlechterspezifischen Differenzen in der Form solcher Weltbeziehungen. Dass in einer Gesellschaft, deren Wirtschaftssystem kapitalistisch und deren Weisheit wissenschaftlich organisiert ist, die Subjekte durch eine andere Weltbeziehung charakterisiert, ja: konstituiert sind als in einer Agrargesellschaft, oder dass ein Waldarbeiter buchstäblich auf eine andere Weise in die Welt gestellt ist als ein Wissenschaftler oder ein Tänzer, scheint mir ebenso trivial wie in seiner Bedeutung unerforscht zu sein.
Der gemeinsame, wenngleich nicht immer explizit gemachte Fokus der folgenden Untersuchungen liegt nun in der Vermutung, dass die Frage, unter welchen Bedingungen menschliches Leben gelingt, sich übersetzen lässt in die Frage nach der Qualität oder den Qualitäten der jeweiligen Weltbeziehung und dass dabei ein fundamentaler, ja kategorialer Unterschied besteht zwischen einem Modus des In-die-Welt-gestellt-Seins, bei dem diese Welt (in der subjektiven, objektiven und/oder sozialen Dimension) dem Subjekt als ein antwortendes, tragendes, atmendes ›Resonanzsystem‹ erscheint, und einer Weltbeziehung, der jene Welt als stumm, kalt und indifferent – oder sogar als feindlich – erscheint. In der Traditionslinie der Kritischen Theorie, aber auch weit darüber hinaus diente lange Zeit der Begriff der ›Entfremdung‹ als Chiffre für diese letztere Form der Welterfahrung. Entfremdungstheorien (in materialistischen wie existentialistischen Varianten) identifizieren dabei das Stumm-, Fremd- oder Indifferentwerden der Dingwelt oder der Natur, der Sozialwelt oder sogar der eigenen leiblichen und psychischen Existenz als Kern einer (sozial verursachten oder aber unvermeidlichen) pathologischen Weltbeziehung. Dieses Konzept ist im weiteren Verlauf der sozialphilosophischen und soziologischen Debatte jedoch nach und nach aus der Mode gekommen. Diskreditiert wurde der Entfremdungsbegriff dabei insbesondere dadurch, dass ihm als gelingende Form der Weltbeziehung die Idee der ›Eigentlichkeit‹ oder Authentizität entgegengesetzt wurde, die ihrerseits mit der Vorstellung entweder einer ›wahren‹ Natur des Menschen (und daher einer ›richtigen‹ Form des menschlichen Lebens) oder aber zumindest eines feststehenden ›inneren Kerns‹ des Individuums verknüpft ist.2 Weil sich diese Vorstellung aber als 9kaum haltbar erwiesen hat, machen jüngere Arbeiten den Versuch, dem Zustand der Entfremdung nicht die Eigentlichkeit oder Authentizität, sondern nur die Idee der Autonomie, der Selbstbestimmung, entgegenzusetzen.3 Weltbeziehungen und Weltaneignungen gelingen nach dieser letzteren Auffassung dann, wenn Menschen sich selbst zu bestimmen und selbstbestimmt zu handeln in der Lage sind. Wenngleich vieles für diese Rekonzeptualisierung spricht, reicht sie meines Erachtens nicht aus, weil sich einerseits insbesondere unter spätmodernen Bedingungen vielerorts beobachten lässt, dass just die Ausweitung und Steigerung von Selbstbestimmungsmöglichkeiten und die Verminderung von Begrenzungen und Abhängigkeiten zu neuen und verstärkten Entfremdungserfahrungen führt, während andererseits die Auffassung, dass alles menschliche Leben, das nicht im modernen Sinne als selbstbestimmt verstanden werden kann, als entfremdet zu gelten habe, schlechterdings unplausibel ist. Hinzu kommt, dass das Autonomiekonzept meines Erachtens in einer unübersehbaren Spannung zu anerkennungstheoretischen Ansätzen steht, die Entfremdungserfahrungen eher dort identifizieren, wo sich Subjekte als minderwertig, als missachtet oder wertlos erfahren, und deshalb der Entfremdung tendenziell das Konzept der Anerkennung entgegensetzen. Deshalb möchte ich vorschlagen, dem Zustand oder der Erfahrung der Entfremdung nicht länger den Autonomie- oder den Authentizitätsgedanken entgegenzusetzen und auch nicht den Zustand der Anerkennung und Wertschätzung, sondern das Konzept der Resonanz: Gelingende Weltbeziehungen sind solche, in denen die Welt den handelnden Subjekten als ein antwortendes, atmendes, tragendes, in manchen Momenten sogar wohlwollendes, entgegenkommendes oder ›gütiges‹ ›Resonanzsystem‹ erscheint.
Anerkennung ist dabei ohne Zweifel eine (wichtige) Ermöglichungsbedingung von Resonanz, wenngleich Anerkennung und Resonanz nicht identisch sind: Wenn Person A von Person B wertgeschätzt oder sogar geliebt wird, bedeutet das keineswegs, dass sich zwischen A und B eine Resonanzbeziehung einstellt. Diese 10entsteht erst und nur da, wo A und B sich ›berühren‹, wo sie in eine Beziehung des wechselseitigen Antwortens eintreten. Darüber hinaus machen Subjekte Resonanzerfahrungen aber auch außerhalb der Sphäre sozialer Interaktion. In der Moderne haben sich die Sphären der Ästhetik und der Naturerfahrung als Resonanzsphären sui generis etabliert: Wer etwa von Musik zutiefst ergriffen, berührt und erschüttert wird, wer auf diese Weise einen Moment des ›Einklangs‹, der ›Tiefenresonanz‹ zwischen sich und einer (wie immer gearteten) akustischen Welt ›da draußen‹ erfährt, macht eine Resonanzerfahrung – ebenso wie der- oder diejenige, die unter den Sternen am Meeresstand oder bei Sonnenaufgang auf einem Berggipfel die Welt ›atmen hören‹. Als eine weiterhin wirksame zusätzliche Resonanzsphäre kann darüber hinaus der Bereich der religiösen Erfahrungen gedeutet werden: In Gebet, Lied oder Abendmahl beispielsweise ›erfahren‹ (christliche) Gläubige ein antwortendes ›Du‹, eine Beziehung zwischen Subjekt und (Über-)Welt, die über eine instrumentelle oder kausale Wechselbeziehung hinausgeht.4 Dass sich in allen dreien dieser Sphären (Ästhetik, Natur, Religion) die Resonanzerfahrung nicht manipulativ sicherstellen bzw. fixieren lässt – dasselbe Musikstück, die identische Szenerie, das gleiche Ritual, welches ein Subjekt an einem Tag bis ins Innerste ergreift, kann es am nächsten Tag völlig ›kalt lassen‹ –, macht dabei deutlich, dass wir es hier mit einem Moment der Subjekt-Welt-Beziehung zu tun haben, das über instrumentelle, kausale und/oder epistemologische Relationen hinausgeht.
Daraus lässt sich der Gedanke formulieren, dass menschliches Leben (zumindest momenthaft) dort gelingt, wo Subjekte konstitutive Resonanzerfahrungen machen, dass es dagegen misslingt, wo Resonanzsphären systematisch durch ›stumme‹, das heißt rein kausale oder instrumentelle Beziehungsmuster verdrängt werden. Sofern Resonanzbeziehungen sich nur dort ausbilden können, wo die Aneignung oder Anverwandlung von Weltausschnitten gelingt, kann dann das Fehlen von Autonomie und/oder sozialer Anerkennung, insbesondere unter den Bedingungen der Moderne, weiterhin als eine zentrale Ursache für Entfremdungserfahrungen gelten.
Wenn die Beiträge in diesem Buch daher unter der organisierenden Idee einer Analyse von ›Weltbeziehungen‹ zusammengeführt 11werden können, so ist damit ein Thema bezeichnet, das zwar in enger Verwandtschaft zur Disziplin der Wissenssoziologie steht, diesen Titel und diese Zuordnung aber insofern nicht verdient, als es nicht oder zumindest nicht primär um eine ideengeschichtliche oder weltanschauliche Untersuchung des subjektiven oder kulturellen Weltverhältnisses, ja letztlich überhaupt nicht um die kognitiven oder propositionalen Gehalte moderner Subjekt-Welt-Beziehungen geht. Auf dem Prüfstand stehen also nicht das Weltwissen oder auch nur die ›Mentalitäten‹ moderner Subjekte, sondern ihr Weltverhältnis (und damit unvermeidlich auch: ihr Selbstverhältnis) per se, und dieses ist stets und primär ein leibliches, emotionales, sensuelles und existentielles und erst danach ein mentales und kognitives. Weltbeziehungen können mithin im Sinne der angedeuteten Überlegungen ›stumm‹ oder ›resonant‹ sein, und sie können dies ohne Zweifel in mannigfaltigen Formen und Mischverhältnissen, die zu untersuchen eine ebenso reizvolle wie schwierige intellektuelle Herausforderung darstellt, da bisher weder die Philosophie noch die Psychologie oder die Soziologie dafür über ein geeignetes analytisches Instrumentarium zu verfügen scheinen.
Der vorgelegte Band ist indessen noch nicht der Ort für die systematische Entfaltung dieser Idee. Er kann jedoch als breit angelegte Vorstudie für eine solche umfassende ›Soziologie der Weltbeziehung‹ dienen, indem er auf unterschiedlichen Wegen die kulturellen, politischen, aber auch ökonomischen Kontexte und Differenzen moderner Weltbeziehungen und die methodischen Schwierigkeiten bei der Verfolgung dieser Konzeption exploriert.
Gerade weil die Arten und Differenzen menschlicher Weltbeziehung sich nicht auf Unterschiede der kognitiven Repräsentation von Welt reduzieren lassen, erfordert ihre Analyse die Rekonstruktion kultureller Lebensformen als Ganzen. Erst in dem Ensemble aus Institutionen und Praktiken, aus Sprache und Habitus und den durch sie erzeugten Emotionen und Interaktionen formt sich die historisch und kulturell je spezifische Weise einer Weltbeziehung. Um einen Sinn für die Differenzen zwischen solchen Weltbeziehungen zu gewinnen, sind komplexe hermeneutische Operationen erforderlich, die es erlauben, mit den Mitteln der Sprache die Unterschiede auch in den nichtsprachlichen Modi der Welterfahrung, Weltaneignung und Weltbearbeitung spürbar werden zu lassen. Der erste hier aufgenommene Beitrag »Lebensformen vergleichen 12und verstehen« knüpft an das Paradigmen-Konzept des Wissenschaftshistorikers Thomas S. Kuhn und an Überlegungen Charles Taylors an, um die Grundlinien eines solchen hermeneutischen Verfahrens herauszuarbeiten. Charles Taylors Philosophie dient dabei als wichtiger Ankerpunkt und als Inspirationsquelle nicht nur für diesen, sondern auch für die übrigen Beiträge des ersten Teils dieses Buches – und darüber hinaus auch für die Idee, Resonanzerfahrungen zum Ankerpunkt einer Analyse der Bedingungen gelingenden Lebens zu machen.5 Tatsächlich liegt in ihr, wie ich im zehnten Kapitel zu zeigen versuchen werde, die innere Verbindung zwischen meinen an Taylor orientierten früheren und den ›beschleunigungsdominierten‹ späteren Arbeiten.
Die Lebensform der Moderne in ihrer umfassenden Gestalt wird dabei in besonderem Maße von der Vorstellung ihrer politischen Gestaltbarkeit bestimmt: Seit der Aufklärung entwickelte sich (zunächst in Europa und Nordamerika, dann aber auch weit darüber hinaus) die Politik – und insbesondere die demokratische Politik – zum zentralen Instrument der Aneignung oder ›Anverwandlung‹ der kollektiven Lebenswelt. Im Modus der Politik werden die kollektiven Strukturen gleichsam ›zum Sprechen‹ gebracht; die soziale Welt bildet für die Bürgerinnen und Bürger demokratischer Gemeinwesen insofern eine Resonanzsphäre, als sich ihre geteilten Werte und ausgehandelten Entscheidungen darin widerspiegeln, weil sie sich in die Institutionen gleichsam einbringen und in ihnen wiedererkennen können. So jedenfalls lautet die Kerneinsicht des republikanischen und kommunitaristischen Politikverständnisses. Dem steht indessen ein stärker liberal-individualistisches Politikverständnis gegenüber, dem zufolge der Staat und die öffentlichen Institutionen gerade nicht als ›Resonanzsphären‹ für die Bürger missbraucht werden dürfen, sondern hinsichtlich deren unterschiedlichen und pluralen Identitäten und Wertvorstellungen als 13neutral, unparteilich und unbestechlich erscheinen müssen: Indifferenz erscheint dem liberalen Politik- und Gerechtigkeitsverständnis als ein Vorzug und nicht als ein Problem der politischen und rechtlichen Institutionen. Damit aber, so lautet das im zweiten Beitrag entwickelte Argument, könnte es zusammenhängen, dass die tatsächliche Wohlstands- und Chancenverteilung in den entwickelten Gesellschaften nicht den Gerechtigkeitsvorstellungen der Bürger folgt, sondern ›blinden‹ (kapitalistischen) Sachzwängen und dass sich Entfremdungsgefühle gegenüber den Strukturen des Gemeinwesens ausbreiten, welche die Form einer wachsenden ›Politikverdrossenheit‹ annehmen.
Der dritte Beitrag versucht, die individuellen und kollektiven Elemente des menschlichen ›Weltverhältnisses‹ einerseits und seine kognitiven, ideengeleiteten sowie die habitualisierten, ›verkörperten‹ oder emotionalen Momente andererseits systematisch zueinander in Beziehung zu setzen. Ausgehend von der für die hier wiedergegebenen Studien grundlegenden Einsicht, dass Selbst-Welt-Beziehungen stets das Ergebnis konstitutiver Selbst- (und Welt-)Interpretation sind, entwickelt er ein konzeptuell angelegtes ›Vier-Felder-Schema‹ der Selbstinterpretation. Die Weltbeziehung von Subjekten wird demnach gleichermaßen bestimmt (1) durch ihr reflexives Selbstverständnis (›Identität‹), (2) durch ihre verkörperte, habitualisierte, zu einem großen Teil unbewusste Welthaltung, (3) durch die institutionellen Kontexte und die sozialen Praktiken, an denen sie partizipieren und in die sie eingebunden sind, und (4) schließlich durch die Selbstbeschreibungen und Leitbilder der kulturellen Gemeinschaft, der sie zugehören. Diese Konzeption legt den Gedanken nahe, dass tiefe Resonanzerfahrungen in jenen (seltenen und unvermeidlich transitorischen) Momenten entstehen, in denen sich diese vier Ebenen in Übereinstimmung befinden – dass aber Entfremdung aus der dauerhaften Unvereinbarkeit von habitualisierter und expliziter, institutionalisierter und politischer Selbst- und Weltdeutung resultiert.
Nach der in diesen drei Beiträgen versuchten konzeptuellen, methodischen und theoretischen Grundlegung einer Soziologie der Weltbeziehung widmet sich der zweite Teil der hier vorgelegten Studien verstärkt der Analyse der spezifisch modernen Form des Subjekt-Welt-Verhältnisses. Den drei folgenden Beiträgen gemeinsam ist dabei die Überzeugung, dass die Art und Weise, wie moderne 14Subjekte die Welt erfahren und sich in der Welt bewegen, grundlegend bestimmt wird durch die Steigerungslogik der modernen Gesellschaft. Das fundamentale Charakteristikum dieser Gesellschaft ist die Tatsache, dass sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag, was bedeutet, dass sie nicht nur kontingent (in besonderen Situationen), sondern strukturell und dauerhaft auf Wachstum, Innovationsverdichtung und Beschleunigung angewiesen ist, um sich in ihren Strukturbedingungen zu erhalten und zu reproduzieren. Dies führt zu einer fortwährenden Dynamisierung (und damit zugleich zu einer Ent-Ontologisierung) des modernen Weltverhältnisses: Die Beziehung des modernen Subjektes zur Dingwelt, zur Sozialwelt und zu sich selbst ist fundamental dadurch bestimmt, dass sich jene Welten in permanenter Veränderung und immer schnellerer Bewegung befinden. Von elementarer Bedeutung für die alle Formen und Sphären der modernen Weltbeziehung durchdringenden Dynamisierungs- und Steigerungszwänge ist ohne Zweifel das dominante Wirtschaftssystem der Moderne. Nicht nur Karl Marx, sondern auch Max Weber, als sein soziologischer Antipode, hat auf dieses konstitutive Grundfaktum für jede Form moderner Soziologie hingewiesen, als er den Kapitalismus als die »schicksalsvollste Macht unseres modernen Lebens« bestimmte.6 Das vierte Kapitel unternimmt daher den Versuch, die (weitgehend verborgenen) Wirkungsweisen und Einflussmechanismen dieser ›marktpaternalistischen Schicksalsbeziehung‹ aufzudecken und ihnen – gewissermaßen als kollektive Selbstschutzmaßnahme – das Konzept eines demokratisch-deliberativen ›Auto-Paternalismus‹ gegenüberzustellen. Damit soll zugleich die spezifisch kapitalistische Form der Weltbeziehung genauer bestimmt werden.
Die Beiträge über »Modernisierung als Beschleunigung« und »situative Identität« betonen demgegenüber expliziter die Zeitlichkeit der menschlichen Weltbeziehung. Die Art und Weise, wie Menschen – individuell und kollektiv – in die Welt gestellt sind, wie sie sich selbst und die Welt erfahren und wie sie sich Welt aneignen, sich in ihr positionieren und sich bisweilen auch vor ihr zu schützen versuchen, hängt elementar davon ab, wie sie in die Zeit gestellt sind. Die Moderne ist aber dadurch gekennzeichnet, dass sich diese Beziehung systematisch und kontinuierlich verändert 15durch jenen Prozess, den ich in einem früheren Buch als Prozess der Beschleunigung7 interpretiert habe. Im fünften Kapitel versuche ich daher noch einmal deutlich zu machen, warum jene in der Soziologie oft als ›Modernisierung‹ apostrophierten Veränderungen in der epistemischen und ökonomischen, sozialen und emotionalen, politischen und ästhetischen Weltbeziehung als ein seit nunmehr fast dreihundert Jahren andauernder Vorgang sozialer Akzeleration beschrieben werden können, ja müssen. Daran anschließend geht dann der sechste Beitrag der Frage nach, wie dieser Beschleunigungsprozess mit jenen Entwicklungen zusammenhängt, die sich unter dem Stichwort der Individualisierung beschreiben lassen, und welche Konsequenzen sich aus ihm für die Möglichkeiten und Zwänge individueller Identitätsbildung und Lebensführung ergeben. Die aktuelle Form subjektiver Weltbeziehungen, so lautet die dort entwickelte These, ist wesentlich bestimmt durch das spätmoderne Stadium einer entfesselten Beschleunigungsdynamik, der gegenüber inhaltliche bzw. ideelle und normative Fragmente und Differenzen der Selbstbestimmung geradezu als sekundär erscheinen.
Damit aber ist der Punkt erreicht, an dem die soziologische Zeitdiagnose und Moderneanalyse in eine kritische Theorie der Gesellschaft übergeht. Die beiden Beiträge des dritten Teils versuchen daher die Umrisse einer kritischen Theorie der Zeitverhältnisse zu entwerfen. Das siebte Kapitel unternimmt dazu den Versuch, das gesellschaftskritische Potential der Beschleunigungstheorie explizit in die Traditionslinie der Kritischen Theorie zu stellen und dabei deutlich zu machen, welchen Beitrag jene zu den beiden großen aktuellen Versionen dieses intellektuellen Unternehmens – Honneths Kritik der Anerkennungsverhältnisse und Habermas’ Kritik der Kommunikationsverhältnisse – zu leisten vermag. Darüber hinaus unternimmt dieser Beitrag aber auch den Versuch, die beschleunigungsbedingte Veränderung unserer Beziehung zu den Dingen und zu den Menschen, mit denen wir interagieren, zu den Räumen und Orten, an denen wir leben, und zu unseren eigenen Wünschen, Werten und Bedürfnissen auf ihr Entfremdungspotential hin zu analysieren. Die Dynamisierung unserer Weltbeziehungen, so lautet die dabei entwickelte These, unterminiert tendenziell die Neigung und die Möglichkeit, sich Weltausschnitte (in Erfahrungen) ›anzu16verwandeln‹ und Resonanzbeziehungen aufzubauen – und steigert damit die Wahrscheinlichkeit von Entfremdungserfahrungen: Die beschleunigt erfahrene und durchschrittene Welt bleibt tendenziell ›stumm‹. Dass diese Form der Weltbeziehung indessen weniger eine Frage individueller Einstellungen oder kultureller Werthaltungen als vielmehr eine Folge sozialstruktureller Dynamisierungsimperative ist, möchte der achte Beitrag deutlich machen. Dieser identifiziert das Wettbewerbsprinzip als die zentrale Triebfeder der neuzeitlichen Dynamisierungs- und Beschleunigungslogik. Indem die Konkurrenz zum zentralen Allokationsmodus wurde – nicht nur die ökonomische Verteilung folgt ihrer Logik, sondern generell die Vergabe von Positionen und Privilegien (in der Politik, in der Wissenschaft, der Kunst etc.), aber auch von Freundschaft und Beziehungen und von Status und Anerkennung –, ist es der modernen Gesellschaft gelungen, die materielle und die soziale Welt buchstäblich in Bewegung zu versetzen und darüber enorme Wohlstandsgewinne zu erzielen. Der Preis dafür ist jedoch eine permanente Beunruhigung, deren Unerbittlichkeit sämtliche Sphären menschlicher Weltbeziehung immer stärker zu ›kolonialisieren‹ scheint.
Im vierten und letzten Teil des Buches plädiere ich daher für den Versuch einer – positiv an der Möglichkeit von Resonanzerfahrungen und negativ an der Idee einer Vermeidung strukturell verursachter Entfremdung orientierten – Revision der spätmodernen Weltbeziehung. Leitidee ist dabei die Vorstellung einer gelingenden ›Wiederaneignung‹ oder ›Anverwandlung‹ von Welt – einerseits, kollektiv, im Modus demokratischer Politik, welche noch immer das Versprechen der Antwort- oder ›Resonanzfähigkeit‹ der kollektiven Strukturen und Voraussetzungen unseres Lebens birgt, und andererseits, individuell, durch den Entwurf einer veränderten Konzeption gelingenden Lebens. Lebensqualität, so versuche ich im zehnten und letzten Beitrag zu zeigen, hängt nicht vom erreichten oder erreichbaren materiellen Wohlstand und auch nicht von der Summe an Lebensoptionen ab – sondern von der Möglichkeit zu und vom Reichtum an Resonanzerfahrungen. Bei diesem Beitrag handelt es sich um meine bisher unveröffentlichte Jenaer Antrittsvorlesung aus dem Jahre 2006. Sie enthält, wenngleich in überaus holzschnittartiger, vorläufiger und tastender Form, wesentliche Kernelemente einer Soziologie der Weltbeziehung, wie ich sie in meiner nächsten Monographie systematisch entwerfen möchte.
17I. Konzeptuelle Grundlegungen
191. Lebensformen vergleichen und verstehen
Eine Theorie der dimensionalen Kommensurabilität von Kontexten und Kulturen
I.
Was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir sagen können, wir hätten in Kontexten der Verständigung einen anderen Menschen, eine andere Kultur, eine differente Weise des (wissenschaftlichen, moralischen oder ästhetischen) Denkens und Handelns verstanden und seien daher in der Lage, ein vergleichendes Urteil über unsere eigene und die fremde Situation, Denkungsart oder Handlungsweise zu fällen? Was könnte den kategorialen Boden für ein solches Urteil bilden? In welchen Fällen stellt die Aufgabe eines derartigen Verstehens und Vergleichens eine ernsthafte Herausforderung dar, und unter welchen Bedingungen vollzieht sie sich nahezu ›von selbst‹?
Solche Fragen sind traditionelle Kernfragen der philosophischen Hermeneutik. Ich möchte im Folgenden im Anschluss an Überlegungen des Wissenschaftstheoretikers Thomas S. Kuhn und des kanadischen Sozialphilosophen Charles Taylor ein Modell der dimensionalen Kommensurabilität von Verstehenshorizonten vorschlagen, das vielleicht ein wenig Licht in das nach wie vor recht undurchdringliche Halbdunkel jenes Problemzusammenhangs zu bringen vermag.
Eine fundamentale Schwierigkeit im Hinblick auf die menschliche ›Grundoperation‹ des Verstehens – gleichgültig, ob es sich auf Kulturen oder Lebensformen, auf Formen der Moral, ästhetische Stilrichtungen oder sogar auf Wissenschaftsauffassungen richtet – besteht zweifellos darin, dass sie sich stets auf dem Boden eines holistischen Geflechts von Auffassungen, Begriffen, Überzeugungen, Bewertungen, Annahmen und Fragestellungen vollzieht. Jeder auf diese Weise gebildete Verstehenshorizont scheint einerseits zwar ›universalistisch‹ insofern zu sein, als er den gesamten zur Disposition stehenden Phänomenbereich abdeckt, sieht sich andererseits aber anderen, ebenso holistischen Verstehenshorizonten gegenüber, welche denselben Phänomenbereich mit Hilfe anderer Auffassungen, Begriffe, Überzeugungen, Fragestellungen und Handlungsweisen 20erfassen, die sich gegenüber den eigenen insofern als inkommensurabel erweisen, als es keinen neutralen Standpunkt gibt, von dem aus die jeweiligen Vor- und Nachteile abgewogen werden können oder bei abweichenden Phänomenbeurteilungen oder inkompatiblen Handlungsweisen über richtig und falsch entschieden werden könnte. Mit der Inkommensurabilität von Verstehenshorizonten ist dabei nicht einfach deren Inkompatibilität gemeint, wie häufig fälschlich angenommen wird.8 Die Aussagen »Das Spiel beginnt um 18 Uhr« und »Das Spiel beginnt um 20 Uhr« sind inkompatibel, aber nicht inkommensurabel. Inkommensurabilität sollte daher definiert werden als das Verhältnis zweier Systeme, deren Begriffe oder Bedeutungseinheiten sich nicht adäquat, das heißt nach den Vorgaben der logischen Einschließung, Ausschließung und Überschneidung, ineinander übersetzen lassen, so dass sich das im einen System Intendierte nicht restlos in der vorgegebenen Begriffs- und Bedeutungsmatrix des anderen Systems darstellen lässt. Sie kann dann natürlich (und wird es häufig) Inkompatibilität implizieren, wenn es eine Hinsicht oder eine Reihe von Konsequenzen aus diesen Systemen, Perspektiven oder Horizonten gibt, derentwegen sich nicht beide zugleich einnehmen oder vertreten lassen. Besteht eine solche Art von Inkommensurabilität zwischen zwei Systemen (Lebensformen, Kulturen, Theorien), ohne dass sich eine absolute Entscheidung zugunsten des einen oder anderen begründen lässt, so rechtfertigt dies nach Bernard Williams9 die Verwendung des Begriffs Relativismus.
Die Abwesenheit einer neutralen Metasprache oder eines Standpunktes, von dem aus sich unterschiedliche Verstehenshorizonte vergleichen oder überblicken ließen, und die daraus resultierende ›Partikularität‹ alles Verstehens begründet im Anschluss an Wittgenstein, Gombrich und Kuhn die These von der ›Priorität des Paradigmas‹, sie liegt auch Hans-Georg Gadamers Einsicht in die (universale) Rolle der ›Vorurteile‹ als nahezu transzendentale Bedingung des Verstehens zugrunde.10 Alles Verstehen ist demnach unauf21hebbar kontextgebunden, weil es Fragen generierende Vorstrukturen voraussetzt, welche »die Blickbahnen des Verstehens im Voraus bestimmen«.11
Das Kernproblem, mit dem ich mich im Folgenden befassen möchte, wird deshalb nicht sein, wie Verstehen überhaupt, das heißt vom festen Boden eines bestimmten Paradigmas oder Verstehenshorizontes aus, möglich ist, sondern wie sich das Verstehen und a fortiori die Verständigung zwischen unterschiedlichen Paradigmen oder Horizonten vollziehen könnte.
Zunächst liegt hier natürlich die Vermutung nahe, dass es die Phänomene oder die Fakten des in Frage stehenden Phänomenbereiches selbst sind, welche die Vermittlung zwischen konkurrierenden Paradigmen oder Verstehenshorizonten leiten und Inkommensurabilitäten zumindest dort, wo sie zu Inkompatibilitäten führen, auflösen können. Während es offensichtlich ist, dass ein solches vergleichendes Verfahren im Hinblick auf die Gegenüberstellung von Moralsystemen, ästhetischen Auffassungen oder Kultur- und Lebensformen auf große Schwierigkeiten stößt, vor allem hinsichtlich der Bestimmung der relevanten Fakten, scheint diese Annahme insbesondere im Bereich der klassischen Methodologie der Naturwissenschaften plausibel zu sein, die ja auf der Überzeugung beruht, dass die Falsifizierbarkeit von Hypothesen im Experiment eine unvoreingenommene Entscheidung zwischen konkurrierenden Forschungsprogrammen ermöglicht. Daher ist es von besonderem Interesse, dass eine Wissenschaftstheorie wie diejenige des Physikers Thomas S. Kuhn12 eine entscheidende Wende in der postempiristischen Wissenschaftstheorie insofern einleitete, als sie auch und gerade für die Naturwissenschaften die Priorität des Paradigmas nachzuweisen versuchte. Ich möchte nun im Folgenden zunächst anhand einer Rekonstruktion des Kuhnschen Paradigmenbegriffs die kategorialen Strukturen holistischer Verstehenshorizonte gleichsam exemplarisch am Beispiel der Wissenschaft herausarbeiten, um daran anschließend und in Anknüpfung an Überlegungen Charles Taylors gewissermaßen eine Ebene tiefer 22zu steigen und nach der Struktur der konstitutiven Verstehenshorizonte von Kulturen oder Lebensformen zu fragen. Von dort ausgehend werde ich dann mein Modell dimensionaler Kommensurabilität entwickeln, um die Möglichkeit und die Voraussetzungen interkontextuellen und interkulturellen Verstehens und Sich-Verständigens auf dem Wege einer Horizontverschmelzung zu erkunden. Abschließend möchte ich einige Überlegungen dazu anstellen, wieso eine so begründete Arbeit an den Grenzen des je eigenen Horizontes für moderne westliche Gesellschaften möglicherweise eine Aufgabe von höchster Dringlichkeit darstellt.
II.
Der Grundgedanke von Kuhns Struktur wissenschaftlicher Revolutionen besteht darin, dass eine wissenschaftliche Gemeinschaft konstituiert und geleitet wird durch den Besitz eines gemeinsamen Paradigmas. Solche Paradigmen haben dabei sowohl eine kognitive als auch eine normativ-soziale Funktion. Aus diesem Grunde sind sie mehr als einfach nur Begriffssysteme.13
Paradigmen strukturieren und, wie Kuhn in einer eigenen Wahrnehmungstheorie zu zeigen versucht, programmieren in gewissem Sinne sogar unsere Erfahrungen. Sie selbst bleiben daher der (zumindest direkten) empirischen Überprüfung entzogen, während das mit einem Paradigma Verglichene durch den Vergleich verifiziert oder falsifiziert wird. In kognitiver Hinsicht kann ein Paradigma als »System von Überzeugungen ontologischer, erkenntnistheoretischer und methodologischer Natur verstanden werden, durch das die generellen Ziele, Möglichkeiten und legitimen Vorgehensweisen wissenschaftlichen Arbeitens festgelegt werden«.14 Ein Paradigma definiert und generiert also die wissenschaftlich zu 23bearbeitenden und relevanten Fragen und bestimmt das, was als zulässiger Lösungsweg gelten kann, sowie das Spektrum möglicher Antworten auf Forschungsfragen. Implizit enthalten sind dabei auch ontologische Annahmen über den Aufbau der Welt und die in ihr vorhandenen Einheiten sowie eine Konzeption dessen, was ›wichtig ist‹ oder ›worauf es ankommt‹ in dieser Welt. Entscheidend ist dabei allerdings, dass Paradigmen nicht über formallogische und theoretische Regeln, Systeme und Entwürfe konstruiert werden, sondern zunächst immer von konkreten wissenschaftlichen Lösungen, das heißt einzelnen paradigmatischen Musterbeispielen (exemplars)15 ausgehen. Methodologien und metaphysische Annahmen werden aus solchen in der wissenschaftlichen Praxis entwickelten Musterlösungen abgeleitet oder sind implizit in ihnen enthalten oder mit ihnen verknüpft; sie werden aber nur in Krisenzeiten, in denen sich eine Disziplin ihrer Grundlagen unsicher geworden ist, explizit formuliert und theoretisch reflektiert.
In der Terminologie Kuhns lassen sich somit drei Abstraktionsebenen des Begriffs unterscheiden. Die konkreteste Verwendung von Paradigma begegnet, wie dargelegt, in der Bedeutung von ›Musterbeispiel‹ (exemplar), modellbildender Einzellösung. Für die mittlere Abstraktionsebene hat Kuhn in seinen späteren Arbeiten den Begriff der wissenschaftlichen oder disziplinären Matrix vorgeschlagen.16 Diese Matrix umfasst die genannten Musterbeispiele, also die ›untere‹ Ebene, aber auch symbolische Verallgemeinerungen, heuristische und ontologische Modelle, welche den Wissenschaftlern bevorzugte Analogien und Metaphern liefern, sowie die maßgebenden normativen Orientierungen, die verbindliche Urteile darüber erlauben, was als wissenschaftliche Fragestellung und Lösungsmethode zulässig und relevant ist. Sie liefert somit die Methodologie und das Instrumentarium für den geordneten Forschungsgang der ›normalen Wissenschaft‹, wie sie vor allem über die Lehrbücher vermittelt werden. Der Ausdruck ›disziplinär‹, den Kuhn einführt, weil die Matrix »der gemeinsame Besitz der Ver24treter einer Fachdisziplin ist« und durch ›Gruppenfestlegungen‹ bestimmt wird,17 weist dabei natürlich schon auf die soziale Dimension von Paradigmen hin. Auf der höchsten Abstraktionsebene, aber eben erst dort und nicht von vornherein und ausschließlich, besitzen Paradigmen einen metaphysischen Charakter; sie sind hier Weltanschauungen oder Weltbilder. Dies besagt, dass jedes Paradigma mit einer ganz bestimmten »Art und Weise, die Welt zu sehen und die Wissenschaft in ihr auszuüben«, verknüpft ist. Denn jede Wissenschaft muss, bevor sie tätig werden kann, gewisse Grundannahmen machen hinsichtlich Fragen wie: »Welches sind die Grundbausteine des Universums? Wie wirken sie aufeinander und auf die Sinne ein? Welche Fragen können sinnvoll über diese Bausteine gestellt […] werden?« Daher gründet normale Wissenschaft zwangsläufig »auf der Annahme, daß die wissenschaftliche Gemeinschaft weiß, wie die Welt beschaffen ist«.18 Wie bereits bemerkt, geht Kuhn hierbei davon aus, dass solche Paradigmen sogar unsere Wahrnehmungsprozesse zu steuern vermögen. Dies erklärt die ›Priorität des Paradigmas‹ vor aller wissenschaftlichen Beobachtung und Überlegung. Die genannten drei Abstraktionsstufen stehen dabei natürlich in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis: Veränderungen auf der einen Ebene können – oder müssen in manchen Fällen sogar – auch Veränderungen auf den anderen Ebenen nach sich ziehen. Modifikationen des Weltbildes können so zu einer Anpassung der disziplinären Matrix und eventuell zu einer Neubestimmung kanonischer Musterlösungen führen, während bahnbrechende Einzellösungen umgekehrt Rückwirkungen auf die Methodologie einer Disziplin und eventuell auch auf das in ihr angelegte oder aus ihr hervorgehende Weltbild haben können. In der Regel setzen jedoch nach Kuhns Modell der Wissenschaftsentwicklung Veränderungen an den konkreteren Ebenen ein und wirken dann zu den abstrakteren fort.
Weil es nun aber (synchron und diachron) unterschiedliche forschungsleitende Paradigmen gibt und weil diese Paradigmen nicht nach einem formallogischen Algorithmus miteinander verglichen und bewertet werden können, so dass es keine eindeutigen Verfahren gibt, mit deren Hilfe man die Überlegenheit eines Paradigmas gegenüber einem anderen beweisen könnte, ist die soziale Dimension 25von Paradigmen neben der kognitiven von entscheidender Bedeutung. Da jedes Paradigma seine eigene Sprache, seine eigenen Rätsel, Lösungswege und Rationalitätsstandards produziert – nicht zufällig hielt Kuhn zeitlebens an der Idee fest, dass diejenigen, die unterschiedlichen Paradigmen folgen, in ›verschiedenen Welten‹ leben19 –, kommt es beim Versuch transparadigmatischer Verständigung zu massiven Kommunikationsstörungen. Die Begriffe verschiedener wissenschaftlicher Gemeinschaften sind genuin inkommensurabel in dem oben dargelegten Sinne,20 weil Theorien, Daten und Sprache in einem komplexen Interdependenzverhältnis stehen: Paradigmen treffen nicht nur eine unterschiedliche Auswahl und Gewichtung der jeweils für relevant erachteten Fakten, sondern sie konstituieren diese Daten (wenigstens zum Teil) erst, indem sie die Wechselwirkung zwischen Stimulus und Empfindung (mit-)bestimmen.
In einem noch unbekannten Ausmaß ist die Herstellung von Daten aus Stimuli ein erlernter Vorgang. Nach dem Lernen ruft der gleiche Stimulus ein anderes Datum hervor. Ich komme zu dem Ergebnis, daß Daten zwar die Minimalelemente unserer individuellen Erfahrung sind, aber gemeinsame Reaktionen auf einen gegebenen Stimulus nur bei Mitgliedern einer verhältnismäßig einheitlichen Gemeinschaft: einer Ausbildungs-, einer wissenschaftlichen oder einer Sprachgemeinschaft [sic!].21
Wie beim Phänomen des Gestaltwechsels von Vexierbildern, bei denen der Betrachter etwa einmal eine Vase und dann, ohne Übergang, plötzlich zwei Gesichter sieht, so verändert sich daher auch die Welt des Wissenschaftlers nach einem Paradigmenwechsel.
26Der Übergang von einem Paradigma zu einem anderen enthält deshalb nach Kuhn – und dies hat entscheidend zu seiner kontroversen Popularität beigetragen – auch in den vermeintlich so harten Naturwissenschaften ein psychologisches und soziales Moment der ›Bekehrung‹. Im normalen Fortgang der Wissenschaft sichert eine paradigmengeleitete Scientific Community rigoros eine einheitliche Sozialisierung, wissenschaftliche Orientierung und interne Strukturierung und lässt Abweichungen nicht zu. Mit anderen Worten, sie sorgt dafür, dass ihre Mitglieder nicht die falschen Fragen stellen oder falsche Methoden verfolgen. Wissenschaftliche Revolutionen, die dann eintreten können, wenn eine Disziplin in eine Krise geraten ist, in der ihre Standards in Frage gestellt werden, sind daher stets eine Folge gruppendynamischer (sozialpsychologischer) Prozesse, wobei Kuhn wissenschaftliche Rationalität nicht normativ-absolut, sondern jeweils soziologisch bestimmt sieht: »Wissenschaftliche Kenntnisse sind wie die Sprache das Gemeineigentum einer Gruppe, oder es gibt sie nicht«, lautet eine seiner zentralen Einsichten.22
In späteren Arbeiten hob Kuhn zunehmend die konstitutive Rolle der Sprache für die paradigmengeleitete Tätigkeit einer wissenschaftlichen Gemeinschaft, die er als Diskursgemeinschaft begriff, hervor. Paradigmen können daher als ›Begriffsnetze‹ verstanden werden, welche die Welt auf je spezifische Weise konzeptualisieren. Solche Begriffsnetze – und damit die Bedeutung einzelner Begriffe – sind dabei nicht nach formallogischen Ein- und Ausschlusskriterien bestimmt, sondern über Ähnlichkeitsrelationen (auch hierin folgt Kuhn Wittgenstein). Die Gesamtheit solcher Ähnlichkeitsrelationen bezeichnete der späte Kuhn als ›Lexikonstruktur‹, in der unser Wissen ›über die Welt‹ enthalten ist, so dass diesem konzeptuellen Lexikon auch eine weltkonstituierende Rolle zukommt.23 Dies verdeutlicht noch einmal, inwiefern konkurrierende Paradigmen inkommensurabel, das heißt nicht ineinander übersetzbar oder aufeinander rückführbar sind und wieso der For27scher nach einem Paradigmenwechsel in einer ›anderen Welt‹ lebt. Denn eine Übersetzbarkeit im strengen Sinne erfordert, dass für jeden Begriff der Quellsprache ohne intensionale oder extensionale Bedeutungsverschiebung ein Begriff in der Zielsprache gefunden werden kann. Rivalisierende Paradigmen besitzen aber unterschiedliche Lexikonstrukturen, weshalb für einen Vergleich genuin hermeneutische Erkenntnisleistungen24 erforderlich sind, da die Bedeutung eines einzelnen Begriffs erst durch das Erfassen der (lexikalischen) Gesamtstruktur erkannt werden kann und vice versa. Inkommensurabilität meint damit also auch nicht Unvergleichbarkeit per se, sondern lediglich die Unmöglichkeit eines Vergleichs unter formallogischen Gesichtspunkten. In diesem letzteren Sinne wird eine Wahl zwischen konkurrierenden Paradigmen zu einer politischen Entscheidung, deren höchste Norm »die Billigung durch die jeweilige Gemeinschaft«25 ist.
Unabhängig davon, ob sich diese Konzeption bezüglich ihrer Theorie des Wechsels von normaler und revolutionärer Wissenschaft für die Naturwissenschaften tatsächlich erhärten lässt, haben die zahlreichen Versuche, sie auf die Sozial- und Kulturwissenschaften zu übertragen, nach meiner Einschätzung zu einem erstaunlichen Ergebnis geführt.26 Zunächst einmal fällt auf, dass es in diesen Wissenschaften keine geschlossenen Scientific Communities mit rigider Sozialstruktur im Sinne Kuhns, sondern konkurrierende Schulen gibt, deren Gegenstände nicht als eindeutig lösbare ›Rätsel‹ aufgefasst werden können, weshalb es in der Regel auch kaum eindeutige Modelllösungen gibt. Vor allem aber sind die sozialwissenschaftlichen Forschergemeinschaften nicht autonom gegenüber der Gesamtgesellschaft, von der in der Regel die Wahrnehmung von (mit den vertrauten Methoden nicht zu bearbeitenden) Anomalien ausgeht und deren Veränderungen vor allem den Forschungsgegenstand der Ersteren verändern. Die Forschergemeinschaft und die untersuchte Gemeinschaft stehen in den Sozialwissenschaften in einem doppelt-reflexiven Wechselverhältnis: Nicht nur verän28dern gesellschaftliche Wandlungen den Untersuchungsgegenstand der Sozialwissenschaften und haben maßgeblichen Einfluss auf deren Lexikonstruktur, sondern Erkenntnisse und Begriffsneudefinitionen der Letzteren haben mitunter auch Rückwirkungen auf Erstere. Sozialwissenschaftliche Theoriebildung und soziale Praxis stehen somit in einem unauflöslichen Wechselbezug, in dem Theorien selbst konstitutiver Bestandteil der kulturellen Wirklichkeit sind, und es ist dieser Aspekt, der uns im Folgenden beschäftigen soll. Denn während es wenig Sinn hat, sozialwissenschaftliche Forschergemeinschaften als solche als autonome, paradigmengeleitete Gemeinschaften im strengen Kuhnschen Verstande zu betrachten, gewinnt Kuhns Entwurf dann wieder entscheidende Relevanz und Erklärungskraft, wenn die soziale oder kulturelle Gemeinschaft selbst als paradigmengeleitet und die soziale Wirklichkeit als paradigmenkonstituiert verstanden wird. Er kann dann entscheidend dazu beitragen, die ›Priorität des Paradigmas‹ im Hinblick auf die soziale Wirklichkeit von Kulturen und Lebensformen zu verstehen und damit die ›ontologische Dimension‹ von Verstehenshorizonten auszuloten.
III.
Die Idee, dass nicht nur die Entwicklung wissenschaftlicher, sondern auch diejenige sozialer, kultureller oder politischer Gemeinschaften mit Hilfe des Paradigmenkonzeptes zu untersuchen sein könnte, wird von Kuhn selbst nahegelegt, wenn er nicht nur den Revolutions- und Krisenbegriff in expliziter Analogie zu politischen Umwälzungen bestimmt, sondern (wiederum in Anlehnung an Wittgenstein) den Paradigmenwechsel auch als Übergang zwischen unvereinbaren Lebensweisen der Gemeinschaft27 beschreibt und darüber hinaus hinzufügt, dass seine Theorie der Entwicklung von Gemeinschaften keineswegs neu sei, sondern in anderen Bereichen – etwa der politischen Geschichtsschreibung – längst Anwendung finde.28 Sein Buch über die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen schließt
29mit der Unterstreichung der Notwendigkeit ähnlicher, vor allem vergleichender Studien der entsprechenden Gemeinschaften auf anderen Gebieten. Wie wählt man, und wie wird man zum Mitglied einer bestimmten wissenschaftlichen oder nichtwissenschaftlichen Gemeinschaft gewählt? Worin bestehen der Prozeß und die Stadien der Sozialisation in der Gruppe? Was sieht die Gruppe kollektiv als ihre Ziele an? Und wie wird sie mit unzulässigen Abweichungen fertig?29
In der Tat scheint es schon auf den ersten Blick in politischen und kulturellen Gemeinschaften alle diejenigen Elemente zu geben, die fehlen, wenn man die Entwicklung der Sozialwissenschaften isoliert betrachtet: Es gibt kürzere Phasen revolutionärer Umwälzungen und längere Phasen regelgeleiteter, stetiger gesellschaftlicher Entwicklung; es gibt eine mehr oder weniger rigide Sozialstruktur und wertevermittelnde, konsensschaffende Sozialisationsprozesse, und es gibt institutionalisierte Entscheidungsmechanismen, welche gesellschaftliche Konflikte (heute etwa Verteilungskonflikte) auf eine Weise lösen, die an Kuhns ›rätsellösende Tätigkeit‹ erinnert. Mehr noch, Krisen des sozialen und politischen Systems werden durch Entwicklungen ausgelöst, die, wie Kuhn selbst explizit festhält, dem Auftreten wissenschaftlicher Anomalien vergleichbar sind:30
Politische Revolutionen werden durch ein wachsendes […] Gefühl eingeleitet, daß die existierenden Institutionen aufgehört haben, den Problemen, die eine teilweise von ihnen selbst geschaffene Umwelt stellt, gerecht zu werden. Ganz ähnlich werden die wissenschaftlichen Revolutionen durch ein wachsendes Gefühl […] eingeleitet, daß ein existierendes Paradigma aufgehört hat, bei der Erforschung eines Aspektes der Natur, zu welchem das Paradigma selbst den Weg gewiesen hatte, in adäquater Weise zu funktionieren.
Wenngleich es in der Diskussion um Kuhn nur einige wenige und begrenzte Versuche gegeben hat, das Paradigmenkonzept auf solche Weise auf die Gesellschaft als Ganzes, das heißt auf die kulturelle, soziale und politische Realanalyse hin, auszudehnen,31 blieben die 30Möglichkeiten, die sich daraus für die Erforschung der Entwicklung kultureller Gemeinschaften und der Konstruktion sozialer Wirklichkeit ergeben, bisher weitestgehend ungenutzt.32
31Von entscheidender Bedeutung ist nun, dass auch die für Kuhn so zentrale soziale Dimension eines Paradigmas, die sich in der Organisation und Struktur einer (wissenschaftlichen) Gemeinschaft niederschlägt, nahtlos auf die kulturelle Gemeinschaft übertragen werden kann. Tatsächlich scheint Kuhns Beschreibung der Scientific Community sogar eher der politisch-sozialen oder kulturellen als der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu entstammen: Die Gemeinschaft sichert rigoros die Einhaltung und Akzeptanz der vom Paradigma vorgegebenen Werte und Autoritätsstrukturen, sie bestraft abweichendes Verhalten, ignoriert außerhalb des Paradigmas liegende Sachverhalte, bestimmt legitime und illegitime Handlungsweisen und vermittelt durch strikte Sozialisations- und Erziehungsmuster das dem Paradigma angemessene Weltbild, ja sichert sogar eine bestimmte Wahrnehmungsweise der Welt.33
Politische oder im weiteren Sinne kulturelle Paradigmen legen also fest, was wichtig ist in der Welt, was zählt, worauf es ankommt, welche Entitäten und zwischen ihnen auftretende Probleme es gibt und wie diese zu lösen sind. Zur genaueren Bestimmung von Natur, Funktion und Status solcher ›operativer‹ kultureller Paradigmen ist es nun aber ausgesprochen aufschlussreich, auf die Arbeiten von Charles Taylor zurückzugreifen. Für ihn stellen gesellschaftliche Paradigmen zuerst und vor allem bestimmte Weisen der Selbstinterpretation dar, weshalb er – wenngleich er die Thesen Kuhns kennt34 – in der Regel den Begriff der Selbstinterpretation dem des Paradigmas vorzieht. Menschen sind für Taylor unhintergehbar definiert dadurch, dass sie ›selbstinterpretierende Tiere‹ sind, deren Selbstinterpretationen indessen nicht monologisch erzeugt werden, sondern das Ergebnis intersubjektiv-kultureller Sozialisationsprozesse darstellen, die Individualität vor dem Hintergrund je kulturell verbindlicher intersubjektiver und gemeinsamer Bedeutungen ermög32lichen. Solche Selbstinterpretationen sind jedoch – ähnlich wie die Kuhnschen Paradigmen – durchaus nicht in erster Linie das Ergebnis reflexiv-expliziter oder theoretischer Überlegungen, sondern sie sind »embedded in a stream of action«.35 Sie bestehen ebenfalls auf drei unterschiedlichen, interdependenten Ebenen wachsender Reflexivität, deren primäre die in konkreten Praktiken und Handlungsweisen (die Parallele zu Kuhns konkreten Einzellösungen ist nicht zu übersehen) implizit enthaltene oder ›materialisierte‹ Selbstinterpretation ist.
Unterhalb der Ebene der Doktrinen gibt es mindestens zwei weitere: diejenige eines verkörperten Hintergrundverständnisses und eine symbolische Ebene, auf der das zum Ausdruck kommt, was aus dem verkörperten Habitus heraus erwächst. Neben dem doktrinären, expliziten Verständnis der Gesellschaft gibt es also das Verständnis, das im Habitus verkörpert ist, und eine Ebene von Bildern, die noch nicht in explizite Doktrinen übersetzt wurde. Für diese könnten wir einen Begriff borgen, der von zeitgenössischen französischen Autoren benutzt wird, den des »imaginaire social«.36
Selbstinterpretationen, die wie Kuhnsche Paradigmen intersubjektiv erzeugt und verankert sind, sind nun allerdings nicht als ex-post-Deutungen von etwas unabhängig von ihnen Vorgegebenem (etwa einer sozialen Wirklichkeit) zu verstehen, sondern haben einen konstitutiven Charakter. Personale Identitäten und soziale Wirklichkeiten werden in und durch Selbstinterpretationen erzeugt, deren grundlegendes Element jeweils in einer bestimmten ›Lexikonstruktur‹ liegt, die – wie wir bereits gesehen haben – soziale Praktiken und soziale ›Welt‹ nicht nur konzeptualisiert, sondern (mit)konstituiert. Selbstinterpretation gewinnt dadurch bei Taylor (der hier in der Tradition Heideggers steht) einen ›ontologischen‹ Charakter. Unterschiedliche Selbstinterpretationen sind daher unauflöslich verknüpft mit unterschiedlichen Lebensformen oder Lebensweisen in Wittgensteins Sinne. Es sind solche ›Gesellschaftsparadigmen‹, die uns die Möglichkeiten unseres Denkens, Redens, Handelns und Seins vorgeben. Der Übergang von einer sozialkonstitutiven Selbstinterpretation zu einer anderen stellt wie 33ein Wechsel von einem wissenschaftlichen Paradigma zu einem anderen den Übertritt in eine andere Welt dar, in der eine andere Sprache, andere Selbstkonzepte, Wertmuster, soziale Praktiken etc. existieren. Mehr noch, ein Mensch, der einen solchen Paradigmenwechsel vollzieht – sofern er es denn kann –, wird dadurch selbst ein anderer, weil die kulturelle Selbstinterpretation (das operative Paradigma) seine Identitäts- und Handlungsmöglichkeiten prädefiniert.
Wenn wir über einen Menschen nachdenken, dann sehen wir ihn nicht einfach als lebenden Organismus an, sondern als ein Wesen, das denken, fühlen, entscheiden kann und fähig ist, berührt zu werden, zu antworten, Beziehungen zu anderen aufzunehmen. All dies setzt aber eine Sprache voraus, ein verknüpftes System von Formen der Welterfahrung, der Interpretation eigener Gefühle, der Deutung sozialer Beziehungen sowie der Beziehung zur Vergangenheit, zur Zukunft, zum Absoluten etc. Es ist also eine spezifische Weise, sich in einer solchen kulturellen Welt zu platzieren, was wir die Identität eines Menschen nennen.37
Die entscheidende Leistung solcher sozial- und identitätskonstitutiver Selbstinterpretationen besteht für Taylor nun darin, dass sie den Subjekten neben einer kognitiv-kategorialen Struktur zur Erfassung der Wirklichkeit eine Art ›moralischer Landkarte‹ an die Hand geben, mit deren Hilfe sie im Sinne ›starker Wertungen‹ das Wichtige vom Unwichtigen, das Richtige vom Falschen, das Schöne vom Hässlichen etc. unterscheiden, sich also in der Welt orientieren und daher für ihr Leben und Handeln die relevanten, richtungsweisenden Fragen stellen lernen. Die Kategorie der Selbstinterpretation gewinnt daher in dem Moment an Gestalt, in dem sie durch die Idee der starken Wertung als der (neben der Selbstinterpretation) zweiten Fundamentalkategorie der Taylorschen Philosophie ergänzt wird. Die durch solche Wertungen gebildeten ›moralischen Landkarten‹ stellen substantielle ethische Konzeptionen (›Rahmen‹) dar, die einen sinnstiftenden und damit Verstehen ermöglichenden ontologischen Entwurf dessen, worauf es ankommt, was wichtig ist, beinhalten. Unabhängig von solchen festen Rahmen sind stabile Identitäten, planvolles menschliches Handeln und natürlich auch jegliche Verstehensleistungen undenkbar.38
34Das Gewebe von Bedeutungen, welches eine Kultur definiert, kann damit als ›operatives Paradigma‹ verstanden werden, dessen primärer Ort die Sprache ist, welche jenes kontrastive (und normative) Feld an Bedeutungen und Begriffen aufspannt, das den sozialen Praktiken ihren Sinn und ihre Gestalt verleiht. Doch eine Sprache kann ebenso wenig unabhängig von einer konkreten sozialen Wirklichkeit existieren, wie diese ohne die sie konstituierenden Begriffe auskommt. Sprache und Lebensform bleiben im Sinne Wittgensteins untrennbar aufeinander verwiesen.
Taylors Analyse ermöglicht uns somit ein Verständnis davon, wie ein ›operatives Paradigma‹ wirkmächtig und realitätskonstituierend wird nicht nur und nicht in erster Linie dadurch, dass es unmittelbaren Zwang auf die Ausbildung von individuellen Identitäten, Überzeugungen und Handlungsweisen ausübt, sondern vor allem dadurch, dass es – als »tacit knowledge« (Polanyi) – deren unhintergehbaren Rahmen darstellt und deren Möglichkeitsraum definiert. Das operative Gesellschaftsparadigma leitet die individuelle Selbstinterpretation, ermöglicht (kommensurablen) Dissens und Cleavages zwischen den Mitgliedern einer Gemeinschaft und schafft die Formen zur Lösung korrespondierender Konflikte. Indem es in den gesellschaftlichen Praktiken, Institutionen und Sprachen ›verkörpert‹ ist, stellt es eine sozial konstruierte, aber unhintergehbare ›historische Tatsache‹ im Sinne Webers dar. Gewinnt man auf diese Weise also mit Hilfe Taylors ein tieferes Verständnis der Natur und Funktionsweise eines ›operativen Paradigmas‹, lassen sich umgekehrt aus den Arbeiten Kuhns und aus der daran anschließenden Diskussion entscheidende Hinweise für die Behandlung zentraler Fragenkomplexe entnehmen, wie ich sie eingangs formuliert habe und wie sie sich auch im Anschluss an Taylor ergeben.
Dazu ist es hilfreich, sich zunächst noch einmal die grundlegenden Parallelen zwischen beiden Ansätzen zu vergegenwärtigen. Beide gehen von einer ›Priorität des Paradigmas‹ aus, das heißt, für Kuhn wie für Taylor sind Paradigmen welt- und erfahrungskonstituierend und dürfen deshalb nicht einfach als unterschiedliche 35Weisen, eine vorgegebene Welt oder Erfahrung zu interpretieren, verstanden werden.39 Diese Vorrangigkeit des Paradigmas oder auch der Lexikonstruktur begründet, warum es keinen Metastandpunkt und keine Metasprache zur Beschreibung von Natur oder Wirklichkeit geben kann. Nach einer wissenschaftlichen oder kulturellen Revolution lebt der Wissenschaftler bzw. der Kulturmensch in einer anderen, und zwar inkommensurabel anderen, Welt. Sowohl nach Kuhn als auch nach Taylor sind solche Paradigmen als umfassend holistische Gebilde zu verstehen, die aus einem ineinandergreifenden Netz von Begriffen, Sprachen, Wahrnehmungsweisen, Praktiken und Institutionen bestehen. Daraus ergeben sich aber unmittelbar drei schwerwiegende, miteinander verknüpfte theoretische Probleme, zu denen im nächsten Abschnitt skizzenhaft eine Antwort versucht werden soll:
(1) Wenn alles menschliche Denken, Handeln und Sprechen stets kontextuiert in dem Sinne ist, dass es vom Boden eines präexistenten Paradigmas aus erfolgt, wie ist es dann möglich, die Intentionen, Bedeutungen oder Wertungen eines anderen Paradigmas zu verstehen?
(2) Wie (wenn überhaupt) lassen sich unterschiedliche, ›inkommensurable‹ Paradigmen hinsichtlich ihrer kognitiven oder auch normativen Leistung vergleichen? Es ist bereits deutlich geworden, dass ein Rekurs auf eine vorparadigmatische Realität dabei deshalb nicht möglich ist, weil wir auf eine solche Wirklichkeit keinen Zugriff haben. Paradigmen erzeugen Wirklichkeit in dem Sinne, dass das Reale »das ist, womit man fertigwerden muß«, was sich nicht einfach dezisionistisch oder voluntaristisch zum Verschwinden bringen lässt.40 Diese Art des Realismus ist natürlich kompatibel mit der für die Hermeneutik grundlegenden Annahme, dass verschiedene 36Sprachen und Lebensformen eine Pluralität von Wirklichkeiten hervorbringen, die wechselseitig inkommensurabel sein können.
(3) Gibt es angebbare Wege, die über das Verstehen hinaus eine genuine Verständigung (im Gegensatz zu einer spontanen ›Bekehrung‹) zwischen Vertretern differierender Paradigmen ermöglichen könnten? Als grundlegendes Problem muss hierbei natürlich gelten, dass die unhintergehbaren Wirklichkeiten bzw. die durch starke Wertungen ausgezeichneten Güter oder Handlungsweisen einer Lebensform in einer anderen Lebensform oft nicht einmal denkbare Optionen darstellen, weil ein korrespondierender Bedeutungshorizont und eine entsprechende Sprache dort nicht vorhanden sind.41
Es scheint dabei offensichtlich zu sein, dass solche Fragen umso schwerer wiegen, je umfassender die zur Diskussion stehenden paradigmatischen Verstehens- (und damit Selbstinterpretations-)Horizonte sind. Anhänger verschiedener wissenschaftlicher, moralischer, politischer oder ästhetischer Konzeptionen innerhalb eines bestimmten Kulturkreises stehen zwar vor dem Problem inkommensurabler ›Fachparadigmen‹, doch ist anzunehmen, dass sie von einer mehr oder minder weitreichenden Übereinstimmung im Hinblick auf ihre alltagsparadigmatischen Wahrnehmungen und Situationsdeutungen ausgehen können, welche ihnen als geteilte Grundlage für den Versuch wechselseitigen Verstehens und Sich-Verständigens dienen kann. Dies gilt unbeschadet des postulierten ›universalen‹ bzw. holistischen Charakters auch solcher ›Fachparadigmen‹, die sich gegen eine verlustlose Reduktion auf geteilte alltagsparadigmatische Verstehensweisen hartnäckig sperren und daher Operationen, wie sie im Folgenden vorwiegend am Beispiel interkulturellen Verstehens beschrieben werden, gleichfalls unverzichtbar machen.
37IV.
Die in den vorangehenden Abschnitten entwickelte These der Abhängigkeit alles menschlichen Verstehens von vorgängigen, wechselseitig inkommensurablen Paradigmen wirft unweigerlich das gravierende Problem des (je nach untersuchtem Phänomenbereich moralischen, ästhetischen, wissenschaftlichen oder kulturellen) Relativismus auf. Dieser gilt (vor allem in der Form des Kulturrelativismus) zumeist als verknüpft mit zwei unliebsamen Folgen, derentwegen etwa Charles Taylor – trotz seiner unübersehbar kulturalistischen Position – als radikaler Gegner des Relativismus auftritt und sich zu einem (nicht sehr klaren) Realismus bekennt. Interessanterweise scheinen seine Gründe weithin geteilt zu werden, wenn man bedenkt, dass selbst so offensichtliche ›Relativisten‹ wie Rorty, Winch, Foucault oder Kuhn42 diesen Begriff zur Kennzeichnung ihrer Position ablehnen. Der erste Grund besteht in der Befürchtung, die Zulassung des Relativismus müsse früher oder später zur Annahme eines nihilistischen, radikal-subjektivistischen oder projektionistischen Standpunktes führen.43 Auf diese Befürchtung kann ich hier nicht ausführlich eingehen, sie erweist sich aber, wie ich andernorts zu zeigen versucht habe, deshalb als nicht stichhaltig, weil die paradigmenkonstituierte Realität nichtsdestotrotz eine unhintergehbare und objektive (›materialisierte‹) Wirklichkeit darstellt, die verlässliche Maßstäbe für das ja stets situierte Leben und Handeln der Subjekte bietet und daher mit subjektivistischen, projektionistischen oder nihilistischen bzw. ›Anything-goes‹-Positionen nicht zu vereinbaren ist. Stellt die Suche nach einem neutralen oder universalistischen Metastandpunkt gewissermaßen den untauglichen Versuch einer Überbietung der Priorität des Paradigmas dar, so begehen die letztgenannten Positionen den umgekehrten Trugschluss einer Unterbietung des Paradigmas durch dessen Auflösung in subjektivistische Erkenntnisakte. Die intersubjektive Priorität 38des Paradigmas in allen Verstehens- und Interpretationsleistungen anzuerkennen bedeutet nicht, diese auf subjektivistische ›Willkürakte‹ zu reduzieren. Der zweite Grund beruht auf der Überzeugung oder Hoffnung, dass eine interkulturelle Begegnung und Verständigung sowie ein kritischer Dialog zwischen den Kulturen und Lebensformen reale Möglichkeiten sind, während der Relativismus kulturelle Grenzen als ›schicksalhafte Gegebenheiten‹ und unüberwindliche Hindernisse zu betrachten scheint, welche uns auf eine primitiv-ethnozentrische Perspektive (oder gar eine kulturimperialistische Position im Sinne Rortys) festnageln.44 Kulturrelativistische Positionen, so Taylors Sorge, machen uns in der interkulturellen Begegnung sprachlos und lassen die essentiellen Differenzen im Dunkel der Inartikuliertheit.
Die im Folgenden zu lösende Aufgabe soll es daher sein, einen Weg zur Versöhnung des (Kultur-)Relativismus mit der Möglichkeit interkultureller Verständigung aufzuzeigen. Ich möchte dazu im Anschluss an einige verstreute Überlegungen Taylors zur Frage transkulturellen Verstehens45 ein eigenständiges exemplarisches Modell entwickeln, mit dessen Hilfe fruchtbare Dialoge und ›lokale‹ ethische Urteile über Kultur- und Paradigmengrenzen hinweg möglich werden, ohne dass dabei auf kontexttranszendierende Maßstäbe oder gar universalistische Kriterien Bezug genommen werden muss.46
Natürlich besteht eine Möglichkeit des Herangehens an fremde Kulturen und Lebensformen stets darin, bei der Analyse ihrer Praktiken, Institutionen und Selbstverständnisse einfach von der eigenen kognitiv-moralischen Landkarte, vom je eigenen Verstehens- und Bedeutungshorizont auszugehen. Die unweigerliche Folge eines solchen Ansatzes ist es, dass diese Kulturen als höchst kritikwürdig erscheinen. Ihre Praktiken scheinen das Wesentliche an der Wirklichkeit, das, worauf es ankommt, stets zu verfehlen oder 39falsch aufzufassen, und, schlimmer noch, die sozialen Akteure in solchen Kulturen scheinen selbst die ›wahre‹ Bedeutung dessen, was sie tun, beständig misszuverstehen. Der Grund für Letzteres liegt darin, dass Paradigmen (in ihrer Funktion als kognitiv-moralische Landkarten) die Bedeutungsmuster festlegen und so den Zielpunkt und Wert der Praktiken, Institutionen und Ereignisse bestimmen und damit Handlungen erst intelligibel werden lassen.47 Dies besagt aber zugleich, dass die scheinbaren Rationalitätsdefizite und die Unterlegenheit anderer, insbesondere sogenannter ›primitiver‹ Kulturen nicht auf deren tatsächliche Minderwertigkeit, sondern auf abweichende Bedeutungshorizonte bzw. auf differente gesellschaftlich wirksame und realitätskonstituierende Paradigmen hinweisen. Wie die Diskussion in den voranstehenden Abschnitten deutlich gemacht hat, gibt es nach dem hier vertretenen Ansatz jedoch keinerlei kontexttranszendierende Maßstäbe, welche es erlauben würden, interkulturelle Differenzen aus einer ›akulturellen‹ oder neutralen Perspektive zu bewerten. Dies gilt natürlich insbesondere auch für genuin moralische Fragen. Akzeptiert man die Priorität des Paradigmas, dann sind auch die Maßstäbe der Gerechtigkeit kulturgebunden und können nicht den (gesamten) moralischen Horizont der Kultur, aus der sie stammen, selbst bewerten (wie etwa Amy Gutmann48 meint), sondern lediglich – gleichsam ›binnenparadigmatisch‹ – einzelne Praktiken und Institutionen auf ihre Übereinstimmung mit den grundlegenden moralischen Überzeugungen jener Kultur überprüfen. Sprache, Handlungsweisen und konstitutive Güter bilden gemeinsam eine Lebensform, welche personale Identitäten ebenso wie soziale Realitäten erst her40vorbringt und so gar keine erkennbare ›Außenseite‹ aufweist.49 Aus dieser Perspektive kann es nicht überraschen, dass auch zeitgenössische westliche Moralphilosophen immer wieder die ›Entdeckung‹ machen, dass gerade ihre Gerechtigkeitsauffassung (im Vergleich zu der anderer Kulturen) die einzige wirklich legitimierbare ist und ihre (das heißt die westlich-liberalen) Gesellschaften mehr oder weniger die einzigen sind, welche die Maßstäbe der Gerechtigkeit wenigstens ansatzweise verwirklichen. Alle anderen (›primitive‹, ›archaische‹, ›fundamentalistische‹, ›despotische‹) Kulturen scheinen die ›wahre‹ Natur des Menschen, des Diskurses, des sozialen Lebens (je nachdem, welches Element paradigmatisch ontologisiert wird) beständig misszuverstehen.
Der einzige Ausgangspunkt, der für einen interkulturellen Diskurs, welcher nicht derart in ethnozentrischen (Vor-)Urteilen gefangen bleiben will, bestehen bleibt, ist die in Taylors philosophischer Anthropologie formulierte Einsicht, dass die Angehörigen fremder Kulturen ebenso wie wir selbstinterpretierende und stark wertende Wesen sein müssen. Wir wissen, dass sie auf der Grundlage eines ›Verstehenshorizontes‹ operieren, der sich gegenüber dem unsrigen zwar in der Substanz, nicht aber in der elementaren Form als inkommensurabel erweisen mag. Dies wiederum impliziert, dass sie ebenso wie wir von einem kognitiven und moralischen Bedeutungshorizont aus argumentieren, von dem sie glauben, dass er ›ontologisch‹ fundiert sei, weil die Letztbestandteile eines Paradigmas immer mit der Zuschreibung einer ontologischen Fundierung einhergehen.50 Diese Ausgangslage begründet natürlich auf der einen Seite, wieso es eine Art ›universeller Feindschaft‹ zwischen den Kulturen zu geben scheint.51 Von der Perspektive des je eigenen ethischen Horizontes aus verletzen, verleugnen und verfehlen die Mitglieder anderer Lebensformen beständig das, was wirklich gut ist. Wenn westliche Liberale heute glauben, ihre höchsten Güter 41(sei es Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit oder ein substantieller Katalog von Menschenrechten) seien von universeller Geltung, so bestätigt das letztlich nur dieses Muster. Da indessen die Annahme einer ontologischen Fundierung der eigenen kognitiv-moralischen Landkarte den Glauben daran impliziert, dass der Geltungsanspruch der je eigenen ethischen Überzeugungen kontexttranszendierend ist, rechtfertigt dies auf der anderen Seite aber auch die Vermutung, dass es eine natürliche Disposition zum Dialog und zur Artikulierung der eigenen kognitiv-moralischen Landkarte in allen Kulturen gibt, selbst wenn politisch-strategische Gründe einen tatsächlichen Dialog oftmals erschweren mögen.52 Denn in einer interkulturellen Begegnung oder im Konfliktfall werden beide Seiten die Aussage »Wir leben und handeln eben so« als Antwort auf eine Begründungsforderung als unbefriedigend empfinden, eben weil sich aus ihrer Sicht die in Frage gestellten oder verletzten Normen rechtfertigen lassen. Sofern Menschen natürlicherweise annehmen (müssen), dass das, was aus ihrer Sicht ›wahrhaft‹ gut (oder wahr oder schön) ist, auch per se und schlechthin gut ist, müssen sie auch annehmen, dass die Regeln und Normen, welche aus diesem Guten folgen, intelligibel sind und von allen befolgt und verstanden werden sollten.
Ich möchte dies an einem Beispiel illustrieren. Würden wir etwa von den Mitgliedern einer archaischen Stammesgesellschaft aufgefordert, einen bestimmten Baum keinesfalls zu berühren, wären wir sofort geneigt, nach dem Grund hierfür zu fragen. Und die Angehörigen des Stammes würden wohl kaum antworten, »weil wir nun mal so leben«, sondern etwa sagen, dies sei der Wille der Götter, oder die Berührung eines heiligen Baumes würde großes Unheil über ihren Stamm hereinbrechen lassen oder etwas Ähnliches, das in jedem Fall Anlass zu weiteren Fragen von unserer Seite aus geben würde. Damit aber wäre bereits ein erster Schritt zur Artikulation ihrer ›kognitiv-moralischen Landkarte‹ und zum Dialog getan. Es wäre allerdings ein harmonistischer Fehlschluss, anzunehmen, dass alle scheinbar tiefen kulturellen Konflikte sich auflösen ließen, wenn wir nur erst den Weg zum Dialog und zur Artikulation von Güterkonzeptionen gefunden hätten. Verständigung ist keineswegs 42eine notwendige Konsequenz aus einem wirklichen gegenseitigen Verstehen, doch stellt dieses eine unabdingbare Voraussetzung für jene dar.
Von entscheidender Relevanz ist dabei nun, dass sich aufgrund der komplexen Natur von Paradigmen der Bedeutungs- und Verstehenshorizont einer anderen Kultur nicht ohne die Einbeziehung der mit ihr unauflösbar verknüpften Institutionen und Praktiken verstehen lässt, die als ihre fundierende und ›objektive‹ Verkörperung aufgefasst werden können und denen gegenüber Artikulationen stets sekundär bleiben. Es ist die Sprache der Institutionen und Praktiken (der exemplars in Kuhns Terminologie), welche implizit den vollständigen Horizont einer Kultur enthält, indem sie ein Bild des Wesens der Welt, der Position und Funktion des Menschen in ihr und in der Gemeinschaft, der besten Ein- und Ausrichtung des individuellen und sozialen Lebens, des Gemeinwohls, des verlässlichen Wissens etc. birgt.53 Die Frage jedoch, wie sich die inhärente Bedeutung (the point) einer fremdartigen Praxis adäquat erfassen lässt, stellt eines der Grundprobleme der kulturellen Hermeneutik dar.
Was wir normalerweise tun, wenn wir einer uns fremden Praxis – zum Beispiel einem Regentanz, einem religiösen Ritual oder einer politischen Versammlung – begegnen, besteht darin, dass wir sie zu den Bedeutungsmustern unserer kognitiv-moralischen Landkarte in Beziehung setzen und ihr daraus einen Sinn und eine Bedeutung zu geben versuchen. Und natürlich können wir überhaupt nur damit beginnen, die fremde Praxis zu verstehen, indem wir von unserem eigenen Verstehenshorizont ausgehen. Wie etwa auch Gadamer54 gezeigt hat, können wir unserer je eigenen Bedeutungswelt gar nicht entkommen, es sei denn um den Preis des völligen Verlustes der Fähigkeit, zu verstehen.
Wenn wir jedoch dabei stehen bleiben und dementsprechend die fremdartige Praxis und die Kultur, aus der sie entstammt, aus einer unbeteiligten Beobachterperspektive (wie sie etwa Quine oder Davidson vorschlagen) zu begreifen und zu beschreiben versuchen, verstehen wir letztlich gar nichts von jener Kultur. Denn das 43Eindringen in das holistische Bedeutungsnetz aus Sprache, Überzeugungen, Denk- und Handlungsweisen, welche gemeinsam das operative Paradigma oder den Bedeutungshorizont der fremden Kultur konstituieren, stellt eine hermeneutische Herausforderung dar, die zumindest teilweise die Übernahme der Teilnehmerperspektive erfordert, weil Bedeutungen in den Praktiken ›verkörpert‹ sind und sich der Erschließung durch reine Beobachtung entziehen. Von grundlegender Bedeutung für Lebensformen in dem von Taylor und Wittgenstein definierten Sinne ist ja nicht nur, dass sich ihr Bedeutungs- und Wertehorizont nicht von ihrer Sprache und Praxis trennen lässt, sondern dass diese zusammen auch Form und Gestalt der möglichen Handlungs-, Erfahrungs- und sogar Empfindungsweisen bestimmen.55
Wir können daher eine fremde Praxis so lange nicht wirklich verstehen, wie wir nicht über die entsprechende Sprache verfügen, welche jene Praxis mitkonstituiert; und wir können umgekehrt jene Sprache nicht verstehen, bevor wir nicht das implizite Wissen (Polanyi) der Praxis erworben haben. Und weil beide zusammen die Güter definieren, welche in diesen Praktiken angestrebt werden, haben wir keine Grundlage für deren Bewertung, bevor wir nicht im Besitz der erforderlichen begrifflichen und praktischen Kenntnisse sind. Die Implikationen hiervon werden sofort klar, wenn wir uns etwa vor Augen führen, dass auch die oben benutzten Begriffe des Regentanzes, des religiösen Rituals und der politischen Versammlung der lexikalischen Struktur unserer Welt, unserem Begriffs- und Bedeutungskosmos entstammen und daher keineswegs eine kommensurable Entsprechung in jenen Kulturen haben müssen, deren soziale Praxis wir damit zu beschreiben versuchen.56 Ein 44klassisches Beispiel für eine solche ›Verortung‹ einer fremden Praxis im eigenen Bedeutungshorizont stellt etwa der verbreitete Versuch früher Ethnologen dar, magische Praktiken wie etwa den Regentanz einfach als irregeleitete und erfolglose Versionen unserer Wissenschaft und Technik zu interpretieren.57
Aus all dem wird hinreichend ersichtlich, in welchem Maße das Verstehen genuin differenter Paradigmen ein hermeneutisches Problem darstellt. Gadamer nennt den Weg, auf dem ein solches Verstehen erreicht werden kann, eine Horizontverschmelzung. »Verstehen [ist] immer der Vorgang der Verschmelzung […] vermeintlich für sich seiender Horizonte.«58 Ebenso wie nach Gadamer die für das Studium eines fremden Textes nötige Horizontverschmelzung nur möglich ist, wenn wir an ihn mit der Erwartung herangehen, dass er uns etwas Bedeutungsvolles und Kohärentes zu sagen hat,59 argumentiert Taylor, dass wir fremde Kulturen erst dann verstehen können, wenn wir von der Annahme ausgehen, dass sie etwas Wertvolles enthalten, das potentiell unserer eigenen Kultur in nichts nachsteht (equal worth presumption):
As a presumption, the claim is that all human cultures that have animated whole societies over some considerable stretch of time have something important to say to all human beings […]. It is a starting hypothesis with which we ought to approach the study of any other culture. The validity of the claim has to be demonstrated concretely in the actual study of the culture. Indeed, for a culture sufficiently different from our own, we may have only the foggiest idea ex ante of in what its valuable contribution might consist. Because, for a sufficiently different culture, the very understanding of what it is to be of worth will be strange and unfamiliar to us.60
Da wir jedoch wissen, dass die Angehörigen anderer Kulturformen ebenso wie wir selbstinterpretierende starke Werter sind und vom 45Boden eines relativ stabilen Verstehenshorizontes oder Paradigmas aus denken und handeln, können wir uns allmählich in eine Position versetzen, von der aus es möglich wird, das zu entdecken, was sie pflegen und wertschätzen. In seinem Aufsatz »Comparison, History, Truth« formuliert Taylor dies folgendermaßen:
Das Ziel einer kulturvergleichenden Anstrengung besteht eben darin, uns in die Lage zu versetzen, die Anderen unverzerrt wahrzunehmen, mithin also die Vorstellung des Guten in ihrem Leben zu erkennen, auch wenn wir zugleich registrieren, dass ihre Vorstellung des Guten mit der unseren konfligiert. Es kommt also darauf an, über den Punkt hinauszukommen, an dem wir die anderen einfach als diejenigen sehen, die unsere Grenzen überschreiten und verletzen. Es geht darum, sie auf eine Weise wahrzunehmen, die auf der Basis unseres Ausgangsverständnisses nicht möglich gewesen wäre, weil dieses für die fremden Bedeutungen keinen Platz hatte. Nun aber sehen wir zwei Güter, während wir zuvor nur ein Gut und seine Verneinung wahrgenommen haben.61
Um dies zu erreichen, bedürfen wir einer Sprache qualitativer Kontraste, welche die relevanten Unterscheidungs- bzw. Variationsdimensionen62 der fremden Kultur erkennbar werden lässt. Diese Idee beruht auf Taylors Einsicht, dass Kulturen die sozialen Phänomene stets mit Hilfe einer Sprache von kontrastiven Begriffen beschreiben und bewerten, welche Objekte und Ereignisse entlang deskriptiver und evaluativer Strata kategorisieren, die man in der 46