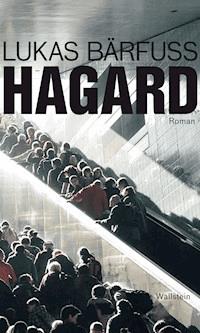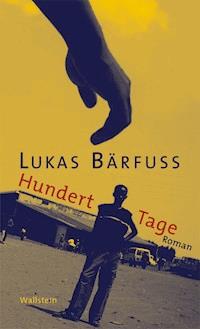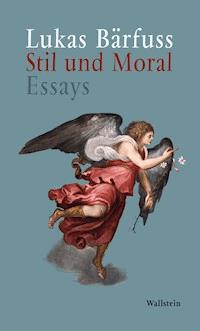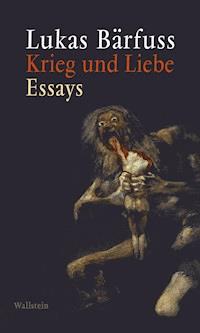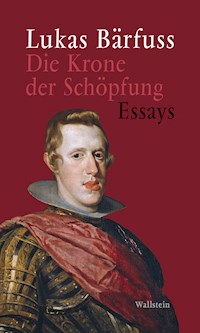14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Erbe seines Vaters hat Lukas Bärfuss ausgeschlagen: Es waren vor allem Schulden. Geblieben ist nur eine Kiste, die der Sohn nach fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal in Augenschein nimmt und die ihn zurückführt in seine eigene, schwierige Kindheit, in eine Jugend auf der Straße. Die Fragen werden drängend: Was hat er geerbt von seinem abwesenden, kriminellen Vater? Wie steht es um ein auf Privatvermögen zielendes Erbrecht, das uns, obwohl kaum hundert Jahre alt, wie ein Naturgesetz vorkommt? Wie steht es um die Verantwortlichkeit jenseits der familiären Bindung, wie steht es um die Teilhabe der Nachgeborenen, deren Schicksal wir bestimmen mit dem, was wir ihnen hinterlassen, mit unserem Erbe, unserem Müll? Antworten werden sich nicht finden lassen, solange das planende Denken vor dem Wegfall aller Selbstverständlichkeiten die Augen verschließt, solange es sich einer Enttäuschung verweigert, die uns die wichtigen Fragen erst ermöglichen würde: Wollen wir weiter so leben wie bisher? Und wenn nicht: wie dann?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Lukas Bärfuss
Vaters Kiste
Eine Geschichte über das Erben
Über dieses Buch
Das Erbe seines Vaters hat Lukas Bärfuss ausgeschlagen: Es waren vor allem Schulden. Die markante Nase seines Vaters hat er dagegen schon an seinen eigenen Sohn weitervererbt. Den Genen entkommen wir nicht, doch wie steht es um ein auf Privatvermögen zielendes Erbrecht, das uns, obwohl kaum hundert Jahre alt, wie ein Naturgesetz vorkommt? Wie steht es um die Verantwortlichkeit jenseits der familiären Bindung, wie steht es um die Teilhabe der Nachgeborenen, deren Schicksal wir bestimmen mit dem, was wir ihnen hinterlassen, unser Erbe, unseren Müll? Antworten werden sich nicht finden lassen, solange das planende Denken vor dem Wegfall aller Selbstverständlichkeiten die Augen verschließt, solange es sich einer Enttäuschung verweigert, die uns die wichtigen Fragen erst ermöglichen würde: Wollen wir weiter so leben wie bisher? Und wenn nicht: Wie dann?
Vita
Lukas Bärfuss, geb. 1971 in Thun, ist Dramatiker, Romancier und streitbarer Publizist. Davor hat er u. a. als Tabakbauer, Gabelstaplerfahrer, Eisenleger und Gärtner gearbeitet. Seine Stücke werden weltweit gespielt, die Romane sind in zwanzig Sprachen übersetzt. Lukas Bärfuss ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und lebt in Zürich. Für seine Werke wurde er u. a. mit dem Berliner Literaturpreis, dem Schweizer Buchpreis und dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-01580-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vaters Kiste
Beim Aufräumen war eine Kiste übrig geblieben. Aus einer dunklen Wohnung in den Bergen hatte ich sie vor fünfundzwanzig Jahren zu mir an die Dufourstrasse getragen und ungeöffnet verstaut, bis ich an die Aarwangen- und später an die Bertastrasse gezogen war. Von dort trug ich die Kiste an die Straßen der drei Gottheiten Apollo, Minerva und Neptun, schließlich in einem heißen Sommer an den Mühlebach, dann hinauf an die Asyl-, ein paar Monate an die Witikonerstrasse, und jetzt schließlich zu mir, in diese gute Stube. Da stand sie nun. Eine gewöhnliche Bananenschachtel der Del Monte Company. Und ich wusste nicht, was ich mit ihr anfangen sollte.
Die Kinder waren groß geworden, ein neuer Lebensabschnitt kündigte sich an und forderte Platz. In der Wohnung lag das Treibgut der vergangenen Jahre, Zeugs, das nun ohne Zweck und Verwendung war und gesichtet, bewertet, weggeworfen oder eingelagert werden musste. Ich ging alles gründlich durch, begegnete dabei meinen Liebsten, den Jahren des Erwachsenwerdens, meinen ersten Schritten in der Kunst, den Zäsuren: Heirat, Geburt, Krankheit, Scheidung, Tod, und ich begegnete vor allem mir selbst.
Ich weiß nicht, wie weit mich bei diesem Reinemachen die eigene Sterblichkeit drängte. Ein Freund war erkrankt, mitten im Leben, unrettbar, er verschied bald darauf. Die Männer in meiner Familie hatten kein hohes Alter erreicht, schon bald würde ich die meisten an Jahren eingeholt haben. Anzeichen, dass es mit mir zu Ende ging, gab es keine. Mit meiner Gesundheit war ich zufrieden, trotzdem fragte ich mich, ob etwas in mir wusste, dass meine Stunden gezählt waren, und mich deshalb zum Reinemachen zwang. Meine Ärztin, die ich mit meinen Sorgen behelligte, bescheinigte nach einer eingehenden Untersuchung meine tadellose Verfassung. Ich sei bloß ein bisschen abgespannt. Wie mit allem könne man es auch mit dem Aufräumen übertreiben. Ausgleich und Bewegung solle ich nicht vergessen und mir gelegentlich eine Pause gönnen. Die Zeiten seien hart genug.
Ich war erleichtert, wenigstens ein bisschen. Aber mit meiner Kiste half mir das nicht. Sie war das einzige Zeugnis eines Mannes, von dem es hieß, er sei mein Vater gewesen. Wie die meisten Menschen meiner Kindheit war er fast spurlos verschwunden. Von meiner Mutter besaß ich ein halbes Dutzend Bilder, von meinem Vater dasselbe, und auch von meinem jüngeren Selbst gab es keine Lebensspuren, keine Alben mit hübschen Familienporträts, keine Basteleien aus dem Werkunterricht. Von ehemaligen Lehrerinnen erhielt ich gelegentlich Klassenfotos zugeschickt, einmal auch eine Tüte mit alten Schulheften. Aber sonst war nichts geblieben, keine Möbel, kein Schmuck, keine Bücher, obwohl die Hälfte meiner Verwandtschaft unter dem Boden lag. Einen Teil meiner Jugend hatte ich auf der Straße verbracht, ohne feste Adresse, und wer ohne Haus ist, ohne Wohnung, der trägt keine Akten mit sich, keine Erinnerung und an Papier nur, was er sich in kalten Nächten unter den Pullover stopfen kann. Deshalb war meine Kindheit bloß in Bruchstücken greifbar, und eines dieser Bruchstücke, ein wesentliches, war diese Kiste. Sie war ein Kuriosum, eine Anomalie, ohne Zweck oder Verwendung. Und doch enthielt sie einen Teil meiner Herkunft und ein Kapitel meiner Geschichte, aber da ich alles getan hatte, um eben dieser Herkunft oder Geschichte zu entkommen, hatte ich es vermieden, mich näher mit ihr zu befassen. Ich kannte ihren Inhalt, jedenfalls hatte ich das in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren geglaubt und keine Notwendigkeit gesehen, meine Annahme zu überprüfen.
Aber nun packte mich eine gefährliche Neugier. Ich konnte die stumme Präsenz der Kiste nicht mehr ertragen, es war das Schweigen über meinen Vater, das ich darin hörte. Und ich wollte nicht, dass dieses Schweigen eines Tages auf meine Kinder überging. Es war meine Verantwortung, der Kiste einen Platz zu geben, im Tresor, im Giftschrank oder auf dem Müll. Mit dem Erbe ging es mir wie allen: Eines Tages musste sich jeder darum kümmern.
Aber das hieß, dass ich die Kiste öffnen und mir den Inhalt näher ansehen musste. Davor fürchtete ich mich, jedenfalls dachte ich nur mit Widerwillen daran. Das lag an der Geschichte, die mit dieser Kiste verbunden war.
In jenem Dezember vor fünfundzwanzig Jahren war ich im Norden Kameruns, in Waza, einem Reservat an der Grenze zum Tschad. Sudan-Sahel-Zone, staubtrocken, der letzte Regen war vor zwei Monaten gefallen, der nächste erst in einem halben Jahr zu erwarten. Die Elefanten hatte ich gesucht und gefunden, ferner Giraffen, Thompson-Gazellen, Büffel, gefährlich, weil sie sich in Herden bewegen, und ich hatte die Spur eines Löwen gesehen.
Wir waren in einem bordeauxroten Opel Kadett unterwegs, für die Gegend mehr als ungeeignet, ein Witz, und doch der einzige Wagen, der sich hatte auftreiben lassen.
Unser Fahrer, ein schwerer Mann mittleren Alters, war verschnupft, ein vollgerotztes Kleenex nach dem anderen warf er in die Savanne, zog eine weiße Spur hinter sich her, und als ich ihn in meinem westeuropäischen Umweltdünkel auf die Unschicklichkeit hinwies, griff er sich einen Stock und stopfte die Zellulose in die Ritzen der ausgetrockneten Erde, bis sie verschwunden waren.
In der Trockenzeit wuchs in der Savanne bloß ein dürres Kraut mit holzigen Stängeln, quadratkilometerweit. Die heiße Luft über der Ebene malte Schlösser in den Horizont, hier und da Büsche, Schirmakazien, darin Hirsefresser, eine Meisenart, die ihre Nester in Form von Körben in die Bäume webt, Termitenhügel noch und noch.
Irgendwann hatten wir einen Platten. Aber wir hatten keinen Ersatzreifen, und so verbrachte ich eine unbequeme Nacht unter dem afrikanischen Himmel, mit zwei schnarchenden Männern in einem Opel Kadett. Unweit brüllte ein Löwe, und ich erinnere mich, wie ich den Knopf herunterdrücke, mit dem man die Autotüre von innen schließt, und ich weiß nicht, ob ich damals lachen musste bei der Vorstellung, ein Löwe könnte eine Autotür öffnen, jedenfalls kam noch in der Nacht ein Wagen vorbei, der uns zurück ins Resort brachte.
Die Elefanten waren früher am Tag am Horizont sichtbar geworden als Staubwolke, und der Fährtenleser versprach, dass sie im Laufe des Tages bei der Wasserstelle ankommen würden. Dort saßen die barhäuptigen Geier, Geschöpfe aus einer anderen Zeit und in einer anderen Zeit, mächtige Tiere, leicht in der Luft, aber schwer, sobald sie den Boden berührten. Irgendwo ein Gerippe.
Und dann erschienen sie vor mir, die grauen Ungetüme, Fressmaschinen, die sich mit diesem Stroh begnügen mussten, von hier nach dort zogen, Kühe mit ihren Kälbern, Kreaturen, wie sie fremder nicht sein konnten, und gerade diese Fremdheit entfachte meine Bewunderung und mein Entzücken. Es kann sein, dass dieses Gefühl ein koloniales war, eines der Eroberung und der Entdeckung, aber ich kann nicht behaupten, dass ich mich wie ein Eroberer oder wie Entdecker gefühlt hätte, eher wie ein Niemand, der keine Ahnung hatte, was er hier wollte. Ich hatte Heimweh, und ich war ziemlich weit weg von Zuhause, wo niemand auf mich wartete, kein Arbeitgeber und keine Schule, keine Eltern, höchstens ein paar Freunde, die gewiss eine Weile ohne mich auskamen.
Das Campement verlassen, die Boukarous leer und ich der einzige Gast an jenem Abend. Touristen hatte man lange keine gesehen. Die Gegend war unsicher. Nach dem Essen setzte ich mich auf einen Felsen. Über mir das Sternenzelt, die Luft klar, die Milchstraße, wie ich sie noch nie gesehen hatte, ein kleiner europäischer Mann, der sich entschieden hatte, Schriftsteller zu sein, ohne Idee, wie er das werden konnte, ein Moment der Verlorenheit, der mich auf rätselhafte Weise mit dem Universum verband, dessen einzelne Teile, die Sterne, die Erde, die Menschen, die Tiere, so verloren waren, wie ich es war.
Ich bin nicht sicher, was in jener Nacht geschah, aber auf einmal packte mich die jähe Erkenntnis, dass meine Zeit hier abgelaufen war und ich zurückkehren musste, in meine Welt, zu meinen Aufgaben. Ich musste mich um mein Leben kümmern, um meine Probleme. Es wurde eine unruhige Nacht, ich konnte kaum den nächsten Tag abwarten, um mich schleunigst aus diesem Staub zu machen.
Früh am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg, zuerst zurück nach Maroua. Bis Yaoundé, in die Hauptstadt, waren es anderthalbtausend Kilometer, von denen die Hälfte in einem überfüllten Toyota HiAce zurückzulegen war, auf einer Straße, die nur gelegentlich diesen Namen verdiente. Am gefährlichsten waren ausgerechnet die asphaltierten Strecken. Dort drückte der Fahrer das Gaspedal durch, obwohl im Belag Löcher so groß wie Badewannen klafften, und ich erinnere mich, wie im Radio der Koran rezitiert wurde, und ich erinnere mich, wie in einem Stück Wald, den die Straße passierte, ein Feuer ausgebrochen war, weshalb sich viele Tiere, vor allem Vögel, darunter eine Art mit türkisblauem Gefieder, auf den Asphalt geflüchtet hatten, und wie der Fahrer trotz der Tiere nicht vom Gas ging, und ich erinnere mich an ein flappendes Geräusch und an den Geruch brennenden Holzes.
Dann die Fahrt über die Bénoué-Ebene, die Falaise hinauf, die Steigung, die auf das Hochland führt, nach Ngaoundéré, Endhaltestelle der kamerunischen Eisenbahnlinie, eine Stadt, in der morgens Nebel liegt und die Mototaxifahrer eingepackt in Arktisjacken durch die Straßen fahren, die Kapuzen bis zur Nase zugeschnürt. Die Nächte waren kalt in dieser Gegend, Dunst hing zwischen den Häusern, und am Bahnhof bestieg ich den Zug, bezog mein Abteil und fuhr in einer Nacht weiter in den Süden, nach Yaoundé, in die Hauptstadt, zu meinen Freunden am Theater.
Dort erwartete mich eine Nachricht. Es war das letzte Jahrzehnt der Faxgeräte. Ich erkannte auf der Stelle die Handschrift meiner Mutter. Leider sei der Vater verstorben. Das Schreiben war drei Wochen alt. Ich machte einige Anrufe in die Heimat, erhielt aber auf meine Fragen keine Antworten, und weil die Gespräche teuer waren, verschob ich die Klärung und machte mich bereit für die Abreise.
Zu Hause lag Schnee, ein klarer, kalter Winter, das neue Jahr war kaum eine Woche alt, und ich begann, die Asche meines Vaters zu suchen. Die Verwandten hatten sich um nichts gekümmert, niemand wusste etwas von einer Bestattung. Mein Vater war das schwarze Schaf der Familie gewesen, und nicht einmal mit seinen sterblichen Überresten wollte man etwas zu tun haben. In seiner Jugend hatte er ein paar krumme Dinger gedreht, war dafür nach Witzwil und auf den Thorberg gewandert, in die Gefängnisse, die bei uns noch Zuchthäuser hießen. Das wurde er ein Leben lang nicht los, auch wenn er nach dem Knast ein ordentliches Leben zu führen versuchte, in der Gegend blieb und sich mit einer bescheidenen Existenz als Kellner in mittleren Gasthöfen begnügte.
Ich fand die Verachtung für den Vater kleinlich; schließlich war er tot und tat keinem mehr etwas zuleide. Aber ich stand in der Pflicht, der Hinweis der Verwandten, zuerst habe ein Sohn sich um seinen toten Vater zu kümmern, war nicht von der Hand zu weisen. Auf eine gewisse Weise, die ich zum ersten Mal erlebte, war ich für eine Sache wirklich verantwortlich. Es schien in der Natur selbst zu liegen, in meiner Existenz als Mensch, dass ich den Totendienst leistete und der Pflicht gegenüber meinen Ahnen gerecht wurde. Aber dazu brauchte ich zuerst seine Asche.
Die letzte Zeit seines Lebens hatte er auf der Straße gelebt und war in den kalten Nächten im Durchgangsheim der Heilsarmee untergekommen. An einem Dienstagvormittag Anfang Dezember war er in der Nähe des Bahnhofs zusammengebrochen. Der Infarkt riss ein Loch in sein Herz, das er keine Minute überlebte. Das Krankenhaus, wohin man ihn brachte, arbeitete mit mehreren Bestattern zusammen, wie man mir mitteilte, aber sie konnten nicht sagen, bei welchem die Urne meines Vaters herumstand, bloß eine Liste gab man mir, und ich hatte ein paar seltsame Anrufe zu machen, ein Sohn, der nach den Überresten seines Vaters suchte, irgendwie peinlich.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: