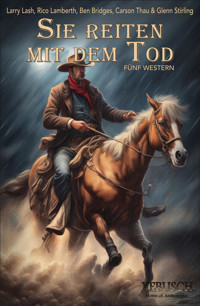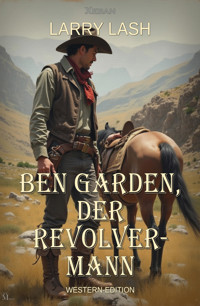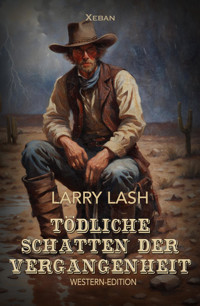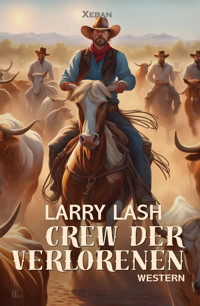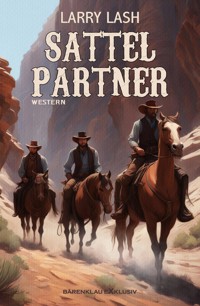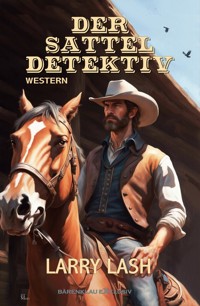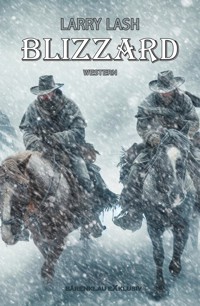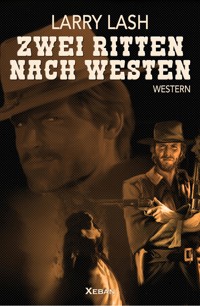3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es war Heimweh, nichts anderes als die Sehnsucht, noch einmal die Stätte seiner Kindheit wiederzusehen, den verborgenen Pfaden nachzugehen, die er einstmals als kleiner Junge beschritten hatte. Damals lebten hier noch in Arizona Apachen, und kein anderer als Cochise, der mächtige Häuptling, war sein Ziehvater. Und er ahnte bereits zu jener Zeit, dass weiße Menschen ihn an die Indianer verkauft hatten. Doch das war lange her. Er war auch nicht gekommen, um Rechenschaft zu fordern und Rache zu üben. Als er sich in die Lohnliste der großen Ranch eintragen ließ, die dort entstanden war, wo früher freie Indianer umherschweiften, tat er es in der Absicht, schon bald wieder davonzureiten. Doch es kam völlig anders.
Er wurde noch einmal gezwungen zu kämpfen, sich seiner Haut zu wehren, wenn er nicht mit hineingerissen werden wollte in den Strudel mörderischer Auseinandersetzungen zweier Parteien, die sich gegenseitig einfach nur auslöschen wollten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Larry Lash
Verdeckte Karten
Westernroman
Impressum
Copyright © by Author/Edition Bärenklau
Cover: © Steve Mayer nach Motiven, 2022
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Verdeckte Karten
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Der Autor Larry Lash
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash
Das Buch
Es war Heimweh, nichts anderes als die Sehnsucht, noch einmal die Stätte seiner Kindheit wiederzusehen, den verborgenen Pfaden nachzugehen, die er einstmals als kleiner Junge beschritten hatte. Damals lebten hier noch in Arizona Apachen, und kein anderer als Cochise, der mächtige Häuptling, war sein Ziehvater. Und er ahnte bereits zu jener Zeit, dass weiße Menschen ihn an die Indianer verkauft hatten. Doch das war lange her. Er war auch nicht gekommen, um Rechenschaft zu fordern und Rache zu üben. Als er sich in die Lohnliste der großen Ranch eintragen ließ, die dort entstanden war, wo früher freie Indianer umherschweiften, tat er es in der Absicht, schon bald wieder davonzureiten. Doch es kam völlig anders.
Er wurde noch einmal gezwungen zu kämpfen, sich seiner Haut zu wehren, wenn er nicht mit hineingerissen werden wollte in den Strudel mörderischer Auseinandersetzungen zweier Parteien, die sich gegenseitig einfach nur auslöschen wollten …
***
Verdeckte Karten
1. Kapitel
Die Nüstern des Pferdes blähten sich. Das Tier roch die Wärme, die nach dem Regen aus dem Boden aufstieg und sich mit dem Harzgeruch der Wälder vermählte. Das Pferd witterte Wasser, welches irgendwo in der Salbeilandschaft zwischen den Hügeln sein musste. Es dürstete nach Wasser wie sein Herr, der vornübergebeugt im Sattel saß und mit schmalgezogenen Augenlidern das Land betrachtete, das sich vor seinen Blicken ausweitete.
Einen Tag lang hatten beide, Mensch und Tier, kein Wasser mehr zu sich genommen. Das Land, das hinter ihnen lag, war eine einzige Öde. Das verdorrte Gras war mit dem roten Staub Arizonas bedeckt. Dieser rötliche Staub lag auch auf Pferd und Reiter. Das Haar des Reiters allerdings war nicht vom Staub rostrot geworden, diese rötliche Haarfarbe gehörte schon seit eh und je zu dem Reiter. Sie bildete einen krassen Gegensatz zu dem Fell des Pferdes, das unter der roten Staubschicht schwarz und seicht war.
Ben Hull hatte einen Rappwallach unter dem Sattel, ein Tier, dessen wohlgestaltetes Äußeres jeden Pferdekenner hellauf begeistern musste. Nur selten sah man ein solches Pferd, das, angefangen von den rotgetönten Nüstern, den dunklen Augen, dem trockenen Kopf, dem breiten, geschwungenen Hals einen Körper hatte, wie man ihn nur selten sah. Die Äderung trat plastisch hervor. Das Tier hatte hohe Läufe und schmale Fesselgelenke und lange Mähnen und Schweifhaar, das ungestutzt im Wind wehte.
»Wir sind gleich am Ziel, Blade«, sagte der Reiter vom Sattel her zu seinem Pferd, als wäre es ein menschliches Wesen, dem er eine Erklärung schuldig sei. »Nur noch etwas Geduld, dann bekommen wir Wasser und können uns ausruhen.«
Seit Tagen schienen sie unterwegs zu sein. Der Reiter hatte sicherlich viele Nächte unter freiem Himmel kampiert, nur mit einer Decke zugedeckt und über sich die Sterne. Mitte der dreißig mochte er sein. Er war nicht sehr groß, doch breitschultrig und starkknochig. Sein lederfarbenes Gesicht zeigte an den Augenwinkeln jene Krähenfalten, wie sie bei Menschen zu finden sind, die gewohnt sind, in die Weite zu blicken. Seeleute und Cowboys besaßen solche Krähenfalten. Ben Hull hatte blaue Augen, die sehr unterschiedlich, manchmal hell und scharf, dann wieder dunkel und forschend blicken konnten. Er trug eine Winchester im Scabbard und an der Hüfte einen 45er Colt, der mit seinem stahlblauen Lauf aus dem offenen Holster hervorschaute. Zum Schutze gegen Dornen und Kakteen hatte Ben Hull Chaps angeschnallt, lederne Überbeinkleider, die mit Messingschnallen verziert waren.
Der Rappe schritt jetzt schneller aus. Das Tier wurde wie magisch vom Geruch des Wassers angezogen. Der Reiter hielt das Tier nicht zurück. Im Gegenteil, auch er dürstete, auch ihm war die Kehle wie ausgedörrt. Er ließ Black seinen Weg selbst suchen. Das Tier beschleunigte seine Gangart, als es über die nächste Hügelkuppe hinweg in einem grünen Tal einen kleinen Bach sah.
Ben Hull sah mehr. Er bemerkte nicht nur, dass dieses Land genügend Wasser hatte, dass hier und dort belaubte Bäume in Gruppen zusammenstanden und weiter im Hintergrund Ahorn und Fichtenbäume gen Himmel ragten, nein, er sah auch den Rauch, der hinter einer Bachbiegung im Talausschnitt fast kerzengerade zum Himmel stieg.
»Also doch, sie sind angekommen«, murmelte er vor sich hin. Ein Gefühl der Erleichterung hob seine Brust, und es war ihm, als ob Zentnerlasten von seinen Schultern genommen würden. Die drängende Ungeduld verschwand aus seinen Augen, und ein Lächeln verklärte sein Gesicht, so dass die Strenge, die ihm eine besondere Prägung gab, wie ausgelöscht war.
Das kleine, winzige Lächeln verriet mehr von Ben Hull, als viele Worte es vermocht hätten. Es zeigte, dass unter der harten Schale dieses Mannes, der sein Innerstes vor der Außenwelt verschloss, ein weicher Kern sein mochte.
Am Bach angelangt ließ Ben Hull seinen Rappen trinken, ohne ihm das Zaumzeug abzunehmen oder ihm sonst wie Erleichterung zu verschaffen. Im Gegenteil, Ben Hull blieb sogar im Sattel sitzen. Er sprang nicht ab, um den eigenen Durst zu löschen, um die Handgelenke und das Gesicht ins frische Wasser zu tauchen. Nein, er dachte nicht mehr daran ein Bad zu nehmen und den Staub abzuschütteln. Vom Sattel her beobachtete er die Rauchfahne.
Während der Rappe trank und vorsichtig das Wasser aufnahm, drehte Ben mit der linken Hand eine Zigarette, steckte sie sich zwischen die Lippen und zündete sie an. Ganz ruhig saß er im Sattel, als hätte die Müdigkeit ihn übermannt. Das Gegenteil war der Fall. Hinter seiner breiten, klar geschnittenen Stirn arbeiteten die Gedanken. Er achtete nicht auf das Land, er kannte es. Hier hatte Cochise einst gelebt, hier hatten Apachenzelte gestanden. Von hier aus waren die Männer aus Cochises Stamm losgeritten, um weite Beuteritte zu unternehmen.
Nichts verriet mehr, dass hier einmal Nomaden gelebt hatten und vertrieben worden waren. Gras überwuchert waren längst ihre Feuerstellen, geblieben war der blaue Himmel und der klare Bach, in dem die Forellen sprangen, und auch das wilde grüne Land in seiner atemberaubenden Schönheit. Cochise und sein Volk hatten dieses Land geliebt. Ben Hull wusste das, denn er hatte seine Knabenjahre bei den Apachen verbracht. Er war einer der Ihren gewesen, hatte mit ihnen gelitten und ihre Not gespürt, er hatte mit ihnen gekämpft und Beuteritte gemacht. An seinem Körper waren die verblassten Narben seiner Kriegsweihe noch zu sehen. Wie ein Apache hatte er gelebt. Jetzt war es ihm, als wäre die Vergangenheit wieder in ihm lebendig.
Ben Hull war in dem Alter gewesen, in dem man sonst schon Heimweh bekommt, wenn man die Heimat verlassen muss. Er aber hatte kein Heimweh bekommen. Er war als Knabe nicht aus einem brennenden Prärieschoner oder aus einer Siedlerhütte heraus entführt worden. Männer seiner eigenen Rasse, weiße Banditen hatten ihn an die Apachen verkauft. Die Weißen waren Teufel in Menschengestalt gewesen, ohne Skrupel und ohne Gefühle, von demselben Schlage wie die zweite Frau seines Vaters, die ihn für tot hatte erklären lassen, um ihrem eigenen Sohn, Ben Hulls Halbbruder, die Vorteile der alleinigen Erbschaft zu verschaffen. Ben erinnerte sich noch genau daran. Er war damals alt genug gewesen, um es nicht zu vergessen. Der Zufall hatte es damals gewollt, dass einer der Mexikanerjungen aus der Dienerschaft, der im gleichen Alter war wie er selbst, vom Pferd herunter in eine Schlucht gestürzt war und nach dem tödlichen Sturz so unkenntlich war, dass nur die Kleider eine Identifizierung zuließen.
Bens Stiefmutter hatte sich nicht gescheut, dem Toten Bens Kleider anzuziehen. Die Stiefmutter hatte zwei Gehilfen, die für sie alles taten. Mit Hilfe dieser beiden wurde Ben gefesselt und eingesperrt. Er hatte in dem finsteren Gemach gehockt, als seine eigene Beerdigung vorbereitet wurde. Was in ihm vorgegangen war, als er die Freunde und Bekannten hörte, die aus der Nachbarschaft gekommen waren, um ihr Beileid auszusprechen, wusste er selbst am besten. Er war dabei, als man die Totenlieder sang und als man die Gebete für ihn sprach, aber er konnte sich nicht bemerkbar machen.
Sein wildes Aufbäumen gegen die Fesseln und Knebel nutzte nichts. Bei den Anstrengungen schnitten die Fesseln nur umso tiefer ins Fleisch, und durch die Knebel drohte er zu ersticken. Ein anderer wurde in die Familiengruft hinabgelassen. Ihn schleppte man in der Nacht hinaus, verlud ihn auf einen Wagen und fuhr davon. Es waren die Gehilfen seiner Stiefmutter, die diese Arbeit verrichteten. Eine Woche lang brachte die Angst Ben fast um den Verstand. In dieser Zeit sah er nur ab und zu das Sonnenlicht. Man hatte ihm wohl zu essen und zu trinken gegeben, ihn aber dann wieder in die Decken eingehüllt. Immer wieder hatte er befürchtet, dass man ihn irgendwo in eine Schlucht werfen würde, um sich seiner zu entledigen. Die Kerle, in dessen Gewalt er war, sahen nicht so aus, als hätten sie ein Gewissen. Sie waren seiner Stiefmutter hörig. Als Bens Vater zum zweiten Mal heiratete, waren sie mit seiner Stiefmutter auf die Ranch gekommen. Der Vater hatte nichts gegen diese Männer einzuwenden gehabt. Zwar mochte er sie nicht, doch er liebte seine um viele Jahre jüngere zweite Frau abgöttisch und konnte keinen ihrer Wünsche ausschlagen. Ja, auch daran erinnerte Ben sich und auch, dass sein Vater ein stiller Mann war, zielbewusst und strebsam, ein Mann, der sich ein kleines Königreich aufbaute und über die Menschen herrschte, der aber seiner Frau gegenüber so jämmerlich versagte.
Gegen Bens Mutter hatte der Vater sich immer durchzusetzen vermocht. Lag es daran, dass die Stiefmutter sehr schön war, dass der Vater ihr jeden Wunsch von den Augen ablas? By Gosh, sie war schön! Ihr tizianrotes Haar wetteiferte mit dem Glanz ihrer grünen Augen. Ihr schlanker, biegsamer Körper war wie von Meisterhand geschaffen, ihr Lachen war irgendwie aufreizend. An all das konnte Ben sich noch gut erinnern, aber auch daran, wie ihn die Apachen gekauft hatten und wie er Cochises Ziehsohn geworden war.
In Cochises Tipi ging es rau zu, aber Ben wurde dort nie geschlagen. Er wuchs vollkommen frei auf. Er jagte und fischte mit altersgleichen Apachenjungen und wurde dann Jungkrieger. Ben hatte den scharfen Feuergeruch der Brandstellen eingeatmet, er hatte selbst Büffelfleisch zubereitet und gegessen und war mit den Apachen in die Dörfer der Mexikaner eingefallen. Bei einem dieser Überfälle hatte er seinen ersten Gegner getötet. Die Apachen hatten ihm einen Kriegernamen gegeben. Damals hatte Ben geglaubt, dass er immer bei den Apachen bleiben würde. Es war allerdings anders gekommen. Solange die Staaten New Mexiko, Nevada und Kalifornien nicht besaßen, hatten sie nichts gegen die Überfälle der Apachen auf die Siedlungen der Mexikaner. Das änderte sich schlagartig, als die Friedensverhandlungen in Cahuenga abgeschlossen wurden und die Apachen gegen amerikanische Staatsbürger vorgingen. Von diesem Augenblick an wurden die Apachen gnadenlos gejagt, bis die wenigen, die überlebten, in Reservate abwanderten.
Das Apachenland war nicht verlassen geblieben, Weiße hatten es erobert. Nie wieder würden hier die Trommeln dröhnen und die Tänzer um das Totemfeuer tanzen, nie wieder würden die Krieger, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, zur heiligen Büffeljagd aufbrechen. Es gab zudem kaum noch Büffelherden. Die Büffel waren nicht nur von den Weißen haufenweise abgeschossen worden, was weit schlimmer war, sie hatten keine Abwehrstoffe in ihrem Blut gegen die Rinderseuchen, genauso wenig wie die Indianer Abwehrstoffe gegen die Krankheiten der Weißen hatten. Scharlach, Masern und anderes mehr wüteten unter den indianischen Stämmen. Was der weiße Mann leicht ertragen konnte, raffte die Söhne Manitus dahin. Durch Infektionskrankheiten wurden in kurzer Zeit ganze Stämme ausgerottet.
Ben Hull hatte es erlebt, wie die Masern in Cochises Dorf gewütet hatten. An die achtzig Menschen hatten den Tod gefunden. Man hatte sie auf Scheiterhaufen gelegt und verbrannt. Nur wenige im Dorf waren der schrecklichen Krankheit nicht zum Opfer gefallen. Ben war von der Krankheit nicht befallen worden. Er wusste nicht, dass er sie im Babyalter bereits durchgemacht hatte und so gegen sie gefeit war. Er erinnerte sich aber noch des Wehklagens im Dorf, an die Frauen, die sich die Haare gerauft und Asche auf das Haupt gestreut hatten.
Als Ben Hull jetzt über den Bach schaute, spürte er Heimweh nach den Gefährten seiner Jugend. Wo waren sie? Verweht waren die Spuren der Apachen, vergessen, dass sie hier ihre Heimat hatten. Ihr Stern war versunken. Es würde keine großen Häuptlinge mehr geben. Ein Volk war untergegangen, doch das Leben selbst ging weiter. Ben war mit den Apachen in die Reservation gezogen, ein Krieger, der mit vielen Wunden bedeckt war und sich die Achtung der Apachen erworben hatte. Er hatte nicht bei seinen Freunden bleiben dürfen, er musste sich von ihnen trennen. Man hatte ihm gesagt, dass er bei den Leuten der eigenen Rasse leben und von ihnen lernen müsse. Das war ihm schwergefallen. Bei den eigenen Rasseangehörigen hatte er bald die Lüge kennengelernt. Er hatte festgestellt, dass der weiße Mann sich in der Zwischenzeit kaum geändert hatte, dass seine Gier vielleicht noch größer geworden war.
Vielleicht waren nicht alle so, doch Ben hatte das Pech, dass er an Leute geriet, die keinen Schuss Pulver wert waren. Sie nannten ihn Ben Hull, und niemand ahnte, dass nur der Vorname echt war. Den Namen Hull hatte Ben sich selbst zugelegt. Irgendein Warn Instinkt hatte ihn dazu veranlasst, nicht den richtigen Namen zu führen. Das war nun schon einige Jahre her, und er hatte sich an den Namen gewöhnt.
Seit einer Woche befand Ben Hull sich wieder in Arizona. Das Heimweh hatte ihn dazu getrieben, wieder die Gegend aufzusuchen, die ihm eine so schöne Jugendzeit beschert hatte. Er hatte Arbeit auf einer Großrinderranch aufgenommen.
2. Kapitel
Der Rappwallach hatte zu trinken aufgehört. Das Tier nahm den Kopf hoch. Es roch wohl den Rauch, den der Wind jetzt herübertrieb. Die Nüstern blähten sich, und ein Schnauben ertönte. Ben klopfte den Hals des Tieres, nahm die Zügel auf und ritt am Bachufer entlang in Richtung der Rauchsäule.
»Man könnte sich einbilden, dass hinter dem Weg knick ein Lagerfeuer Cochises brennt«, murmelte Ben Hull. »Doch Cochise ist tot, und bald werden die letzten Apachen in den ewigen Jagdgründen um ihn versammelt sein. Ihre Kriegsschreie und ihre Jagdrufe sind verstummt. Ihr Land gehört den weißen Großranchern. Niemand mehr wird das Donnern unbeschlagener Pferdehufe hören. Ich habe zu viel erwartet, ich hätte nicht nach hier zurückkommen sollen. Niemand kann das Vergangene neu heraufbeschwören. Die Zeit ist gegen uns, gegen den Menschen. Nie habe ich das deutlicher empfunden als jetzt, nie war ich einsamer.«
Der Rappe spitzte die Ohren. Seine dunklen Augen schauten unruhig. Ben klopfte ihm den Hals und sprach beruhigend auf ihn ein. Er lenkte den Rappwallach in das Weidegebüsch hinein und vermied es, über das offene Gelände, das das erste Tal vom zweiten trennte, zu reiten. Er setzte den Ritt in der Deckung der Weidebüsche auf dem weichen Uferboden fort. Der Hufschlag seines Pferdes war kaum zu hören. Er ritt wie ein Indianer, der Feinde vor sich weiß.
Wenn Bens Berechnungen stimmten, dann waren vor ihm keine Feinde, sondern weiße Männer, die auf ihn warteten, Männer aus der JG-Crew, nach dem Namen des Rinderkönigs Jack Graham.
JG waren die Buchstaben des Brandstempels. Im ganzen Land schien es nur Rinder mit diesem Brandzeichen zu geben. Es gab wohl einige mittlere Ranchen und eine ganze Anzahl von Kleinranchen, beherrschend waren aber die Buchstaben JG. Man konnte dieses Brandzeichen nicht nur auf den Weiden Arizonas sehen, sondern auch auf den Weiden von Montana, Arkansas und Texas. In den ganzen Staaten verstreut hatte Jack Graham seine Rinderherden. Die Ranch hier in Arizona war die größte und die schönste, aber auch die jüngste. Kein Reiter konnte an ihr vorbeireiten, ohne sie bewundern zu müssen. Für jeden Cowboy im Lande war es eine Ehre, für die JG zu reiten.
Der Rauchgeruch verstärkte sich. Ben hielt den Wallach in der Deckung der Büsche an, als er eine Bewegung durch das Laubwerk der herunterhängenden Weidebüsche erkannte. Dann erblickte er die Männergruppe, drei Mann stark. Sie hockten wie auf dem Präsentierteller um das Feuer und brieten Wild, als gäbe es keine Gefahr auf der Welt, rein gar nichts, was ihnen Schaden zufügen könnte. Ihre Pferde standen angehobbelt weiter im Hintergrund, das heißt, man hatte den Pferden die Vorderbeine so gefesselt, dass sie frei grasen konnten, sich aber nicht weit zu entfernen vermochten. Es war deutlich zu erkennen, dass die drei Männer Ben Hull noch nicht erwartet hatten. Nach ihren Berechnungen musste er wohl erst nach Mitternacht eintreffen. Sie gingen von der Annahme aus, dass er die Durststrecke meiden würde. Das genaue Gegenteil war der Fall, Ben hatte die Durststrecke gewählt und war mitten durch ein wüstenähnliches Land geritten, nur um schneller am Ziel zu sein.
Die Männer am Feuer waren Cowboys wie er. Der Mann, der rechts am Feuer hockte und sich fast die Stiefelsohlen verbrannte, war Roger Dea, ein hagerer Mann mit vorstehenden Wangenknochen und Vorderzähnen. Man sagte von ihm, dass er irgendwo Prediger gewesen sei, bevor er Cowboy wurde. Er liebte es salbungsvoll zu sprechen, seine große Leidenschaft aber waren scharfe Getränke. Letzteres war wohl auch der Grund dafür gewesen, dass er seinen Posten als Prediger aufgab und sich nach einer anderen Stellung umsah. Vielleicht war der Gemeinde der ihm ständig anhaftende Geruch von Whisky zu viel gewesen. Dieser Geruch störte auch andere Cowboys der Ranch, aber daraus machte Roger Dea sich nichts mehr. Erstaunlicherweise konnte Dea aufs Essen verzichten, nicht aber auf den Whisky.
Neben Roger Dea war Jim Darneen. Jim war zwanzig Jahre alt, wirkte aber älter. Im Moment lag er lang im Gras auf dem Rücken und starrte in den Himmel über ihm. Er kaute an einem Grashalm und schien anzunehmen, dass es kein schöneres Vergnügen gab als an einem Halm zu kauen und in den Himmel zu starren. Sein Haar war wie Rabengefieder so schwarz und glänzend und hing ihm bis auf die Schultern herab, was im Moment durch seine liegende Stellung allerdings nicht zu sehen war. Für einen Apachen hätte sein Haarschopf einen schönen Skalp abgegeben. Jim Darneen würde sich allerdings seinen Skalp nicht so leichtnehmen lassen. Er war ein drahtiger Bursche, schlank und sehnig und hatte ein raues Benehmen. Vielleicht war er es nur, um sich durchzusetzen.
Der dritte am Lagerfeuer war Dick Barkley. Die Haarfarbe Barkleys musste man als blond bezeichnen, das heißt den Rest der Skalplocke, der nach den Stürmen des Lebens noch übriggeblieben war und auf dem Hinterkopf ein kärgliches Dasein fristete. Seine Stirn war dadurch um vieles höher geworden, was ihm ein gelehrtes Aussehen verlieh. Das Bild litt allerdings etwas, wenn er den Mund öffnete und man die Zahnstummel zu sehen bekam, die seine Kiefer zierten. Man musste sich fragen, wie diese Stummel die Pfeife zu halten vermochten, aus der er Rauchwolken paffte. Wie vermochten diese Zähne auch das Wildbret zu zerkleinern?
Gerade Dick Barkley aber war es, der sich jetzt eine Scheibe von dem dampfenden braunen Fleisch abschnitt und sich in den Mund steckte, als wäre das Fleisch weich wie Pudding. Es war erstaunlich zu sehen, wie schnell das Fleisch geschluckt wurde. Ein Grinsen überzog Dicks Gesicht, dann langte er nach einem weiteren Happen und sagte kauend: »Schmeckt vorzüglich, beginnen wir das Mahl!«
»Um das zu bekommen, was du übriggelassen hast«, entgegnete Roger Dea ironisch. »Mit zwei Bissen hast du das Kaninchen fast allein aufgegessen, zurückgeblieben sind nur Knochen. Das ist zu wenig für ausgehungerte Wölfe, wie Jim und ich es sind. Wir hätten keinen Vielfraß mitnehmen sollen und haben noch allerhand vor. Wenn du so weitermachst, können wir gleich umkehren und brauchen nicht mehr auf den Neuen zu warten, den uns der Vormann zur Verstärkung schicken will.«
»Ich mag den Neuen nicht«, meldete sich Jim, wobei er den Grashalm zerbiss und beide Teile fortspuckte. »Wer ist er denn? Man wird nicht warm mit ihm. Schon am ersten Tage hat er Joe Bell, als dieser ihn prüfen wollte, so zusammengeschlagen, dass Joe einige Tage im Bett bleiben musste. Joe hat lediglich feststellen wollen, ob er bei der Remudawache nicht eingeschlafen war.«
»Hinterher schlief Joe umso fester«, grinste Dick Barkley. »Joe nimmt sich manchmal zu viel heraus. Er sollte nicht so neugierig sein. Der Neue hat ihn schlafen gelegt, und Joe sollte kein Drama daraus machen. Er hat nur bekommen, was er selbst herausforderte. Warum zum Teufel ließ Joe sich in diese Sache ein?«
»Er will leider nicht mit der Sprache heraus«, erwiderte Jim Darneen. »Vielleicht handelte er im Aufträge unseres Vormannes, der den Neuen besonders scharf unter die Lupe nehmen wollte. Ich will jedoch nichts gesagt haben. Jube Pilote hat so seine eigenen Ansichten über die Crewführung, und ich möchte ihm lieber nicht ins Gehege kommen, Freunde. Jube ist verteufelt hart und rau.«
»Und der Neue auch«, meldete sich Roger Dea. »Ich habe ihn studiert und bin zu der Überzeugung gekommen, dass Jube, unser Vormann, ihn nicht zufällig zu uns schickt. Jube weiß einen Mann sehr gut einzuschätzen. Trotzdem, der Neue ist mir zu undurchsichtig, wir werden ihn im Auge behalten müssen, Freunde. Schließlich holen wir nicht irgendwen ab, sondern die Nichte unserer Chefin. Es geht dabei durch bandenverseuchtes Gebiet! Deshalb sollte das Mädel auch nicht mit der Postkutsche fahren, vor allem auch deshalb nicht, weil dieser Drohbrief von ihrer Entführung sich dreimal wiederholte. Die Rancherin ist sehr besorgt.«
»Wer ist das nicht!«, entgegnete Jim Darneen und hockte sich auf. »Der Teufel scheint los zu sein.«
»Gewiss, der Teufel«, sagte Roger Dea und wandte den Blick zum Himmel, als wollte er den lieben Gott beschwören. »Auf die Idee, den Teufel verantwortlich zu machen, sind schon ganz andere Leute als du gekommen. Bei dem Bruder meines Großvaters war das ähnlich.«
»Erzähle mir keine Geschichten, Roger.«
»Es sind keine Geschichten«, grinste Roger. »Der Hexenwahn hat über Jahrhunderte hinweg nicht nur die alte, sondern auch die neue Welt in Atem gehalten. Eine Menge Leute wurde auf den Scheiterhaufen verbrannt, und nicht nur die Richter waren beschäftigt, sondern auch die Hexenjäger. Wahrhaftig, mein Großonkel hat damals keine schlechten Geschäfte gemacht. Zwanzig Dollar kassierte er für das Auffinden einer Hexe. Er fand sie mit Hilfe der sogenannten Nadelprobe.«
»Roger«, mischte sich nun Dick Barkley ein, »ich denke, dass diese Zeit ein für alle Mal vorbei ist. Was kümmert es uns noch heute!«
»Ich bin dessen nicht so sicher«, grinste Roger Dea seine beiden Partner an. »Nicht nur, dass mein Großonkel es nicht verhindern konnte, dass ihm zum Schluss selbst der Prozess gemacht wurde und seine Asche in alle Winde verstreut wurde. Er sagte vor seinem Tode noch, dass die Menschen immer neue Gründe finden würden, um sich gegenseitig auszurotten, und das, Freunde, hat mein Großonkel mit einer prophetischen Begabung richtig erkannt. Himmel, schaut euch nur um! Es ist noch nicht allzu lange her, da standen hier in der Nähe die Wigwams der Apachen. Diese Indianer waren Menschen wie wir, Menschen aus Fleisch und Blut, die leben wollten. Wo sind sie jetzt?«
Seine beiden Partner starrten ihn an.
»Verschone uns mit deinen Reden!«, sagte Dick Barkley und teilte das Wildbret mit seinem Bowiemesser. »Es war wohl schon zu allen Zeiten so. Es soll Völker gegeben haben, die nur deshalb Krieg führten, um Gefangene zu machen, die sie ihren Göttern opferten.«
»Gewiss, so handelten die Azteken. Sie nannten ihre Kriege, die nur dazu dienten, Gefangene zu machen, Blumenkriege.«
Der hagere Roger Dea verstummte. Er hatte eine kaum sichtbare Bewegung bei den Uferbüschen wahrgenommen und schnellte im nächsten Moment herum, wobei seine Rechte den Colt aus dem Holster zog.