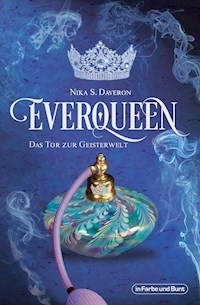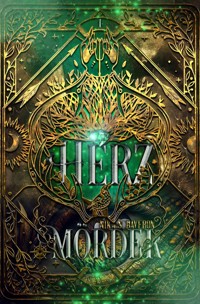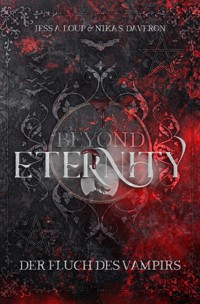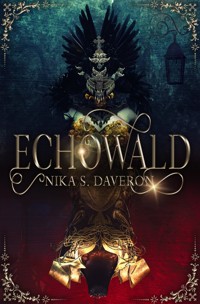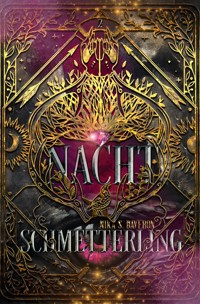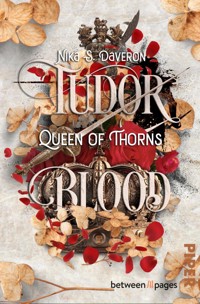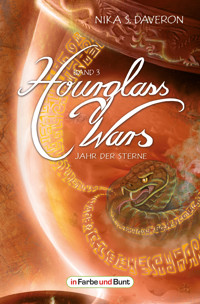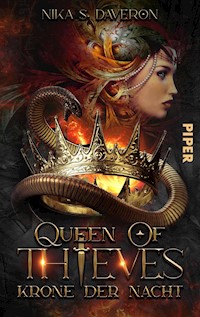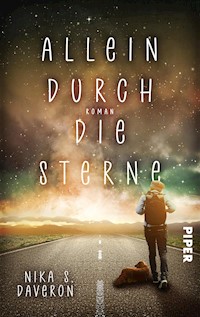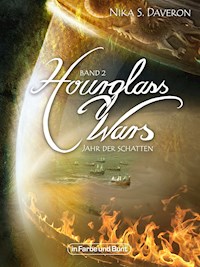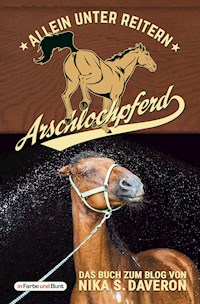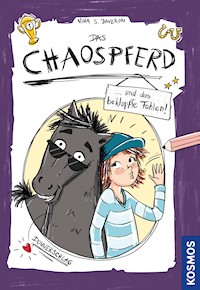Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als die achtzehnjährige Trêve Kerrigan im Jahr 1921 in Grytviken, einem Ort mitten in der Antarktis, ankommt, fühlt sie sich im ewigen Eis regelrecht begraben. Ihr Vater, ein renommierter Walfänger, ist nur selten zu Hause, und sie langweilt sich tödlich auf South Georgia, bis eines Tages Haya in ihr Leben tritt – eine geheimnisvolle junge Frau, die faszinierend schaurige Geschichten erzählt. Als Trêve beginnt, diese aufzuschreiben, geschehen jedoch seltsame Dinge auf der Insel. Dunkle Kreaturen schleichen nachts um die Häuser, und obendrein gehen äußerst merkwürdige Dinge im Labor von Hayas Vater vor sich. Und dann ist da noch der Mann ohne Schatten, der die Tore zum Inferno der gescheiterten Schöpfung öffnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für atty und Leo
Mit euch würde ich mir immer wieder ein Bett teilen!
Impressum:
Texte: Nika S. Daveron
Umschlag: Nika S. Daveron (Bildmaterial Adobe Stock, Turan, Jorge Ferreiro & Shutterstock, pavila)
Lektorat: Jess A. Loup
Korrektorat: Tamara Weiß
Für eine Auflistung der Triggerwarnungen im Buch »Vermillion: Blut und Eis«, können Sie Nika S. Daveron gerne per Mail unter: [email protected] oder über ihre Facebookseite https://www.facebook.com/NikaSDaveron/ kontaktieren.
Trêve
Haya
Kendall
Trêve
Haya
Kendall
Trêve
Haya
Kendall
Trêve
Haya
Kendall
Trêve
Haya
Kendall
Trêve
Haya
Kendall
Trêve
Haya
Kendall
Trêve
Haya
Undine
Über die Autorin
Nika S. Daveron
Vermillion: Blut und Eis
Trêve
Der Ort heißt Grytviken. Und er liegt am Ende der Welt. So viel weiß Trêve Kerrigan von ihrem Vater. Und sie weiß, dass es dort unheimlich kalt ist. Aber sie ist Kälte gewohnt, hat sie doch ihre Kindheit auf Spitzbergen verbracht. Jedenfalls einen Teil davon, bevor ihr Vater beschlossen hat, sich auf die Jagd nach größeren Tieren zu machen. Vorher waren es Walrösser, Füchse und Robben gewesen. In Grytviken sind es Wale. Zwei Jahre hat sie ihren Vater nicht gesehen. So wirklich bedauert Trêve es nicht, denn sie mag nicht, was er tut. Doch nachdem ihre Mutter dahingeschieden ist, hat sie keine Ausrede mehr, warum sie nicht nach Grytviken kommen sollte.
Das ist der Grund, warum sie, in dichten Pelz gehüllt, auf dem Deck der Narragansett steht und sich den eisigen Wind ins Gesicht pusten lässt. South Georgia scheint das eine Ende der Welt zu sein. Genau wie Spitzbergen das andere Ende der Welt ist. Die Flagge der britischen Krone weht an Land, Trêve kann sie sehen, wenn sie die Augen zusammenkneift.
Der Kapitän der Narragansett tritt neben sie. »Miss, wir legen gleich an. Haben Sie Ihr Gepäck?«
Trêve nickt und deutet auf die beiden Reisekoffer zu ihren Füßen. Ist der Alte blind? Ein Wunder, dass sie die vielen Untiefen überhaupt unbeschadet überstanden haben, wenn der Kapitän nicht einmal ein paar Koffer vor seiner Nase sehen kann.
Das väterliche Telegramm in ihrer Brusttasche ist kurz und knapp. Ihr Vater spricht ausschließlich im Befehlston, egal ob per Post oder von Angesicht zu Angesicht. Manchmal hegt Trêve den Verdacht, dass er lieber General geworden wäre. Aber immerhin, er ist Kapitän auf seinem eigenen Walfangschiff. Sie hat mit Erstaunen davon gelesen, dass ihr Vater tatsächlich Erfolg hat und durchaus eine feine Summe Geld sein Eigen nennt.
Die Narragansett beginnt ihr Wendemanöver, um im Hafen von Grytviken anzulegen, während Trêve ihren Blick schweifen lässt. Das also ist ihr neues Heim. Eine sichelförmige Bucht, die Schiffe der Walfänger, das spitze Dach einer kleinen Kirche und viele kleine Häuser. Das Leben hier scheint zu gedeihen, jedenfalls besser, als auf der kahlen Insel vor Spitzbergen.
Es ist Herbst, wenn man das so nennen kann. Oder Spätsommer. Wenige Grad unter null, Sonnenschein, und eine nicht sonderlich dicke Schneedecke, die die Stadt einhüllt. Aus einigen Kaminen dringt Rauch hervor und es wirkt auch sonst alles heimeliger als in Spitzbergen.
Die Mannschaft der Narragansett beginnt mit ihrem Ritual, sie lassen den Anker hinab. Einige brüllen zackige Befehle ins Wasser, die Nixen von South Georgia unterstehen schon seit einer Ewigkeit der königlichen Oberhoheit Englands. Und wenn man es genau nimmt, werden sie wie Sklaven missbraucht. Obwohl natürlich die Sklaverei schon lange abgeschafft ist. Offiziell. Inoffiziell heißt es im Gesetzestext aber, dass die Nixen, als Halbwesen dem Menschen dienlich sein müssen, da ihre tierischen Instinkte, sie für eine Anerkennung zur menschlichen Spezies nicht qualifizieren.
Trêve kennt die Nixen. Sie findet die meisten von ihnen nett, aber viele von ihnen meiden die Menschen. Kein Wunder. Die Nixen von Spitzbergen sehen allerdings ganz anders aus als diese hier. Dort oben, im Norden haben sie blonde Haare und blaue Augen. Hier im Süden wirken sie dunkler. Sie sieht schwarze Mähnen, braune Haut und stählerne Muskeln. Ihre dunklen Flossen glänzen ölig im tiefblauen Wasser.
Einer der Nixenmänner schaut zu ihr hoch. Spöttisch, verächtlich und voller Hass. Trêve tritt von der Reling zurück. Was soll’s? Man kann nicht mit jedem Nix auskommen.
»Hat Ihnen Ihr Vater gesagt, wo Sie ihn finden?«, fragt der dicke Kapitän.
Trêve nickt. »Da hinten. Wo die komischen Dinger stehen«, gibt sie Auskunft. Das Runde sind wohl Silos, wenn sie es richtig deuten kann. Was sich darin befindet, kann sie nur mutmaßen.
Der Kapitän nickt. »Sie können’s gar nicht verfehlen, es ist das letzte Haus am Ort. Die Straße führt genau dort hin. Gehen Sie einfach am Landesteg entlang, dann können Sie es nicht verfehlen.«
»Vielen Dank«, sagt sie lediglich und greift dann nach ihren Koffern. Sie bereut es jetzt schon, so viel mitgenommen zu haben, doch in ihrer Zeit in England, hat sie einiges zusammengetragen, was sie nicht missen will. Immerhin wird sie eine ganze Weile bleiben müssen, wenn sie Pech hat. Begraben in Grytviken, am südlichen Ende der Welt.
Ein junger Mann der Narragansett-Crew eilt ihr hinterher und nimmt ihr einen der Koffer aus der Hand. »Wenn Sie erlauben, Miss?«
»Jetzt ist’s eh schon zu spät«, antwortet sie.
Aber Trêve lächelt trotzdem dankbar. Wer weiß, wann sie mal auf jemanden angewiesen ist? Da ist es vielleicht nicht so klug, sich unnahbar zu zeigen.
Sie verschwindet, gefolgt von dem Seemann im Inneren des Schiffs und steigt zusammen mit ihm die Treppe hinab. Ihre Schritte erzeugen ein unheimliches Echo, ansonsten ist es im Inneren der Narragansett ganz still. Die Motoren sind ausgeschaltet.
»Bleiben Sie, Miss?«, erkundigt sich der junge Mann bei ihr.
»Muss ich wohl«, antwortet sie. Leider, fügt sie in Gedanken hinzu.
»Ist gar nicht so verkehrt hier«, sagt der Fremde beschwichtigend. »Sie wollen ein Kino bauen, damit die Walfänger sich nicht so langweilen. Und das wissenschaftliche Institut ist auch hier, die haben interessante Sachen.«
»Aha«, sagt Trêve, weil ihr nichts Besseres dazu einfällt. Hätte sie doch nur geheiratet. Dann wäre sie noch in London. Nur hat sie dort keinen Mann auftreiben können, der bereit gewesen wäre, sie zu heiraten. Wohl auch deswegen, weil man als Tochter eines Walfängers nicht gerade eine noble Partie abgibt. Außerdem – vielleicht ist das Alleinsein gar nicht so schlecht.
Je tiefer sie kommen, desto lauter wird die Brandung. Die zischende Nixensprache dringt zu ihnen herein und Trêve sieht durch ein Bullauge, wie die Halbwesen die Leinen festmachen.
Endlich weht ein Hauch frischer Luft zu ihr herüber. Die Laderampe ist heruntergelassen worden und sie betreten den Lagerraum der Narragansett, wo bereits die Männer die Waren, die sie an Land bringen wollen, vorbereiten. Unverderbliche Lebensmittel, Feuerholz, Kohle, Pelze, Stoffe - eben all das, was auf South Georgia nicht erhältlich ist. Pelze gibt es natürlich schon, aber Robbenfelle erzielen in der Heimat einen besseren Preis. Also werden sie verkauft. Bevor das Schiff ablegt, wird man es mit den Erzeugnissen aus dem Walfang füllen. Tran, Knochen, Fleisch - auf Eis gelagert.
Unten riecht es streng, denn die Narragansett hat bereits einige Fahrten nach South Georgia hinter sich. Es ist ein gutes, amerikanisches Schiff, das ständig zwischen Heimathafen, England und dem Ende der Welt hin- und herpendelt.
»Ich kann Sie leider nicht nach draußen begleiten, Miss, ich werde an Bord gebraucht.« Der junge Mann scheint das wirklich zu bedauern.
Sie dankt ihm und nimmt ihren zweiten Koffer an sich, bevor sie endlich ins Freie tritt. Der Steg schwankt merklich unter den schweren Lasten, die die Männer aus dem Bauch des Schiffs schleppen, so dass Trêve sich fühlt, als stünde sie auf einer kleinen Scholle.
Eine riesige Lücke klafft zwischen Land und Steg, so dass Trêve erst ihre Koffer hinüberwirft und dann einen beherzten Sprung machen muss, um nicht in die eisigen Fluten zu fallen. Den Männern macht diese Hürde offensichtlich keine Mühe, aber die haben auch alle viel längere Beine als sie.
Im Hafen herrscht reges Treiben. Jemand hat sich die Mühe gemacht, die Straße zu räumen, damit die Menschen trockenen Fußes von hier nach dort gehen können. Überall liegt ein merkwürdiger Geruch in der Luft, der Trêve unangenehm ist. Sie weiß nicht, ob sie sich daran noch gewöhnen wird. Sie erhascht einen letzten Blick auf die Nixen, die in einer geschlossenen Formation abtauchen und dann in den Fluten verschwinden.
Zwei alte Damen rauschen an ihr vorbei, ihre wogenden Pelze sind zurückgeschlagen, weswegen Trêve ihre runzligen Gesichter sehen kann. Die beiden unterhalten sich auf Norwegisch. Trêve spricht fließend Norwegisch seit ihrer Zeit auf Spitzbergen. Die Kolonie in Grytviken ist genauso multikulturell wie ihre alte Heimat, was sie zumindest ein wenig tröstet. An der nächsten Ecke hört sie ein paar Holländer feilschen.
Ein großer Fischstand auf der Ecke lockt mit verführerischen Düften. Gebratener Lachs mit frischen Kräutern mariniert. Das Leben scheint regelrecht zu pulsieren. Zwei Kinder laufen an ihr vorbei. Dunkle Haare, ebenso braune Haut wie die der Nixen. Trêve ist erstaunt, dass man hier überhaupt so braun werden kann. Die zwei Jungs verschwinden hinter dem Stand des Fischhändlers, und sie hört lautes Kichern.
Sie hebt ihre Koffer und stapft die Straße hinab. Ein Laufbursche mit einem Korb Orangen streift sie an der Schulter, wirft ihr einen entschuldigenden Blick zu und bleibt stehen.
»Sie sind neu hier, oder?«
Trêve nickt leicht. Der Bursche nimmt eine Orange aus dem Korb und reicht sie ihr. »Ein Willkommensgeschenk«, sagt er mit einem verschwörerischen Zwinkern und verschwindet in der Menschenmenge.
Sie starrt auf die Orange und steckt sie in ihre Tasche. Vielleicht ist doch gar nicht alles so schlecht hier. Sie schaut sich noch einmal um. Die großen Silos liegen vor ihr. Also muss sie nur der Straße weiter folgen, so wie der Kapitän gesagt hat.
Die vielen Anlegestellen für die Schiffe sind leer. Offenbar sind die meisten Walfänger auf Tour, doch es ist trotzdem noch genug los in Grytviken. Dann wird es vielleicht nicht so langweilig, wenn ihr Vater auf Fang geht. Mit Walfang möchte sie so wenig wie möglich zu tun haben, sie kann es nicht leiden, wenn Tiere getötet oder geschlachtet werden. Aber das wird wohl so gut wie unmöglich zu vermeiden sein.
Je näher sie dem Haus ihres Vaters kommt, desto weniger Menschen sind auf der Straße. Dort, wo die Narragansett angelegt hat, herrschte Trubel. An dem Ort, an dem ihr Vater wohnt, dominiert die Arbeit das Leben.
Ein einziges Walfangschiff liegt in der Bucht, ein paar Jäger sind damit beschäftigt, ihre Fracht einzuladen. Manche von ihnen mustern sie ganz unverhohlen. Einer winkt ihr. Trêve ignoriert die Männer und läuft weiter, bis sie schließlich das letzte Haus an der Straße erreicht. Das Blechdach ist verrostet, aber die Wände frisch gestrichen und ein gemauerter Ofen steht auch davor. Sie hat zwar keine Ahnung, wofür man den braucht, aber er sieht zumindest neu aus. Das lässt sie hoffen, dass ihr Vater nicht nur Unsinn erzählt hat, um ihr South Georgia schmackhaft zu machen. Sie steigt die zwei Treppenstufen zum Haus hinauf, stellt die Koffer auf den Boden und klopft.
Das kleine Bronzeschild mit der Aufschrift Kerrigan baumelt im eisigen Wind. Ihr Herz schlägt schneller, als sie im Inneren Geräusche hört. Sie hat ihn so lang nicht mehr gesehen … Die Tür wird geöffnet und ihr Vater tritt nach draußen. Er sieht völlig verwirrt aus.
»Vater, mach schnell, hier draußen ist es kalt«, sagt sie. Erst dann scheint er zu begreifen, brummt etwas in seinen dichten Bart und hievt ihre Koffer nach drinnen. Im Inneren des Hauses ist es behaglich warm, so dass Trêve endlich ihren Mantel ausziehen kann.
»Mit dir habe ich noch gar nicht gerechnet«, nuschelt ihr Vater. Er wirkt verschlafen.
»Wir sind drei Tage hinter dem Zeitplan«, antwortet sie ein wenig ungläubig.
Wortlos schließt er sie in die Arme. Zu mehr ist er wohl nicht fähig. Er sieht wirklich müde aus und seine Augen liegen in tiefen Höhlen. Seufzend lässt Trêve sich auf einen Hocker, direkt neben dem Feuer, sinken und schiebt ihren Koffer mit dem Fuß ein wenig beiseite.
»Ist alles in Ordnung bei dir?«
»Ja, ja«, murmelt ihr Vater. »Bin nur müde. Hast du alles Nötige in London geklärt?«
Das klingt doch schon viel eher wie ihr alter Herr Vater. Trêve nickt und kramt in ihrer Tasche herum. »Deine Fanglizenz ist auch erneuert worden.«
Ihr Vater nimmt das Schriftstück entgegen und macht ein wohlwollendes Gesicht, streicht ihr sogar einmal über den dunklen Schopf. Dann fällt ihm auf, dass sie eine andere Frisur trägt.
»Du siehst ja aus wie ein Knabe«, schimpft er.
»Vater, ich bin achtzehn. Alle Damen tragen das so. Ich habe es in London gesehen.«
»London«, schnaubt er. »Kein Mensch in Grytviken interessiert sich dafür, was in London Mode ist.«
»Ich muss trotzdem nicht wie ein Bauernmädchen aussehen«, kontert sie.
Alle Frauen tragen ihr Haar kurz. Mit Wasserwelle. Trêve hat gelernt, ihre Haare genauso hinzubekommen, wenn es auch viel länger dauert, als bei der geübten Madame Tourzel, die sie frisiert hat.
Ihr Vater deutet auf eine kleine Tür im hinteren Teil des Zimmers. »Das ist deine Kammer. Du musst sie noch saubermachen, vorher hat mein erster Maat darin gewohnt.«
»Ja, Vater«, antwortet sie, weil sie weiß, dass jede andere Antwort eine Menge Ärger bedeutet.
»Wir können heute Abend plaudern. Aber ich muss mich jetzt wirklich wieder hinlegen. Morgen früh laufen wir aus und ich sollte wach sein.«
»Das macht nichts«, murmelt Trêve und streckt die Hände nach dem Feuer aus. »Leg dich wieder schlafen. Ich wollte dich nicht wecken.«
Ihr Vater nickt unwillig, als überlege er, ob sie tatsächlich die Wahrheit spricht, dann schlurft er von dannen, öffnet die gegenüberliegende Tür und verschwindet dahinter. Trêve bleibt allein am Feuer zurück.
Was für ein Empfang! Typisch ihr Vater. Selbst nach einem Jahr kann er keine großen Gefühle für seine Tochter aufbringen. In Wahrheit kann er das vor allem nicht, weil sie kein Junge geworden ist, das weiß sie von ihrer Mutter. Sie wird sein Handwerk niemals weiterführen. Trêve selbst findet, dass es Unsinn ist, heutzutage haben Söhne ihren eigenen Kopf und geben einen Dreck auf Familienunternehmen. Ihr Vater weiß überhaupt nicht, was in der Welt vor sich geht. Wie auch, wenn er sein halbes Leben im Eis verbringt?
Trêves Kammer ist kein bisschen heimelig, im Gegensatz zum Wohnraum. Es gibt natürlich keine Heizstelle, aber das Bett ist durchgelegen und die Matratze so löchrig, dass sie erwägt, ihre erste Nacht auf dem Teppich davor zu verbringen. Allerdings wird sie sich auf dem kalten Fußboden garantiert den Tod holen. Also wirft sie die Tagesdecke, die sie von ihrer Mutter hat, darüber, und beginnt mit dem Auspacken. Besonders viel ist es nicht, aber die Bücher, die sie in London erstanden hat, trösten sie ein wenig. Ein paar Fotografien gibt es noch, Spitzbergen, ihre Mutter, sie selbst auf einem weißen Pony, sie mit einem Robbenbaby.
Die Bilder stellt sie auf das Regal gegenüber ihres Bettes. Ihre Kleidung findet in einem Wandschrank Platz. Sonst besitzt sie nichts, das sie hätte mitnehmen können, außer ein paar eher sinnlosen Gegenständen: eine Truhe mit Briefpapier und passendem Füllfederhalter und ein paar Schminkutensilien, die Madame Tourzel ihr geschenkt hat.
Keine gute Ausbeute für achtzehn Jahre Leben. Aber es lebt halt auch nicht jeder im ewigen Eis. Als sie mit auspacken fertig ist, erkundet sie auf den Zehenspitzen ihr neues Heim. Das Fenster in ihrem Schlafraum zeigt ihr den tristen Ausblick der eisigen Hügel, aber es scheint zumindest ruhig zu sein. Ein Waschzuber steht draußen.
Nachdenklich geht sie zurück in die warme Wohnstube. Ihr Vater geht morgen auf Waljagd. Was soll sie dann mit sich anfangen? Eine Tour dauert oftmals Monate. Womit kann man sich auf South Georgia die Zeit vertreiben?
Sie erkundet die Kochstelle und die Vorratskammer, die zum Bersten gefüllt ist. Kostspielige Lebensmittel aus anderen Teilen der Welt. Sogar Kaffee. Ihrem Vater scheint es hier nicht schlecht zu gehen. Selbst Schokolade findet sich hier.
Sein leises Schnarchen dringt aus seiner verschlossenen Schlafzimmertür, während Trêve sich umschaut. Ein paar Felle an den Wänden. Öllampen überall an der Decke. Kein Wunder. South Georgia schwimmt ja in Waltran, warum sollten sie also kostspielige Leitungen legen?
Schließlich setzt sie sich an den väterlichen Schreibtisch und klappt die Schranktüren auf und zu. Dokumente, Anträge, Briefe. Sogar zwei Stellenausschreibungen, ihr Vater heuert noch mehr Walfänger an. Sie ist wirklich erstaunt, wie gut die Geschäfte laufen. Das hat sie ihm so nicht zugetraut, denn er gerät ständig in Streit mit seinen Angestellten und sie bleiben alle nicht lang.
Trêve greift nach einem der Füller, wahllos, und zieht irgendein Blatt Papier hervor. Die Tinte, mit der sie ihm eine Nachricht hinterlässt, ist knallrot: Ich bin in der Stadt unterwegs. Komme zum Abendessen zurück.
Obwohl Stadt natürlich übertrieben ist für Grytviken. Doch die Sonne draußen scheint und Trêve ist nicht müde von der langen Reise, auch wenn sie es eigentlich sein sollte. Stattdessen ist sie sogar ein wenig aufgeregt, als sie Stiefel und Mantel anlegt und nach draußen tritt. Ihren Höhepunkt hat die Sonne gerade überschritten, und für das Ende der Welt sind die Temperaturen ganz passabel, sodass sie auf die Kapuze verzichtet.
Die Silos gehören zu einer Fabrik, die die Fänge der Waljäger verarbeitet. Es stinkt bestialisch, als Trêve vorbeiläuft, und sie beeilt sich sehr, fortzukommen und wieder in die belebte und weitaus besser riechende Hauptstraße am Hafen einzutauchen. Auch dort ist nicht sonderlich viel zu entdecken, aber es ist besser als nichts. Es gibt einen kleinen Schmuckstand, der irgendwelche albernen Knochenketten verkauft, die ihr überhaupt nicht gefallen, einen Stand für Felle und Kleidung und dann noch etwas, das ihre Augen zum Leuchten bringt: ein Bücherladen.
Trêve bleibt davor stehen und schaut in die Auslage, doch sie kommt nicht dazu, sie durchzusehen, denn ein Mann rempelt sie an.
»Oh, entschuldigen Sie, Miss.«
Sie blickt auf und erkennt den jungen Mann vom Schiff, der ihr Gepäck getragen hat.
»Sind Sie nicht …?«, fragt sie, stockt aber. Seinen Namen hat er nicht genannt.
Er zieht die Mütze vom Kopf. Dunkelbraune Haare kommen zum Vorschein und seine bernsteinfarbenen Augen zwinkern ihr zu. Ein paar Bartstoppeln am Kinn. Eigentlich sieht er ganz nett aus, nicht wie einer von den typischen, mürrischen Matrosen.
»Kendall Laland mein Name«, sagt er und reicht ihr die Hand.
»Haben Sie mir nicht vorhin noch erzählt, dass Sie an Bord gebraucht werden?«
Er zwinkert noch einmal verschwörerisch. »Verraten Sie mich nicht, Miss, aber ich habe überlegt, ob ich mir nicht eine Auszeit von der Seefahrt nehme. Der Kapitän ist ein Weichei und … offen gestanden, ich kann mir echt Besseres vorstellen, als auf diesem Kutter mein Leben zu verbringen. Hier ist es doch ganz nett.«
»Find ich gar nicht«, erwidert sie. »Ich war zuletzt in London. Das ist ein Leben, kann ich Ihnen sagen.«
»Hat mich nie gereizt. Ich mag die Einsamkeit – in Maßen. Aber in London ist man niemals mit seinen Gedanken allein. Es muss zwar nicht unbedingt das hier sein, aber …« Er zuckt mit den Schultern. Selten hat Trêve einen so sorglosen Burschen getroffen. Jedenfalls vermittelt er eine gewisse Sorglosigkeit. »Ich denke, man kommt hier ganz gut über die Runden.«
»Ich bin dafür die falsche Ansprechpartnerin. Immerhin bin ich nicht länger hier als Sie, Mr. Laland.« Er grinst für Trêves Geschmack ein bisschen zu unverschämt, so dass sie sich zum Gehen entschließt. »Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück.«
Laland scheint den Wink verstanden zu haben und verschwindet in der Menge, weswegen Trêve nun wieder alleine vor dem Bücherstand steht. Eine zahnlose, alte Frau fragt sie auf Norwegisch nach ihren Wünschen, doch sie winkt ab. So viel Geld hat sie nicht, sie muss es sich einteilen. Trêve taucht in die Menschenmasse ein, die sich durch die Straße wälzt. Das hier überhaupt so viele Leute leben! Das hat sie nicht für möglich gehalten.
Die Glocke der Kirche schlägt vier Uhr. Auch das Licht hat sich verändert, es scheint jetzt schon zu dämmern. Das sah in Spitzbergen natürlich anders aus, taghelle Nächte, Mittsommer, Zwielicht. Wahrscheinlich wird es hier um fünf Uhr stockduster, doch Trêve erkennt sogar ein paar Straßenlaternen. Die sind zwar mit Tran gefüllt, aber immerhin, es gibt welche. Vielleicht ist es doch nicht so rückständig hier. Wenn sie die Augen schließt und den Meeresgeruch ausblendet, dann könnte man meinen, auf den Straßen von London zu wandeln.
Es werden, je näher sie dem anderen Ende von Grytviken kommt, weniger Menschen, bis sie schließlich eine völlig unbelebte Straße betritt. Auf einem der Hügel steht ein Haus, das sie als Forschungsstation erkennt. Die vielen Antennen und Apparaturen weisen darauf hin, und alles in allem erinnert sie die Einrichtung an die russische, die es auf Spitzbergen gab.
»Wer bist denn du?« Ein paar blonde Zöpfe und riesige blaue Augen tauchen hinter einem großen Wasserbottich auf. Trêve fällt es schwer, das Alter des Mädchens zu schätzen, vielleicht ist sie achtzehn, vielleicht auch erst vierzehn.
»Ich bin neu hier«, antwortet Trêve wenig geistreich.
Das fremde Mädchen grinst und reicht ihr eine behandschuhte Hand. »Haya Landa. Ich wohne da oben.«
»Trêve Kerrigan«, erwidert sie.
»Ich hab’ mir gedacht, dass du neu bist. Ich hab’ dich hier noch nie gesehen. Und normalerweise kommen um diese Jahreszeit keine Neuen mehr. Also, wieso bist du hier?«
»Ich sehe mich nur um.«
Hayas Augen glänzen im kalten Wind. Sie sieht wirklich sehr kindlich aus. »Das meinte ich nicht. Warum bist auf South Georgia?«
»Weil mein Vater hier arbeitet.«
Das fremde Mädchen grinst über beide Ohren. »Dann geht’s dir wie mir. Mein Vater arbeitet auch hier. Aber der ist ständig mit seinem Kram beschäftigt. Ich langweile mich fürchterlich.«
»Ich glaube, so wird es mir demnächst auch gehen«, murmelt Trêve. »Was machst du denn den ganzen Tag hier?«
Bei Haya hat sie nichts dagegen, dass das Mädchen sie ausfragt. Sie ist allerdings auch nicht so aufdringlich, wie dieser Mr. Laland.
»Ich … also … nicht viel. Manchmal gucke ich den Nixen zu, oder erkunde die Landschaft außerhalb von Grytviken. Das darf mein Vater nicht wissen, aber ich wüsste nicht, was man hier sonst tun könnte, wenn man nicht arbeiten darf.«
Trêve will nicht zu neugierig sein, also fragt sie nicht, wieso Haya nicht arbeitet. Ums Arbeiten hat sie sich bisher noch keine Gedanken gemacht, aber ganz sicher wird sie ihrem Vater bei seinem blutigen Handwerk nicht helfen.
»Soll ich dich rumführen?«
»Wenn du Zeit hast.«
Normalerweise ist Trêve Fremden gegenüber ein bisschen misstrauisch, allerdings fällt es einem schwer, jemandem wie Haya zu misstrauen. Trêve ist es nicht gewohnt, dass Mädchen mit ihr befreundet sein wollen. Die meisten Robbenjäger auf Spitzbergen hatten Söhne, somit ist sie mit Jungs aufgewachsen. Das hier ist neu, aber irgendwie auch ganz nett.
»Wir können bis zum Hafen runtergehen. Es ist schön dort, wenn sie die Lichter anzünden.« Haya läuft voraus, sie hat keine Probleme mit Schnee und Eis, das merkt man ihr an. Sie scheint schon lange an diesem oder an einem ähnlichen Ort zu leben. »Wenn du möchtest, nehme ich dich mal mit nach Leith Harbour.« Haya wirft ihr ein schelmisches Lächeln zu. »Da geht es ein bisschen wilder zu. Oder sagen wir: Es geht überhaupt mal wild zu. Hier ist ja nichts los.«
Trêve ist erstaunt, solche Worte aus diesem Mund zu hören, aber sie nickt dennoch, weil sie nicht unhöflich sein will.
Gemeinsam erklimmen sie den kleinen Hügel, von dem die Straße zurück zum Hafen führt. Es sind mittlerweile weniger Menschen unterwegs, die meisten scheinen nach Hause gegangen zu sein. Die Narragansett liegt düster da, an Bord brennt kein Licht, sie scheinen nicht ablegen zu wollen.
»Woah«, macht Haya. »Das ist mal ein großes Schiff. Normalerweise kommen hier nur kleinere rein.«
»Hm«, antwortet Trêve erst, weil sie nicht weiß, was sie darauf erwidern soll. Dann sagt sie: »Ich bin damit hergekommen.«
»Wie war die Überfahrt?«
»Lang.«
»Du bist nicht sonderlich gesprächig, oder?«
»Es geht so«, murmelt Trêve. Sie ist schon gesprächig. Aber das hier - alles ist so neu und unbekannt. Sie weiß nicht einmal, ob sie sich hier wohlfühlen soll oder nicht. »Ich merke nur, dass ich langsam müde werde.«
»Weißt du was? Komm doch morgen einfach her. Oder sag mir, wo du wohnst, ich hole dich ab.« Haya lässt nicht locker.
»Du kennst mich doch gar nicht«, sagt sie ein wenig verwirrt.
»Mag sein.« Das Mädchen grinst wieder. Sie scheint gerne zu lachen. »Aber du bist die Einzige in meinem Alter. Alle Frauen hier sind entweder uralt oder haben Kinder. Niemand ist wirklich jung. Wenn ich dir auf die Nerven falle, kannst du ja wieder nach Hause gehen.«
»Wie alt bist du denn.«
»Fast neunzehn.«
Trêve ist erstaunt. Haya ist sogar älter als sie. Aber sie benimmt sich nicht so. »Ich wohne am anderen Ende von Grytviken. Da, wo die Walverwertung steht. Die großen Silos da hinten.« Sie zeigt vom Hügel hinunter in die grobe Richtung, wo sich ihr jetziges Heim befindet.
Haya nickt und schiebt ihre blonden Zöpfe wieder unter die Kapuze. »Ich komme auf jeden Fall vorbei. Mein Vater mag keine Gäste.«
»Ach, weißt du, meiner auch nicht, glaube ich. Aber der ist ab morgen auf dem Schiff und bleibt garantiert eine Weile weg.«
»Hast du es gut«, stöhnt Haya theatralisch. »Mein Vater geht nur ganz selten vor die Tür, seine Experimente sind hoch wissenschaftlich und er will sie mir nie erklären. Das ist ganz schön öde bei uns, das kann ich dir sagen.«
Trêve weiß selbst nicht recht, warum, aber wenn man noch nie eine Freundin gehabt hat, dann geht man eben auch auf solche Angebote ein. Selbst wenn sie völlig überstürzt sind.
Haya
Haya Landa hat es mit ihrem Vater nicht immer leicht. Doch aus anderen Gründen als Trêve. Seine cholerischen Anfälle sind bisweilen schwer zu ertragen, und sie ist ganz froh, wenn er über seine Arbeit versunken im Labor sitzt und keine Notiz von seiner Tochter nimmt. Ein Glück, dass es heute auch so ist, denn nachdem sie Trêve verabschiedet hat, ist es im Haus still. Vielleicht ist er auch nur einmal mehr vor seinen Geräten eingeschlafen. Haya weckt ihn nicht, denn an schlechten Tagen reicht das schon für einen Wutanfall, also wirft sie nur ein wenig Feuerholz in den Kamin, damit die Wohnstube nicht auskühlt und macht sich daran, das Abendessen vorzubereiten.
Vom Fenster aus kann sie die Bucht von Grytviken gut überblicken, das ist auch einer der Gründe, warum sie gern kocht. Beim Kartoffelschälen kann man so wunderbar vor sich hinträumen. Das ist auch etwas, das der Vater nicht mag – Hayas Tagträume. Die sind ganz schön verrückt für eine junge Frau, also hält sie sie wohlwissend unter Verschluss. Am Anfang hat sie den Fehler gemacht, Leuten davon zu erzählen. Als es ihrem Vater zu Ohren kam, warf er eines seiner Reagenzgläser nach ihr. Die Narbe an der Schläfe zeugt noch heute davon, das dünne Glas splitterte sofort und hinterließ einen tiefen Riss in ihrer Haut.
Seitdem spielt sie lieber wieder das kleine, naive Mädchen, das ihr Vater am liebsten hat. Wer bekommt schon gern Gläser an den Kopf geworfen? Und die zwei Jungs, denen sie davon erzählt hat, sprechen seitdem nicht mehr mit ihr. Halten sie für verrückt.
Na, und wenn schon. Ihre Tagträume sind schillernd und klangvoll und vor allem sind sie unheimlich für Fremde. Aber nicht für Haya, die ihre Schattengestalten sehr gern hat. Monster, Ungeheuer und Bestien bevölkern sie, und obwohl das nicht normal ist, hat Haya sich an sie gewöhnt. So wie an South Georgia. Sie bezweifelt, dass sie in ihrem Leben jemals etwas anderes sehen wird.
Ächzend zerrt sie den schweren Kochtopf hervor und beginnt damit, Gemüse zu waschen und kleinzuschneiden. Die meiste Zeit funktionieren die Wasserleitungen in Grytviken zwar nicht, aber für den Moment ist es warm genug, dass Haya das Wasser aus dem Hahn nutzen kann. Allerdings ist die Leitung ein Privileg der wissenschaftlichen Station, andere Bewohner von Grytviken müssen sich ihr Wasser draußen holen. Nicht alle, aber die meisten.
»Haya!« Der Schrei geht ihr durch Mark und Bein, ihr Vater kann nur ganz leise oder ganz laut kommunizieren.
Kein Wunder, dass ihre Mutter sich von ihm getrennt hat. Offiziell heißt es natürlich, dass ihr das Klima von South Georgia nicht bekommt, aber Haya kennt die Wahrheit.
»Ich komme«, antwortet sie über die Schulter hinweg, stellt den Topf ab und geht hinüber zu dem angrenzenden Labor ihres Vaters. Heute ist es stockfinster dort drin und nur ein paar Kerzen erhellen den Raum.
»Hast du an das Öl gedacht?«, herrscht er sie körperlos aus der Schwärze an. Seine Stimme kommt von links. Welche Versuche er aufgebaut hat, weiß Haya nicht.
»Schon gestern, Vater. Ich hab’s dir hinter die Tür gestellt.« Das ist so eine Frage, auf die man grundsätzlich nichts Richtiges antworten kann, wenn man mit ihm spricht. Und prompt fällt ihm auch etwas ein: »Ich habe dir verboten, irgendwelche Sachen in meinem Labor abzustellen. Bring es nach draußen.«
»Mache ich.« Sie kneift die Augen zusammen, Haya ist ziemlich lichtempfindlich und wird schnell geblendet.
Sie stößt sich den Arm an einem Regal, dann tasten ihre Finger nach dem Kanister.
»Wogegen bist du gestoßen?«, fragt ihr Vater barsch.
»Gegen ein Regal, glaube ich.«
»Und wie lautet die erste Regel für mein Labor?«
Haya möchte am liebsten schreien, aber sie beherrscht sich: »Nichts anfassen.«
»Korrekt. Gehören da vielleicht auch Regale zu?«
»Ja, Vater.«
»Dann sieh zu, dass du rauskommst. Und mach die Tür zu. Dein Geklapper in der Küche ist mir auch viel zu laut.« Sie verdreht die Augen, was er zum Glück in der Dunkelheit nicht sehen kann und trägt den Kanister mit dem Lampenöl nach draußen. Wofür er es braucht, ist ihr sowieso ein Rätsel, er hat Strom – als einziger in Grytviken.
Sachte schließt sie die Tür und stellt das Lampenöl in die Zimmerecke, bevor sie in die Küche zurückgeht. Manchmal wünscht sie sich, dass ihr Vater einfach verschwindet. Von den Schatten des Labors verschluckt – Schwupp und weg. Das ist einer der vielen Tagträume, die sie immer und immer wieder träumt: Die Schatten an den Wänden vereinigen sich zu einem Strudel, Zähne und Klauen brechen hervor, sie holen ihn, zerren ihn fort und nichts bleibt von ihm übrig, außer seinem grässlichen, grauen Hut, den er ständig trägt. Überhaupt ist alles an ihm Grau. Die Haare, die Haut und auch seine Kleidung. Er ist ein schrecklich trostloser Mensch.
Haya lässt den Blick aus dem Fenster schweifen. Die Narragansett ist mittlerweile hell erleuchtet, sie scheint noch bei Nacht in See zu stechen. Dampf dringt aus dem dicken Schlot und weht zu ihr herüber, vereinigt sich in ihren Gedanken mit den Schatten und bringt ihren Vater fort. Wohin, das weiß Haya nicht und es gibt auch keinen Platz in ihren Träumen für ihn.
Sie schüttelt sich. Manchmal fällt es ihr schwer, sich von ihren eigenen Gedanken zu lösen. Sie weiß auch, dass es nicht normal ist, was sie tut. Aber wer auf dieser Insel bleibt schon normal? So zwingt sie sich, an den nächsten Tag zu denken. Trêve besuchen! Wichtig, nicht vergessen! Sie hat noch nie einen Besuch gemacht, noch nie hat irgendjemand in Grytviken sie überhaupt eingeladen.
Dabei ist Hayas Grund nicht das reine Interesse an Trêve, und das beschert ihr ein schlechtes Gewissen, denn es klingt so nach Ausnutzen. Haya hat beobachtet, wie Trêve am Bücherstand stehengeblieben ist. Das bedeutet, dass sie lesen kann. Und wer lesen kann, kann in der Regel auch schreiben.
Sie selbst kann es nicht, ihr Vater hat ihr zwar Rechnen beigebracht, aber Haya nur drei Jahre in der Schule gelassen. Daher kann sie nur ihren eigenen Namen schreiben, mehr aber nicht. Dadurch, dass sie ständig irgendwo im Packeis vergraben lebt, hat sich auch niemand darum gekümmert.
Dabei ist es für Haya essentiell wichtig, dass jemand ihr beim Schreiben hilft. Aber sie darf nicht mit der Tür ins Haus fallen. Beim letzten Versuch ist es schiefgegangen, sie hat sich mit einem älteren Herrn angefreundet, der ihr versprochen hat, ihre Geschichten aufzuschreiben. Nach der ersten Seite bat er sie zu gehen. Das war in der Taverne von Leith Harbour gewesen. Dieses Mal darf sie es nicht überstürzen. Auf keinen Fall. Trêve ist ihre letzte Chance, auch wenn sie sich da niemals wirklich sicher sein kann. Aber in Hayas Kopf hat sich die Tatsache so festgesetzt. Ebenso wie die andere Tatsache: Schreibt sie ihre Träume auf, verlassen sie endlich ihren Kopf. Denn nicht alle Träume sind angenehm, aber dennoch muss sie sie immer wieder erleben. Ob das wirklich so ist, kann sie natürlich nicht beurteilen, doch es ist Hayas eigene These, und sie ist sogar ein wenig stolz darauf. Falls sie demnächst widerlegt wird … bloß nicht daran denken!
Sie wirft die letzten Kartoffeln in den Topf und entzündet den Herd. Draußen ist kaum noch etwas zu sehen. Sie hört das Schnattern der Pinguine dicht am Fenster. Manchmal füttert Haya sie. Aber das gibt ständig Ärger mit ihrem Vater, also lässt sie es heute bleiben. Er ist eh schon gereizt.
Es wird sehr früh hell in Grytviken, entsprechend schnell ist Haya auf den Beinen, auch um ihrem Vater weiterhin aus dem Weg zu gehen. Sie stellt ihm ein Frühstück vor die Tür, schnappt sich ihre Tasche und verschwindet nach draußen.
Ein paar Grad nur unter null, die Sonne zeigt sich bereits und taut den Schnee auf den Häuserdächern. Überall steigt Rauch aus den Kaminen. Öl, Kohle und Feuerholz sind ein wichtiges Gut auf South Georgia, und immer neue Schiffe schaffen das Gut heran. Die Uhr an der Kirche schlägt sieben und es ist natürlich viel zu früh, Trêve zu besuchen, Haya muss ihre Zeit anders totschlagen. Sie geht hinunter zur Hauptstraße, wo die Fischer gerade anlegen. Manchmal hat sie den Eindruck, dass Grytviken nie schläft, denn sobald die Walfänger zurückkehren, machen sie die Nacht zum Tag. Die riesigen Kadaver müssen so schnell wie möglich verwertet werden, besonders in den wenigen Sommerwochen, in denen die Temperaturen über null liegen.
Dann brennen hinten, am gegenüberliegenden Hügel der Bucht, die ganze Nacht die Laternen und ein merkwürdiger Geruch erfüllt die Luft.
Als sie das Wasser erreicht, tummeln sich dort bereits die ersten Nixen, die den Fischern zur Hand gehen. Sie Gesichter werden von Mal zu Mal verbissener, es gibt neue Gesetze aus England, die ihnen überhaupt nicht schmecken. Haya kann sie leider nicht lesen, obwohl sie am Haus des Bürgermeisters angeschlagen stehen. Das wurmt sie, aber wer soll es ihr beibringen?
Sie winkt einem jungen Nix, der gerade eines der Netze an den Haken des Flaschenzugs hängt. Walkon und sie kennen sich schon eine Weile und er ist eigentlich ganz freundlich.
»Du wirst immer früher wach«, stellt er fest, als er sie erkennt. »Bald stehst du noch im Dunkeln auf.«
Er hat einen merkwürdigen Akzent, so wie alle Nixen. Seine schwarze Schwanzflosse blitzt im Wasser auf, dann lässt er das Netz los und treibt zum Steg hinüber. Manchmal beneidet Haya die Nixen. Das kalte Wasser scheint ihnen nichts auszumachen und sie können problemlos stundenlang unter Wasser bleiben.
Auch das ist einer ihrer Tagträume – die Welt unter South Georgia erkunden.
»Hallo, Walkon«, begrüßt sie ihn. »Schimpfen die Herren nicht, wenn du dich mit mir unterhältst?«
Er rollt mit den Augen. »Tun sie das nicht immer?«
»Wie mein Vater«, erwidert sie lächelnd.
Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Walkon mit ihr spricht. Weil er weiß, dass es ihr nicht besser geht als ihm. Die anderen Nixen interessiert das nicht, für sie sind die Menschen nichts als versnobte, privilegierte Geschöpfe. Walkon aber versteht, dass es Menschen gibt, die nicht anders als Nixen leben. Nur eben an Land. Außerdem ist er noch jung und noch nicht so verbittert wie die anderen.
»Ist die Narragansett gestern noch ausgelaufen?«, fragt sie ihn.
Die Nixen wissen alles, was auf dem Meer vor sich geht, wenngleich sie dieses Wissen auch nicht gerne mit den Menschen teilen.
»Ja, ziemlich überhastet. Haben die Hälfte ihrer Männer hiergelassen. Glaub, die hatten Angst vor etwas.«
»Vor was denn?« Haya weiß, dass die Gewässer um South Georgia und die restlichen Sandwichinseln eigentlich sicher sind. Piraten legen sich nicht mit England an, jedenfalls nicht mehr in diesen Zeiten. Im letzten Jahrhundert mag das ja vielleicht noch so gewesen sein, aber nicht heute.
Walkon grinst verschmitzt. »Ich glaube, sie haben dem Nixengeschwätz zu lange zugehört. Kennst du die Geschichten über Riesenkraken und andere Seemonster?«
Obwohl Haya selbst ja ständig mit ihren eigenen Geschichten vor sich hinlebt, findet sie das doch sehr verrückt. »Wer glaubt denn so etwas?«
»Viele von der Crew haben noch nie Nixen gesehen. Das sind blutjunge Burschen. Da kann man dann schon mal etwas ins Träumen geraten.«
Walkons Lächeln wird noch viel breiter. Seine schwarzen Locken hängen ihm wirr in die Stirn, der Reif aus Seegras, mit dem er sie bändig, hängt schief am Kopf.
Die Fischer brüllen ein paar Befehle, aber der junge Nix reagiert nicht darauf.
»Ihr seid echt unmöglich.« Aber Haya kann sich das Lachen nicht verkneifen.
»Es ist doch schon ein neues Schiff auf dem Weg«, antwortet Walkon leise. »Ich hab’s heute Nacht gesehen, ziemlich weit draußen noch. Denke, es wird gegen Mittag da sein. Es ist also kein Verlust entstanden.«
»Schon wieder? Grytviken scheint ja inzwischen sehr beliebt zu sein.«
»Es kommen immer mehr Walfänger. Scheint eine Goldgrube für euch zu sein«, antwortet der Nix düster.
Er mag es nicht, dass die Menschen Wale jagen. Alle Nixen sind dagegen. Aber sie haben eben auch nichts zu sagen.
»Hey, du!«, schreit einer der Fischer und deutet auf Walkon. »Marsch, zurück mit dir zu den Netzen. Wir sind noch nicht fertig.«
Ohne ein Wort taucht der Nix im Wasser ab, und Haya wirft dem alten Mann einen bösen Blick zu. Aber der Alte reagiert darauf nicht.
Manchmal ist es ein bisschen so, als wäre sie durchsichtig. Niemand pflegt Kontakt zu ihrem Vater oder zu ihr, aber jeder kennt die beiden natürlich. Nur wird ein Wissenschaftler auf einer Insel wie South Georgia irgendwie belächelt. Der tut ja schließlich nichts. Jedenfalls nicht mit seinen Händen. Und sie selbst tut noch viel weniger (wofür sie allerdings nichts kann). In Leith Harbour ist es anders, da weiß niemand, wer Haya ist und was sie in Grytviken tut. Wie in einer anderen Welt.
Sie sieht den Nixen dabei zu, wie sie die letzten Netze einholen und verlässt den Steg schließlich. Einige der Stände auf der Hauptstraße haben schon geöffnet. Einer der Läden hat eine neue Ladung Gläser bekommen und Haya muss geblendet die Augen schließen. Das Glas funkelt und flimmert in der kalten Sonne, wirft seine bunten Schatten auf die frisch geräumte Straße und die kleinen Schneehaufen am Rand.
Die Farben werden lebendig, sie steigen in die Luft empor und vereinen sich, aus dem Strudel steigen Vögel nach oben, große Vögel, die Haya nicht kennt. Ihre langen Schwanzfedern bauschen sich im Wind auf, sie werden heller, orange, rot, gelb. Es sind Phönixe. Sie verbrennen alle vor ihren Augen, als sie nur einmal blinzelt. Ihre Asche verpufft im weißen Schnee.
Haya atmet tief durch. Manchmal übernehmen ihre Tagträume ihr Denken und dann ist es wie in diesem Moment. Kein Wunder, dass viele Menschen sie für einen Sonderling halten.
Die Dame vom Stand mustert sie kritisch. »Willst du was kaufen?«, fragt sie unfreundlich.
Haya verneint.
»Dann geh weiter. Mach Platz für die Kundschaft.«
Das lässt Haya sich nicht zweimal sagen, mit hämmerndem Herzen geht sie schnell davon und bleibt erst stehen, als der Stand aus ihrem Blickfeld verschwunden ist. Allerdings kommt sie sich irgendwie verloren vor. Es ist immer noch viel zu früh, um Trêve zu besuchen. Nicht mal acht Uhr. Wenn sie es sich nicht direkt verscherzen will, dann muss sie warten.
Aber wer seine Zeit in Grytviken verplempern will, der wird von South Georgia bitterlich enttäuscht. Es gibt wenige Dinge, die Spaß machen. Obwohl sie die Gerüchte über das Kino gehört hat, das bald kommen soll. Eine alte Lagerhalle soll dafür herhalten. Im Kino ist Haya noch nie gewesen, aber bewegte Bilder soll es da geben. Geschichten, die man sehen, nicht lesen kann. Eine tolle Erfindung.
Sie entschließt sich, die einzige Teestube der Hafenstadt zu besuchen. Dort kann man immerhin im Warmen sitzen, und niemand sieht, wie man unnütz auf der Straße herumsteht. Außerdem ist die Wirtin freundlich zu ihr. Sie hat ihr sogar schon mal Arbeit angeboten. Aber Hayas Vater war ganz und gar dagegen. Er ist immer dagegen, egal was sie auch anstellt. Beim letzten Mal hat sie einen derben Schlag gegen den Hinterkopf bekommen, seitdem fragt sie natürlich nicht mehr.
Als sie die Tür zur Teestube aufstößt, ist es angenehm warm darin, so warm, dass Haya sogar ihren Mantel abnehmen kann. Darum kümmert sich die Wirtin immer.
»So früh auf?«, fragt die hünenhafte Betreiberin.
Cosma Sorafune ist eine ausgewanderte Halbasiatin, Witwe, und sie betreibt ihr Teehaus so gewissenhaft, als wäre sie noch in Kyoto, wo sie wohl ursprünglich herkommt. Von ihrem deutschen Vater hat sie die Statur, von der Mutter das japanische Äußere. Allerdings hat sie schnell gemerkt, dass sie mit einem waschechten Teehaus nicht weit kommt in Grytviken, deswegen kann man bei ihr genauso Alkohol trinken wie in einer der Tavernen von Leith Harbour.
Aber Haya weiß, dass sie sich freut, wenn man einen Tee bei ihr trinkt. Immerhin importiert sie die Teeblätter extra aus Asien. Sie lässt sich auf einen der wackeligen Stühle fallen und nickt Cosma zu. »Ja. Hab’s zu Haus nicht mehr ausgehalten. Mein Vater macht irgendwelche Experimente und möchte nicht gestört werden.«
Die große Frau lacht leise und nickt. »Wie immer?«
»Bitte.«
Cosma verschwindet hinter ihrem Tresen in die Küche. Ihr gegenüber gibt sich Haya relativ offen, obwohl die Frau nichts von ihren merkwürdigen Träumen weiß. Aber von dem schlechten Verhältnis zu ihrem Vater. Sie hat es Cosma offenbaren müssen, als sie die Stelle abgelehnt hat.
»Weißt du, seit wann der große Dampfer weg ist?«, fragt Cosma, als sie wieder aus der Küche kommt.
In ihrer Hand hält sie eine dampfende Tasse und stellt sie vor Haya auf den Tisch.
»Angeblich sind sie noch heute Nacht gefahren. Ich habe es aber nicht gesehen.«
»Und das freiwillig?« Cosma runzelt die Stirn.
»Sie fürchteten sich wohl vor Seeungeheuern«, erwidert Haya, doch sie verschweigt ihr Gespräch mit Walkon wohlwissend.
Nicht jeder mag die Nixen.
»Seeungeheuer? Meinen sie unsere Nixen?«
»Keine Ahnung. Da waren wohl viele Frischlinge dabei, die irgendwelches Seemannsgarn geglaubt haben.«
Hayas Gedanken beginnen zu Wirbeln so wie zuvor am Stand mit den Gläsern. Sie kneift sich in die Hand, damit nicht dasselbe noch einmal passiert. Sie kann jetzt nicht völlig ausklinken.
»Dummköpfe sagt man auch dazu.«
Manchmal ist Cosma mit ihrer Meinung etwas heftig unterwegs, aber Haya mag das an ihr.
»Dafür kommt nachher ein anderes Schiff. Die Fischer haben eins gesehen.«
»Hoffentlich bringen die meinen Tee«, stöhnt die Wirtin und fasst sich an den Kopf. »Ich sitze langsam wirklich auf dem Trockenen. Meine Kühlkammern sind voller Bier aus den Niederlanden, aber Tee … du hast gerade meine letzte Mischung Schwarztee bekommen.«
Die Tür schwingt auf und zwei Männer betreten die Teestube, die diesen Namen eigentlich gar nicht verdient hat. Cosma verschwindet und geleitet die beiden an einen der Tische, während Haya aus dem Fenster starrt.