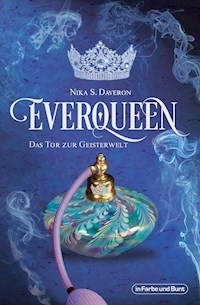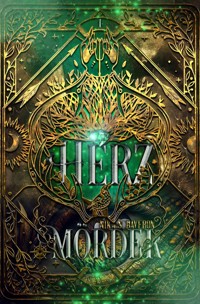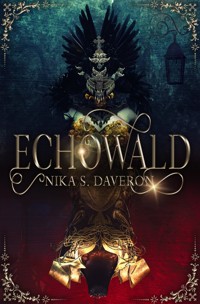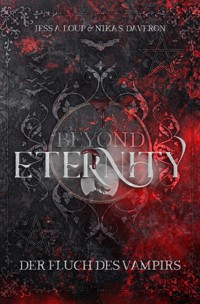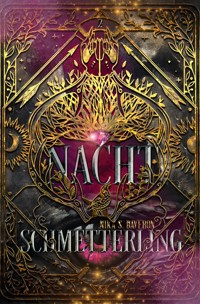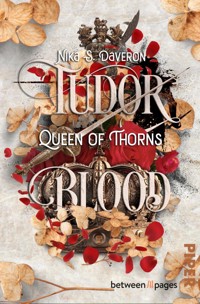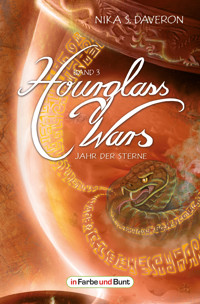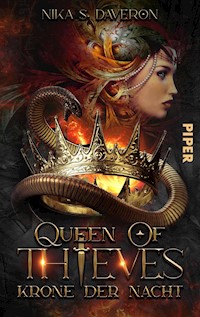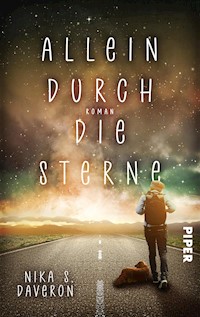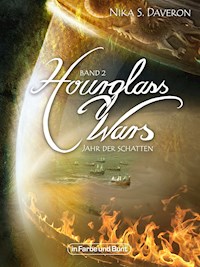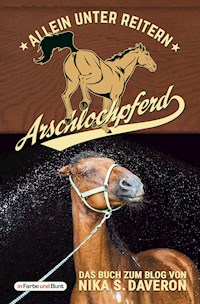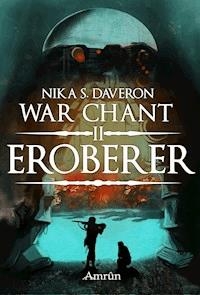
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amrun Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: War Chant
- Sprache: Deutsch
Nach der Eroberung durch die Kukurun, sind zwar die Sieger von Odyssey vertrieben, doch dafür herrscht nun unangefochten der War Chant. Harbinger lebt als Sklavin ohne Erinnerung unter ihnen und fügt sich in ihr Schicksal bis zu dem Tag an dem sie Crawford wiedertrifft, den letzten Sieger von Odyssey. Schnell beschließen sie, dass es nur einen Weg geben kann: Runter von dieser Insel. Doch ohne Hilfe erscheint das aussichtslos. Verfeindete Rebellengruppen liefern sich erbitterte Kämpfe mit den Eroberern und Harbinger und Crawford werden in einen Krieg verwickelt, den sie eigentlich schon vor langer Zeit verloren haben. Der zweite Teil der dystopischen Reihe von Nika S. Daveron.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
War Chant II
Eroberer
Nika S. Daveron
© 2017 Amrûn Verlag Jürgen Eglseer, Traunstein
Covergestaltung: Christian Günther
Lektorat & Korrektorat: Jessica Idczak
Alle Rechte vorbehalten
ISBN – 978-3-95869-561-0
Besuchen Sie unsere Webseite:
http://amrun-verlag.de
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Eroberung.
Nach der Eroberung begann eine neue Zeitrechnung auf Odyssey. Das Jahr 1 nach der Eroberung, 1 ndE. So heißt die Zeitrechnung jetzt. Odyssey wird nicht mehr von den Siegern beherrscht, sondern von den Eroberern. In ihrer Sprache: Kukurun. Die meisten Bewohner von Odyssey sprechen ihre Sprache nicht, aber sie haben Dolmetscher, damit sie ihren Sklaven Befehle geben können.
Sie begannen damit, die Überlebenden zusammenzutreiben und zu kennzeichnen. Wir sind nun Eigentum. Ich folge meinem Herrn, wann immer er Begleitung benötigt, doch der Dolmetscher ist der einzige, der das Wort an mich richtet. Akemi heißt mein Herr und er ist ein wichtiger Mann, er trägt die buntesten Papageienfedern, die ich je gesehen habe. Je bunter sich ein Kukurun kleidet, desto wichtiger ist er. Die Sklaven tragen nur Grau, Weiß oder Schwarz, je nach Dienst, den sie verrichten. Ich bin Haussklavin und deswegen trage ich Weiß. Die, die auf den Straßen arbeiten, tragen Grau. Und die Menschen, die wirklich gefährlichen Dinge auf Odyssey tun, Schwarz.
Akemi gab mir den Namen Turmalina und brandmarkte mich mit seinem Zeichen, einer roten Hand mit fehlendem Ringfinger. Wenn ein Sklave nicht spurt, trennt Akemi ihm den Ringfinger ab. So können sie ihren Dienst noch verrichten, erleiden aber dennoch unsägliche Schmerzen.
Mein Herr lebt im Bunker, dem ehemaligen Senat der Sieger, unweit von den Trümmern des Käfigs, dessen Stahlstreben wie stumme Mahnmale in der Mitte von Odyssey aufragen. Mitten drin: der War Chant, Kriegsmaschine und Gott der Kukurun. Sie zwangen jeden vor ihm auf die Knie.
Sie richteten den Käfig für ihn her, denn die Eroberer wollten nicht auf ihr Vergnügen verzichten. Es war nicht einfach für sie, weil der eigentliche Käfig sich nicht ersetzen ließ. So große Stahlstreben gab es auf Odyssey nicht mehr. Doch sie richteten die Tribünen her, soweit es ihnen möglich war, und auch Teile der Katakomben.
Weil es nur so wenig Überlebende auf Odyssey gab, gingen ihre Bauvorhaben viel zu langsam voran und wir lebten alle noch immer auf derselben Müllinsel, die es vorher gewesen war. So erzählte man es mir zumindest.
Akemi, auch wenn er nicht mit mir direkt sprach, sagte einmal zu seinem Dolmetscher, er habe mich schon während der ersten Invasion der Eroberer nach Aquarius mitgenommen und mich anschließend zur zweiten wieder mit nach Odyssey gebracht.
Daran kann ich mich jedoch nicht erinnern. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, vielleicht war ich zu klein, um mich daran zu erinnern. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Aber wen kümmert es?
So lebte ich in Akemis Gefolge im Bunker, einem hässlichen Klotz aus Stein, und war dankbar, dass er kein Interesse an mir zeigte, sondern an einer kleinen Sklavin namens Taruma, die ständig das Bett mit ihm teilen musste. Taruma hätte hübsch sein können, wenn sie nicht nur aus Haut und Knochen bestanden hätte, doch die Kukurun sahen es nicht gern, wenn ihre Sklaven satt waren. Nur hungrige Sklaven waren gute Sklaven.
Ich verrichtete meine Arbeit in der Küche, räumte den hohen Herrschaften ihre Sachen hinterher und sprach kein Wort. Niemals. Ich war stumm. Ob stumm geboren oder nicht, wusste ich nicht. Aber selbst wenn ich mir Mühe gab, aus meiner Kehle kam nie mehr als ein Krächzen. Daran hatten sich die meisten Sklaven schon gewöhnt, obwohl sich einige Vorwitzige öfter einen Spaß daraus machten, mir Fragen zu stellen, die ich nicht mit einem Nicken oder Kopfschütteln beantworten konnte. Wenn sie das taten, hätte ich sie am liebsten erwürgt, doch Sklaven, die aufeinander losgingen, standen schneller unter Arrest, als sie auch nur »Ich war es nicht« sagen konnten – und ich konnte nicht einmal das.
Wir mussten Lämmer sein. Lämmer unter Wölfen. Sanftmütig, gehorsam und wenn nötig, dienten wir auch als Nahrungsmittel. Ich wusste, dass die Kukurun Menschenfleisch nicht verschmähten.
Zum ersten Mal kam ich mit dieser Tradition in Berührung, als ich durch die zertrümmerten Straßen von Soyuz schlich, mit dem Auftrag, einen Fischer herbeizuholen. Der hohe Herr brauchte jemanden, der die Fische ausnehmen konnte, die man in seine Küche brachte. Ich trug ein Papier mit mir herum, das den Befehl meines Herrn beinhaltete und das ich selbst nicht lesen konnte.
Aus der Ferne hörte ich die allgegenwärtige Musik des War Chants, der eine irre Mischung aus Riesenspieluhr und Kriegsmaschine darstellte. Wann immer er aktiv war, dudelte er seine scheußliche Melodie, die überall auf der Insel zu hören war. Ein frischer Wind verriet mir, dass die Insel sich momentan irgendwo im Norden befand – es war nur sehr selten so kalt. Ich zog meinen weißen Umhang enger um mich und machte größere Schritte.
Irgendwo zwischen den Trümmern roch ich es: gebratenes Fleisch. Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Wie lang hatte ich so etwas nicht mehr gerochen? Abrupt blieb ich stehen und wollte den Ort der Versuchung lokalisieren. Vielleicht konnte ich jemandem etwas von dem Braten abkaufen? Ich besaß ein paar eigene Muscheln und verwahrte sie immer in meinem Kittel.
Mit Muscheln konnte man hier zwar nur bei Menschen aus Odyssey etwas kaufen, aber es reichte, um sich hin und wieder einen Leckerbissen zu gönnen. Was das betraf, waren die Eroberer kulant. Eigene Muscheln, die man sich dazuverdiente, durfte man auch ausgeben. Sie hatten ein merkwürdiges Gemisch aus drakonischen Strafen und lockeren Regeln, die man übertreten durfte, wenn einem danach war. Damit hielten sie die Sklaven ruhig. Die Ungewissheit war es, wodurch sich kaum jemand irgendetwas traute, denn man wusste nie, ob das Vergehen nun als Nichtigkeit oder als unverzeihliche Straftat behandelt wurde.
Ich hörte Stimmen: Sie sprachen Kukurun, nicht die Sprache der Sieger, wie man unsere nannte. Mein Mut sank und ich wollte eigentlich in die entgegengesetzte Richtung davonlaufen, als ich die Kreuzung passierte, doch ich blieb stehen.
»Komm mal rüber, Junge«, brüllte der Dolmetscher, als sie mich sahen.
Dass ich für einen Jungen gehalten wurde, passierte mir ständig, es lag daran, dass mein Herr Akemi all seinen Sklaven die Haare abrasierte – außer natürlich seiner Bettsklavin.
Ein paar höher gestellte Herren waren offensichtlich auch dabei, denn ich sah ein paar bunte Kleckse, die sich um ein rauchendes Feuer geschart hatten. An ihren roten Federn erkannte ich, dass sie zum Militär gehörten. Darunter befand sich ein Kopfputz aus roten Federn, der jetzt in der Abendsonne schillerte.
Ich konnte mich schlecht widersetzen oder ihnen mitteilen, dass ich für Herrn Akemi unterwegs war, also ging ich zögerlich hinüber, während der Dolmetscher schimpfte, warum ich so langsam war.
Aber ich war wie gelähmt. Der Anblick des frischen Fleischs weckte meinen Hunger, doch die Anwesenheit der vielen Kukurun-Soldaten machte mir Angst. »Willst du was abhaben?«, fragte der Dolmetscher mich.
Die fünf Kukurun schnatterten aufgeregt und lachten dabei. Dann traten sie beiseite und gestatteten mir einen Blick auf eine junge Frau, die weinend im Staub lag. Ihr Körper krampfte sich zusammen. Sie schluchzte herzerweichend und ich hatte augenblicklich Mitleid mit ihr. Was würden sie ihr antun? Die Frau trug das Grau der Sklaven, doch ihren Kittel hatte man aufgerissen und ihre blanken Brüste blitzten hervor. Hatten sie sie vergewaltigt?
Zorn kroch in mir hoch und ich starrte den Dolmetscher herausfordernd an.
»Was is‘ nun?«, fragte er mich in akzentfreier Siegersprache. Ich mochte die Leute nicht, die als Dolmetscher fungierten. Sie benahmen sich nie besser als die Eroberer. Bei uns in der Küche wurde oft über sie gesprochen. Sie waren Abschaum, hatten schnell die Zeichen der Zeit erkannt und waren auf Seiten der Eroberer gewechselt, hatten ihnen Tür und Tor auf Odyssey geöffnet. Unsere Köchin schimpfte ständig über sie und sie zettelte mit allen Dolmetschern Streit an. Deswegen fehlte ihr auch ein Ringfinger.
Ich deutete artig auf mein Brandzeichen, wie man es von mir verlangte, und wartete. Was hätte ich auch tun sollen? Ich konnte ja nicht sprechen.
Der Eroberer, der mir am nächsten stand, riss mit spitzen Fingern eine Keule vom Fleisch, obwohl das Feuer irrsinnig heiß sein musste, und stopfte sich ein Stück davon in den Mund. Die Frau schluchzte noch lauter und einer der Soldaten gab ihr einen Tritt. Seine Worte verstand ich nicht. Kukurun war eine grausige Sprache, die in den Ohren schmerzte, und mein Hirn weigerte sich, sie zu verstehen.
»Das ist ja schön«, sagte der Dolmetscher mit den Schweinsaugen und dem runden Gesicht. »Aber ich hab dich gefragt, ob du was davon willst.«
Ich schüttelte schnell den Kopf. Irgendetwas ging hier vor sich und ich war mir sicher, dass ich etwas Grausames dafür tun müsste, vielleicht der Frau wehtun oder …
Der Eroberer mit der Keule schwenkte das Fleisch in meine Richtung und sagte mit vollem Mund ein paar Worte zum Dolmetscher.
»Er sagt, du sollst was nehmen, es ist genug für alle da.«
Ich schüttelte nachdrücklicher den Kopf und zeigte nun verzweifelt auf mein Brandzeichen. Könnte ich doch nur sprechen! Ich hätte ihnen eine wortreiche Entschuldigung geliefert, warum ich nichts essen dürfte, nur um dieser Situation irgendwie zu entgehen. Ein anderer Kukurun stand nun auf, gab der am Boden liegenden Frau einen Tritt und kam herüber. Auch er schnatterte etwas. Er sah aus wie ein fetter, böser Papagei. Mit Krummsäbel und einem großen Maschinengewehr.
»Iss!«, herrschte der Dolmetscher mich an. »Du bekommst so etwas Gutes nie wieder. Die Herren haben dich ausdrücklich dazu aufgefordert!«
Die Frau krümmte sich auf dem Boden, ihr blondes, schmutziges Haar war voller Algen und Dreck, vermutlich Kot, so wie sie roch. Sie sah fürchterlich aus. Als wäre sie nicht mehr lebensfähig. Die meisten ihrer Zähne hatte sie verloren, das konnte ich sehen, als sie mich nun direkt anblickte.
Ein merkwürdiges Leuchten huschte plötzlich über ihr Gesicht, als sie ihren zahnlosen Mund öffnete und sagte: »Lauf!«
Ich wollte tun, was sie sagte, sie musste wissen, was hier geschah oder geschehen würde, doch ich konnte nicht, ich war wie erstarrt. Der Soldat hielt mir die fettige Keule abermals vor die Nase und sagte in der Siegersprache: »Iss.«
Zögerlich nahm ich den halb abgenagten Knochen entgegen und schaute mich unsicher um. Es hatte zu regnen begonnen und das Feuer zischte aggressiv vor sich hin, während die Augen der Eroberer sich nun auf mich richteten.
Ich war nicht so naiv zu glauben, dass sie mir einfach so eine Freundlichkeit anbieten wollten, halb erwartete ich, dass das Fleisch verdorben, oder vergiftet sein würde, doch es schmeckte angenehm und war gut gewürzt. Nur hatte ich keine Ahnung, von welchem Tier das sein sollte. Allerdings bekam ich meistens sowieso nur Hund, was wusste ich schon über Fleisch?
Hunde gab es auf Odyssey in Massen, früher hatte es hier eine Hunderennbahn gegeben. Während der Invasion waren die Hunde von dort entkommen und hatten sich unkontrolliert vermehrt.
»Schmeckt‘s?«, fragte der Dolmetscher.
Ich nickte zaghaft und gab die Keule zurück, leckte mir über die Lippen und wartete, was sie sich nun einfallen ließen.
Die Kukurun stießen sich gegenseitig gegen die Rippen und lachten abscheulich, während sie auf die Frau zeigten, deren Augen nun völlig leer waren. Sabber lief aus ihrem geöffneten Mund und plötzlich würgte sie Galle hervor, direkt auf meine weißen Stoffschuhe, die mir Akemi gerade hatte anfertigen lassen.
Ich musste mich zusammenreißen, um es ihr nicht nachzutun.
»Tagar«, blubberte es aus ihrem Mund.
Ich hätte gerne gefragt, was sie damit meinte, aber als der erste Blitz plötzlich den Abendhimmel durchbrach, wurde es mir schlagartig klar. Das war ein Name. Der Name des … Kindes, das ich gerade gegessen hatte.
In meinem Gesicht musste sich wohl Erkenntnis abgezeichnet haben, denn die Kukurun fingen an, wie auf Kommando zu lachen und zu prusten, und der Dolmetscher grinste ebenfalls über beide Ohren. Statt nun die Augen zu senken, mich zu übergeben oder mich einfach respektvoll zu entfernen, holte ich aus und schlug dem hässlichen Schweinsgesicht von Dolmetscher die Schneidezähne aus.
Obwohl ich erwartete, dass die Kukurun mich bald für mein Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen würden, geschah eine ganze Weile überhaupt nichts. Ich lebte mein Leben als Sklavin, das zwar nicht besonders ereignisreich war, aber unter den Umständen immer noch besser als gar nicht zu leben. Ich wusste, wie die Eroberer mit ihren erbeuteten Inseln umgingen.
Umso erstaunter war ich, dass ich meinen Herrn kaum ein paar Tage später in den Käfig begleiten durfte, was mir bisher nicht erlaubt gewesen war.
Der Käfig war eine ehemalige Arena, voll mit rotem Sand und einem Gittermuster, das nur noch zur Hälfte stand. Die Eroberer feierten hier ihre prachtvollen Feste für den War Chant und die Opferzeremonien.
Die Opferzeremonien kannte ich sonst nur vom Hören, mein Herr hatte mich niemals mitgenommen, als wir noch auf Aquarius gelebt hatten. Doch an irgendeinem hohen Feiertag, der mir nicht geläufig war, nahm er mich mit. Nicht nur mich, nein, auch seine liebste Bettsklavin Taruma und ein molliges Mädchen aus der Küche mit schwarzer Haut. Angeblich eine Beute vom Festland. Yarna hieß sie und erzählte manchmal von hohen Bäumen, Tieren, die ich nie zuvor gesehen hatte, Steinen und Konstruktionen von Menschenhand, die bis in den Himmel wuchsen. Wir anderen hatten sie jedoch alle im Verdacht, sich bloß wichtigmachen zu wollen, schließlich wusste jeder Mensch auf dieser oder einer anderen Müllinsel, dass das Festland schon lange im Meer versunken war.
So marschierte unsere kleine Prozession eines Abends durch die leeren Straßen. Fackelträger wiesen uns den Weg und begleiteten uns hinauf zu den Überresten des Käfigs. Darin stand, golden im Fackelschein glänzend, der War Chant. Gott und Maschine der Kukurun, eine Kriegsmaschine und eine Spieluhr. Seine schaurige Melodie konnte einem den Schlaf rauben, wenn man nachts davon geweckt wurde. Sie besagte nichts anderes, als dass Menschen starben, wann immer sie erklang.
Mein Herr war in Begleitung einiger anderer hochgestellter Kukurun und beachtete uns kaum. Ich ging am Ende des kleinen Trosses, während Taruma mir einige Informationen über die Hohen Herren gab.
»Der rechts ist ein Knabenliebhaber. Aber nur ganz junge.«
Ich schüttelte mich. Ekelhaft. Ich verstand nicht, was jemand in seinem Alter, der Kukurun war bereits ergraut, mit kleinen Jungen im Sinn hatte.
»Und der andere steht auf ganz ekelhafte Sachen.« Sie kicherte hinter vorgehaltener Hand. »Ich sage nur so viel: Glitschige Fischinnereien spielen dabei eine große Rolle.«
Ich winkte ab. Aber Taruma schien das nicht zu stören. Wenn man stumm ist, fühlen sich die Leute meistens genötigt, die Stille füllen zu müssen.
»Ich bin wirklich froh, dass mein Hoher Herr ein ganz normaler Mann ist. Gut, er mag gerne mehrere Mädchen auf einmal, aber …«
»Psst,« zischte Yarna. »Die Herren hören dich.«
Schon allein die Tatsache, dass Yarna problemlos unsere Sprache und die der Kukurun sprechen konnte, war für mich ein Zeichen, dass ihre Festlandlüge keinerlei Grundlage hatte. Wieso hätten sie dort unsere Sprache sprechen sollen? Wahrscheinlich war sie nur eine Kukurun, die ihre Freiheit verloren hatte. Auch das gab es im merkwürdigen Konstrukt der Schichten im System der Kukurun und es war nicht selten, dass einer von ihnen aufgrund von Schulden oder Verbrechen seine Freiheit verlor.
Wir erreichten den Eingang des Käfigs, ein halb zerfallener Torbogen, der vor Ruinen aus Metall stand. Dahinter gab es Tribünen, die, obwohl ich es nicht sehen konnte, dicht gefüllt sein mussten. Die Stimmen der Besucher drangen bis zu uns auf der Straße herunter. Anscheinend war es ein sehr großes Fest.
Ich wartete, bis mein Herr sich von den anderen Kukurun getrennt hatte und uns herbeiwinkte.
Lediglich ein zweiter Mann begleitete uns. Er trug elegante grüne Federn am Gürtel und im Haar. Seine Haut war weiß bemalt.
»Mitkommen«, brummte er. Es war selten, dass überhaupt ein Eroberer unsere Sprache konnte.
Ich folgte dem kleinen Trupp durch das Tor, wo wir bereits von weiß verschleierten Dienerinnen in eine Loge gelotst wurden. Mein Herr hatte viel Einfluss auf Odyssey, er besaß sogar eine Privatloge, wo bereits ein Festmahl aufgefahren wurde. Einziger Nachteil: Man saß sehr tief, sodass man zum War Chant aufsehen musste, der nun mit einem Ruck zum Leben erwachte.
Mein Hoher Herr nahm auf einer Liege Platz und forderte Taruma auf, sich auf den einzigen Stuhl in der Loge zu setzen. Yarna und ich blieben an der Brüstung stehen und schauten hinunter in den roten Sand. Wie er sich wohl anfühlen mochte? Ich hatte noch nie Sand berührt.
Die Fackeln im Käfig wurden erstickt und ließ seinen Kopf rotieren, begleitet vom Chor der begeisterten Eroberer, die seinen Namen skandierten. Mich ließ dieses Ding nur erschaudern. Mir wäre nicht im Traum eingefallen, ihn zu bejubeln, solange mich niemand dazu zwang.
Ein Kukurun mit einem Kopfputz aus roten Federn, reckte die Faust aus seiner Loge und brüllte ein paar Worte.
Aus einem weiteren Tor, das in ein noch intaktes Gebäude führte, wurden zwei Gefangene geführt. Bei einem von ihnen stockte mir der Atem: Es handelte sich um einen kaum zehnjährigen Jungen. Er war klein und dürr, hatte schwarzes Haar und dunkle Haut. Der andere war ein Sieger, das erkannte ich an seinem Ledermantel und der Mütze, die er falsch herum trug. Vielleicht war er auch kein Sieger und sie hatten ihn nur in eine Siegermontur gesteckt.
Ich wusste, wie die aussahen, mein Hoher Herr hatte meine Anwesenheit befohlen, als er einige von ihnen aus ihren Häusern vertrieben hatte. Der Dolmetscher hatte mir versichert, dass es die letzten von Odyssey waren.
Wieder laute Rufe von Seiten der Kukurun, dann drehte sich der War Chant gemächlich zu seinen Opfern um. Ob ihn jemand steuerte, konnte ich nicht sagen, ich hatte gehört, dass er eine eigene Intelligenz besaß. Ob das aber wirklich so war, konnte ich natürlich nicht nachprüfen.
Der vermeintliche Sieger rannte los, in Richtung der hohen Metallgitter des ehemaligen Käfigs. Auf der anderen Seite hielten die verschleierten Kämpfer der Kukurun Wache und sorgten dafür, dass niemand einfach so ihre Arena verließ. Der Mann rannte schnell, der Junge hingegen blieb einfach stehen. Ich konnte sein Gesicht zwar nicht sehen, doch ich war mir sicher, dass er Todesangst hatte.
Ich konnte noch im letzten Moment die Augen schließen, als ein Jubelschrei durch die Kukurun ging. Ich öffnete meine Augen erst nach einer ganzen Weile wieder. Der Junge war fort. Nachdem der War Chant sich wieder in Bewegung setzte, erkannte ich den matschigen Fleck im Sand des Käfigs, der aus Knochenresten, Fleisch und Gedärmen bestand. In einer einzigen Sekunde hatte der War Chant sich das erste Leben geholt, das man ihm versprochen hatte. Und ich hatte keine Zweifel daran, dass er sich auch noch das zweite holen würde.
Über die Treppe kam der Eroberer, der unsere Sprache beherrschte, zu uns herauf und vertrieb Taruma von ihrem Stuhl, was mein Herr missbilligend mit ansah. Rasch holte er seine Lieblingssklavin zu sich auf die Liege, wo er an ihren Brüsten herumfingerte, während er Yarna fortschickte. Sie verschwand daraufhin und ich beneidete sie im Stillen dafür. Etwas zu tun zu haben, bedeutete auch, woanders hinsehen zu dürfen.
Während ich mich bemühte, meinen Blick auf die halb eingestürzte Tribüne gegenüber zu richten, bemerkte ich zunächst nicht, dass in meiner Loge nur noch geflüstert wurde. Als wollten sie nicht, dass ich etwas mitbekam. Wie lächerlich, wem hätte ich es erzählen sollen?
Ein Aufschrei ging durch das Publikum, dann stampfte der War Chant beinahe gemütlich mit gedämpfter Melodie in die Mitte des Runds und ließ den Rumpf rotieren.
Ich sah gerade noch, wie er eine blutige Klinge zurückzog, dann gab es plötzlich einen Tumult auf den oberen Reihen. Laute Buhrufe durchzogen die Nacht und es wurde sogar Müll in den Sand geworfen.
Mein Herr sprang auf und beriet sich schnatternd mit dem anderen Kukurun. Jetzt war sogar Tarumas Busen vergessen, den sie nun auch hastig wieder bedeckte und ängstlich zurückwich.
Schnaufend kehrte Yarna mit einem Krug zurück. Wahrscheinlich Wein oder Schnaps. Die Kukurun bauten sowohl Getreide als auch Wein an.
Mit einer Verbeugung reichte sie dem Hohen Herrn den Krug, doch der schlug ihn ihr aus der Hand.
Er packte Yarna am Kragen und schleifte sie an mir vorbei zur Brüstung. Ich sah die Panik in ihren Augen, wollte erst meine Hand nach ihr ausstrecken, doch meine innere Stimme hielt mich zurück. Mein Herr brüllte lauter als die wütende Meute, die daraufhin verstummte. Anschließend skandierten sie seinen Namen, als er Yarna mit erstaunlicher Kraft über die Brüstung warf. Obwohl wir nicht hoch saßen, hörte ich doch das unheilvolle Knacken, und als ich hinunterschaute, bemerkte ich, dass ihr Arm in einem fürchterlichen Winkel abstand.
Weinend kroch Yarna durch den Arenasand und flehte in der Sprache der Kukurun um Vergebung. Doch statt Gnade walten zu lassen, wurden plötzlich mehr und mehr Sklaven in die Arena geschleift. Manche Eroberer taten es wie mein Hoher Herr und warfen ihre Sklaven einfach kopfüber aus den Logen. Ich sah einen, dem sofort das Genick brach. Andere schleppten sie persönlich bis hinunter in den Sand.
Erschrocken trat ich von der Brüstung zurück, als die Musik des War Chants aufjaulte, doch der zweite Kukurun, der Gast meines Herrn, packte mich am Genick und schob mich nach vorn. Halb erwartete ich, dass er mich ebenfalls hinunterwerfen würde, doch er sagte nur: »Anschauen.«
So musste ich mir den gesamten Rachefeldzug des War Chants an den Menschen ansehen. Wie er sie verbrannte, zerbrach, zersägte und ganz zum Schluss Yarnas Schädel unter seinem riesigen Fuß zermalmte. Applaus brandete von den Tribünen auf. Erst dann lockerte der Kukurun den Griff um meinen Nacken. »Hättest du sein können, Sklavin!«
Als ich zurücktrat, sah mein Herr mich auf merkwürdige Weise an. Er sagte zwei Worte zu dem anderen Kukurun und der klärte mich auf: »Böse Sklavin.«
Ich erstarrte. Er wusste es also …
Ich bezahlte für meinen Frevel, wenn auch nicht in dem Maße, als hätte ich einen Eroberer geschlagen. Odysseys Einwohner waren so gut wie vogelfrei und auch die Dolmetscher hatten da einen nur wenig besseren Stand, auch wenn sie gerne so taten. Ich wurde entsprechend meines Vergehens weggesperrt und drei Tage in einer dunklen Kammer gelassen. Morgens warf man mir einen Schwamm in die nasse Zelle, damit ich nicht verdurstete, und ansonsten kam niemand. Und Akemi sprach, nachdem er mich hervorgeholt hatte – natürlich mit ein paar mahnenden Worten seines Dolmetschers, nie wieder darüber. Doch ansonsten geschah nichts. Wenn man mal davon absah, dass Schweinsgesicht von diesem Tag an auf der Lauer lag, um mich zu erwischen. Das erzählte mir jedenfalls Budysa, eine Küchensklavin, die als eine der wenigen manchmal mit mir sprach. Niemand hatte Lust darauf, sein Gespräch einseitig zu bestreiten, aber Budysa hörte sich sowieso am liebsten selbst reden und hatte kein Problem mit mir.
»Wirklich, Turmalina«, sagte sie, kurz nachdem man mich aus der Zelle geholt und in die Küche geschickt hatte. »Der Kerl sucht nach dir. Sieht fürchterlich aus, die ganze Fresse verschmiert, die Lippen aufgeplatzt und alle Vorderzähne ausgeschlagen. Ich habe selten so gelacht wie heute Morgen, wo ich ihn direkt vor dem Bunker angetroffen habe.«
Als sie mein zweifelndes Gesicht bemerkte, fügte sie hinzu: »Dir passiert schon nichts. Der Hohe Herr Akemi musste dich nur bestrafen, weil du das Eigentum von einem Eroberer beschädigt hast. Sonst nichts. Das ist, als hättest du einem von den Bunker-Kukuruns den Teppich verschmutzt. Wenn der Dolmetscher dich anfasst, werden Akemis Sklaven dich beschützen, darauf kannst du Gift nehmen.«
Gerne hätte ich ihr von dieser ekelhaften Szene in der Gasse erzählt, um sie zu warnen, aber das ging ja nicht. Und sicher war ich mir auch nicht, was die Sklaven tun würden, wenn mich Schweinsgesicht wirklich jagen sollte. Allerdings konnte ich mich ja anscheinend auf meine Faust verlassen. Mit einem einzigen Schlag vier Zähne zu erwischen und eine Lippe zum Aufplatzen bringen, war ja immerhin auch etwas. Ich blickte auf meine schmutzigen Hände hinab und schüttelte mich. Als könnte ich Schweinsgesichts Spucke noch daran riechen. Ich brauchte dringend ein Bad.
»Wirst du heute Abend noch irgendwo gebraucht?«, fragte Budysa mich.
Ich schüttelte den Kopf.
»Dann geh ins Bett. Ich kann den Käse auch ohne dich schneiden.«
Ich nickte ihr zu und stand auf. Woher hatte sie nur den Käse? Die Eroberer hatten viele Dinge mitgebracht, die man hier kaum kannte. Käse … Ich erinnerte mich zwar nicht an meine Mutter als Person, aber an ihre Worte: »Käse gibt es nur an hohen Feiertagen, Kleines. Wenn du dir einen davon wegnimmst, werde ich böse. Hast du das verstanden?«
Ich musste sehr klein gewesen sein, als sie das zu mir sagte, denn ich nahm an, dass meine Mutter wohl nicht jahrelang mit mir gesprochen hätte, als wäre ich ein dummes Kleinkind. Obwohl ich nicht sehr viele Erinnerungen an die Zeit vor den Eroberern hatte, zwei Szenen waren mir stets präsent: Ein Junge, der auf einer Veranda saß und mich anlächelte, und ein Mann. Wer der Junge war, wusste ich nicht. Aber wenn ich an ihn dachte, fühlte ich mich geborgen. Aber nicht glücklich.
Glücklich machte mich die andere Szene: eine Stimme. Eine Berührung. Ein Mann. Er nahm mich in seine Arme und ich fühlte mich … beschützt. Frei.
Seltsam, dass die Gefühle voneinander getrennt waren. Geborgen fühlte ich mich bei dem Mann nämlich nicht. Nur bei dem Jungen. Vermutlich war ich einfach nur verrückt. Oder man hatte solche Träume ganz automatisch, wenn man Sklave wurde.
Ich schleppte mich müde und ausgezehrt in mein Bett und schlief lange und traumlos. Als ich am nächsten Morgen erwachte, war niemand da, der mich abholte. Normalerweise stand bereits zur Morgendämmerung eine Abordnung von Haussklaven in meinem Zimmer und wartete darauf, dass ich mich ihnen anschloss.
Das fand ich merkwürdig, draußen war es bereits hell und niemand hatte mich geweckt. Wollte man mir Schonung gewähren, nachdem man mich eingesperrt hatte? Darauf war ich nicht wirklich gefasst und ich hatte auch alle Mühe, mir das vorzustellen.
Ich stand auf und zog mich an, bevor ich in die Küche eilte, wo Budysa bereits wartete.
»Guten Morgen, Schlafmütze!«, rief sie mir zu und rührte in ihrem großen Kochtopf. »Fragst du dich, warum dich niemand geweckt hat?«
Ich nickte.
»Der Hohe Herr Akemi hat es angeordnet. Er hat gesagt, niemand soll dich stören.«
Ich sah sie hilflos an. Weshalb? Warum sollte er mir plötzlich Schonung gewähren? Wollte er mich als neue Bettsklavin? Ich hätte mir lieber die Kehle durchgeschnitten, als das Bett mit diesem ekligen Kerl zu teilen.
»Er fand, dass der Dolmetscher vom Herrn Ifraaj eh zu frech war und es gut ist, dass ihm mal jemand gezeigt hat, was er von einem solchen Verhalten hält. Er belohnt dich daher mit einem freien Morgen.«
Ich glaubte, mich verhört zu haben. Ein freier Morgen? Budysa deutete auf den Tisch, der voller Lebensmittel war. »Nimm dir was und setz dich. Du darfst außerdem etwas auf dem Markt in Soyuz kaufen, das dir gefällt. Nur etwas Kleines. Aber ich glaube, niemand hat so ein Glück wie du.«
Nun, wie man es nahm … ich hatte Kinderfleisch gegessen und im Käfig mitansehen müssen, wie man Menschen grausam verstümmelte. Als ich mich daran zurückerinnerte, verließ mich schlagartig der Appetit und ich legte die Tomate, die ich gerade in die Hand genommen hatte, zurück.
»Nichts?«, fragte Budysa verwirrt. »Turmalina, du musst wirklich besser essen. Die Sklaven bekommen hier so viel … und du wirst immer dünner. Bei anderen Herren gibt es weniger. Ich versteh dich nicht.«
Ich schüttelte lediglich den Kopf und Budysa deutete auf die Anrichte neben der Tür. »Da liegen drei Federn und ein paar Muscheln. Für den Markt.«
Die Kukurun zahlten in Federn. Je bunter, desto besser. Die Muscheln bevorzugten die Einheimischen.
Ich nahm sie, steckte sie in die Tasche und trat nach draußen. Die Treppen am Bunker wurden wieder poliert, sie waren aus festem Stein, wie sonst kaum etwas in Soyuz, und man pflegte sie deswegen besser als alles andere hier.
Auf der Straße, die ins Herz der Stadt führte, waren bereits die Reparaturarbeiten im Gange und ich sah verschiedene Sklaven, die schwere Eisenträger schleppten oder Müll herumtrugen, der zur Ausbesserung der Schäden diente.
Ich wusste zwar, dass die Insel noch nicht befriedet war, wie die Kukurun das nannten, aber hier in Soyuz konnte man glauben, dass es nur noch einen Herrscher gab. Und der war ein Eroberer.
Doch auch an diesem Morgen hörte ich die Sklaven leise über Rebellen sprechen, die sich irgendwo zusammengerottet hatten.
Hinter der nächsten Kreuzung erreichte ich den Markt, wo bereits einige Kukurun mit ihrem Gefolge flanierten. Die Hohen Herren gingen niemals ohne ihre Sklaven aus und so sah ich lange Kolonnen von Menschen, die hinter bunt gekleideten Leuten Körbe oder Kisten schleppten. Manche Gruppen wirkten sogar recht fröhlich und schnatterten wie die Hühner. Andere schwiegen ängstlich.
Es kam immer darauf an, an welchen Herrn man geriet. Ich hatte es wohl ganz gut getroffen, wie mir an diesem Morgen bewusst wurde. Aber ich hatte auch von anderen Hohen Herren gehört, die ihre Sklaven ständig schlugen oder ein diebisches Vergnügen daran hatten, sie mit brennenden Eisen zu malträtieren. Von diesen Männern hielt man sich lieber fern. Den Kukurun war das meistens egal. Nur wenn ein Eroberer sich an anderer Leute Sklaven verging, gab es Streit. Der ging sogar so weit, dass der Verlierer dem War Chant gegenübertreten musste. Das hatte ich schon mitangesehen, allerdings unten an den Docks, als sie den War Chant nicht hatten weiterbewegen können. Er war defekt und konnte nicht laufen, taugte jedoch immer noch, um dem bösartigen Kukurun, der zwei Sklavinnen eines anderen getötet hatte, den Kopf abzutrennen. Die Eroberer hatten die ganze Nacht gefeiert und getrunken, nachdem der Kopf ins Meer gerollt war.
Für sie schien es kaum einen anderen Lebensinhalt als das Töten zu geben.
Hinter den Ständen unterhielten sich die Leute ebenfalls über Rebellen. Sie waren nicht alle Sklaven, aber sie zahlten Tribut an die Kukurun. Dennoch – die Abhängigkeit vom Wohlwollen der Kukurun zeichnete auch sie. Der Unterschied zwischen ihnen und uns bestand lediglich darin, dass sie am Ende des Tages nach Hause gehen konnten. Und sie besaßen Geld.
Ich hatte sie immer schon beneidet, all diese freien Händler auf dem Marktplatz. Als ich mich einem Stand näherte, rempelte mich jemand an. Zornig wandte ich mich um, denn ich erwartete, dass der Fettsack von Dolmetscher sich rächen wollen würde, doch zu meinem Erstaunen sah ich nur ein schmutziges Kind.
Es trug keine Sklavenkluft, also gehörte es wohl zu einer der Händlerfamilien. Aber es wirkte abgemagert und krank und hatte einen grässlichen Ausschlag an der rechten Wange.
»Miss«, stammelte der Junge in den zerrissenen Klamotten. »Ich habe Hunger und kein Geld …«
Ich konnte ihm nicht antworten, aber ich griff in meine Tasche und hielt ihm die drei Federn hin.
Seine Augen wurden groß. »Für mich?«
Ich nickte ermutigend. Bevor er jedoch danach greifen konnte, kam ein Händler herbeigeeilt. In einer Hand ein großes Fischmesser.
»Scher dich davon, du kleine Ratte!«, fluchte er und fuchtelte bedrohlich mit dem Messer herum.
Erschrocken machte ich einen Schritt zur Seite und sah ihn fragend an.
Der Junge war bereits im dichten Gedränge des Marktes verschwunden.
Keuchend kam der Händler neben mir zum Stehen. »Hat er dir was geklaut, Sklavin?«
Ich schüttelte verwirrt den Kopf.
»Dieses Bettlerpack! Gehören alle zu dieser verrückten Sekte. Kinder des Lichts oder so. Irgendwo aus dem Norden. Die klauen alles, was sie in die Finger bekommen, die kleinen Biester. Sie sind schlimmer als Ratten.«
Ich steckte meine Federn wieder ein und folgte dem Mann, der zu seiner Bude zurückkehrte. Dahinter stand jemand, der ihm ähnlich sah, vielleicht sein Bruder. Ich schnupperte. Es roch nach Fisch und Fleisch. Offenbar handelte es sich um einen Imbiss.
»Möchtest du etwas?«
Ich nickte, hielt aber weiterhin Ausschau nach dem kleinen Jungen.
»Schon wieder diese Kinder des Lichts«, brummte der Mann, dem ich gefolgt war.
»Die sind wirklich eine Plage. Sollten die Eroberer nicht mal was gegen tun? Die Sieger haben nicht erlaubt, dass sie sich in Soyuz herumtreiben«, stimmte der andere ihm zu.
Manchmal klang es so, als trauerten sie ihren Siegern hinterher. Nach allem, was ich wusste, waren die auch nicht besser als die Kukurun.
»Was darf’s denn sein?«, fragte der Mann hinter der Auslage. Sie hatten sich einen provisorischen Stand zusammengezimmert. Plastik diente als Sonnenschutz und die Auslage war eine alte Kiste. Aber immerhin hatten sie große Fässer mit Fischen und gesalzenem Fleisch.
Ich deutete auf Brote, die an Holzstäben steckten. »Macht zwei Federn«, klärte er mich auf. »Bist du stumm? Du sagst gar nichts.«
Ich nickte nur und wartete, bis er mir das Brot aushändigte. »Muss schlimm sein, in Zeiten wie diesen mit so etwas gestraft zu sein.«
Ich merkte immer öfter, dass die Leute mitleidig reagierten, wenn sie merkten, dass ich stumm war. Und ich hasste es inbrünstig.
Ich steckte die letzte Feder ein und verließ den Stand mit meinem Brot am Stock, auf dem ich herumkaute. Es war süßes Brot mit einem Klecks Honig in der Mitte und ich war mir sicher, dass ich ewig nicht mehr so gut gegessen hatte.
Ich versuchte, im Tumult des Marktplatzes den Jungen wiederzufinden, um ihm wenigstens meine letzte Feder zu geben. Doch er war wie vom Erdboden verschluckt.
Als ich in das Haus meines Hohen Herrn zurückkehrte, war es fast Mittag und Budysa wartete in der Küche auf mich.
»War es schön?«, fragte sie mich.
Ich nickte. Mehr konnte ich ja nicht zu dem Gespräch beitragen. Also setzte ich mich auf den Hocker neben dem Tisch und sah sie an. Budysa erzählte gern und diese Geste brachte sie eigentlich immer zum Plaudern.
»Ich hätte auch gerne mal ein paar Mußestunden«, meinte sie seufzend und verdrehte vor Wonne die Augen. Dann nahm sie mich genauer ins Visier. »Los, geh baden. So wie du aussiehst, wird der hohe Herr wütend sein, wenn du ihm unter die Augen trittst. Und du riechst auch nicht sonderlich gut.«
Ich erhob mich von dem Hocker und verschwand aus der provisorischen Küche, die früher vielleicht eine Amtsstube von irgendeinem Sieger gewesen war, der im Senat saß. Seitdem die Eroberer hier waren, hatten sie alles in Privatwohnungen verwandelt, aber mir hatten einige Odysseybewohner erzählt, wie der Bunker früher ausgesehen hatte. Da ich nie darin gewesen war, musste ich mich auf ihre Worte verlassen und mir vorstellen, wie es wohl gewesen war.
Von außen wirkte der Bunker schmucklos, von innen war er ein wahres Prachtstück und vor allem völlig unversehrt. Sowohl Rebellion als auch Eroberung hatten ihm nichts anhaben können.
Ich ging durch einen langen, runden Flur und erreichte das Bad für die Sklaven, das sich auf einer Terrasse befand. Es war nicht mehr als eine große Tonne mit Wasser, aber die Aussicht war dafür phänomenal.
Zwei junge Männer badeten darin, einem von ihnen fehlte ab dem Ellenbogen der Arm und er grüßte mich nur knapp und geringschätzig. Seinen Namen wusste ich nicht, obwohl wir nicht sonderlich viele Sklaven waren. Der andere hieß Madurai und war ein hochgewachsener Kerl mit vielen Muskeln und einer riesigen Narbe, als hätte jemand versucht, ihn aufzuschlitzen. Sie begann am Hals und endete kurz unter seinem Bauchnabel.
Er nickte mir knapp zu und ich tat es ihm gleich, bevor ich meinen beschmutzten Kittel auszog und darauf wartete, dass die beiden die Tonne verließen. Scham war hier ein Fremdwort.
»Du bist ja echt ein Liebchen«, sagte der mit dem abgetrennten Arm und stand auf.
Ich zuckte lediglich mit den Schultern.
»Ich hab was zu dir gesagt«, grunzte Halbarm und Madurai gab ihm einen Stoß von hinten. »Sie ist stumm, Volltrottel.«
»Als ob. Ich weiß, dass sie sprechen kann. Ich bin gestern erst an ihrer Zelle vorbeigekommen. Sie hat geheult und nach ihrer Mom geschrien.«
Wohl kaum, dachte ich. Ich kannte weder meine Mutter, noch hatte ich während meines Arrests herumgebrüllt.
Madurai schüttelte den Kopf und gab den Halbarm einen Tritt, der ihn beinahe aus der Tonne beförderte.
»Lass den Spinner reden, Turmalina.«
Halbarm sprang aus der Tonne und drehte sich drohend zu Madurai um. »Halt’s Maul, sonst …« Sein teigiger Körper schwabbelte vor Empörung und obwohl er nicht wirklich fett war, wirkte er unförmig, was eine Leistung war, wenn man so wenig aß wie wir Sklaven.
Statt Madurai nun zu drohen, was ihm sonst blühte, zeigte er auf den Armstumpf und spuckte mir vor die Füße. »Ich hab nur eine Sklavenschlampe von einem Kukurun ein bisschen zu genau angesehen und schon war der Arm ab. Du darfst hingegen einen Dolmetscher verprügeln, ohne dass man dir ein Haar krümmt. Lässt du dich vom Hohen Herrn ficken?«
Wie gerne hätte ich ihm darauf etwas geantwortet. Sklavinnen und Sklaven, die mit den Kukurun paktierten, waren zumindest aus Odyssey-Sicht der letzte Abschaum, dazu zählten Dolmetscher und Bettsklaven. Das hatte ich schon immer lächerlich gefunden, als ob jemand das freiwillig tat. Es war ja auch niemand freiwillig Küchensklave …
Mir blieb also nichts anderes übrig, als den Kopf zu schütteln und einfach in der Tonne Platz zu nehmen, während Halbarm mich mit ein paar wüsten Beleidigungen bedachte, und als ich nicht reagierte, wieder gegen Madurai wetterte.
»Er hat sie nicht nur angesehen«, erklärte Madurai mir. »Er hat sie angegrabscht. Und sie war die Bettsklavin vom ehrwürdigen Iffraj. Der mag das gar nicht.«
»Ich habe nur geguckt«, verteidigte sich Halbarm lahm.
Ich wagte es zwar nicht zu lachen, aber mein Grinsen verriet ihm wohl, was ich von seiner dummen Geschichte hielt.
Das Wasser war kalt und nicht gerade dazu gemacht, lange zu verweilen, somit schrubbte ich den Schmutz von meinem Körper und tauchte kurz unter, damit wenigstens meine Kopfhaut ein wenig sauber wurde. Das bisschen Flaum kam in ein paar Tagen eh wieder runter, damit war der Hohe Herr Akemi unnachgiebig. Als ich prustend auftauchte, war Madurai fort, ich hatte gar nicht mitbekommen, dass er verschwunden war. Stattdessen blickte ich in ein heftig atmendes Schweinsgesicht, dem Sabber aus dem hässlichen wulstigen Mund lief. Seine Lippen erinnerten mich an Würmer.
»ßo ßieht man ßich wieder, ßtumme ßchlampe.« Wo Schweinsgesicht hergekommen war, wusste ich nicht, aber er lispelte ganz fürchterlich und sprühte mir seinen stinkenden Speichel direkt ins Gesicht.
Er packte meinen Kopf und tauchte mich zurück in das kalte Wasser. Ich paddelte, stieß und wehrte mich und entglitt seinem Griff. Ich erreichte die Oberfläche und sog gierig die Luft ein. Schweinsgesicht kämpfte mit seinem Gleichgewicht auf der Leiter und ich sprang auf und gab ihm einen heftigen Stoß, der ihn rückwärts fallen ließ. Es krachte laut und er blieb unter der Leiter liegen, während ich aus dem Waschzuber sprang und auf dem nassen Holzboden und vorwärts schlitterte. Er war jedoch nicht allein. Er hatte zwei Kumpanen dabei, allerdings keine Kukurun, sondern zwei Kerle, die gut und gerne als seine Geschwister durchgehen konnten. Beide waren dick und rotwangig, die Haare ebenso fettig und braun wie seine. Und einer trug einen Krummsäbel.
»Lass das fallen«, herrschte Madurai sie. Der Lärm musste ihn angelockt haben. In der Hand hielt er einen großen Kerzenständer, während Halbarm sich im Schatten herumdrückte.
»Halt dich da raus«, grunzte der Kumpan. »Das geht dich nichts an.«
Schweinsgesicht war mittlerweile wieder auf den Beinen und funkelte mich aus seinen dunklen Augen wütend an.
»Du kleine Fotße«, lispelte er. Blut tropfte von seiner ramponierten Lippe.
Ich machte einen Schritt rückwärts und stieß gegen den Waschzuber. Eine der Latten ragte mir entgegen. Wenn ich sie herausriss, gab sie eine passable Waffe ab. Schweinsgesicht würde mich nicht anfassen. Dafür würde ich sorgen, und wenn es das Letzte war, was ich tat.
»Ich rufe die Wachen«, drohte Madurai mit seinem Kerzenleuchter.
»Mach doch«, grunzte einer der Kumpane. »Die dürften aber sehr beschäftigt sein. Haben ihnen ein Weib mitgebracht.«
Mein Herz klopfte mir bis zum Hals, als Schweinsgesicht näher kam. Dann ging alles fürchterlich schnell, die Latte war plötzlich in meiner Hand und ich schlug mit aller Kraft direkt gegen den Hals des Angreifers. Ein entsetzter Aufschrei hallte durch den Bunker, als Schweinsgesicht zu Boden ging und seine Kumpane auf mich zukamen, doch ich entwand mich ihren Griffen, sprang auf den fetten Bauch des Dolmetschers und rammte ihm das abgebrochene Ende des Holzes direkt durch die Kehle. Blut pulsierte in meinen Ohren. Obwohl mein Herzschlag sich anfühlte, als wäre ich gerade einmal um die Insel gelaufen, war ich völlig ruhig und konzentriert. Und weder angewidert von dem Bild, noch erschrocken von meiner Reaktion. Ich fühlte einfach nichts, als seine Kumpane sich mir näherten und ich dem ersten einen Tritt gegen das Bein gab.
Doch ohne Schuhe, ohne festen Halt, war das nicht sonderlich beeindruckend, sondern machte ihn nur wütend. Ich hörte Schreie von unten. Die Kukurun mussten uns gehört haben, denn der dicke Dolmetscher röchelte immer noch, während Halbarm um Hilfe schrie und die zwei Angreifer mich wüst beschimpften. Madurai schlug einem von ihnen den schweren Kerzenständer auf den Kopf. Es gab ein ekelhaftes Knacken und er brach zusammen. Seine Füße zuckten unkontrolliert und es war vorbei.
Bevor ich noch einmal meinen Knüppel schwingen konnte, fühlte ich einen stechenden Schmerz in der Schulter, dann wurde mir schwarz vor Augen.
Ich erwachte in der dunklen Zelle, die bereits nach dem Zwischenfall mit Schweinsgesicht mein Zuhause gewesen war. Aber ich war nicht überrascht. Eine wilde Wut, gepaart mit Trotz hatte Besitz von mir ergriffen und der einzige Gedanke, den ich fassen konnte, war: Kommt doch her, wenn ihr euch traut! Scheißkerle. Feige Scheißkerle. Zu dritt gegen ein stummes Mädchen zu kämpfen, das kaum größer war als ein Kind.
Meine Zunge klebte am Gaumen und ich stürzte das Wasser aus dem Krug hinunter, der neben mir stand. Bestimmt hatte Budysa an mich gedacht. Wollten sie mich jetzt noch einmal drei Tage in der Zelle lassen? Bitte, sollten sie doch. Die Abreibung, die der Scheißkerl bekommen hatte, war das allemal wert. Er hatte mich gezwungen, Menschenfleisch zu essen. Was er bekommen hatte, war nur gerecht. Die arme Frau auf der Kreuzung … Prompt drängte sich mir ihr weinendes Gesicht auf und mir wurde schlecht.
In den letzten Tagen hatte ich versucht, dieses Erlebnis zu verdrängen, doch jetzt, wo ich wieder mit meinen Gedanken alleine war, kam es mit aller Macht zurück.
Jemand hatte mir Kleidung angelegt, bemerkte ich nun auf den zweiten Blick. Zum Glück. So natürlich wie wir Sklaven mit unserer Nacktheit umzugehen hatten, so ungern wollte ich nackt in dieser Zelle bleiben. Auch hier hatte ich Budysa im Verdacht. Ich musste mich unbedingt bedanken, sobald ich zurück war. Leider konnte ich nicht schreiben, sodass ich ihr wohl irgendwie mit Gesten klarmachen musste, dass ich ihr dankte.
Wie spät es war und wie viel Zeit vergangen war, wusste ich auch nicht. Meine Schulter juckte fürchterlich und als ich meine Hand hob, um mich zu kratzten, zuckte ich zusammen. Vorsichtig drehte ich den Kopf und erblickte das verräterische Einstichloch eines Pfeils. Die Eroberer benutzten Blasrohre, wann immer sie Menschen nicht verletzen wollten. Wenn sie Sklaven fingen zum Beispiel. Ich hatte das schon öfter erlebt. Trotz ihrer Eroberung waren natürlich nicht alle Menschen auf Odyssey ihre Sklaven. Einige von ihnen hatten sich anscheinend retten können. Es gab Untergrundbewegungen im Norden. Im Süden befand sich wiederum ein Gebiet, das die Eroberer nicht zu betreten wagten und auch nicht vom War Chant ansteuern ließen.
Warum das so war, konnte man natürlich nur mutmaßen, aber Madurai hatte mir einmal erzählt, dass es dort Technologie gab, die den War Chant ausschalten, wenn auch nicht zerstören konnte. Und ohne den War Chant waren auch die Kukurun nur ein paar Soldaten. Sie waren nicht vollzählig. Die Bewohner von Odyssey allerdings auch nicht. Und sie besaßen keine Waffen, jedenfalls nicht in Soyuz. Das machte es den Kukurun einfach. Und Leute wie ich wurden auf Sklavenmärkten verkauft.
Vielleicht würde meine Strafe dieses Mal härter ausfallen. Schweinsgesichts Besitzer könnte darauf bestehen. In dem Fall war mein Herr in der Pflicht, dem nachzukommen. Die Kukurun hatten irgendein krudes Verständnis für Ehre und Schuld, das mir nicht geläufig war. Und ein eigenes Kastensystem. Entsprechend konnte der eine Herr durchaus den anderen dazu bringen, seinen Sklaven hinzurichten, wenn er höhergestellt war. Aber noch wollte ich mich nicht damit befassen. Noch war es nicht mehr als ein Arrest.
Ich tastete in der Zelle umher und erreichte die Tür. Daneben stand sogar ein Tablett. Ich musste gegen meinen Willen lächeln. Budysa. Was für ein Glück!
Gierig schlang ich das Maisbrot herunter und verputzte den Fisch, obwohl das vielleicht nicht so klug war, da ich nicht wusste, wie lange ich hierbleiben musste.
Diese Frage erübrigte sich nach einer Weile. Ich hörte erst Schritte und dann den Riegel zu meiner Zelle, der ächzend beiseitegeschoben wurde.
»Aufstehen«, schnarrte Herr Akemis Übersetzer. Der Mann war einen halben Kopf größer als ich und hieß Olesko, jedoch hatte ich nie viel mit ihm zu tun, immerhin war er der Dolmetscher für die Soldaten. Warum er hier erschien und nicht Avow, der eigentliche Dolmetscher des Kukurun, war mir ein Rätsel.
Ich gehorchte mechanisch und kam auf die Beine. Ein paar blaue Flecken zierten meine Beine, wie ich feststellen musste, als das Sonnenlicht durch den Türschlitz drang. Ansonsten war ich unversehrt.
»Mitkommen«, blaffte er. Als ich ihn fragend ansah und mich nicht rührte, wurde er grob und packte mich an meiner schmerzenden Schulter. Ich stieß wütend seinen Arm weg und trat aus der Tür.
Das Wetter hatte sich gewandelt. Während des Vorfalls war es auf dem Balkon trüb und regnerisch gewesen. Vielleicht war doch mehr als ein Tag vergangen …
Olesko führte mich die Treppe hinunter in das Herz des Bunkers, doch dort blieben wir nicht. Stattdessen schlossen sich zwei Soldaten in ihren schwarzen Schleiern an und eskortierten mich nach draußen.
Ich musste die Augen schließen. Der Gestank von Odyssey war heute besonders stark, in meiner Zelle hatte ich ihn nicht so wahrgenommen, doch jetzt traf er mich unvermittelt.
»Weiter«, knurrte der Dolmetscher, weil ich mit tränenden Augen stehengeblieben war.
Warum war Avow nicht hier? Oder irgendjemand anders, der mich mochte? Olesko tat es jedenfalls nicht, so viel stand fest.
Wir betraten die Straße, die zum Käfig führte. Ich ahnte Böses, als ich die Ruinen aus der Ferne sah. Es musste Mittag sein, die Straßen waren voll von Eroberern und Sklaven, die umherhetzten, auf Baustellen arbeiteten oder einfach nur beaufsichtigt wurden. Ich hatte nie einen Kukurun gesehen, der irgendeiner hilfreichen Arbeit nachging.
»Weiter!« Das kühle Metall in meinem Rücken ließ mich erschaudern und ich ging schneller. Verflucht, ich hätte Schweinsgesicht nicht umbringen sollen … Aber er hätte mich umgebracht, da gab es keinen Zweifel. Was mich so wütend gemacht hatte, war auch nicht die Tatsache, dass er es versucht hatte, sondern dass es im Wasser geschehen war. Ich fürchtete mich vor Wasser und hasste es inbrünstig. Schweinsgesicht hatte meinen wunden Punkt erwischt. Und dafür hatte er bezahlen müssen.
Näher und näher kamen wir dem Käfig. Der goldene Kopf des War Chants ragte daraus hervor und starrte mich mit seinen toten, kalten Rubinaugen düster an. Hoffentlich war das Ding nicht funktionstüchtig.
Während der Eroberung war der War Chant nur kurz einsatzbereit gewesen und die hier auf Odyssey stationierten Kukurun reaktivierten ihn nur zu hohen Feiertagen und zu Demonstrationszwecken, um ihre Sklaven ruhig zu halten. Doch während der Reparaturen und Verbesserungen war seine Musik überall zu hören.
Wir erreichten die Allee, die in den Käfig hineinführte, und die schwarzen Gitterstäbe reckten sich mir drohend entgegen. Wie der Käfig einst ausgesehen hatte, konnte ich nur noch erahnen. Große Teile der Tribünen waren eingestürzt, der Boden teilweise eingebrochen, denn die darunterliegenden Katakomben waren unterspült worden. Von den Katakomben hatte ich nur gehört. Ein paar der Sklaven hatten mir gesagt, dass dort ein riesiges Waffenarsenal schlummerte und die Leichen von hunderten Gladiatoren vor sich hinmoderten.
Wir Sklaven hatten kein anderes Thema als Odyssey vor der Eroberung. Rebellion und Sieger – das war es, was uns beschäftigte. Und sehr oft fielen die Worte: »Wir hatten zwar nicht viel, aber wir waren frei.« Das bezweifelte ich. Allerdings hatte ich auch nie auf Odyssey gelebt. Die Geschichten hörte ich mir dennoch an, ich hätte sie ja doch nie unterbrechen können.
Als wir eines der Tore erreichten, kam Olesko zum Stehen. Seine fleckige Glatze schimmerte im Sonnenlicht vor Schweißperlen. Er sprach ein paar Worte mit den Kukurun und die öffneten daraufhin das Tor.
Der schattige Gang führte direkt in den Käfig und ich musste diesen Weg wohl oder übel gehen.
Ich will nicht in den Käfig! Das war alles, was ich denken konnte. Ich will nicht, will nicht, will nicht! Zorn, Trotz und Furcht rangen in mir und ich überlegte für einen Moment, ob ich wohl das Kunststück mit Schweinsgesicht wiederholen konnte. Doch die beiden Soldaten hinter mir besaßen Schusswaffen und waren keine Dilettanten, wie der Dolmetscher es gewesen war.
Als wir den hellen Sand des Käfigs erreichten, sah ich mich einer großen Gruppe von Eroberern gegenüber. Einer davon war Akemi. Der andere, der direkt neben ihm stehen durfte – und somit mindestens denselben Rang bekleidete wie er –, war ein bunt gekleideter Herr mittleren Alters. Wie für Kukurun typisch trug er grelle Papageienfedern in einer Reihe aufgestellt, direkt mit seinem Haar verknotet. Seine Haut war bunt bemalt und seine Hände in goldene Farbe getaucht. So sahen sie aus, die Hohen Herren von Odyssey und Aquarius.
Er selbst hatte einige seiner Soldaten mitgebracht und zu meinem Erschrecken hatten sie Schweinsgesichts Leiche und auch die seines Kumpanen aufgebahrt. Immerhin konnte ich mir nun denken, wofür man mich anklagte … nur: Wie sollte ich mich gegen die Anschuldigungen verteidigen? Verflucht, ich war stumm! Ich war mir nicht mal sicher, ob ich wirklich Stimmbänder besaß!
Mein Herz schlug mir bis zum Hals, als die zwei Soldaten von Herrn Akemi mich in die Mitte der Gruppe zwangen. Die beiden Kukurun-Oberhäupter traten zur Seite, als weitere Soldaten einen enthaupteten, nackten Leichnam in die Mitte zerrten. Ich erkannte die Narbe auf seiner Brust: Madurai.
Was hinter den Menschenleibern geschah, die sich bereits wieder in Reih und Glied gestellt hatten, konnte ich nur erahnen, aber mir war klar: dahinter wartete der Henker.
Sie hatten einen Henker hier auf Odyssey, davon sprachen die Sklaven oft. Doch normalerweise bekamen wir den nur zu Gesicht, wenn wir Sklaven uns gegen die Herren auflehnten. Ich hatte nie davon gehört, dass jemand zum Tode verurteilt wurde, weil er einen anderen Sklaven umgebracht hatte.
Schweinsgesicht musste seinem Herrn sehr wichtig gewesen sein. Vielleicht auch ein Bettsklave, für einen Kukurun, der auf fette Männer stand. Hier gab es alles. Jeden kranken Auswuchs, jede nur erdenkliche Sexualität.
»Turmalina«, rief der Dolmetscher mit unangenehm schriller Stimme. »Du bist des Verbrechens angeklagt, den Sklaven des Hohen Herrn Ifraaj getötet zu haben.«
Ich wollte ihnen sagen, dass er mich angegriffen hatte, ich hatte mich nur verteidigt. Er hatte mir sogar aufgelauert. Aber die einzige Person, die das hätte bezeugen können, hatte nicht einmal mehr einen Kopf. Also tat ich das einzige, was mir so übrig blieb: Ich schüttelte den Kopf.
»Du leugnest?«, donnerte Olesko.
Die Kukurun schnatterten durcheinander und das Gesicht von Herrn Ifraaj wurde so rot wie die Federn auf seinem Kopf.
Ich nickte.
Wieder Worte in der Sprache der Eroberer.
Mein Herr sah mit Bedauern auf mich hinab. Zwei Worte kamen aus seinem Mund: »Ech, chachal.«