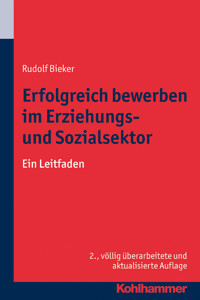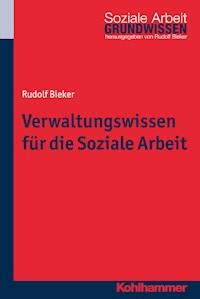
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Verwaltung ist in der Sozialen Arbeit allgegenwärtig, vor allem die kommunale Sozialverwaltung. Sie stellt nicht nur selbst eine Vielzahl von sozialen Leistungen bereit, sondern gewährleistet auch, dass sich freie bzw. private Träger als Leistungserbringer, Angebotsträger und sozialpolitische Akteure an der Verwirklichung des lokalen Sozialstaates beteiligen können. Eine zentrale Rolle spielt die Verwaltung auch, wenn es um die Abwendung von Gefahren geht, z.B. für das Kindeswohl. Der Band beschreibt den Aufbau der öffentlichen Verwaltung und ihre zentralen Handlungsfelder auf dem Gebiet der kommunalen Sozialpolitik. Er führt in den institutionellen Mikrokosmos von Politik und Verwaltung auf lokaler Ebene ein und schließt dabei auch Themen wie "Woher kommt das Geld für die Soziale Arbeit?" und "Was ist ein kommunaler Haushalt?" nicht aus. Darüber hinaus werden die rechtlichen Anforderungen behandelt, denen Soziale Arbeit als Verwaltungshandeln entsprechen muss (Verwaltungsverfahren, Datenschutz).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grundwissen Soziale Arbeit
Herausgegeben von Rudolf Bieker
Band 19
Rudolf Bieker
Verwaltungswissen für die Soziale Arbeit
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2016
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-026036-8
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-026037-5
epub: ISBN 978-3-17-026038-2
mobi: ISBN 978-3-17-026039-9
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Vorwort zur Reihe
Mit dem so genannten „Bologna-Prozess“ galt es neu auszutarieren, welches Wissen Studierende der Sozialen Arbeit benötigen, um trotz erheblich verkürzter Ausbildungszeiten auch weiterhin „berufliche Handlungsfähigkeit“ zu erlangen. Die Ergebnisse dieses nicht ganz schmerzfreien Abstimmungs- und Anpassungsprozesses lassen sich heute allerorten in volumigen Handbüchern nachlesen, in denen die neu entwickelten Module detailliert nach Lernzielen, Lehrinhalten, Lehrmethoden und Prüfungsformen beschrieben sind. Eine diskursive Selbstvergewisserung dieses Ausmaßes und dieser Präzision hat es vor Bologna allenfalls im Ausnahmefall gegeben.
Für Studierende bedeutet die Beschränkung der akademischen Grundausbildung auf sechs Semester, eine annähernd gleich große Stofffülle in deutlich verringerter Lernzeit bewältigen zu müssen. Die Erwartungen an das selbständige Lernen und Vertiefen des Stoffs in den eigenen vier Wänden sind deshalb deutlich gestiegen. Bologna hat das eigene Arbeitszimmer als Lernort gewissermaßen rekultiviert.
Die Idee zu der Reihe, in der das vorliegende Buch erscheint, ist vor dem Hintergrund dieser bildungspolitisch veränderten Rahmenbedingungen entstanden. Die nach und nach erscheinenden Bände sollen in kompakter Form nicht nur unabdingbares Grundwissen für das Studium der Sozialen Arbeit bereitstellen, sondern sich durch ihre Leserfreundlichkeit auch für das Selbststudium Studierender besonders eignen. Die Autor/innen der Reihe verpflichten sich diesem Ziel auf unterschiedliche Weise: durch die lernzielorientierte Begründung der ausgewählten Inhalte, durch die Begrenzung der Stoffmenge auf ein überschaubares Volumen, durch die Verständlichkeit ihrer Sprache, durch Anschaulichkeit und gezielte Theorie-Praxis-Verknüpfungen, nicht zuletzt aber auch durch lese(r)-freundliche Gestaltungselemente wie Schaubilder, Unterlegungen und andere Elemente.
Prof. Dr. Rudolf Bieker, Köln
Zu diesem Buch
Soziale Arbeit wird auf der Grundlage von Gesetzen weithin durch öffentliche Verwaltungsträger organisiert, finanziert und zu einem Gutteil auch unmittelbar ausgeführt. Die Soziale Arbeit ist als Profession nicht nur in Verwaltungsbehörden inkorporiert, sie ist auch dort, wo sie unmittelbar individuelle Ansprüche auf soziale Leistungen prüft, gewährt oder ablehnt, Verwaltung ‚pur‘ und kaum anders als eine Baubehörde durch das Verwaltungsrecht gebunden. Zwar wird Soziale Arbeit vielfach in privater (meist freigemeinnütziger) Trägerschaft erbracht, die Abhängigkeit der „Freien“ von Verträgen, Mittelzuweisungen und Kontrollen durch die öffentlichen Träger ist jedoch so durchdringend, dass man auch hier nur aus Unwissenheit annehmen könnte, mit Verwaltung habe man auf Seiten der „Freien“ allenfalls randseitig zu tun.
Von herausgehobener Bedeutung für die Soziale Arbeit ist die kommunale Verwaltungsebene. Sie wird in erster Linie von den kreisfreien Städten, Kreisen und Höheren Kommunalverbänden gebildet. Die Kommunen tragen einen Großteil der Verantwortung für die Verwirklichung des Sozialstaats. Viele der von Bürgern in belastenden Lebenssituationen benötigten Sozialleistungen, insbesondere aus den großen Leistungsbereichen der Jugendhilfe und Sozialhilfe, befinden sich in der Gewährleistungsträgerschaft der Kommunen.
Wenn die Finanzierungsspielräume vieler Kommunen heute kaum mehr als das unbedingt Nötige erlauben, ist die Soziale Arbeit umso mehr gefordert. Es geht darum, Erreichtes zu verteidigen und wieder aufscheinende Spielräume neu zu erschließen. Die Soziale Arbeit ist – ob frei oder öffentlich – im Verhältnis zur Verwaltung ebenso Betroffene wie Akteurin. Erfolgreiche Akteurin kann sie nur sein, wenn sie sich in den Koordinaten des allgegenwärtigen Verwaltungskosmos kompetent zu bewegen versteht. Um das dafür erforderliche Basiswissen geht es in dem vorliegenden Band.
Ich bedanke mich bei Dorothee Frings, Paul Fülbier und Rolf-Jürgen Lorenz für ihre inhaltlichen Hinweise, bei der Hochschule Niederrhein für die gewährte Lehrermäßigung und bei Tea Rasch und meiner Frau Marlies für ihre Korrekturhilfe.
Köln, im Oktober 2015
Rudolf Bieker
Lesehinweise
Pfeile vor einem Wort verweisen auf das Glossar im Anhang des Bandes.
Rechtsquellen werden der besseren Lesbarkeit wegen in verkürzter Form zitiert (Ziffer des Paragrafen, Absatz in römischen Zahlen, Gesetzesquelle).
Die Verwendung geschlechtsbezogener Artikel geschieht frei von jeder Präferenz des Verfassers.
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Zu diesem Buch
Kapitel A – Aufbaustruktur der öffentlichen Verwaltung in Deutschland
1 Verwaltung
2 Verwaltungsträger, -organe, -behörden
3 Staatliche Verwaltungsträger
3.1 Trennung der Verwaltungsebenen
3.2 Länderverwaltung
3.2.1 Länder als Hauptverwaltungsträger
3.2.2 Aufbau der Länderverwaltung
3.3 Bundesverwaltung
4 Kommunale Verwaltung
4.1 Kommunen
4.2 Typen kommunaler Verwaltungsträger
4.2.1 Gemeinden
4.2.2 Kreisangehörige Gemeinden
4.2.3 Kreisfreie Städte/Stadtkreise
4.2.4 (Land-)Kreise
4.2.5 Sonstige kommunale Verbände
5 Private Beauftragte
Kapitel B – Kommunen als Verwaltungsträger
1 Das Selbstverwaltungsrecht der Städte und Gemeinden
1.1 Garantie der Selbstverwaltung
1.2 Funktionen kommunaler Selbstverwaltung
1.3 Kernkompetenzen der Selbstverwaltung
1.4 Staatliche Einflussnahme auf die kommunale Selbstverwaltung
1.5 Bedeutung der Selbstverwaltungsgarantie für die Soziale Arbeit
2 Aufgaben der Gemeinden zwischen Selbst- und Fremdverwaltung
3 Organe der Gemeinden
3.1 Rat
3.1.1 Aufgaben und Zuständigkeiten
3.1.2 Zusammensetzung
3.1.3 Arbeitsweise
3.1.4 Fraktionen
3.2 Bürgermeister
3.3 Ausschüsse
3.4 Ausschüsse mit sozialpolitischer Aufgabenstellung
3.4.1 Sozial- und Gesundheitsausschuss
3.4.2 Jugendhilfeausschuss
3.5 Organe mit bezirklicher Zuständigkeit
4 Verwaltungsorganisation
4.1 Führungsorganisation
4.1.1 Monokratisches oder kollegiales Führungsmodell
4.1.2 Aufgaben und Kompetenzen der Verwaltungsspitze
4.1.3 Führungskräfte unterhalb der Verwaltungsspitze
4.2 Verwaltungseinheiten
4.2.1 Ämter
4.2.2 Dezernate
4.2.3 Fachbereiche
4.3 Eigenbetriebe und privatrechtliche Organisationseinheiten
4.3.1 Eigenbetriebe
4.3.2 Privatrechtliche Organisationseinheiten
4.4 Bezirkliche Verwaltungsstellen
4.5 Stellen für Beauftragte
5 Entscheidungen in einer Gemeinde
5.1 Einvernehmliche und konflikthafte Entscheidungen
5.2 Einfluss der Verwaltung auf politische Entscheidungen
5.3 Abstimmungsprozesse im Vorfeld einer förmlichen Beschlussfassung
5.4 Förmliches Beschlussverfahren
6 Politische Mitwirkung durch Beiräte, externe Beauftragte und Fachgremien
6.1 Beiräte
6.2 Beauftragte
6.3 Fachgremien
7 Sonstige externe Einflussnehmer
Kapitel C – Kommunale Sozialverwaltung
1 Begriff Sozialverwaltung
2 Sozialstaatliche Einbindung der Kommunen
3 Bürgerbezogene Aufgaben
3.1 Bereitstellung sozialer Leistungen
3.1.1 Sozialhilfe
3.1.2 Kinder- und Jugendhilfe
3.1.3 Gesundheitshilfe und Gesundheitsförderung
3.1.4 Grundsicherung und Arbeitsmarktintegration
3.1.5 Wohnen
3.2 Gefahrenabwehr
3.2.1 Interventionen bei Kindeswohlgefährdung
3.2.2 Jugendgerichtshilfe
3.2.3 Maßnahmen nach den Gesetzen über psychisch kranke Menschen
4 Trägerbezogene Aufgaben
4.1 Finanzierung und Förderung
4.2 Gefahrenabwehr und -prävention
4.2.1 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und Einrichtungen
4.2.2 Schutz der Nutzer/innen von Wohn- und Betreuungsleistungen
Kapitel D – Verwaltungshandeln
1 Rechtsstaatliche Grundsätze des Verwaltungshandelns
2 Verfahrensrechtliche Anforderungen
2.1 Verwaltungsverfahren
2.2 Aufklärungs-, Informations- und Beratungspflichten
2.3 Prüfung der Zuständigkeit
2.4 Einleitung des Verfahrens
2.5 Sachverhaltsermittlung
2.6 Prüfung des Anspruchs und der Handlungsmöglichkeiten
2.6.1 Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
2.6.2 Klärung der rechtlichen Handlungsmöglichkeiten
2.7 Beteiligung der Leistungsadressaten
2.7.1 Wunsch- und Wahlrecht
2.7.2 Bedarfsermittlung und Hilfeplanung
2.8 Leistungsentscheidung/Verfahrensabschluss
2.8.1 Erlass des Verwaltungsaktes
2.8.2 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
2.8.3 Form der Bekanntgabe
3 Verfahrensrechte der Beteiligten
3.1 Benennung eines Bevollmächtigten oder Beistandes
3.2 Recht auf Akteneinsicht und Aktenauskunft
3.3 Anhörungsrecht
4 Umgang mit Daten
4.1 Rechtsgrundlagen
4.2 Schutz des Sozialgeheimnisses
4.3 Erhebung von Sozialdaten
4.4 Nutzung von Sozialdaten
4.4.1 Zweckbestimmte Nutzung
4.4.2 Interne Weitergabe von Daten
4.5 Übermittlung von Sozialdaten an externe Stellen
4.5.1 Grundsätze
4.5.2 Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (§ 69 SGB X)
4.5.3 Übermittlung an Polizei-, Justiz- und Ordnungsbehörden (§ 68 SGB X)
4.5.4 Ausgewählte sonstige Übermittlungserlaubnisse (§§ 71, 73 SGB X)
4.6 Strafrechtliche Schweigepflicht (§ 203 StGB)
4.6.1 Gesetzliche Voraussetzungen
4.6.2 Befugte Offenbarungen
4.7 Besondere Schweigepflicht in der Jugendhilfe (§ 65 SGB VIII)
5 Aufhebung von Verwaltungsentscheidungen
5.1 Aufhebung einer rechtswidrigen Entscheidung („Rücknahme“)
5.1.1 Rücknahme einer rechtswidrigen belastenden Entscheidung
5.1.2 Rücknahme einer rechtswidrigen begünstigenden Entscheidung
5.2 Aufhebung einer rechtmäßigen Entscheidung („Widerruf“)
5.2.1 Widerruf einer rechtmäßigen belastenden Entscheidung
5.2.2 Widerruf einer rechtmäßigen begünstigenden Entscheidung
5.3 Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der Verhältnisse
6 Schadensausgleich
6.1 Amtshaftung
6.2 Sozialrechtlicher Herstellungsanspruch
Kapitel E – Haushalt und Finanzen
1 Einnahmequellen der Gemeinden
1.1 Steuereinnahmen
1.1.1 Lohn- und Einkommenssteuer
1.1.2 Umsatzsteuer
1.1.3 Gewerbesteuer
1.1.4 Grundsteuer
1.1.5 Örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern
1.2 Entgelte (Gebühren und Beiträge)
1.2.1 Gebühren
1.2.2 Beiträge
1.3 Finanzzuweisungen
1.4 Sonstige Einnahmen
1.5 Ergebnis und Schlussfolgerungen
2 Kommunaler Haushalt
2.1 Haushaltsplan und Haushaltssatzung
2.2 Struktur des kommunalen Haushaltsplans
2.3 Entwurf des Haushaltsplans durch die Verwaltung
2.4 Nachträgliche Anpassungen
2.4.1 Haushaltsänderungen ohne Nachtragssatzung
2.4.2 Haushaltsänderungen durch Nachtragssatzung
2.4.3 Haushaltssperre als Sofortmaßnahme
2.5 Jahresabschluss mit Bilanz
2.6 Folgen eines unausgeglichenen Haushaltes
2.7 Beteiligung der Öffentlichkeit
Kapitel F – Kreise und andere Kommunalverbände
1 Kreise
1.1 Begriff des Kreises
1.2 Grundlegende Funktion des Kreises
1.3 Abgrenzung zu den Gemeindeaufgaben
1.4 Kreisaufgaben
1.4.1 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
1.4.2 Pflichtaufgaben der Kreise
1.4.3 Staatliche Auftragsangelegenheiten der Kreisebene
1.5 Organe des Kreises
1.5.1 Kreistag
1.5.2 Ausschüsse
1.5.3 Landrat
1.6 Finanzierung der Kreisaufgaben
1.7 Sonderformen eines Kreises
2 Kommunalverbände unterhalb der Kreisebene
2.1 Verwaltungsgemeinschaften
2.2 Verbandsgemeinden/Samtgemeinden
2.3 Ämter
3 Kommunalverbände oberhalb der Kreisebene
3.1 Funktionen der Höheren Kommunalverbände
3.2 Aufgaben
3.2.1 Jugendhilfe
3.2.2 Sozialhilfe
3.3 Organe der höheren Kommunalverbände
3.4 Finanzierung
4 Zweckverbände
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Glossar
Register
KAPITEL A – AUFBAUSTRUKTUR DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DEUTSCHLAND
Was Sie in diesem Kapitel lernen können
Die öffentliche Verwaltung in Deutschland ist ein filigranes Konstrukt, an dem neben Bund und Ländern viele sonstige Verwaltungsträger beteiligt sind. Als integraler Teil der Länderverwaltung spielen die Kommunen eine herausgehobene Rolle als Verwaltungsträger. Das Kapitel vermittelt Grundlagen- und Strukturwissen, auf das in den nachfolgenden Kapiteln wiederholt Bezug genommen wird.
1 VERWALTUNG
Organisatorisch lässt sich „Verwaltung“ mit der Gesamtheit der Verwaltungsträger identifizieren, die im Interesse des Gemeinwohls Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen (organisatorischer Verwaltungsbegriff). Im formellen Sinne bezeichnet Verwaltung das gesamte Handeln der Verwaltungsträger, unabhängig davon, ob es sich auch seinem Inhalt nach (materiell) als Verwaltungstätigkeit bezeichnen und dadurch von anderen Staatstätigkeiten abgrenzen lässt (formeller Verwaltungsbegriff). Im formellen Sinne liegt Verwaltungstätigkeit auch dann vor, wenn diese Recht setzender Art ist (z. B. Erlass einer kommunalen →Satzung). Während der organisatorische und der formelle Verwaltungsbegriff allgemein anerkannt sind und hinreichende Klarheit schaffen, bereitet es Schwierigkeiten zu bestimmen, was Verwaltung inhaltlich ist (materieller Verwaltungsbegriff). Hier ergeben sich ähnliche Probleme wie beim Begriff der Sozialen Arbeit: Man kann sie zwar beschreiben, wegen ihrer Vielgestaltigkeit aber kaum definieren. Eine befriedigende Positivdefinition ist deshalb bisher gescheitert (vgl. Maurer 2011, 4).
In der Verwaltungslehre wird das Definitionsproblem meist dadurch gelöst, dass man Verwaltung gegen andere, leichter zu definierende Sektoren der Staatstätigkeit abgrenzt und demzufolge benennt, was Verwaltung nicht ist (Negativdefinition). Die Vorlage dafür liefert das Grundgesetz.
Nach der Konzeption des Grundgesetzes (Art. 1 III, Art. 20 II, Art. 20a GG) bildet die öffentliche Verwaltung gemeinsam mit der Regierung (Bundes- und Landesregierungen) die sogenannte vollziehende Gewalt (Exekutive). Damit stellt sie eine der drei zentralen Staatsgewalten neben der Legislative (Rechtsetzung durch die Parlamente des Bundes und der Länder) und der Judikative (Rechtsprechung durch die Gerichtsbarkeit von Bund und Ländern) dar. Von „Regierung“ unterscheidet sich „Verwaltung“ durch die „staatsleitende, auf politische Entscheidungen bezogene Tätigkeit“ einer Regierung (Maurer 2011, 3).
Abb. A-1: Staatliche Gewaltenteilung
Lässt man die Regierungstätigkeit an dieser Stelle unberücksichtigt, könnte eine einfache Definition von Verwaltung so lauten: Verwaltung ist staatliche Tätigkeit außerhalb von Gesetzgebung und Rechtsprechung.
Dies mag überzeugend klingen, unterstellt aber eine Trennschärfe zwischen den „Staatsgewalten“, die es in Wirklichkeit nicht gibt: Auch Verwaltungen erlassen allgemeinverbindliche Rechtsnormen (z. B. →Rechtsverordnungen, →Satzungen); ebenso sind sie judikativ tätig (z. B. Bußgelderhebung bei hartnäckiger Schulverweigerung). Umgekehrt sind auch Gerichte und Parlamente in gewissem Umfang verwaltend tätig (z. B. Rückforderung unrechtmäßiger Zuwendungen an →Parteien durch den Bundestagspräsidenten; Führung des Grundbuches durch das Amtsgericht; Verwaltung des Gerichtspersonals).
Annäherungen an einen halbwegs präzisen materiellen Begriff von Verwaltung lassen sich zumindest über eine Kombination von Positiv- und Negativdefinition erreichen. In Anlehnung an einen Vorschlag von Stern 1980 (zit. bei Maurer 2011, 4) lässt sich Verwaltung demnach wie folgt bestimmen:
Verwaltung ist diejenige Staatstätigkeit außerhalb von Rechtsprechung, Gesetzgebung und Regierung, die in rechtlicher Bindung durch Verfassung und Gesetzgeber die ihr übertragenen Angelegenheiten des Gemeinwesens ständig und eigenverantwortlich nach gesetzlich mehr oder weniger präzise vorgegebenen Zwecksetzungen wahrnimmt.
Zentrale Elemente dieser Begriffsbestimmung sind:
• die Abgrenzung zu der sonstigen Staatstätigkeit
• die Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz (Grundgesetz, einfache Bundes- und Landesgesetze, EU-Recht)
• die Bezugnahme auf Angelegenheiten des Gemeinwesens (öffentliche Aufgaben, über die als solche politisch entschieden werden muss; Püttner 2007, 31)
• die Ausrichtung der Verwaltung auf die Umsetzung gesetzgeberischer Entscheidungen (z. B. Gewährung von Sozialleistungen)
• die mehr oder weniger offene Programmierung bzw. Determinierung des Verwaltungshandelns, die der Verwaltung oftmals viele Spielräume lässt.
Gegenüber der juristischen Sichtweise, in der die gesetzesausführende Funktion von Verwaltung im Mittelpunkt steht („vollziehende Gewalt“), betont der politikwissenschaftliche Verwaltungsbegriff die politisch mitgestaltende Rolle von Verwaltung. Danach ist Verwaltung nicht nur ausführendes Organ, sondern auch politischer Akteur, der in enger Verbindung zu Regierung und Legislative Einfluss auf die Formulierung von Gesetzen und politischen Programmen nimmt (z. B. Einflussnahme der Kommunen auf die Landespolitik; Einflussnahme der Rentenversicherungsträger auf die weitere gesetzliche Ausgestaltung von Erwerbsminderungsrenten; Vorschläge der Bundesagentur für Arbeit zur Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik). Zur Politikvorbereitung gehören die Problemdefinition, die Bereitstellung entscheidungserheblicher Informationen, die Erarbeitung und Vorauswahl von Lösungsvorschlägen und allgemein die Politikberatung (vgl. Mattern/von Fircks 1994, 14). Die Verwaltung „ist nicht allein von der Politik programmiert, sondern programmiert auch die Politik, sie wendet Recht nicht nur an, sondern sie erzeugt es auch, bis hin zu den Gesetzen, die fast ausschließlich in der Bürokratie angeregt und konzipiert werden“ (Bogumil/Jann 2009, 197). Gleichzeitig hat die Verwaltung aber auch nicht unerheblichen Einfluss auf die Umsetzung legislatorischer Entscheidungen (z. B. Umgang mit Flüchtlingen, Leistungsintensität in der Sozial- und Jugendhilfe). Mitunter beginnt die „eigentliche politische Auseinandersetzung erst während des Vollzugs“ (ebd.). Die Vorstellung einer unpolitisch operierenden, rein fachlich-professionell tätigen, politisch-neutralen Verwaltung geht an der Realität vorbei. Politikwissenschaftler sprechen deshalb von einem politisch-administrativen System, in dem sich Politik und Verwaltung wechselseitig beeinflussen und angleichen. Beide artikulieren und verhandeln Interessen und sind mit der gesellschaftlichen Umwelt eng vernetzt (ebd., 187). Auch die Verwaltung nimmt politische Funktionen wahr.
Abb. A-2: Politikwissenschaftlich erweiterter Verwaltungsbegriff
2 VERWALTUNGSTRÄGER, -ORGANE, -BEHÖRDEN
Träger der öffentlichen Verwaltung sind Bund und Länder sowie diesen zuzuordnende, aber rechtlich selbständige andere juristische Personen des öffentlichen Rechts (z. B. Sozialversicherungsträger, Gemeinden). Ergänzt werden die öffentlich-rechtlichen Träger durch sog. Beliehene (natürliche Personen oder privatrechtliche juristische Personen), die im staatlichen Auftrag und unter staatlicher Aufsicht bestimmte öffentliche Aufgaben anstelle des Staates wahrnehmen (→A-5).
Innerhalb der Länder spielen die Gemeinden und Gemeindeverbände als Verwaltungsträger eine herausragende Rolle. Gemeinden und Gemeindeverbände (u. a. die Landkreise) sind zwar staatsrechtlich Teil der Landesverwaltung, gleichwohl aber eigenständige Rechtspersönlichkeiten (→Körperschaften des öffentlichen Rechts). Sie sind Teil der unteren Staatsverwaltung, aber keine landeseigenen Behörden, sondern Selbstverwaltungskörperschaften, die in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich eine große Zahl von Verwaltungsaufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen. Auch wenn das Land manche seiner landeseigenen Verwaltungsaufgaben aus verwaltungsökonomischen Gründen von den Kommunen ausführen lässt, berührt dies nicht die grundsätzliche Autonomie der Kommunen. Diese ist in der Verfassung ausdrücklich verankert und geht deutlich über die Ausführung von Gesetzesbefehlen und Verwaltungshilfen für das Land hinaus. Die herausgehobene verfassungsrechtliche Stellung der Gemeinden (→Kap. B) und Kreise (→Kap. F) und die große quantitative Bedeutung der kommunalen Verwaltungsträger macht die Kommunen praktisch zur dritten Säule der öffentlichen Verwaltung (Bund, Länder, Kommunen; vgl. Thieme 2007, 161; Junkernheinrich/Lorig 2013, 23; Naßmacher/Naßmacher 2007, 19). Die kommunale Ebene wird daher in den nachfolgenden Kapiteln als eigenständiger Sektor der öffentlichen Verwaltung ausgewiesen.
Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, müssen Verwaltungsträger mit Rechten und Pflichten ausgestattet werden. Damit erlangen sie Rechtsfähigkeit, die es ihnen ermöglicht, wie jede natürliche Person am Rechtsverkehr teilzunehmen. So können sie z. B. gegen Dritte klagen (z. B. auf Rückzahlung einer zu Unrecht bezogenen Sozialleistung) oder durch Dritte verklagt werden (z. B. wegen Untätigkeit).
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsträger nehmen ihre Verwaltungsaufgaben durch Behörden wahr. Behörden sind organisatorische Einheiten eines Verwaltungsträgers mit Handlungszuständigkeit nach außen. Verwaltungsträger und Behörden gehören zusammen, sind aber nicht identisch.
Verwaltungsträger sind keine Behörden, sie haben Behörden.
Behörden sind nicht rechtsfähig. Sie handeln zwar im eigenen Namen, ihr Handlungsergebnis wird jedoch dem Verwaltungsträger, für den sie tätig sind, zugerechnet. Die Klage einer Kommune gegen die Bezirksregierung wirkt daher nicht gegen die Behörde „Regierungspräsident“ als Verwaltungsorgan der Bezirksregierung, sondern gegen das jeweilige Bundesland.
Indem sie dessen Verwaltungsaufgaben erledigen, sind Verwaltungsbehörden zugleich Organe des Verwaltungsträgers. Der Begriff Organ geht aber über den Behördenbegriff hinaus („Behörde als Unterfall des Organs“; Maurer 2011, 544). So ist der Landtag zwar ein Organ des Landes, im organisatorischen Sinne aber keine nach außen gerichtete Verwaltungsbehörde. Auch der Rat einer Stadt ist Organ des Verwaltungsträgers Gemeinde, aber nicht das Verwaltungsorgan der Stadt. Der Gemeinderat trifft als Willensbildungsorgan der Gemeinde zwar wichtige Entscheidungen, die Umsetzung obliegt aber dem Bürgermeister als dem Verwaltungsorgan. Der Gemeinderat ist demzufolge Organ, aber nicht Behörde.
Versteht man den Begriff Behörde weniger im organisatorischen Sinne (als Organ, das für die Ausführung von Verwaltungsaufgaben zuständig ist), sondern mehr im funktionalen Sinn (Verwaltungsaufgaben ausführend), dann können auch Organe, die organisatorisch betrachtet keine Verwaltungsbehörden sind, Behörden sein.
Beispiel:
Das Verfassungsorgan Bundespräsident handelt verwaltend, wenn eine Referentin eingestellt wird. Ebenso handelt der Rat einer Stadt, der einen Beigeordneten (leitender Beamter) entlässt, als Verwaltungsbehörde.
Der funktionale Behördenbegriff stellt auf das „Verwalten“ als Inhalt der Tätigkeit ab (Verwaltung im materiellen Sinne, siehe A-1). Nimmt ein Organ nach außen gerichtet öffentliche Verwaltungsaufgaben wahr, wird es insoweit zur Behörde (siehe § 1 IV VwVfG). Werden Verwaltungsaufgaben von staatlich beauftragten Privaten („Beliehenen“) wahrgenommen (→A-5), handelt es sich im funktionalen Sinne ebenfalls um Behördentätigkeit; da Beliehene aber nicht in einen öffentlichen Verwaltungsträger eingegliedert sind, stellen sie keine Verwaltungsbehörde im organisatorischen Sinne dar.
Von dem Behördenbegriff abzugrenzen ist der Begriff des →Amtes, sofern man darunter eine interne Organisationseinheit einer Behörde versteht. So ist das städtische Sozialamt rechtlich weder Organ noch Behörde. Die Mitarbeiter/innen des Sozialamtes sind zwar praktisch gesehen die Behörde (sie tun die Arbeit), im Rechtssinne sind sie aber nur die Vertreter der Behörde „Bürgermeister“. Im Briefkopf der Ämter heißt es deshalb meist „Stadt D., Die Oberbürgermeisterin, Amt für Jugend und Soziales“.
Behörden dürfen (ebenso wie andere Organe) nur im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit handeln. Diese Zuständigkeit kann verschiedener Art sein und ist im Alltag des Verwaltungshandelns immer wieder zu klären (→D-2.3).
3 STAATLICHE VERWALTUNGSTRÄGER
3.1 Trennung der Verwaltungsebenen
Grundsätzlich dürfen Verwaltungsaufgaben nur einer einzigen staatlichen Verwaltungsebene (Bund oder Länder) zur eigenverantwortlichen Erledigung zugewiesen werden. Verwaltungskompetenzen von Bund und Ländern sollen weitgehend getrennt bleiben, um vor allem die Länder „vor einem Eindringen des Bundes in den ihnen vorbehaltenen Bereich der Verwaltung zu schützen“ (BVerfG, Urteil vom 20.12.2007 -2 BvR 2433/04, 2434/04). Zugewiesene Aufgaben sind mit eigenem Personal, eigenen Sachmitteln und eigener Organisation wahrzunehmen („Verbot der Mischverwaltung“). Eine Ausnahme bilden die Jobcenter nach § 44b SGB II, bei denen Bundesverwaltung (Bundesagentur für Arbeit) und Landesverwaltung (Kommunen als Teil der Landesverwaltung) eine gemeinsame Verwaltungsbehörde bilden.
Demzufolge kann auf der staatlichen Verwaltungsebene mit wenigen Ausnahmen (siehe Art. 91a ff. GG) zwischen Bundes- und Landesverwaltung unterschieden werden. Der Stellung der Länder als Verwaltungsträger entsprechend beginnt die nachfolgende Darstellung mit den Ländern.
3.2 Länderverwaltung
3.2.1 Länder als Hauptverwaltungsträger
Die Ausführung von Gesetzen obliegt in der Hauptsache den Ländern (Art. 30 GG). Diese sog. „Verwaltungskompetenz“ haben die Länder auch dann, wenn es sich um Bundesgesetze handelt. Erst recht gilt die Landeszuständigkeit im Bereich der Landesgesetzgebung. Die Länder wiederum übertragen einen Großteil der Aufgaben auf die Kommunen. Nur in wenigen im Grundgesetz bestimmten Gesetzgebungsbereichen (Art. 86 ff. GG) ist der Bund eigener Verwaltungsträger mit eigenen Behörden (z. B. Bundespolizei, Bundeswehr, Flugsicherung). Die
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!