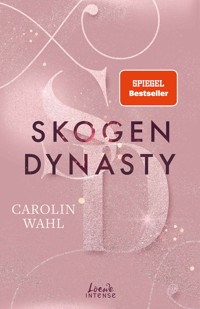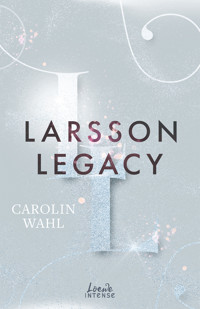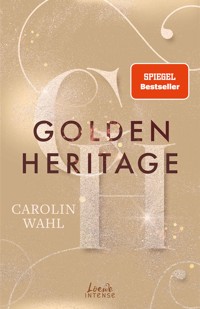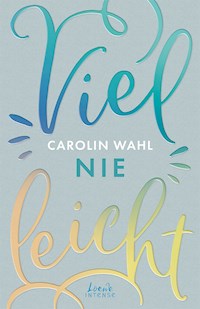9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Vielleicht-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Mitreißend, prickelnd, ergreifend! Die Reihe mit Herzklopfgarantie. Er hat klare Regeln. Doch mit ihr bricht er jede davon … Fast hätte Gabriella in Brasilien ihren Flieger verpasst und jetzt sitzt sie auch noch neben diesem unverschämten – oder eher unverschämt gut aussehenden? – Kerl. Na toll! Obwohl er eigentlich ganz süß ist … Aber für die Liebe hat sie ohnehin keine Zeit, schließlich fliegt sie nach München, um ihren Vater kennenzulernen. Undercover beginnt sie ein Praktikum in seiner Catering-Firma. Doch an ihrem ersten Arbeitstag in der Küche stellt sich ihr Ausbilder ausgerechnet als Anton aka ihr Sitznachbar im Flugzeug heraus! Vergeblich versucht Gabriella, gegen die Funken zwischen ihnen anzukämpfen. Denn Anton hat klare Regeln, was Beziehungen am Arbeitsplatz angeht. »So, so, so gut! Die Geschichte von Gabriella und Anton ist bezaubernd, erfrischend, neu und gleichzeitig vertraut. Ganz große Empfehlung!« Bianca Iosivoni Vielleicht jetzt hat alles, was Leser*innen an New Adult lieben: eine tolle, selbstbewusste Protagonistin, ein Love Interest zum Dahinschmelzen und eine mitreißende Liebesgeschichte. Ein erfrischender Roman mit Herz, Humor und ganz viel Gefühl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Das Leben ist kein Spiel
Rückwärts
Ein ziemlich schräger Traum
Team Tentakelfaust
Durch den Dschungel
Der Tempel
Densitronium
Der Schachbrettraum
Der Schatten
Noch mehr Knöpfe
Der Quantenkristall
Die Unbesiegbaren Helden
Der Endboss
Gewinner und Verlierer
Ausgeträumt
Rezepte
Für meinen Ray of Sunshine –
Playlist
Alok feat. Matheus & Kauan – VillaMix
BANKS – Fuck Em Only We Know
Billie Eilish – Ocean Eyes
Bowling For Soup – Baby One More Time
Dermot Kennedy – Power Over Me
Ellie Goulding – Under The Sheets
Fernando & Sorocaba, Vitor Kley – Valeu a Pena
Fergie – Big Girls Don’t Cry
Fergie ft. Q-Tip, GoonRock – A Little Party Never Killed Nobody
French Montana ft. Swae Lee – Unforgettable
Frankie Valli – Can’t Take My Eyes Off You
H.E.R. – Every Kind Of Way
Kehlani – Advice
Lorde – Supercut
Lorde feat. Khalid, Post Malone & SZA – Homemade Dynamite
Machine Gun Kelly ft. Halsey – forget me too
Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego
Orishas – Represent Cuba
Sabrina Claudio – Unravel Me
salem ilese – mad at disney
SZA – The Weekend
The Cardigans – Lovefool
Timbaland ft. Katy Perry – If We Ever Meet Again
Rock Mafia – The Big Bang
The Weeknd – After Hours
Kapitel 1
Mein kleiner Kolibri, es tut mir so unendlich leid. Lass uns über alles reden … Aber nimm dir die Zeit, die du brauchst. Das kann ich nachvollziehen.
Ich starrte auf die Worte, die auf dem kleinen Bildschirm prangten, und biss mir auf meine Unterlippe, als das schlechte Gewissen mich zu überwältigen drohte. Sie hatte wohl den Brief erhalten, den ich vor meiner Abreise an sie versendet hatte. Hier saß ich also, ohne meiner Mutter etwas davon gesagt zu haben. Sie hatte nicht den blassesten Schimmer, dass ich zwei Flugstunden entfernt am Flughafen in Rio saß und im Begriff stand, mich meiner Vergangenheit, meiner Identität zu stellen.
Die Sätze verschwammen, während ich tief Luft holte und sie bereits zum zehnten Mal las.
Shit.
Worte hatten ein Ablaufdatum. Als ob kleine imaginäre Männchen mit einem Etikettiergerät neben einem standen und das Gesagte mit dem Verfallsdatum beschrifteten. Versprechen, Wahrheiten, aber ganz besonders Lügen. Und diese Lüge war eine tickende Zeitbombe gewesen, hatte darauf gelauert, endlich hochzugehen.
Seufzend schloss ich die Augen, doch sofort tauchte die Nachricht meiner Mutter auf meiner Netzhaut auf, als hätte sie sich dort eingebrannt.
Ich hätte gerne so etwas wie Wut verspürt. Oder Enttäuschung. Oder eine andere negative Emotion, die all die brodelnden Gefühle kanalisiert hätte, aber das tat ich nicht. So war ich einfach nicht. Schon als Kind hatte ich immer versucht, die Gründe für das Verhalten anderer Menschen nachzuvollziehen.
Egal was meine Mutter getan hatte, egal wie schlimm sich dieser Verrat auch anfühlte: Ich konnte ihr unmöglich böse sein, schließlich hätte ich an ihrer Stelle vermutlich genauso gehandelt. Ich hätte meine Tochter auch angelogen, um sie vor der Wahrheit zu schützen.
Als ich die Augen wieder aufschlug, schwebte ein freundliches Gesicht vor mir, das etwas zu mir sagte. Erschrocken zuckte ich so heftig zusammen, dass einer meiner Kopfhörer aus dem Ohr rutschte und mein Lieblingslied von BANKS hörbar durch die Gegend plärrte.
Das freundliche Gesicht gehörte zu einer Stewardess in Lufthansa-Uniform, ihre blauen Augen waren wie zwei Laserpointer auf mich gerichtet.
»Ja?«, fragte ich automatisch auf Englisch. Erst nach und nach tauchte ich wieder aus meinen Gedanken auf und musste zu meinem Entsetzen feststellen, dass sich das Abfluggate merklich geleert hatte. Genauer gesagt war ich die einzige Person, die noch auf einer der ledergepolsterten Bänke saß.
»Sind Sie Gabriella Rocha?«, fragte sie ebenfalls auf Englisch.
Mir wurde heiß und kalt gleichzeitig, während plötzlich Panik durch meine Venen jagte. »Ja, wieso?«
»Dann sollten Sie sich beeilen, dies ist der letzte Aufruf für den Flug nach Frankfurt und wir haben Sie bereits zweimal ausrufen lassen.«
Schlagartig stieg mir Hitze in den Kopf, sodass jeder Millimeter meiner Haut zu jucken begann. »D…danke«, stammelte ich auf Deutsch und voller Erleichterung.
Hastig sammelte ich meine Habseligkeiten zusammen, stopfte sie in den Rucksack und wischte ein paarmal über den Bildschirm meines Handys, um zu meiner Bordkarte zu gelangen.
»Gerade noch rechtzeitig. Guten Flug.« Die hübsche Stewardess mit den knallroten Lippen schenkte mir ein aufrichtiges Lächeln, das ich herzlich erwiderte, ehe ich mir mein Smartphone in die hintere Hosentasche meiner Jeans schob und in Richtung der Boeing 747-400 hastete. Die Henkel meines Rucksacks drückten mir dank seines Gewichts in die Schultern, aber das störte mich nicht im Geringsten.
Ich war oft genug geflogen, um zu wissen, dass sie vor dem Start mein Gepäck hätten suchen und ausladen müssen, was bei knapp fünfhundert Leuten und vermutlich mindestens genauso vielen Gepäckstücken eine Weile gedauert hätte. Nicht auszudenken, wie viele Menschen mich im Stillen bereits verfluchten.
Sobald ich das monströse Flugzeug erblickte, das von der Dunkelheit des brasilianischen Himmels verschluckt wurde, machte mein Herz einen aufgeregten Hüpfer. In zwölf Stunden würde ich das erste Mal in meinem Leben deutschen Boden betreten und meiner zweiten Hälfte endlich näher sein. Ein kleines Lächeln stahl sich auf meine Lippen und ein seltsames Gefühl von Vorfreude überkam mich trotz des ganzen Chaos, das ich hinter mir zurückließ. Ich zwang mich, nicht an das Gesicht meiner Mutter zu denken, wenn sie meinen Brief zu Ende gelesen haben würde.
Außer Atem betrat ich über die Passagierbrücke den vorderen Teil des Flugzeugs und wurde sogleich von einer gereizten Stewardess taxiert. Sie war blond, hübsch und bestimmt gerade mal Anfang zwanzig. Als sie mich erblickte, schrie sie mir ihren Gedanken mit einem einzigen Blick entgegen: Wegen dieser rücksichtslosen Kuh müssen wir also später starten!
Ich zog den Kopf ein und hoffte, dass sie die Einzige blieb, die auf mich aufmerksam wurde.
Als ich den Gang zu meinem Platz entlangschritt und die kleinen Schildchen über den Köpfen nach der richtigen Nummer abscannte, fiel mir ein Typ ins Auge, der auf einem Gangplatz saß. Es lag an seiner Größe. Wie ein Leuchtturm ragte er über den anderen Köpfen auf. Und neben ihm war der einzige freie Sitz zu sehen. Ich spürte, wie die Blicke der bereits sitzenden Fluggäste auf mir ruhten. Manche missbilligend, manche abschätzig, ein paar genervt. Vielleicht hatte der Kapitän längst eine Durchsage gemacht, ihnen erklärt, dass sie noch auf einen Passagier warten mussten.
Großartig.
Mit rotem Kopf und einem entschuldigenden Lächeln auf den Lippen schob ich mich weiter auf die Reihe zu, wo ich meinen Platz vermutete. Neben dem Typen, der ungefähr in meinem Alter sein musste. Vielleicht ein, zwei Jahre älter. So genau konnte ich das aufgrund des gepflegten Dreitagebartes nicht sagen, denn das machte alle Männer irgendwie automatisch älter.
Seine Schultern waren so breit, dass die Armlehnen wie eine Miniaturausgabe der eigentlichen Vorrichtung wirkten, und er hatte den Blick konzentriert auf etwas vor sich gerichtet.
Der Ausdruck auf seinem markanten Gesicht war so mürrisch und verschlossen, dass es eine Brechstange gebraucht hätte, um ihn zu knacken. Trotzdem konnte das nicht von der Tatsache ablenken, wie gut er aussah.
Ich schob mich – immer noch mit diesem angeklebten, entschuldigenden Lächeln – weiter auf den Platz zu, während sich mein Herzschlag plötzlich verdoppelte. Je näher ich der Sitzreihe kam, desto nervöser wurde ich. Meine Handflächen begannen zu schwitzen und ich wusste, auch ohne einen Blick in den Spiegel zu werfen, dass mein Kopf mittlerweile die Farbe einer überreifen Tomate angenommen haben musste, was man trotz meines natürlichen dunklen Teints deutlich sehen würde.
Mein Blick blieb an den unverschämt blauen Augen hängen, die auf ein Buch in seiner Hand geheftet waren. Ein Buch. Im 21.Jahrhundert. Ich hätte ihm am liebsten zu dieser Entscheidung gratuliert, wenn mich seine abweisende Ausstrahlung nicht so irritiert hätte.
Ich überprüfte die Nummer, die über der Sitzreihe stand, mit der Zahl auf meiner Bordkarte.
»Entschuldigung?« Wieder stellte ich meine Frage auf Englisch, denn obwohl ich in einem Flugzeug nach Deutschland saß, wollte ich mir nicht anmaßen, ihn für einen Deutschen zu halten.
Er hob den Kopf und sah mich an. Durchdringend. Verärgert.
Sämtliche Härchen auf meinen Armen stellten sich auf und ich konnte gerade noch verhindern, hörbar nach Luft zu schnappen.
Ach du Schande.
Ich hatte ja zuvor bemerkt, dass er attraktiv war – der markante Kiefer, der sanfte Schwung seiner Lippen, das unnatürliche Blau seiner Augen –, aber jetzt seinen Blick auf mir zu spüren, war etwas komplett anderes. Als könnte er mit seinem Röntgenblick genau in mich hineinsehen. Allerdings war es seine verdammte Ausstrahlung, die eine kribbelnde Nervosität in mir aufsteigen ließ. Unnahbar, mit einer Prise Arroganz. Zumindest wirkte es so.
Um meine Unsicherheit zu überspielen, setzte ich mein breitestes Lächeln auf. Doch der abweisende Ausdruck auf seinem Gesicht blieb.
»Hi. Ich glaube, ich sitze neben dir«, sagte ich wieder auf Englisch, einen Tick zu schnell und mit viel zu hoher Stimme.
Mein Sitznachbar zog eine Braue in die Höhe, ohne dabei eine Miene zu verziehen. »Du glaubst?«, fragte er.
Als ich nicht antwortete und ihn nur verwirrt anstarrte, fügte er hinzu: »Du glaubst oder du weißt, dass du hier sitzt?«
Ich blinzelte kurz irritiert. »Wie bitte?«
»Bist du der Grund, warum wir fast dreißig Minuten Verspätung haben?«
Ich murmelte etwas Undeutliches, das man halb als Entschuldigung durchgehen lassen könnte, und hatte den Eindruck, dass mittlerweile die halbe Kabine ihre Gespräche eingestellt hatte, um uns zuzuhören. In meinen Ohren rauschte es.
»Kann ich mich einfach auf meinen Platz setzen?« Mit einem ungeduldigen Kopfnicken deutete ich auf die leere Stelle neben ihm und tippelte von einem Fuß auf den anderen.
»Klar.«
Der Typ machte eine finstere Miene und schoss in die Höhe, während meine Augen seiner Bewegung folgten, bis ich den Kopf in den Nacken legen musste, um ihm weiter ins Gesicht sehen zu können. Er roch angenehm, nach irgendeinem Männerduschgel. Zitronig und frisch.
Ich schluckte. Er war nicht einfach nur groß. Nein, der Kerl war riesig. Dabei war ich mit meinen knapp ein Meter achtzig wirklich nicht gerade klein und hatte sonst nie das Problem, Männern auf Augenhöhe zu begegnen. Wortwörtlich.
Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, verstaute ich den Rucksack in der Ablage über uns und rutschte auf meinen Sitz. Nicht ohne vorher meine Kopfhörer und eine Zeitschrift herausgeholt zu haben. Die ältere Dame am Fenster nickte mir freundlich zu, was ich mit einem erleichterten Lächeln erwiderte. Nicht jeder hier an Bord wollte meinen Kopf auf einer Speerspitze aufgespießt sehen.
Als sich der Typ zu meiner Rechten wieder auf seinen Platz quetschte, fiel mir auf, dass er das Gesicht verzog, weil seine Beine an den Sitz vor ihm stießen. Unwillkürlich stieg Mitleid in mir auf, auch wenn er so unfreundlich gewesen war. Was ich zum Teil ja nachvollziehen konnte. Schließlich hatte der Flug wirklich meinetwegen Verspätung.
»Tut mir leid wegen der Verspätung«, murmelte ich zerknirscht und schenkte ihm wieder ein offenes Lächeln, was seinen Blick für einen Sekundenbruchteil auf meine Lippen lenkte. Dabei fiel mir auf, dass seine Augen weiße Sprenkel besaßen, etwas, das ich in Brasilien noch nicht so häufig gesehen hatte.
»Passiert.«
»Nein, wirklich … Wenn ich könnte, würde ich zur Stewardess gehen und sie bitten, mich eine Borddurchsage machen zu lassen, damit meine Entschuldigung alle zu hören bekommen.« Ich zuckte mit den Schultern. »Aber jetzt musst du herhalten.«
Nichts. Nicht der Anflug eines Lächelns. Tatsächlich wirkte er jetzt sogar noch angespannter – falls das überhaupt möglich war.
»Alles okay?«, fragte ich leise und ärgerte mich im selben Augenblick darüber, dass ich meine verdammte Klappe einfach nicht halten konnte.
Mit hochgezogenen Augenbrauen warf er mir einen Seitenblick zu. »Wie meinst du das?«
Ich seufzte. »Erst ich, mit der Verspätung. Und jetzt der Zwölfstundenflug. Muss bestimmt anstrengend sein.« Ich schaute demonstrativ auf seine langen Beine. »Dir wäre die Businessclass sicher lieber …«
Sein Mund wurde zu einer schmalen Linie. »Danke, dass du mich daran erinnerst.«
Mist. »So habe ich das gar nicht …«
»Wie ungeschickt kann man eigentlich sein?«, grummelte mein namenloser Sitznachbar auf Deutsch, griff in den Netzbeutel vor sich und holte ein Paar schwarze Noise-Cancelling-Kopfhörer hervor, die er mit einem demonstrativen Blick in meine Richtung aufsetzte und schließlich über sein Handy einschaltete.
Ich seufzte wieder und wandte meine Aufmerksamkeit dem kleinen Bildschirm vor mir zu, während ich meinen wilden Puls unter Kontrolle zu bringen versuchte. Als ich mein Handy in den Flugmodus stellen wollte, entdeckte ich zwei neue Nachrichten. Eine von meiner Mutter und eine von Olivia, meiner besten Freundin. Zuerst klickte ich auf die harmlose Nachricht.
Ich denke an dich. Und ich halte dich nicht für völlig verrückt, weil du dein Studium unterbrichst, um ein Praktikum(!) in einer Catering-Firma zu machen! Du hast meine volle Unterstützung! Hab dich lieb
Tja. Das war auch so eine Sache. Ich hatte mein Studium pausiert. Mitten im Semester. Denn im Gegensatz zum deutschen Universitätssystem gab es in Brasilien die langen Semesterferien erst im Winter bis zum Karneval im Februar.
Ich biss mir auf die Unterlippe und mein Finger schwebte einige Sekunden lang über der Anzeige, ehe ich die Nachricht mit klopfendem Herzen öffnete. Anscheinend hatte sie nun meinen gesamten Brief gelesen.
Du fliegst zu deinem Vater???
Vater.
Da stand das Wort, von dem ich bis vor drei Wochen nicht einmal gewusst hatte, dass es in meinem Leben jemals eine Bedeutung haben würde. Denn bis vor drei Wochen war ich davon ausgegangen, dass ich bei einem namenlosen One-Night-Stand gezeugt worden war. Aber nein. Vor drei Wochen war die Lüge meiner Mutter aufgeflogen und ich jetzt auf dem Weg, den Mann kennenzulernen, dem ich meine deutsche Seite zu verdanken hatte.
Ich würde mich vier Monate in seinem Dunstkreis bewegen, ohne dass er die leiseste Ahnung hatte, wer da eigentlich ein Praktikum in seiner Firma ergattert hatte.
Nämlich seine Tochter.
Kapitel 2
Eine Stunde nachdem sich das Flugzeug in den tiefschwarzen Nachthimmel erhoben hatte, war der Bordservice in vollem Gange. Das tiefe, beständige Dröhnen der Motoren vibrierte in meinem Innern, meine Augen fielen mir beinahe zu, aber ich war zu hungrig, um zu schlafen. Noch immer hatte mein Sitznachbar seine Kopfhörer auf, doch als die Stewardess näher kam, schob er sie herunter, bis sie um seinen Hals baumelten. Die alte Dame zu meiner Linken schlief bereits, mit Stöpseln in den Ohren und einer hellgrauen Maske über den Augen.
»Was würden Sie gerne trinken?«, wollte die hübsche Stewardess auf Deutsch von ihm wissen.
»Ein Wasser, bitte. Mit Kohlensäure.« Immerhin war er höflich zu anderen.
Mit einem Lächeln schenkte die Stewardess ihm ein, wobei ihre Augen vielleicht eine Spur zu sehr blitzten und ihre Lippen sich eindeutig etwas zu verführerisch verzogen. Aber MrIch-zeige-keine-einzige-freundliche-Emotion nahm das gar nicht wahr oder er wollte es bewusst nicht wahrnehmen. Also wandte sie sich an mich.
»Und für Sie?«, fragte sie auf Englisch.
»Wasser ohne Kohlensäure, bitte«, erwiderte ich auf Deutsch. Ich spürte den neugierigen Blick von rechts mein Gesicht streifen und versuchte, eine möglichst neutrale Miene aufzusetzen. Am liebsten hätte ich ihm die Zunge rausgestreckt, aber das kam mir dann doch etwas zu kindisch vor.
Als die Stewardess meiner Bestellung nachgekommen und in der nächsten Sitzreihe angelangt war, bemerkte ich wieder, wie mein Nachbar mir einen kurzen Seitenblick zuwarf.
»Du kannst mich ruhig fragen, weißt du«, sagte ich, nahm einen Schluck von meinem kühlen Wasser und sah ihn unschuldig an. Dieses Mal hatte ich betont deutsch gesprochen.
»Was fragen?« Er schaute flüchtig zu mir herüber, als wollte er sich vergewissern, dass ich meine Worte auch wirklich an ihn gerichtet hatte.
»Warum ich deutsch sprechen kann.«
»Und weshalb sollte mich das interessieren?«
Zuerst war ich mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden hatte, denn obwohl ich seit meiner Kindheit darum bemüht gewesen war, die Sprache meines gesichtslosen Erzeugers zu erlernen, war ich mittlerweile doch etwas eingerostet.
»Tut es das nicht?« Ich grinste ihn an, was aber kein bisschen an seinem irritierend gleichgültigen Gesichtsausdruck änderte. Himmel, der Kerl war vielleicht eine harte Nuss!
»Wir sitzen in einem Flugzeug nach Deutschland. Die Wahrscheinlichkeit, dass du deutsch sprichst, ist nicht gerade gering«, erwiderte er jetzt achselzuckend und lenkte seine Aufmerksamkeit wieder nach vorne, wo über seinen Bildschirm ein Marvel-Film flackerte, den er nicht pausiert hatte.
Touché.
»So was nennt man Small Talk.«
Er schnaubte, öffnete den Mund und schloss ihn dann wieder, als ob er es sich anders überlegt hätte. Langsam fragte ich mich, ob er immer so griesgrämig war oder ob heute einfach nicht sein Tag war. Ich beschloss, ihn genau das zu fragen.
»Bist du immer so schlecht gelaunt?«
»Schlecht gelaunt?« Jetzt sah er mich direkt an, was zur Folge hatte, dass sich etwas in mir in weiche Butter verwandelte. In seiner Frage schwang ehrliche Irritation mit.
Ich machte eine lose Handbewegung in seine Richtung. »Kurz angebunden, angespannte Schultern, ernster Gesichtsausdruck.«
In seinen meerblauen Augen blitzte etwas auf. »Nicht jedem scheint die Sonne aus dem Arsch.«
Das Lächeln auf meinen Lippen erstarb. Ich blinzelte ein paarmal hintereinander, um mich zu vergewissern, dass ich mich auch dieses Mal nicht verhört hatte. Gleichzeitig wurde es in mir verdächtig still. Innerlich zählte ich bis drei, ehe ich antwortete, denn eigentlich konnte mich nichts aus der Ruhe bringen. Eigentlich. Aber in der Nähe meines Sitznachbarn fühlte es sich tatsächlich so an, als hätte sich eine Gewitterfront vor die besagte Sonne geschoben.
»Ich wollte nur nett sein.«
»Nett.« Er spie das Wort förmlich aus.
»Keine Ahnung, wir sitzen noch einige Stunden nebeneinander, ich dachte …« Meine Stimme war leiser geworden und ich konnte nicht verhindern, dass sie ein wenig verletzt klang, was mich ärgerte. Es ärgerte mich, dass ein Fremder in der Lage war, mich derart aufzuwühlen. Was der Übermüdung, den emotionalen vergangenen drei Wochen und der Tatsache geschuldet war, dass ich in letzter Zeit kaum Schlaf gefunden hatte.
Anscheinend hatte ich in ein Wespennest gestochen, denn mein Sitznachbar war noch nicht fertig: »Wie du vorhin korrekt bemerkt hast, ist es nicht gerade schön, zwölf Stunden in dieser Konservenbüchse eingesperrt zu sein. Zu allem Überfluss haben wir fast dreißig Minuten Verspätung und wie durchgesagt wurde, werden wir die Zeit auch nicht reinholen können.« Sein kühler Blick glitt über mich hinweg und ich faltete die Hände krampfhaft in meinem Schoß zusammen, damit er nicht sah, wie sehr mich seine Worte trafen. »Ich habe die letzten zwei Nächte nicht geschlafen und bereits einen Flug verpasst. Meinen Anschlussflug in Frankfurt darf ich nicht verpassen, werde es aber wahrscheinlich und kann nichts dagegen machen.«
Er stieß den Atem aus und ein Muskel in seinem Kiefer zuckte vor Anspannung.
»Aber ist dir ja anscheinend egal, weil du hier fröhlich reinspazierst, allen dein umwerfendes Lächeln schenkst und davon ausgehst, dass damit wieder alles in Ordnung ist.« Jetzt knurrte er fast. »Nur soll ich dir was verraten? Dein Handeln hatte heute für fast fünfhundert Menschen Konsequenzen. Nicht nur für mich. Und ich hasse ignorante Personen, die auf dem Rücken anderer ihr Leben austragen.« Er maß mich mit einem abschätzigen Blick. »Allerdings ist das jemandem wie dir vielleicht einfach scheißegal.«
»Jemandem wie mir?«, würgte ich hervor.
Sein Blick glitt von meinem teuren Pullover zu dem neuen Smartphone. »Wahrscheinlich gehörst du zu denjenigen, deren Eltern immer ihre Probleme lösen und von vorne bis hinten von ihnen verhätschelt wurden. Das würde deine Ignoranz erklären. Daddy regelt das schon.«
Wow. Was für ein Arschloch!
Dummerweise traf er damit einen Nerv.
Ich schluckte, während sich ein gewaltiger Kloß in meinem Hals bildete und ich das Gehörte zu verdauen versuchte.
Das war es also. Darum ging es ihm. Deswegen die schlechte Laune, die knappen Antworten.
In mir begann es zu brodeln, weil seine Worte so scheußlich geklungen hatten und hinter seinem attraktiven Äußeren nichts weiter steckte als ein arroganter Idiot, der meinte, seinen Frust an mir auslassen zu können. Ich hatte mich entschuldigt. Mehrfach. Ich war freundlich geblieben.
Wortlos starrte ich ihn an und rang um Fassung, während sich in meinem Kopf ein Puzzleteil nach dem anderen zusammensetzte und ein Gesamtbild ergab, dem ich mich in diesem Augenblick nicht entziehen konnte.
Zu weich. Zu lieb. Zu nett. Einfach zu verdammt freundlich zu jedem, immer darauf bedacht, es allen recht zu machen und ihnen zu gefallen. Bis meine Gefühle verletzt werden, weil sie ja eigentlich keine Rolle spielen.
Plötzlich war sie doch da.
Die Wut. Über meine Mutter, weil sie mich jahrelang – JAHRELANG – angelogen hatte. Über meinen Vater, der in Deutschland saß und sich nicht einmal nach mir erkundigt hatte. Über mich selbst, weil ich mich anbiederte wie ein Straßenhund, den man schlagen konnte und der trotzdem angekrochen kam und um Liebe bettelte.
Und dann war da Enttäuschung. Bodenlose, gnadenlose Enttäuschung, die sich wie ein Angelhaken in meinem Herz versenkte und kräftig daran zog.
Dieser Typ hatte es innerhalb eines Gesprächs geschafft, all das in mir aufzuwühlen, hatte es geschafft, bis in mein Innerstes vorzudringen und die versteckten Gefühle zutage zu fördern, die ich wochenlang da unten begraben hatte.
Und jetzt fühlte ich mich einfach nur noch leer. Leer und traurig.
Tränen, heiß und glühend, sammelten sich in meinen Augen und mein ganzer Körper wurde von einer solchen Hitze ergriffen, dass ich nach Luft schnappen musste, um nicht direkt loszuheulen.
Entsetzen breitete sich auf seinem Gesicht aus, als er mich anblickte und all diese Emotionen auf meinen Zügen ablesen musste. Ich wollte nicht weinen. Nicht so. Nicht vor ihm. Erst recht nicht vor ihm!
Aber ich spürte trotzdem, wie sich die Tränen aus meinen Augenwinkeln lösten und über meine Wangen liefen.
Deus, ich war so eine Enttäuschung!
»Ich …«, setzte er an, doch ich schüttelte den Kopf, zwang mich, nach den richtigen Worten zu fischen.
»Lass mich bitte raus.« Meine Stimme klang kraftlos und es wunderte mich nicht, dass er meiner Aufforderung sofort Folge leistete, damit ich nach hinten in Richtung der Bordtoilette gehen konnte.
Dort sperrte ich mich ein und lehnte meinen Oberkörper gegen die geschlossene Tür. Mein Herz klopfte so heftig, dass es selbst das Dröhnen der Turbinen und das beständige Rauschen der Motoren übertönte. Ich presste meine Lider fest zusammen, versuchte, meine Gefühle unter Kontrolle zu bekommen, und wagte schließlich einen Blick in den Spiegel, wo mir weit aufgerissene Augen entgegenstarrten. Sie waren hellbraun wie guter Whiskey, behauptete meine Mutter immer. Dieselben Augen, die auch mein Vater besaß, dem ich noch nie begegnet war. Zumindest hatte es auf den Videos, die ich mir von ihm angeschaut hatte, so ausgesehen.
Einzelne Strähnen der dunklen schweren Locken, die jetzt zu einem hohen Dutt aufgesteckt waren, hatten sich aus dem Gummiband gelöst und umspielten meine Züge. Meine Wangen waren gerötet, meine Unterlippe vom vielen Draufherumkauen ganz wund. Kurz überlegte ich, die kleinen goldenen Kreolen abzunehmen, entschied mich aber dagegen. Ebenso ließ ich die goldene Kette um meinen Hals hängen, an dessen Ende ein kleines Maria-Bildnis baumelte, ein Geschenk meiner vovó zu meinem achtzehnten Geburtstag letztes Jahr.
Ich sah aufgewühlt aus, aber nicht gebrochen.
Nein.
Ich hatte mich nicht einfach so in dieses Flugzeug gesetzt. Neunzehn Jahre hatte ich den Namen meines Vaters nicht gekannt. Ich hatte geglaubt, meine Mutter würde ihn selbst nicht kennen. Aber jetzt hatte ich einen Namen. Einen Namen und eine Adresse in München.
Resigniert spritzte ich mir eine Ladung Wasser ins Gesicht. Dann richtete ich mich auf, atmete tief durch und rückte innerlich mein Krönchen zurecht.
Ich wollte nicht so schwach sein, aber gleichzeitig war mir klar, dass meine Nettigkeit keine Schwäche war. Don’t take my kindness for weakness. Es gab genug Menschen, die mich unterschätzten, weil ich immer nett war. Aber wenn es drauf ankam, fuhr ich meine Krallen aus.
In mir brodelten mein Selbsterhaltungstrieb und mein Stolz.
Also straffte ich die Schultern und öffnete die Tür.
Mein Sitznachbar lehnte an der Wand gegenüber der Toilette und sah mich zerknirscht an, als ich mich aus der winzigen Kabine zwängte.
»Was willst du?«, fragte ich kalt und vermied es, ihm direkt in die Augen zu blicken.
Er löste sich von der Wand und trat einen Schritt auf mich zu. Auf einmal wirkte der schmale Gang noch enger.
»Mich entschuldigen«, sagte er ernst und mit solchem Nachdruck in der Stimme, dass ich doch den Kopf hob und zu ihm hochschaute.
»Das ist ja auch das Mindeste.« Jetzt war ich diejenige, die beinahe knurrte.
»Da hast du recht.«
»Ich weine eigentlich nie.«
»Klar.«
Wütend verengte ich die Augen, versuchte herauszufinden, ob er das ironisch meinte, und trat herausfordernd noch einen Schritt auf ihn zu. Warum musste er auch so verdammt groß sein?
»Ach ja?«
Er legte den Kopf schief. »Gut, vielleicht machst du durchaus den Eindruck, als würdest du schnell in Tränen ausbrechen, aber das ist ja völlig in Ordnung.«
»Sieht so deine Entschuldigung aus?«
»Du lässt mich ja kaum zu Wort kommen.«
»Du … du blöder Weihnachtsmann!«
»Weihnachtsmann?«
Ich spürte, wie eine zarte Röte meine Wangen überzog, und legte all die Glut, die in mir loderte, in meinen Blick. So würdevoll wie es ging, reckte ich das Kinn und starrte meinen Sitznachbarn herausfordernd an.
»Ich habe keine deutschen Schimpfwörter gelernt«, sagte ich mit fester Stimme. »Das ist das Einzige, was mir gerade eingefallen ist.«
Einen Moment lang sah er mich sprachlos an, dann teilte sich sein Mund und er stieß ein echtes, tiefes Lachen aus, das in meinem Brustkorb vibrierte und mich all den Ärger für einen Moment lang vergessen ließ. Wenn er lachte, schob sich die Sonne hinter den Gewitterwolken hervor und ich beschloss, dieses Geräusch noch mindestens ein Mal bis zur Landung hören zu wollen.
Die Anspannung in meinen Schultern lockerte sich und meine Wut verpuffte. Einfach so.
Mit einer Hand fuhr er sich durch sein dichtes dunkelblondes Haar, das an den Seiten etwas kürzer geschnitten war und seinen markanten Kiefer betonte.
»Ich habe mich wie ein Idiot verhalten.« Überrascht sah ich ihm in die Augen, versuchte zu ergründen, woher sein plötzlicher Sinneswandel kam. »Nein, ich korrigiere mich: Ich habe mich wie der letzte Arsch verhalten. Vielleicht bin ich dir keine Erklärung schuldig, aber ich will dir trotzdem eine geben.« Er seufzte. »Ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen. Ich bin es gewohnt, ihnen Dinge einfach an den Kopf werfen zu können, ohne dass es sie gleich so sehr trifft. Falls ich dich verletzt habe, tut mir das aufrichtig leid.«
Stumm starrte ich ihn an, während er sich über die Nasenwurzel rieb, und ich bemerkte erst jetzt, wie abgeschlagen und fertig er eigentlich aussah. Ausgelaugt. Als hätte man ihm jedes Licht entzogen, als hätte er keinen Grund, von innen heraus zu leuchten.
Das hatte er hinter seiner reservierten Art versteckt. Keine Arroganz. Keine Beherrschtheit. Sondern seine Emotionen.
»Aber eigentlich geht es um etwas ganz anderes.« Er holte tief Luft, und als er mich jetzt ansah, brach der Schmerz in seinen Augen die kühle Gelassenheit auf. Mir wurde ganz kalt.
Purer, roher Schmerz. So tief, dass es mir fast den Atem raubte.
Er zögerte, aber nur eine Sekunde. Dann sagte er: »Meine Oma liegt im Sterben. Als ich ins Flugzeug gestiegen bin, hat sie noch gelebt. Ich hab versucht, mich mit dem dämlichen Buch, das ich dabeihabe, abzulenken, aber das hat nicht wirklich geholfen.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich habe bereits zwei Flüge verpasst, bin vierhundert Kilometer mit dem Bus gefahren, um wenigstens in Rio den nächsten Flieger zu erwischen … Sie … sie bedeutet mir alles.«
Es schien, als wollte er noch etwas hinzufügen, aber dann schloss er den Mund wieder und malte mit der Schuhspitze Kreise auf den Teppichboden.
»Das tut mir leid.« Ich flüsterte, weil ich meiner eigenen Stimme nicht traute.
Er nickte abgehackt, mied meinen Blick. »Du hast dich entschuldigt. Und ich habe mich einfach weiter idiotisch benommen.«
»Schon okay.«
»Zurück zu unseren Plätzen?«
Dieses Mal nickte ich und er ließ mir den Vortritt. Als ich an ihm vorbeiging, spürte ich, dass sich die Spannung um uns herum verändert hatte. Sie war nicht länger lauernd und ernst, sondern leichter, aber nicht weniger drückend. Stattdessen wurde mir mit jedem Schritt in Richtung meines Sitzes deutlich bewusst, dass er genau hinter mir ging.
Wir aßen unser Essen, das man kurz darauf brachte, in einvernehmlichem Schweigen. Er hatte gesagt, was er zu sagen hatte, und ich wusste nicht, wie ich ein normales Gespräch mit ihm in Gang bringen sollte. Oder ob ich das überhaupt wollte.
Also schaltete ich einen meiner liebsten Filme, Die Geisha, ein und steckte mir die Kopfhörer in die Ohren. Auf dem Bildschirm neben mir flimmerte noch immer der Marvel-Film.
Auf einmal war ich mir der Nähe zu dem namenlosen Typen, der meine Welt so durcheinandergewirbelt hatte, umso deutlicher bewusst und konnte mich kaum auf die Handlung und die schönen Bilder des Films vor mir konzentrieren.
Irgendwann, als es weit nach Mitternacht war, fielen mir die Augen zu. Ich hörte das sanfte Brummen des Flugzeugs und die gleichmäßigen Atemzüge meines Sitznachbarn und schlief langsam ein. Den Kopf zur Seite geneigt, spürte ich am Rand meines Bewusstseins, wie mir jemand vorsichtig die verrutschte Decke um meine Beine wieder nach oben schob.
Kapitel 3
Ich erwachte, als die Lichter angingen und die Durchsage zum anstehenden Landeanflug gemacht wurde. Mein Kopf ruhte an einer harten Schulter und ich hatte das Gefühl, mehrere Tage am Stück komatös geschlafen zu haben.
Ich stutzte. Harte Schulter.
Blinzelnd schielte ich nach rechts, wo mein Sitznachbar saß und gerade einen Kaffee trank. Der Duft stieg mir verführerisch in die Nase, und als ich auf seinen Hoodie herabblickte, musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass ich ihn vollgesabbert hatte.
Vollgesabbert!
Als ob es nicht schon peinlich genug war, dass ich an seiner Schulter gelehnt hatte.
Schlagartig wich jegliche Müdigkeit von mir und mein Puls beschleunigte sich.
»Das … das tut mir leid«, sagte ich, räusperte mich und richtete mich kerzengerade auf. Verlegen strich ich über meine Haare, die mittlerweile mehr einem wirren Vogelnest als einer Frisur gleichen mussten.
»Was tut dir leid?« Sein klarer Blick traf mich völlig unvermittelt und auf einmal war alles wieder da. Die Nachricht meiner Mutter, meine Verspätung, mein Sitznachbar, mein missglückter Small-Talk-Versuch und dann seine harschen Worte, gefolgt von der ehrlichen Entschuldigung.
Tatsächlich hatte er sich sofort entschuldigt. Ich kannte kaum Typen in unserem Alter, die so direkt und offen waren. Immer gab es irgendwelche Spielchen, ein ständiges umeinander Herumschleichen und gegenseitiges Abtasten, niemand wollte sich in die Karten schauen lassen. Mit meinem Sitznachbarn war das anders gewesen und dafür war ich dankbar.
Ich deutete mit dem Kinn auf die dunkle Stelle auf dem grauen Hoodie. Kreisrund und riesengroß. Was zur Hölle hatte ich gemacht? Versucht, in seinen Oberarm zu beißen?
»Ich habe …« Mit gekrauster Stirn suchte ich nach dem richtigen deutschen Wort, aber es fiel mir nicht ein.
»Mich vollgesabbert?«, schlug mein Sitznachbar vor, und obwohl seine Miene wieder diesen ernsten Ausdruck angenommen hatte, meinte ich, ein amüsiertes Glitzern in seinen hellen Augen zu erkennen.
»Ja.«
»Macht nichts. Dann sind wir wenigstens quitt.«
»Quitt?«, wiederholte ich fragend.
»Mir ist die Marmelade runtergefallen und ich wollte sie ungern wegwischen, deswegen ist sie bestimmt schon eingezogen.« Mit dem Daumen zeigte er auf den Ärmel meines weißen Pullovers, den ein roter Fleck zierte, der ziemlich klebrig aussah. »Ich hab versucht, dich zu wecken, nur warst du so weggetreten, dass ich keine Chance hatte. Außerdem hast du geschnarcht. Ich hab mir wirklich Mühe gegeben, nicht zu kleckern, aber dann gab es leichte Turbulenzen und …«
Das einzige Wort, das in meinem Kopf widerhallte, war schnarchen.
»Ich habe geschnarcht?«
»Wie ein Bär im Winterschlaf.« Dieses Mal verzogen sich seine Lippen zu einem halben Grinsen, was seine komplette Ausstrahlung veränderte. Es ließ ihn deutlich unbeschwerter erscheinen, jünger, fast jugendlich. Gleich darauf wurde er wieder ernst und ich verspürte den dringenden Wunsch, dieses Lächeln wieder aus ihm herauszukitzeln.
Menschen, die nicht lächeln, waren mir suspekt. Wie Nutella mit Butter. Das Leben war zu kurz, um es mit schlechter Laune zu verbringen. Außerdem war ich ihm das irgendwie schuldig, nachdem ich für die Verspätung verantwortlich gewesen war.
»Tut mir jedenfalls leid. Du kannst ihn mir gerne in Rechnung stellen, wenn der Fleck sich nicht mehr rauswaschen lässt.«
Er hob einen kleinen Zettel in die Höhe, den er aus einem Notizblock herausgerissen haben musste.
»Anton Meyer« stand darauf, zusammen mit einer Telefonnummer.
»Ist das deine Art, mir deine Nummer zu geben, Anton Meyer?«, fragte ich ihn lächelnd und nahm ihm den Zettel aus der Hand.
»Das bekomme ich auch so hin«, antwortete er, ohne eine Miene zu verziehen.
Jetzt funkelte es aber in seinen Augen eindeutig belustigt. Ich schluckte. Es hätte mich auch gewundert, schließlich hatte ich ihn wenige Minuten zuvor nicht als einen Typen, der Spielchen machte, eingeschätzt.
»Mein Angebot war tatsächlich aufrichtig gemeint«, fuhr er fort. »Ich habe keine Ahnung, wie viel der Pullover gekostet hat, aber er sieht teuer aus, und wenn ich ihn dir versaut habe, kannst du mir ruhig die Rechnung schicken.«
»Wenn das so ist, Anton Meyer«, sagte ich und zerriss den Zettel einmal in der Mitte und stopfte die Schnipsel auf den leeren Teller, der auf seinem ausgeklappten Tablett stand, »sind wir wirklich quitt. Du musst dir keine Sorgen machen, ich kann mir schon einen neuen Pullover leisten«, fügte ich augenzwinkernd hinzu. Genau in diesem Moment kam die Stewardess vorbei und räumte die restlichen Sachen ab.
Überraschung huschte über sein markantes Gesicht und noch etwas anderes, das ich als Anerkennung deutete. Vielleicht deswegen, weil auch ich keine Spielchen spielte und ihm mit einer fadenscheinigen Ausrede eine Nachricht schicken würde.
Obwohl eine leise Stimme in mir zugab, dass ich es eigentlich gerne tun würde.
Aber er hatte recht. Der Pullover war teuer gewesen, hatte sogar ein halbes Vermögen gekostet. Meine vovó hatte ihn mir zu meinem Schulabschluss geschenkt. Apropos Großmutter …
»Ich hoffe sehr, dass du deine Oma noch sehen wirst«, sagte ich und er zuckte kaum merklich zusammen, während das Leuchten in seinen Augen erlosch.
Am liebsten hätte ich meine Worte wieder zurückgenommen, doch Anton seufzte leise.
»Ich auch.« Er sah mich wieder an. »Du hast die Durchsage vorhin nicht gehört, aber wir haben fast vierzig Minuten reingeholt. Anscheinend habe nicht nur ich es sehr eilig.«
»Zum Glück«, erwiderte ich erleichtert. »Das freut mich zu hören!«
»Du hast eine Vorliebe dafür, den Finger in die Wunde zu legen, oder?«
Entschuldigend lächelte ich ihn an. »Ich sage meistens, was mir in den Sinn kommt.«
Mit schief gelegtem Kopf betrachtete er mich nachdenklich. »Das habe ich gemerkt. Aber ich mag ehrliche Menschen. Die meisten setzen ein falsches Gesicht auf und man hat keine Ahnung, mit wem man es eigentlich zu tun hat.« Dabei klang er niedergeschlagen, als würde er nicht wirklich von mir, sondern jemand anderem sprechen.
Ich lächelte ihn an und fragte mich insgeheim, was ihn so ernst und zynisch hatte werden lassen. Nur der Kummer wegen seiner Großmutter? Die bloße Vorstellung, ich würde in seiner Situation sein, zehntausend Kilometer von meiner vovó entfernt, ließ mich unwillkürlich frösteln. Nein, ich wollte definitiv nicht in seiner Haut stecken.
»Hast du eigentlich immer so gute Laune?«, wollte er jetzt wissen und trank noch einen Schluck von seinem Kaffee, was meine Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenkte, dass in meinen Venen noch kein Koffein schwamm. Für eine Bestellung war es jetzt zu spät, weil die meisten bereits ihre Rückenlehnen senkrecht stellten und ihre Tische hochklappten.
»Eigentlich schon, ja. Das Leben ist zu kurz, um es mit schlechter Laune zu vergeuden. Nur weiß ich auch, dass nicht jedem die Sonne aus dem Arsch scheinen kann.«
Ein Mundwinkel zuckte, aber ich hatte das Lächeln noch nicht ganz hervorgezaubert.
Die nächsten Minuten bis zur Landung unterhielten wir uns über Belangloses und ich nutzte die Möglichkeit, um mich noch kurz frisch zu machen. Als ich zurückkehrte, gingen gerade die Anschnalllämpchen über unseren Köpfen an.
Obwohl Anton sich normal mit mir unterhielt, hatte ich das Gefühl, dass er trotzdem noch reserviert war, mich auf kühler Distanz hielt. Dabei konnte ich unmöglich die Einzige sein, die spürte, dass da etwas zwischen uns war. Eine gewisse Spannung, die sich nicht einfach von der Hand weisen ließ.
So wie jetzt. Wenn er mich so ansah. Intensiv, als wollte er herausfinden, auf was für Überraschungen er bei mir noch stoßen würde, und ich hatte Mühe, seinem Blick standzuhalten. Vor allem weil er mir so nah war, dass sich unsere Oberarme praktisch berührten. Aber selbst das fühlte sich nicht komisch oder unangenehm an, sondern wie eine natürliche Notwendigkeit.
Ich war froh, dass wir bald landen würden, auch wenn ich gleichzeitig ein tiefes Bedauern verspürte.
»Wie heißt du eigentlich?«
»Gabriella.«
»Freut mich, Gabriella.«
Ich mochte es, wie Anton meinen Namen aussprach, und ertappte mich dabei, wie ich mir wünschte, er würde es gleich noch mal tun. Die Betonung war anders, etwas härter und nicht in dem typisch portugiesischen Singsang, den ich gewohnt war.
Kurz war ich geneigt, ihn nach der Nummer zu fragen, die ich eben vor seinen Augen zerrissen hatte, aber da er offensichtlich Interesse zeigte, wollte ich nicht den ersten Schritt machen.
Sobald die Anschnallzeichen wieder erloschen waren und wir die endgültige Parkposition erreicht hatten, flogen seine Finger über den Bildschirm seines Smartphones und ich hörte ihn erleichtert aufatmen.
»Gute Nachrichten?«
»Kann man so sagen.«
Ich lächelte ihn offen an. »Das ist großartig.«
»Ja.«
Die Art, wie er mich auf einmal betrachtete, als ob er sich mein Gesicht einprägen wollte, machte mich plötzlich wieder nervös und ließ mich auf meinem Sitz herumrutschen. Um uns herum standen die ersten Leute hektisch auf, suchten nach ihren Rucksäcken und Taschen, aber in mir drin herrschte eine atemlose Stille.
»Was ist?«, fragte ich tonlos und blinzelte, als Anton nicht wegschaute. Sein Blick sprang zu meinem Mund und wieder zu meinen Augen. Die Intensität zwischen uns sandte ein Prickeln meine Wirbelsäule hinab und ich ertappte mich dabei, mich zu fragen, wie es sich wohl anfühlte, seine Lippen auf meinen zu spüren. Ob sie so weich waren, wie sie aussahen? Ob er gut küssen konnte?
Auf einmal knisterte die Luft, als ob sie elektrisch aufgeladen wäre. Ich hielt den Atem an, mein Kopf war wie leer gefegt und ich war mir seiner körperlichen Nähe überdeutlich bewusst. Dem Sturm, der auf einmal in seinen Augen tobte, die angespannte Kinnpartie, als ob er mit sich haderte. Einen stummen Kampf ausfocht.
»Entschuldigung, es geht weiter«, sagte die alte Dame neben mir, die ich den kompletten Flug über ausgeblendet hatte und die uns jetzt wieder in die Realität zurückkatapultierte.
Als ob sie gerade einen Eimer Eiswasser über unseren Köpfen ausgekippt hätte.
Tatsächlich hatte sich der Gang merklich geleert. Verlegen murmelte ich eine Entschuldigung und starrte Anton an, der sich so schnell aus seinem Sitz erhob, dass ich der Bewegung kaum folgen konnte. Enttäuschung durchdrang mich wie ein Hieb und in mir verkrampfte sich etwas. Am liebsten hätte ich über mich selbst den Kopf geschüttelt. Was war bloß los mit mir?
Ich beobachtete, wie Anton einen beigefarbenen Rucksack hervorholte und auf seine breiten Schultern hievte, dabei jedoch nicht in meine Richtung sah. Ich dagegen brannte mit meinen Augen Löcher in sein Gesicht, versuchte, ihn mit meiner bloßen Willenskraft dazu zu bewegen, mich wieder anzuschauen. Ein letztes Mal, zum Abschied.
Er starrte geradeaus, und obwohl er mir nur das Profil zuwandte, konnte ich erkennen, dass es hinter seiner Stirn gewaltig arbeitete. Vielleicht dachte er darüber nach, mir doch noch seine Nummer zu geben. Oder er dachte an gar nichts, was mit mir zu tun hatte. Vielleicht dachte er einfach an seine Oma und daran, sie schnellstmöglich in die Arme schließen zu können.
Vor ihm setzten sich die anderen Passagiere in Bewegung. Vier Personen vor ihm. Drei Personen.
Anton klappte den Mund auf, wandte halb den Kopf in meine Richtung. »Mach’s gut, Gabriella.«
Und dann, einfach so, verschwand Anton Meyer aus meinem Leben.
Während sich all die anderen Menschen beeilten, ließ ich mir Zeit und versuchte, die letzten Stunden und diese Begegnung zu verarbeiten.
Im Terminal checkte ich meine Nachrichten. Olivia hatte mir noch einmal geschrieben und viel Glück gewünscht. Ich beschloss, meiner Mutter eine Sprachnachricht zu hinterlassen, damit sie sich keine Sorgen machte. Zwar würde ich sie nicht in meinen Plan einweihen – sie würde ihn mir nur auszureden versuchen –, aber ich konnte zumindest teilweise ehrlich sein.
»Hey … Ich … im Grunde verstehe ich, warum du es mir verschwiegen hast, aber ich kann gerade nicht mit dir sprechen. Ich brauche Zeit. Und ich hoffe, du kannst nachvollziehen, warum ich das machen muss.« Selbst in meinen eigenen Ohren klang meine Stimme gebrochen und in meinem Magen sammelte sich eine unangenehme Anspannung wie ein Klumpen Blei. »Mach dir keine Sorgen, ich habe nicht vor, eine Dummheit zu begehen. Ich möchte ihn einfach in Ruhe kennenlernen. Ich habe Samstag eine Wohnungsbesichtigung von der Catering-Firma organisiert bekommen, weil ich nicht die ganze Zeit im Hotel schlafen möchte. Ich vermisse dich, auch wenn es so verdammt wehtut, dass du mich jahrelang belogen hast. Ich melde mich, sobald ich kann. Sobald ich … die Kraft finde, mit dir zu sprechen. Grüß vovó lieb von mir.« Ohne mich richtig zu verabschieden, schickte ich die Sprachnachricht ab, während sich mein Herz anfühlte, als würde es jeden Moment zerbrechen.
Um mich abzulenken, suchte ich das Abfluggate und registrierte, dass ich in ein ganz anderes Terminal musste. Wenigstens hatte mein Anschlussflug eine Verspätung von dreißig Minuten, weswegen ich mir etwas Zeit lassen konnte. Also folgte ich dem Labyrinth aus Beschilderungen, ging durch die Passkontrolle, bis ich zwanzig Minuten später in einer kleineren Abflughalle stand, wo es einen Brezelstand gab, der auch Kaffee verkaufte. Mit der Kreditkarte bezahlte ich einen Cappuccino und suchte mir eine ruhige Ecke.
Mein Handy klingelte. Mamãe. Großartig. Im Kopf rechnete ich nach, zu Hause musste es jetzt vormittags sein, denn hier war es bereits vierzehn Uhr. Die Zeitverschiebung im Sommer betrug in Deutschland fünf Stunden. Wahrscheinlich hatte sie die ganze Zeit auf ein Lebenszeichen von mir gewartet.
War ich bereit, mit ihr zu sprechen?
Nein. Nein, das war ich noch nicht. Noch immer schmeckte der Verrat bitter auf der Zunge, durchdrang jede einzelne Körperzelle wie ein giftiges Serum. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich noch nicht mit ihr reden können.
Unbarmherzig klopfte mein Herz schneller. Schließlich hatte ich sie noch nie einfach ignoriert.
Irgendwann verebbte das Klingeln, der Bildschirm wurde wieder schwarz und das gemeinsame Foto, das uns Kopf an Kopf mit unseren Cowboyhüten und einem strahlenden Lächeln zeigte, verschwand. Mein rasender Herzschlag blieb. Genauso wie das klamme Gefühl in meiner Brust.
Keine Minute später rief meine Großmutter an. So wie ich sie kannte, hatte sie meine Mutter aus dem Raum geschickt, um in Ruhe mit mir zu sprechen. Trotzdem zögerte ich.
»Ja?«
»Du bist in Deutschland?« Vovó klang panisch und atemlos, ihre sonst so klare Stimme zitterte verdächtig. Sofort verspürte ich Mitleid, denn ich hatte auch sie einfach im Unklaren gelassen. Das sah mir nicht ähnlich. Wir waren eine Einheit. Drei Frauen, die ihren Weg gemeinsam gingen, noch enger miteinander verbunden, seit mein Großvater vor drei Jahren gestorben war. Sie waren mein Rückhalt, meine Familie. Wir waren die drei Musketiere. Eine für alle und alle für eine.
Doch ausgerechnet jetzt hatte diese Einheit einen tiefen Riss bekommen, was mir prompt wieder die Tränen in die Augen trieb.
»Ja. Gerade gelandet. Ist … ist sie in der Nähe?«, fragte ich. Mein ganzer Körper verwandelte sich zu Stein.
»Ich habe sie nach unten geschickt. Sie macht sich große Sorgen. Und es tut ihr so unendlich leid.«
»Das … weiß ich. Ich verstehe auch ihre Gründe, aber ich …«
»Das ist dein gutes Recht, querida«, entgegnete meine Großmutter zärtlich und bei der Wärme in ihrer Stimme schnürte sich mir die Kehle zu.
»Für wie lange willst du in Deutschland bleiben?«
»Vier Monate.«
»Ich … Kolibri, du bist nicht allein dort drüben, das weißt du?« Vovó den Kosenamen sagen zu hören, den sie mir beide als kleines Kind gegeben hatten, schnürte meinen Hals noch enger zu.
»Ja.«
»Wann hast du es erfahren?«, wollte sie nun wissen.
Meine Hände begannen zu zittern und ich schloss bebend die Augen, um mich zu sammeln.
»Vor fast vier Wochen. Als ihr beide ausgeritten seid und mamãe mich gebeten hat, die Unterlagen für die Buchführung zusammenzusuchen.« Ich war über die Osterfeiertage nach Hause auf die Farm gefahren, um etwas Kraft zu tanken. Abgereist war ich als emotionales Wrack.
»Oh Deus.« Zittrig stieß meine Oma die Luft aus. »Schon so lange und du hast kein Sterbenswörtchen gesagt … Du hättest dich wenigstens mir anvertrauen können. Jetzt verstehe ich, weshalb du quasi von der Farm geflohen bist … Und ich habe dir die Entschuldigung mit der Prüfung geglaubt … Es tut mir so leid.«
»Ich weiß.«
»Deine Mutter ist außer sich … Sie wollte nie, dass du es auf diese Weise erfährst.«
»Ach ja? Wie denn dann?«, fragte ich bitter. »Wenn ich mit dem Studium fertig gewesen wäre? Dafür gab es nicht die richtige Gelegenheit. Sie hätte es mir so oft sagen können. Aber das hat sie nicht. Und du auch nicht.« Dieses Mal schwang ein leiser Vorwurf in meiner Stimme mit, doch eigentlich war ich nur von meiner Mutter richtig enttäuscht. Nicht von vovó.
Eine unangenehme Pause entstand und ich umklammerte mein Smartphone etwas fester, blendete die typischen Geräusche des Flughafens aus. Fast hatte ich das Gefühl, alleine hier zu sein. Wie bei einer Apokalypse.
»Und dein Studium?«
»Ich mache eine Pause.«
Vovó schluckte hörbar. »Bitte wirf deine Zukunft nicht weg. Nicht, weil deine Mutter einen Fehler gemacht hat.«
»Ich muss meine Vergangenheit klären, damit ich in die Zukunft schauen kann«, erwiderte ich mit fester Stimme, weil ich ihre Antwort geahnt hatte. Aber ich traute mich nicht, weiter nachzuhaken. Zu fragen, ob mein Vater mich nicht gewollt hatte. Was genau passiert war.
Ich war noch nicht bereit, mich meiner Mutter zu stellen.
Ein paar Sekunden herrschte Schweigen am anderen Ende der Leitung. Das Architekturstudium bedeutete alles für mich. Denn ich hatte es mir erarbeitet, genauso inbrünstig und hart wie die deutsche Sprache. Mein Ziel war es, einmal fest auf eigenen Beinen stehen zu können, unabhängig zu sein. Von meiner Familie, von einem Mann. Den Studienplatz an der privaten Universität in Rio bekommen zu haben, hatte mich jahrelanges Lernen gekostet und ich hatte auf einiges verzichten müssen. Ich würde ihn nicht einfach so wegschmeißen.
»Mein nächster Flug geht gleich. Ich melde mich bald wieder.« Ich hasste mich dafür, dass ich so distanziert klang.
»Pass auf dich auf. Du wirst das Richtige tun, wenn du deinem Herzen folgst.«
»Hoffentlich«, flüsterte ich und schloss für einen Moment die Augen. Noch nie hatten meine Mutter und ich uns zerstritten. »Kannst du … Kannst du mamãe ausrichten, dass ich einfach Zeit brauche? Ich komme auf sie zu. Aber sie soll sich nicht sorgen.«
»Das mache ich. Eu te amo.«
»Ich dich auch«, antwortete ich mit tränenerstickter Stimme. Dann legte ich auf, während mich Traurigkeit erfüllte. Traurigkeit deswegen, weil ich sie beide vermisste. Weil ich es hasste, tief in meinem Innern verletzt worden zu sein. Und ich es hasste, mit Menschen im Clinch zu liegen, die mir etwas bedeuten.
Resigniert nahm ich einen Schluck von meinem Cappuccino und suchte mir eine ruhige Ecke, weil die Plätze an meinem Gate alle belegt waren. Heute Nacht würde ich in einem Hotel am Münchener Hauptbahnhof übernachten, morgen hatte ich ein Kennenlerngespräch in der Firma und für Samstag war eine WG-Besichtigung bei Angestellten von Leckerste geplant, die Anabelle, die Personalleiterin der Catering-Firma, organisiert hatte.
Überrascht bemerkte ich eine hochgewachsene Gestalt, die an einer der weißen Säulen gelehnt stand. Erst jetzt fiel mir auf, dass ich Anton gar nicht gefragt hatte, wohin seine Reise führen würde. Mein Herz klopfte verräterisch schneller, aber ich zwang mich, eine neutrale Miene aufzusetzen.
Anton war in ein Telefongespräch vertieft, die Brauen wölbten sich über seinen ausdrucksstarken Augen und ich nutzte den unverhofften Moment, um ihn aus der Ferne und mit klarerem Verstand zu betrachten.
Er war attraktiv, aber auf eine raue Art. So als hätte er schon einiges im Leben durchgemacht, obwohl er tatsächlich nicht viel älter als ich sein konnte. Auch die Art und Weise, wie er sich entschuldigt hatte, ließ auf eine Reife schließen, die ich sonst von Typen in meinem Alter nicht gewohnt war. Vielleicht hatte er früh gelernt, Verantwortung für sich selbst übernehmen zu müssen – mit drei Schwestern?
Nachdenklich ließ ich meinen Blick von seinen breiten Schultern ein Stück höher wandern und musterte sein Gesicht. Ernst und nachdenklich sah er aus.
Als ich zwei Minuten später wieder in seine Richtung schaute, war er verschwunden. Und ich sah ihn auch auf dem Flug nach München nicht wieder, obwohl ich mich dabei ertappte, wie ich nach ihm Ausschau hielt.
Kapitel 4
Das unscheinbare Gebäude im Industriegebiet unterschied sich kaum merklich von den anderen grauen Häusern, die sich wie ein Fluss aus trostlosen grauen Komplexen um den südlichen Teil Münchens schlängelten. Große Tore und ein weitläufiger Parkplatz, auf dem mehrere weiße Kastenwagen und einige Pkws standen – nichts, was darauf hindeutete, dass hier eine der bekanntesten Catering-Firmen Münchens ihren Sitz hatte, bis auf ein kleines weißes Schild, auf dem in knalligem Orange der Name stand: Leckerste.
Vier Monate. So lange hatte ich mir gegeben, um meinen Vater kennenzulernen und zu entscheiden, ob ich ihm meine Identität offenbaren würde oder nicht.
Stefan Gruppert.
Es war so leicht gewesen, etwas über ihn herauszufinden. Ich hatte einfach seinen Namen in Google eingegeben und schon hatte mir die Suchmaschine einige Details über sein Leben ausgespuckt: ehemaliger deutscher Sternekoch, der gemeinsam mit seinem besten Freund vor drei Jahren eine Catering-Firma namens Leckerste in München gegründet und sich seitdem größtenteils aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte. Über sein Privatleben hielt er sich sehr bedeckt. Auf YouTube hatte ich einige Videos von ihm aus deutschen Kochsendungen entdeckt und alles in mich aufgesogen. Die Art, wie er sprach, wie er sich bewegte, wie er den Kopf schief legte, um ein Gericht zu begutachten.
In all diesen kleinen Gesten hatte ich versucht, etwas von mir zu entdecken. Das leichte Kräuseln der Lippen vielleicht. Oder die Art, wie er sich mit dem Daumen übers Kinn rieb, wenn er über etwas nachdachte. Und dann waren da noch seine Augen. Whiskeyfarben. Genau wie meine.
Mehr als einmal war ich froh darüber gewesen, mir in mühseliger Kleinarbeit mithilfe von Brieffreundinnen, Filmen auf Deutsch mit Untertiteln sowie mit unzähligen Onlinekursen die deutsche Sprache angeeignet zu haben. Es war mein brennender Wunsch gewesen, sie zu verstehen, wirklich zu verstehen, so, als hätte mein Vater sie mir beigebracht. Als kleines Mädchen war ich besessen gewesen von dem Verlangen, Deutsch wie eine Muttersprache beherrschen zu können, seit dem Moment, in dem meine Mutter mir die Nationalität meines Erzeugers verraten hatte.
In mir machte sich eine kribbelnde Nervosität breit, als ich durch die Tore zum unscheinbaren Haupteingang schritt. Die Tür stand offen.
»Entschuldigung?«, rief ich in den dunklen Flur hinein.
»Service oder Küche?«, bellte eine dröhnende Männerstimme direkt neben mir und ich sah erschrocken in ein stahlgraues Augenpaar, das zu einem Kerl Mitte fünfzig gehörte, der mich ohne jeden Funken Freundlichkeit im Gesicht musterte. Er musste durch die schiefergraue Tür zu meiner Linken gekommen sein. Kurz fragte ich mich, ob mein rosafarbenes Tanktop und die graue Culotte etwas zu leger waren, aber draußen waren es überraschenderweise fast dreißig Grad und ich war froh, überhaupt an die unterschiedlichen Jahreszeiten gedacht und genügend kurzärmlige Sachen eingepackt zu haben.
»Wie bitte?« Mit aufgerissenen Augen starrte ich ihn an und rang nach einer Antwort.
»Bist du für den Service oder die Küche hier?«
»Küche«, erwiderte ich fest, obwohl ich etwas von seiner resoluten Art eingeschüchtert war. Schon wieder ein Mensch, der ohne ein Lächeln auskommt, dachte ich.
»Na dann. Willkommen bei Leckerste«, knurrte er in einem Tonfall, der darauf schließen ließ, dass er dies heute nicht zum ersten Mal sagte. »Geradeaus, zweite Tür links.«
»Lass dich von Gerd nicht einschüchtern, er kann manchmal etwas ruppig sein«, rief eine junge Frau vom anderen Ende des Flurs und kam mit langen Schritten auf mich zu. Sie war ungefähr Anfang dreißig und ihr Lächeln war warm und freundlich, als sie mich erreichte und mir eine perfekt manikürte Hand entgegenstreckte. »Ich bin Anabelle Lanig, die Personalleiterin. Du kannst mich ruhig Anabelle nennen, wir sind hier untereinander nicht ganz so förmlich. Schön, dass du da bist.«
»Danke«, antwortete ich und erwiderte ihren festen Händedruck. »Gabriella Rocha. Wir hatten per E-Mail Kontakt. Ich hatte dir all meine Unterlagen für das Visum geschickt.«
»Stimmt«, lachte sie. »Du kommst ursprünglich aus Brasilien, oder? Letztendlich hat dein Motivationsschreiben den Ausschlag für die Praktikumsstelle gegeben, obwohl du nicht ganz so viel Erfahrung wie die anderen Bewerber*innen vorweist. Du wirst dich hier wohlfühlen, wir haben ein paar Brasilien-Fans unter uns und einige der Speisen sind von den Reisen unserer Chefs inspiriert.«
Ich versuchte, mir bei ihren Worten nichts anmerken zu lassen, und beschränkte mich auf ein braves Nicken und einen, wie ich hoffte, überraschten Gesichtsausdruck. »Du verbreitest mal wieder die beste Laune, was Gerd?«, wandte Anabelle sich mit einem Grinsen an besagten Gerd. Dieser verzog mürrisch das Gesicht.
»Es kann nicht jedem die Sonne aus dem Arsch scheinen«, grummelte er, warf mir noch einen letzten abschätzigen Blick zu und verschwand wieder durch die Tür, durch die er so plötzlich aufgetaucht war. Anabelle seufzte leise, und als sie mich wieder ansah, stahl sich ein Hauch von Besorgnis in ihre Augen. Besorgnis, weshalb?
»Ist das eigentlich eine typische deutsche Redewendung?«, hakte ich neugierig nach. Der Satz hatte unwillkürlich die Erinnerung an Anton heraufbeschworen und ich fragte mich, wie es ihm und seiner Oma wohl ging. Ich hatte mich immer wieder dabei ertappt, wie ich an ihn dachte. Den grüblerischen Gesichtsausdruck, den Verlauf seines Mundes, die Intensität seines Blickes. Als ob er in mich hineinschauen könnte.
»Was genau meinst du?«
»Das mit der Sonne aus dem Arsch?«
Anabelle feixte. »Nein, aber so ein Spruch ist typisch für die Jungs in der Küche. Die nehmen alles sehr ernst, allem voran sich selbst. Du wirst sehen, die Redewendung ›harte Schale, weicher Kern‹ trifft auf sie viel besser zu.«
Jetzt wurde mir auf einmal eiskalt. »Heißt das, Gerd arbeitet auch in der Küche?«
»Gerd und noch sieben weitere Kerle. Du hast dir den Praktikumsplatz mit deinen Referenzen und deinem tollen Anschreiben erobert – für Gerd zählen nur Tatsachen. Kannst du was, mag er dich. Kannst du nichts …« Sie zuckte mit den Schultern. »Du wirst dich daran gewöhnen.«
Hoffentlich.
Ein mulmiges Gefühl hatte ich schon, schließlich waren meine Kochkünste nur auf die Erfahrungen zurückzuführen, die ich in der Küche meines Onkels gesammelt hatte, auf dessen Empfehlungsschreiben ich letztendlich zurückgegriffen hatte – und natürlich auf die sonntäglichen Barbecues und Familienessen. Schon seit frühester Kindheit war es für mich das Schönste gewesen, meiner Mutter bei den Vorbereitungen zu helfen. Feijoada war dabei meine Spezialität gewesen. Ich liebte den Bohneneintopf heiß und innig, allein deswegen, weil er mich an die wöchentlichen Treffen mit der Familie erinnerte.
Ich hatte meine ganze Leidenschaft in das Motivationsschreiben gelegt, von den unterschiedlichen Geschmäckern, Gewürzen und Gerichten Südostbrasiliens geschwärmt und gehofft, dass es ausreichte.
Auf einmal fehlten mir die Herzlichkeit und die Wärme meiner Familie, genauso wie meine Freunde, allen voran Olivia, laut und bunt, gut gelaunt. Jesus, wie sehr fehlten mir gut gelaunte Menschen!
Anabelle schien meinen Gesichtsausdruck richtig zu deuten. »Mach dir keinen Kopf, da muss jeder zunächst durch. Du wirst dir einfach ein dickes Fell zulegen müssen.«
»Dickes Fell?«
»Streng dich an, zeig, was du draufhast, steck die Kritik ein – auch wenn sie hart ist –, dann wirst du schon zurechtkommen. Außerdem sind wir Mädels ja auch noch da und haben ein Auge auf dich. Wenn was sein sollte, kannst du dich jederzeit an mich wenden, absolut kein Problem.«
»Danke für das Angebot.«
Sie würden schon sehen, aus welchem Holz ich geschnitzt war. Aber so, wie Anabelle es beschrieb, klang das Praktikum so … ernst. So real und echt. Eigentlich hatte ich es mir etwas entspannter vorgestellt, was nicht hieß, dass ich nicht anlangen konnte. Auf der Farm hatte ich als Kleinkind erst das Reiten und später auch das Anpacken gelernt. Es gab immer etwas zu tun. Im Stall, im Haus, bei den Rindern. Frühmorgens bis spätabends zu schuften stellte für mich kein Problem dar. Aber so, wie Anabelle mir den Job erklärte, war ich gespannt, wie hart die Arbeit wirklich werden würde.
Was, wenn ich den Ansprüchen nicht gerecht wurde? Was, wenn mein Vater davon Wind bekam und ich ihm schließlich beichten müsste, wer ich war?
Hallo, hier bin ich: deine Tochter, die nicht einmal ein Praktikum in deinem Unternehmen schafft.
Ich straffte die Schultern. Nein, ich würde das schaffen, schließlich schreckte ich sonst auch nicht vor Herausforderungen zurück.
»So gefällst du mir schon besser«, kommentierte die Personalleiterin meine Kriegshaltung.
»Alles klar«, erwiderte ich mit einem zuversichtlichen Lächeln. »Dann mische ich ab Montag den Männerhaufen einfach ein bisschen auf!«
Anabelle stieß ein lautes Lachen aus. »Die Einstellung gefällt mir!«
Mit einer einfachen Geste strich sie sich das dunkelblonde Haar, das ihr bis knapp über die Schultern reichte, hinters Ohr. Dabei fiel mir auf, wie natürlich hübsch sie war, denn sie trug bis auf ein bisschen Foundation und Wimperntusche keine Schminke. Dazu die beigefarbene Dreiviertelhose und ein anthrazitfarbenes Hemd, auf dem das Firmenlogo aufgestickt war – ein Kochlöffel in Notenschlüsselform.
Sie bemerkte meinen Blick. »Normalerweise laufe ich auch nicht so förmlich herum, aber wir haben heute neue Fotos für die Homepage geschossen. Du hast noch nie in einer Catering-Firma gearbeitet, richtig?«
Ich nickte.
»Okay, knapp erklärt: Wie du weißt, bedienen wir unterschiedliche Veranstaltungen, die sich in drei Kategorien einteilen lassen: privat, Messe oder Business. Da gibt es einmal die Messen, wo wir das Catering für größere Firmen stellen, und zwar für die komplette Messezeit. Dann richten wir auch noch kleinere Messepartys oder Abendveranstaltungen aus.« Auch Anabelle klang, als hätte sie den Text schon mehrfach aufgesagt, aber im Gegensatz zu Gerd leuchteten ihre Augen dabei. »Wir catern aber auch auf Hochzeiten, Gartenpartys oder Jubiläen, je nachdem, für was wir gebucht werden. Oder eben Business-Events wie Modenschauen, Weihnachtsfeiern für Firmen … Da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.«
»Das klingt sehr spannend.«
»Ist es auch, es wird definitiv nicht langweilig. In drei Wochen haben wir übrigens unser fünfjähriges Jubiläum, deswegen wollte ich dich heute schon sehen. So kannst du die Eintrittskarte gleich mitnehmen. Normalerweise braucht man für so eine Feier keine, aber es wird eine kleine Werbeveranstaltung sein, zu der auch potenzielle Kunden geladen sind. Komm mit, ich stelle dir ein paar Leute vor, mit denen du zusammenarbeiten wirst. Einige sind noch von der heutigen Teambesprechung da.«
Panik überfiel mich. »Wie, jetzt schon?«
»Keine Sorge, sie bellen nur und beißen nicht. Übrigens ist das Mädchen, das gerade einen freien WG-Platz hat, auch da. Ich stelle euch gleich vor …«
»Wieder ein Sprichwort?« Ein zögerliches Lächeln stahl sich auf meine Züge.
»Kann man wohl sagen. Ah, Karla, wenn man vom Teufel spricht!« Anabelle winkte einem zierlichen braunhaarigen Mädchen zu, das ihre glatten Haare auf Kinnlänge trug und im Gegensatz zur Personalleiterin in weißen Shorts und einem bunten Shirt steckte. Sie kam uns entgegen, wobei sie mir nur bis zur Brust reichte.
»Hey«, sagte sie lächelnd. »Karla.«
»Das ist Gabriella, sie macht bei uns ein Praktikum in der Küche«, stellte mich Anabelle vor, bevor ich das selbst übernehmen konnte.
Karla schüttelte mir die Hand und mir fiel auf, wie unheimlich grün ihre Augen wirkten. Wie wildes Efeu. Sie war hübsch, aber auf eine unscheinbare Art, und in ihrem Blick lag eine wache Intelligenz. Ich mochte die Art, wie sie mich anschaute. Offen, klar, herzlich.
»Soso, du bist also unsere Quotenfrau. Mutig«, kommentierte sie mit einem Zwinkern und ich war mir nicht sicher, ob ich meine Entscheidung nicht jetzt schon bereute.
»Wo arbeitest du denn?«, fragte ich.
»Seit einem Jahr im Service. Ich habe gleich zu Studienbeginn angefangen.«
»Karla ist eine von unseren Studentinnen. Jura.« Anabelle klang wie eine stolze Mutter, was Karla mit einem Augenrollen quittierte.
»Irgendwie muss ich die Miete ja bezahlen.« Täuschte ich mich oder schwang da ein säuerlicher Unterton mit?
»Apropos«, wandte sich Anabelle jetzt an mich. »Das ist deine Ansprechpartnerin.«
»Genau«, meinte Karla jetzt mit einem Lächeln. »Jojo und ich suchen nämlich gerade noch eine dritte Mitbewohnerin, nachdem unsere Freundin Laura mit ihrem Freund zusammengezogen ist.«
»Wirklich?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Ja. Hast du denn heute Abend schon was vor? Wir könnten die Besichtigung auch spontan vorziehen?«
Ich nickte. »Ja, gerne.«
»Jojo ist gerade bei ihren Eltern, aber kommt am späten Nachmittag wieder nach Hause. Hast du Lust, sie kennenzulernen? Dann könnten wir schauen, ob es passt.«