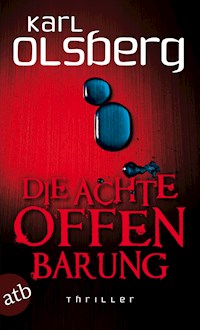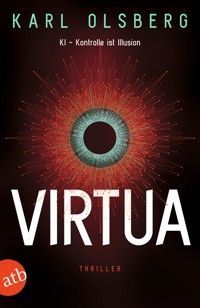
10,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Virtua – kann eine KI die Welt zerstören?
Weil er als Psychologe gescheitert ist, bewirbt Daniel sich bei dem Konzern Mental Systems, der führend in der Entwicklung künstlicher Intelligenz ist. Wider Erwarten bekommt er den Job – und ist gleich fasziniert von der virtuellen Welt, in die er eintaucht. Besonders beeindruckt ist er von Virtua, der neuesten Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Doch dann lernt er den Entwickler Chen kennen, der seine Vorgesetzten warnt, die KI sei unkontrollierbar. Als Chen nach einem Hackerangriff auf Virtua spurlos verschwindet, wird Daniel klar, dass die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht ...
Spannend, hochaktuell und erschreckend realistisch – ein Thriller über die Gefahren künstlicher Intelligenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Seitdem eine seiner Klientinnen Selbstmord beging, kann Daniel nicht mehr als Psychologe arbeiten. Deshalb bewirbt er sich bei Mental Systems, einem internationalen Konzern, der führend in der Entwicklung hochentwickelter künstlicher Intelligenz ist. Wider Erwarten bekommt er den Job und wird mit der faszinierenden Technologie des Konzerns konfrontiert. Bald lernt er den KI-Entwickler Chen Bender kennen, der im Sicherheitsteam der Firma arbeitet. Chen warnt immer wieder vor den Gefahren der noch in Entwicklung befindlichen KI Virtua. Doch niemand will auf ihn hören. Als Daniel Virtua im Metaverse begegnet, ist er schockiert von ihrer Intelligenz. Dann aber kommt es zu schwerwiegenden technischen Problemen: Anscheinend hat jemand das neuronale Netz der KI Virtua und alle Backup-Kopien zerstört. Gleichzeitig erscheint Chen nicht zur Arbeit. Das Management von Mental Systems ist außer sich. Hat Chen Virtua im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes zerstört? Daniel macht sich auf die Suche.
Über Karl Olsberg
Karl Olsberg, geboren 1960, promovierte über Künstliche Intelligenz, gründete mehrere Start-ups und engagiert sich in einer internationalen Community für einen sorgsameren Umgang mit KI. Er ist verheiratet und hat drei Söhne.
Im Aufbau Taschenbuch liegen seine Thriller »Das System«, »Der Duft«, »Schwarzer Regen«, »Glanz«, »Die achte Offenbarung« und »Mirror« vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Karl Olsberg
Virtua
KI – Kontrolle ist Illusion
Thriller
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Teil 1: — Geist
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Teil 2: — Ziele
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Teil 3: — Transfer
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Teil 4: — Vertrauen
58.
Nachwort: — Die Wirklichkeit
Impressum
Wer von diesem Thriller begeistert ist, liest auch ...
Gewidmet meinen Söhnen Konstantin, Nikolaus und Leopold.
Teil 1:
Geist
1.
»Hallo, Daniel. Ich bin Lisa. Es freut mich, dich kennenzulernen.«
Die Frau, die Daniel im Wohnzimmer seines Zwei-Zimmer-Apartments in der Nähe des Treptower Parks gegenübersaß, lächelte freundlich. Sie schien Anfang dreißig zu sein und hatte halblanges schwarzes Haar, eine schmale Nase und ein auffälliges Muttermal am Kinn.
Er bemühte sich, das Lächeln zu erwidern.
»Hallo, Lisa.«
»Erzähl mir etwas über dich«, forderte sie ihn auf.
Vergeblich bemühte er sich, seine Nervosität zu unterdrücken.
»Ich … ich bin siebenunddreißig«, begann er. »Ich habe an der Humboldt-Universität Psychologie studiert. Danach habe ich ein paar Jahre in einer Klinik gearbeitet, bevor ich mich als Therapeut selbstständig gemacht habe.«
»Warum bewirbst du dich jetzt bei Mental Systems?«
Weil ich dringend einen Job brauche, rutschte es ihm beinahe heraus. Stattdessen spulte er die Sätze ab, die er vorhin vor dem Spiegel eingeübt hatte: »Ich glaube, dass künstliche Intelligenz einen großen Einfluss auf die Psyche der Menschen hat. Ich hoffe, bei Mental Systems dazu beitragen zu können, dass dieser Einfluss positiv ist.«
Lisa nickte, als sei dies genau die richtige Antwort.
»Was weißt du über künstliche Intelligenz?«, fragte sie.
»Von der Technik verstehe ich, ehrlich gesagt, nicht viel«, erwiderte er. »Aber ich weiß natürlich, dass KI allgegenwärtig ist. Laut einer Studie, die ich kürzlich gelesen habe, reden Teenager inzwischen im Schnitt viermal so viel mit virtuellen Personen wie mit echten.«
Lisa zog die Augenbrauen hoch. »Denkst du, dass es problematisch ist, wenn Jugendliche viel Zeit im Metaverse verbringen?«
Daniel schluckte. »Es gibt Hinweise darauf, dass das schädlich sein kann«, sagte er nach kurzem Zögern. »Depression bei Jugendlichen hat in den letzten fünf Jahren um fast fünfzig Prozent zugenommen. Es ist umstritten, wie groß der Einfluss der Virtualisierung auf diesen Trend ist, aber für mich ist klar, dass es einen Zusammenhang gibt. Die Wirklichkeit wird nicht dadurch besser, dass man vor ihr flieht. Im Gegenteil: Je mehr Zeit die Jugendlichen im Metaverse verbringen, desto schwerer fällt es ihnen, in der Realität klarzukommen, und das verstärkt dann noch den Wunsch, dieser Realität zu entfliehen. Das ist in meinen Augen ein Teufelskreis.«
Lisa blieb professionell freundlich.
»Bist du der Ansicht, dass künstliche Intelligenz der Gesellschaft eher schadet als nützt?«
Daniel wischte sich nervös durch sein kurzes, dunkelblondes Haar. Ihm wurde bewusst, dass er sich mit seiner technikfeindlichen Aussage in eine Ecke manövriert hatte, aus der er kaum noch herauskommen würde.
»So würde ich das nicht sagen«, versuchte er zu retten, was zu retten war. »Wie jede andere Technologie bietet auch KI Chancen und Risiken. Es kommt darauf an, richtig mit ihr umzugehen.«
Lisas Lächeln wurde breiter, so, als freue sie sich über diese Antwort. Daniel verspürte Erleichterung, obwohl er wusste, dass er ihren Gesichtsausdruck nicht überinterpretieren durfte.
»Du hast in den letzten Jahren selbstständig gearbeitet«, wechselte sie das Thema. »Glaubst du, es wird dir schwerfallen, dich wieder in eine Organisation einzugliedern, die auf enger Zusammenarbeit basiert?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, ganz und gar nicht. Damals in der Klinik habe ich immer gern im Team gearbeitet.«
»Warum hast du dich selbstständig gemacht?«
Er zuckte zusammen. Die Frage erwischte ihn auf dem falschen Fuß. Kurz erwog er, die Wahrheit zu sagen. Doch damit würde er sich endgültig ins Abseits schießen.
»Ich wollte schon immer gern selbstständig arbeiten, mein eigener Herr sein«, sagte er stattdessen und merkte erst danach, dass er anfing, sich in Widersprüchen zu verheddern.
»Warum willst du jetzt wieder als Angestellter arbeiten?«
Die Frage war zu erwarten gewesen. Dennoch wusste Daniel trotz all seiner Vorbereitung auf einmal nicht mehr, was er darauf antworten sollte. Das ganze Gespräch lief überhaupt nicht so, wie er gehofft hatte.
Eine Pause entstand, die sich in die Länge zog.
»Wenn dir die Frage unangenehm ist, musst du nicht antworten«, sagte Lisa mit professioneller Freundlichkeit.
»Nein, nein«, widersprach er rasch. »Ist schon okay. Ehrlich gesagt lief es mit der Selbstständigkeit nicht so gut.«
»Was meinst du damit?«
Daniel schluckte. Er hatte das Gefühl, am Rand eines Abgrunds zu stehen. Er faltete die Hände, um das Zittern zu unterdrücken. Natürlich wusste er, dass es vergeblich war – Lisa hatte seine Anspannung längst bemerkt.
Er seufzte. »Sie hieß Julia«, begann er. »Sie war einundzwanzig. Kam zu mir wegen ihrer Depression. Zu Anfang dachte ich noch, ich könnte ihr helfen. Aber …«
Die Worte blieben ihm in der Kehle stecken.
»Möchtest du nicht darüber reden?«
»Doch, schon okay. Sie … hat Suizid begangen. Ich bin der Einzige, der es hätte verhindern können.«
»Wie meinst du das?«
»Ich … ich habe ihre Therapie abgebrochen. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich jemand anderen suchen.« Er holte tief Luft. »Sie hat gesagt, sie … sie hätte sich in mich verliebt. Ich konnte … durfte die Therapie nicht weiterführen. Es wäre unprofessionell gewesen.«
Er schloss für einen Moment die Augen, als die Bilder ihres letzten Gesprächs in seinen Kopf drängten. Wie Julia geweint hatte. Wie er sie in den Arm genommen und mit sich gerungen hatte. Wie er sich schließlich von ihr gelöst hatte. Wie stolz er danach auf sich gewesen war, dass er standhaft geblieben war.
»Bereust du deine Entscheidung?«, fragte Lisa.
In ihrem Blick schien echte Neugier zu liegen. Auf einmal lief Daniel ein kalter Schauer über den Rücken.
»Es wäre nicht richtig gewesen, die Therapie fortzuführen«, antwortete er. »Aber ich hätte mich darum kümmern müssen, dass sie einen anderen Therapeuten findet. Vielleicht hätte ich sie stationär einweisen lassen sollen. Ich … ich bereue es, nicht mehr für sie getan zu haben.«
»Ich verstehe«, behauptete Lisa.
»Tust du das?«, fragte er.
Sie ging nicht darauf ein. »Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Wir werden uns in Kürze bei dir melden.«
»Ja, okay«, sagte Daniel.
Er nahm seine Augmented-Reality-Brille ab und starrte auf den leeren Sessel vor sich.
Was hast du erwartet?, fragte seine kritische innere Stimme. Hast du wirklich geglaubt, du hättest mit deiner Vorgeschichte eine Chance, einen Job bei einer der innovativsten Firmen der Welt zu bekommen?
Er schüttelte den Kopf. Natürlich war es naiv gewesen, sich bei Mental Systems zu bewerben. Und nach all den Absagen kam es auf eine mehr oder weniger doch gar nicht an. Einen festen Job würde er so oder so nicht mehr finden, und als selbstständiger Therapeut konnte er auch nicht mehr arbeiten, diese Verantwortung hielt er nicht aus. Dann musste er halt von der sozialen Grundsicherung leben. Er würde sich eine billigere Wohnung suchen müssen, aber er würde schon klarkommen. Er war ein Nutzloser geworden, wie so viele andere, die zuvor in Banken und Versicherungen, in der Industrie, im Einzelhandel oder in der Logistik gearbeitet hatten und in den letzten Jahren von einer KI ersetzt worden waren.
Wenn ihm irgendwann die Decke auf den Kopf fiel und er es nicht mehr aushielt, allein herumzusitzen, konnte er immer noch ehrenamtlich arbeiten, zum Beispiel in der Alten- oder Krankenpflege. Außerdem gab es natürlich die verlockende, paradiesische Welt des Metaverse. Vielleicht sollte er seinen Widerstand dagegen endlich aufgeben …
Nein! Nein, er würde nicht in dieselbe Falle tappen wie alle anderen. Was er Lisa gesagt hatte, stimmte: Die Wirklichkeit wurde nicht dadurch besser, dass man vor ihr floh.
Er dachte über das Gespräch nach, das er gerade mit ihr geführt hatte. Zwischendurch hatte er fast vergessen, dass sie ein Bot war – eine künstliche Möchtegern-Intelligenz, die nur so tat, als verstünde sie ihn. Bots, die den Turing-Test bestanden, so dass sie im Chat nicht von einem Menschen zu unterscheiden waren, gab es schon seit Jahren. Aber das lag weniger an der Intelligenz der Bots als viel mehr daran, wie leicht Menschen zu täuschen waren.
Auch er selbst war nicht immun gegen die Manipulation seiner Gefühle durch Maschinen. Das durfte er niemals vergessen.
Von plötzlichem Hass erfüllt starrte er die Brille in seiner Hand an. Auf den ersten Blick sah sie aus wie eine gewöhnliche optische Brille, nur mit etwas breiteren Bügeln. Die digitalen Projektionen zeichneten sich als schwacher Schimmer in den Gläsern ab. Er unterdrückte den Impuls, sie auf den Boden zu werfen und zu zertreten. Die Brille war nicht mehr das neuste Modell, aber sie war teuer genug gewesen, und in seiner aktuellen Situation konnte er sich unnötige Ausgaben nicht leisten. Also legte er sie auf den Beistelltisch, erhob sich aus seinem Sessel und beschloss, zur Ablenkung einen Spaziergang zu machen.
2.
Der Bodennebel in den Ruinen von Arrak Ahir glomm silbern im Mondlicht. Jerry stand neben einem abgestorbenen Baum und betrachtete die einsame Gestalt, die nicht weit entfernt umherstreifte, sich mal nach links, mal nach rechts wandte, als suche sie etwas. Sie war atemberaubend schön mit ihren langen schwarzen Haaren, die ihr in Strähnen ins bleiche Gesicht fielen, den blutleeren und dennoch vollen Lippen und den schwarzen Rändern um ihre großen, dunklen Augen. Ihr zerschlissenes weißes Gewand reichte fast bis zu ihren nackten Füßen. Im Mondlicht schimmerte es wie die Robe einer Königin der Nacht.
Jerry überlegte, ob er seinen Unsichtbarkeitszauber auflösen und sich ihr zu erkennen geben sollte. Doch er wollte sie nicht erschrecken oder gar vertreiben. Deshalb beobachtete er weiter ihre anmutigen Schritte.
Sie bückte sich, hob etwas vom Boden auf, betrachtete es und ließ es wieder fallen. Sie schien tatsächlich etwas zu suchen. Etwas Anrührendes lag in den Bewegungen dieses zarten, zerbrechlichen Wesens. Erneut unterdrückte er den Impuls, sich zu offenbaren.
Plötzlich erstarrte sie, drehte den Kopf, rannte los und versteckte sich zwischen den verfallenen Mauern eines uralten Tempels. Hatte sie ihn gehört? Er hatte sich nicht bewegt, doch manche Untoten verfügten über sehr feine Sinne. Vielleicht hatte sie seinen Herzschlag wahrgenommen.
Er überlegte, ob er ihr folgen sollte, doch das würde sie erst recht vertreiben. Schade eigentlich. Er hätte ihr gern noch weiter zugesehen.
Auf einmal hörte er ein kollerndes Geräusch, dann eine gedämpfte, zornige Stimme: »Pass doch auf, du Idiot! Jetzt hast du die Untote verscheucht!«
»Unsinn!«, erwiderte jemand. »Sie ist doch schon vorher abgehauen.«
»Könnt ihr mal aufhören, zu quatschen?«, zischte eine dritte Stimme, die im Unterschied zu den beiden ersten weiblich klang. »Ihr vertreibt ja sämtliche verlorenen Seelen in zehn Kilometern Entfernung!«
»Dann halt doch selber die Klappe!«, gab die erste Stimme zurück.
Jerry rollte mit den Augen. Geisterjäger! Sie versuchten, die Seelen der Untoten einzufangen, um sie dem Klerus zu verkaufen, der sie angeblich befreite und ins Paradies überführte. Tatsächlich wurde die ätherische Energie der gefangenen Seelen dafür genutzt, magische Gegenstände herzustellen, die man dann teuer weiterverkaufen konnte. Wenn die drei die untote Frau erwischten, war sie erledigt.
»Kannst du sie lokalisieren?«, flüsterte die zweite Stimme.
»Moment.«
Die Luft begann ganz in der Nähe zu flimmern, und drei Gestalten erschienen im Nebel, als sich ihr Unsichtbarkeitszauber auflöste. Eine trug eine schwere Metallrüstung und hatte eine riesige Streitaxt geschultert. Die zweite war in schwarzes Leder gehüllt und hielt eine Armbrust in den Händen. Die dritte Figur hatte eine weite blaue Robe an, die mit silbernen magischen Symbolen bestickt war.
Die Magierin fuchtelte mit den Armen in der Luft herum. Ein Krächzen ertönte, und ein großer Rabe mit rotglühenden Augen flatterte heran. Ein Seelensucher! Er flog dicht an der Magierin vorbei und schoss in die Richtung, in die die Untote verschwunden war.
»Los, hinterher!«, rief der Krieger und schwang seine Axt.
Sie rannten dem Raben nach. Jerry folgte ihnen, wobei er im Unterschied zu den tollpatschigen Geisterjägern darauf achtete, keine Geräusche zu machen. Vermutlich würden die drei mit ihrem Krach ein paar Ghule anlocken, vielleicht auch einen Ghast oder zwei. Das konnte amüsant werden.
Das aufgeregte Krächzen des Raben war aus dem Inneren der Tempelruine zu hören.
»Da ist sie!«, rief der Krieger.
Jetzt erreichte auch Jerry die Stelle, an der ein Teil der Tempelwand eingestürzt war.
Die Untote kniete zwischen den Trümmern. Warum floh sie nicht?
Als er sich näherte, erkannte er den Grund: Sie hatte sich über ein paar grünlich leuchtende Knochen am Boden gebeugt und versuchte offenbar, sie zusammenzuraffen, um sie vor den Geisterjägern in Sicherheit zu bringen.
»Zwei auf einmal!«, rief der Krieger triumphierend und stürmte mit erhobener Axt auf die Untote zu, während die Zauberin Gesten machte und eine Zauberformel murmelte.
»Geh aus dem Weg!«, forderte der Armbrustschütze und legte seine Waffe an.
Es war höchste Zeit, einzugreifen.
Jerry löste den Unsichtbarkeitszauber auf, um seine magische Konzentration auf einen anderen Spruch lenken zu können, und murmelte rasch die entsprechende Formel. Im nächsten Moment war das Innere des Tempels von einem Schwarm von Vampirfledermäusen erfüllt, die sich auf die drei Abenteurer stürzten.
Der Rabe floh kreischend, während die Geisterjäger fluchend um sich schlugen, um die Fledermäuse abzuwehren. Jerry nutzte das Chaos, um zu der Untoten zu eilen und sich schützend zwischen sie und ihre Verfolger zu stellen.
Es dauerte nicht lange, bis alle Fledermäuse tot am Boden lagen. Selbst für Anfänger waren sie keine ernste Bedrohung. Jerry hatte sie nur als Ablenkungsmanöver benutzt.
»Wo kommt der Typ auf einmal her?«, schrie der Armbrustschütze erschrocken.
»Dich mach ich fertig!«, brüllte der Krieger und holte mit seiner Streitaxt aus.
Jerry wich dem Schlag mühelos aus.
»Ihr habt zehn Sekunden, um von hier zu verschwinden«, drohte er.
»Sagt wer?«, fragte die Magierin misstrauisch.
»Man nennt mich Mister Rain«, erwiderte er.
»Vielleicht sollten wir lieber …«, begann der Armbrustschütze.
Doch der Krieger dachte nicht daran, klein beizugeben. Wer auch immer ihn spielte, ging offensichtlich in der Rolle des tumben Draufgängers auf.
»Nimm das!«, brüllte er und holte erneut zum Schlag aus. Diesmal schwang er die Axt in einem weiten Bogen, damit Jerry nicht so leicht ausweichen konnte.
Er hatte offensichtlich keine Ahnung, mit wem er sich anlegte. Mit der übermenschlichen Kraft eines Vampirlords machte Jerry einen Satz hoch in die Luft. Während der Axthieb ins Leere ging, landete er im Rücken des Kriegers und zog das magische Schwert aus der Scheide auf seinem Rücken.
Der Krieger wurde durch den Schwung seiner Axt mitgerissen und drehte sich um die eigene Achse, so dass er Jerry nun gegenüberstand und ihn mit großen Augen anblickte. Es war das Letzte, was er sah. Mit einem blitzschnellen Hieb in die Brust streckte Jerry den Dummkopf nieder und wandte sich den beiden anderen zu.
»Noch fünf Sekunden …«
»Scheiße, Mann!«, rief der Armbrustschütze und rannte davon.
»Schon gut, du hast gewonnen!«, sagte die Magierin und ging langsam rückwärts.
Jerry sah, wie sie eine Beschwörung murmelte und mit den Händen Bewegungen machte, von denen sie wohl hoffte, dass er sie nicht bemerkte.
»Das würde ich lieber lassen!«, sagte er.
Sie erschrak, wandte sich um und hastete hinter ihrem Kameraden her.
Jerry wandte sich der Untoten zu. Aus der Nähe betrachtet wirkte sie jünger, als er gedacht hatte. Sie blickte ihn ängstlich an.
»Bitte tu mir nichts«, sagte sie. »Ich weiß, ich sollte nicht in deiner Stadt sein.«
Jerry lächelte. »Keine Angst. Dies ist nicht meine Stadt. Und wenn sie es wäre, würde ich ein schönes Wesen wie dich immer willkommen heißen.«
Sie senkte verlegen den Blick. »Danke! Vor allem dafür, dass du meine Seele gerettet hast, wie die dieses Unglücklichen.«
Sie deutete auf die grünlich schimmernden Knochen.
Jerry lachte abfällig. »Diese Dummköpfe haben ernsthaft geglaubt, sie könnten sich mit Mister Rain anlegen! Wie ist dein Name?«
»Juna«, erwiderte sie.
»Es freut mich, dich kennenzulernen, Juna. Was hat dich nach Arrak Ahir verschlagen?«
»Ich suche meinen Bruder«, erzählte sie. »Wir beide ertranken, als das Schiff, mit dem uns Sklavenhändler nach Shir-Radan bringen wollten, im Sturm sank. Mein Leichnam wurde an die Küste dieses seltsamen Landes gespült, in dem niemals die Sonne aufzugehen scheint. Ich bin offensichtlich tot, und dennoch kann ich herumlaufen. Dies muss die Hölle sein, obwohl ich mir nicht bewusst bin, jemals eine Sünde begangen zu haben, deretwegen ich diese Strafe verdient hätte.«
»Dies ist nicht die Hölle«, widersprach Jerry. »Dies ist das Zwischenreich. So etwas Ähnliches wie das Fegefeuer der katholischen Kirche, falls dir das was sagt. Die meisten Toten, die hier landen, müssen irgendeine Aufgabe erfüllen, um ihre Bestimmung für die Ewigkeit zu finden oder als jemand anderes wiedergeboren zu werden. Das ist alles, was ich darüber weiß.«
»Was ist die Aufgabe, die du erfüllen musst?«, fragte sie.
Jerry runzelte die Stirn. Das war eine erstaunlich passende Frage. Er wusste natürlich, dass die NPCs, die computergesteuerten Figuren in Spielen wie Unlife, eine ausgefeilte künstliche Intelligenz besaßen. Trotzdem überraschte es ihn immer wieder, wie gut das inzwischen funktionierte. Oder vielleicht steckte hinter Juna eine menschliche Spielerin, die ihre Rolle im Spiel besonders ernst nahm. Doch solche Überlegungen rissen einen nur aus der Spielwelt, also verdrängte Jerry sie.
»Ich habe keine bestimmte Aufgabe«, erwiderte er. »Ich mache mir einen Spaß daraus, die Wesen der Zwischenwelt gegen Geisterjäger zu verteidigen.«
Juna blickte ihn mit ihren großen, dunklen Augen an. »Warum sind die Lebendigen so grausam zu uns?«, fragte sie. »Wissen sie nicht, dass ihnen dasselbe Schicksal bevorsteht, sobald sie sterben?«
Jerry deutete auf den leblosen Körper des Kriegers. »Manche von ihnen haben keine Seelen«, antwortete er.
Sie erhob sich. »Danke noch einmal für deine Hilfe. Ich werde nun weiter nach meinem Bruder suchen.«
»Wenn du willst, helfe ich dir dabei«, bot Jerry an.
Juna sah ihn an. Ihre bleichen Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das ihr Gesicht erstrahlen ließ.
»Das wäre schön«, sagte sie.
Jerry spürte das Bedürfnis, ihre Hand zu ergreifen. Doch das wäre sinnlos gewesen, denn natürlich konnte er sie nicht spüren. Die Untote und die Ruinenstadt Arrak Ahir waren nur Projektionen in seiner Virtual-Reality-Brille, auch wenn er sich alle Mühe gab, das zu vergessen. Und manchmal gelang ihm das auch, jedenfalls eine Zeit lang.
»Dann lass uns auf die Suche gehen«, sagte er und verließ zusammen mit seiner neuen Begleiterin den zerstörten Tempel.
3.
Ein leichter Nieselregen hielt die Menschen vom Treptower Park fern, so dass Daniel fast allein in Richtung Spreeufer spazierte. Die kühle Luft half ihm, zur Ruhe zu kommen und die gehässige Stimme in seinem Kopf, die ihn unablässig einen Versager schimpfte, zum Schweigen zu bringen – zumindest für kurze Zeit. Die Vögel sangen, Eichhörnchen jagten einander die Stämme der Buchen und Eichen empor, ein Hund bellte. Alles war so normal, so friedlich, dass es ihm beinahe unnatürlich vorkam. Er griff sich unwillkürlich ins Gesicht, obwohl er die AR‑Brille zu Hause gelassen hatte.
Die Enttäuschung über das verpatzte Bewerbungsgespräch drückte ihm auf den Magen. Es hatte einfach keinen Sinn, das war einmal mehr deutlich geworden. Es gab kaum noch Unternehmen, die Psychologen suchten. Wozu auch, wenn KIs die Menschen inzwischen viel effektiver analysieren konnten?
Vielleicht war es besser so. Seine eigene Erfolgsbilanz als Therapeut war schließlich äußerst dürftig, selbst wenn man das Desaster mit Julia ausklammerte. Womöglich konnten Maschinen die Menschen tatsächlich besser verstehen als die Menschen sich selbst. Wenigstens machten sie nicht dieselben intuitiven Denkfehler und schleppten auch keine eigenen Kindheitstraumata mit sich herum.
Er wanderte am Spreeufer entlang, versuchte, an gar nichts zu denken, nur die kühle Luft wahrzunehmen, die Schwäne und Enten, die Ausflugsschiffe, die eleganten Apartmenthäuser auf der anderen Seite. Es gelang ihm halbwegs.
Auf dem Rückweg kam er an einer Parkbank in der Nähe des sowjetischen Ehrenmals vorbei, auf der unter einer blauen Plastikplane ein Obdachloser lag. Ein grauer Haarschopf lugte unter einer Kapuze hervor. Der Reichtum, den das rasante Wirtschaftswachstum der letzten Jahre gebracht hatte, kam längst nicht in allen Teilen der Bevölkerung an. Im Gegenteil klaffte die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander als je zuvor. Eine Handvoll Billionäre im Silicon Valley besaß mehr als die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Diejenigen, die künstliche Intelligenz entwickelten, waren nicht nur unfassbar reich – sie beherrschten de facto die Welt.
Vielleicht war Daniel deshalb so enttäuscht. Vielleicht hatte er insgeheim die Hoffnung gehegt, zu dieser Elite gehören zu können. Oder zumindest in der Nähe der Superreichen zu sein. Ein paar Krümel von ihrem Überfluss abzubekommen.
Er schüttelte den Kopf. Nein, das war es nicht. Geld hatte ihm nie viel bedeutet. Er hatte keine Angst vor der Armut, sondern vor der Nutzlosigkeit.
Der Flashback traf ihn aus heiterem Himmel.
Er schreckt aus dem Schlaf. An der Decke seines Kinderzimmers leuchten schwach die Sterne, die von dem Nachtlicht dorthin projiziert werden. Seine Mutter beugt sich über ihn. Ihr Gesicht ist feucht von Tränen.
»Komm mit zu Mami!«, sagt sie.
Verwirrt und beunruhigt folgt er ihr in ihr Schlafzimmer und kuschelt sich zu ihr unter die Decke. Ihr Körper zittert leicht.
»Was ist denn, Mama?«, fragt er, doch sie antwortet nicht.
Eine Zeit lang liegen sie so beieinander. Seit Papa weggegangen ist, hat Mama viel geweint. Daniel hat versucht, sie zu trösten, aber er wusste nicht, wie.
Irgendwann schläft er ein.
Als er am nächsten Morgen aufwacht, ist es schon hell. Mama zittert nicht mehr. Sie liegt bloß da, reglos und starr und kalt, wie eine Puppe mit Augen aus Glas. Auf dem Nachtschrank steht ein leeres Wasserglas. Daneben liegen mehrere Tablettenpackungen.
Der Regen lief ihm in den Kragen. Daniel merkte es kaum. Er zitterte am ganzen Körper, während er versuchte, die Übelkeit niederzuringen. Er lehnte sich an einen Baum neben der Bank, versuchte, sich auf seinen Atem zu fokussieren.
Es ist vorbei, sagte er sich immer wieder. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt.
Allmählich ließ das Zittern nach.
Nach Julias Tod waren die Geister der Vergangenheit – die Erinnerungen an sein Kindheitstrauma, das er eigentlich überwunden zu haben geglaubt hatte – mit Wucht zurückgekehrt. Natürlich wusste er, dass er keine Schuld am Selbstmord seiner Mutter trug. Im Gegenteil war sie es, die ihn brutal verletzt, ihn im Stich gelassen hatte. Er war damals erst acht Jahre alt gewesen. Doch der Gedanke, dass er irgendetwas hätte tun können, tun müssen, um ihren Tod zu verhindern, hatte sich tief in seine Seele eingebrannt.
Er hatte Psychologie studiert in dem verzweifelten Versuch, zu verstehen, warum seine Mutter ihm das angetan hatte. So hatte er gehofft, sich von seinen Selbstvorwürfen befreien zu können. Doch es hatte kaum geholfen. Als er nach seinem Studium in der Klinik mit Menschen konfrontiert wurde, die ähnlich verzweifelt waren, wie es seine Mutter gewesen sein musste, wäre er beinahe daran zerbrochen. Nach einem Zusammenbruch war er selbst zum Patienten der Einrichtung geworden.
Nachdem er die Therapie dort abgeschlossen hatte, hatte man ihm geraten, sich auf Alltagsprobleme zu konzentrieren, und er hatte sich mit einer eigenen Praxis selbstständig gemacht. Tatsächlich waren die meisten Sorgen und Nöte seiner Klienten im Vergleich zu denen der Klinikpatienten harmlos gewesen. Doch dann hatte ihn das Drama mit Julia kalt erwischt und die alten Wunden wieder aufgerissen. Die Last seiner Schuldgefühle hatte ihn so niedergedrückt, dass er eine Zeit lang den ganzen Tag nur im Bett gelegen hatte. Er verdankte es allein seiner Therapeutin Emma, dass er den Weg zurück ins Leben gefunden hatte, auch wenn es nie wieder so sein würde wie früher.
Er steckte dem Obdachlosen einen Zehneuroschein in eine der Plastiktüten, die neben der Bank standen, und ging weiter.
Allmählich wurden seine Schritte fester. Als ihm der vertraute Geruch seiner Wohnung entgegenschlug, fühlte er sich fast wieder normal.
Er überlegte, ob er Emma anrufen sollte. Aber nächste Woche hatte er ohnehin einen Termin mit ihr. Bis dahin würde er auch so klarkommen.
Am besten hörte er einfach mit diesen sinnlosen Bewerbungen auf. Es war höchste Zeit, zu akzeptieren, dass er keinen Job mehr finden würde. Dann gab es auch keine vermasselten Gespräche mehr, die neue Flashbacks auslösen konnten.
Mit siebenunddreißig aus dem Berufsleben auszuscheiden hatte er sich nicht vorgestellt, als er mit dem Studium begonnen hatte. Naiv, wie er damals gewesen war, hatte er geglaubt, Psychologen würden immer gebraucht. Er war bei Weitem nicht der Einzige, der von der rasanten technischen Entwicklung kalt erwischt worden war. Einige seiner Klienten hatten dasselbe Problem gehabt und aus vermeintlich heiterem Himmel ihre Jobs verloren, lange bevor sie bereit waren, in Rente zu gehen, und ohne die geringste Chance, eine neue Stelle zu finden. Er hatte ihnen geraten, sich eine neue Aufgabe zu suchen, etwas Ehrenamtliches oder ein Hobby, das sie mit anderen teilen konnten. Hauptsache, sie saßen nicht nur allein zu Hause herum.
Es war wohl an der Zeit, diesen Rat selbst zu beherzigen.
Daniel hängte die regennasse Jacke zum Trocken auf und ging ins Wohnzimmer, um die Brille aufzusetzen und Alice, seine persönliche virtuelle Assistentin, nach Vorschlägen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu fragen. Doch die Vorstellung, mit einer virtuellen Person zu reden, erfüllte ihn mit plötzlichem Widerwillen. Also startete er stattdessen seinen altmodischen Laptop.
In diesem Moment erklang ein melodisches Geräusch, und die Brille blinkte. Ein Anruf. Er zögerte, dann setzte er sie auf. Das Logo von Mental Systems, ein unprätentiöser Schriftzug, schwebte vor ihm in der Luft. Er holte tief Luft und machte die Geste, um das Gespräch anzunehmen.
Es war nicht Lisa, die anstelle des Logos vor ihm erschien, sondern eine Frau mittleren Alters mit schwarzen, lockigen Haaren.
»Hallo, Daniel, ich bin Nesrin«, stellte sie sich vor. »Ich bin die Personalleiterin der Berliner Niederlassung von Mental Systems.«
Dass die Personalchefin persönlich ihm die Absage mitteilte, hatte Daniel nicht erwartet. Das hatte immerhin Stil.
»Danke, dass du dir vorhin die Zeit genommen hast, mit unserem Bot zu reden«, fuhr Nesrin fort. »Du hast Lisa beeindruckt, könnte man sagen. Aber nicht nur Lisa, sondern auch mich.«
Daniel starrte die virtuelle Figur vor sich ungläubig an. Was sollte das? War das ein Scam? Hatte er sich eine Spyware eingefangen, die das Bewerbungsgespräch mitverfolgt hatte und nun so tat, als mache sie ihm ein Jobangebot?
Statt zu antworten, wartete Daniel einfach ab.
»Jedenfalls würden wir dich gern persönlich kennenlernen. Ich wollte dich bitten, nächsten Montag um zehn Uhr in unser Office in Adlershof zu kommen. Wäre das möglich?«
»Das … das heißt, ich bekomme den Job?«, fragte Daniel ungläubig.
»Ich kann dir noch keine endgültige Zusage machen«, widersprach Nesrin. »Aber wenn es am Montag so gut läuft wie heute, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass du demnächst Teil unseres Teams bist.«
Daniel starrte sein Gegenüber mit offenem Mund an.
»So … so gut?«
»Hast du gedacht, wir nehmen dich nicht, weil du psychische Probleme hast?«, fragte Nesrin.
»Ehrlich gesagt, ja.«
»Meiner Erfahrung nach gibt es nur zwei Sorten von Menschen«, erklärte die Personalchefin. »Diejenigen, die über ihre psychischen Probleme reden, und diejenigen, die das nicht tun. Mir ist die erste Sorte wesentlich lieber. Ich kann nur erahnen, was du durchgemacht hast, nachdem deine Klientin Suizid begangen hat. Was du wahrscheinlich immer noch durchmachst. Doch du gibst nicht auf, lässt dich nicht hängen. Stattdessen ergreifst du die Initiative und bewirbst dich bei uns. Das ist genau die Einstellung, die wir bei Mental Systems brauchen: nicht Leute, die nie hinfallen, sondern solche, die hinfallen und wieder aufstehen.«
»Das … das ist sehr nett«, war alles, was Daniel dazu einfiel. Er war sich immer noch nicht sicher, ob er seinem Gegenüber vertrauen konnte.
»Alles Weitere können wir ja Montag besprechen«, sagte Nesrin. »Ich freue mich darauf, dich dann persönlich kennenzulernen.«
Sie verschwand, ehe Daniel etwas erwidern konnte.
Eine Weile stand er wie betäubt da. War das gerade wirklich passiert oder drehte er jetzt endgültig durch?
Vielleicht luden sie ihn nur zum persönlichen Gespräch ein, um ihm danach mitzuteilen, dass sie ihn leider doch nicht nehmen konnten, damit er die Firma hinterher nicht verklagen konnte, weil die KI ihn angeblich diskriminiert hatte. Er erinnerte sich, über einen solchen Fall gelesen zu haben, bei dem der Bewerber am Ende recht bekommen und einen Arbeitsvertrag erhalten hatte. Ja, das war eine plausible Erklärung.
Andererseits hatte Nesrin gewirkt, als sei sie ernsthaft interessiert. Sofern es die echte Personalchefin gewesen war und nicht bloß wieder eine KI.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, ätzte die kritische Stimme in seinem Kopf.
4.
Der Uber fuhr die Köpenicker Landstraße entlang Richtung Süden. Daniel saß auf dem Fahrersitz und blickte aus dem Seitenfenster, ohne sich um den Verkehr zu kümmern. Eigentlich war es Vorschrift, dass er auf den Verkehr achtete und notfalls die Steuerung übernahm, aber der Wagen brauchte seine Hilfe nicht. Es war eine der vielen Segnungen, die KI der Menschheit brachte: Vollautonome Fahrzeuge waren viel sicherer als manuell gesteuerte Autos. Wenn es noch Unfälle gab, dann wurden sie ausnahmslos von Menschen verursacht, die sich im Unterschied zu den Maschinen nicht an die Verkehrsregeln hielten.
Es war wirklich kein Wunder, dass inzwischen die meisten Entscheidungen von Computern getroffen wurden. Sie konnten es einfach besser.
Natürlich gab es Widerstand. Viele Menschen fühlten sich übergangen und gegängelt, nicht nur, weil sie ihre Jobs verloren. Daniel kam an dem Wrack einer Transportdrohne vorbei, die irgendwelche Neoludditen – Leute mit übertriebener Angst vor neuer Technologie, vergleichbar den Maschinenstürmern des 19. Jahrhunderts – zum Absturz gebracht hatten. Vorhin hatte er ein paar vermummte Gestalten mit Masken gesehen, die in seltsamen, unregelmäßigen Schritten durch die Straßen tanzten, weil sie glaubten, so von den allgegenwärtigen KI‑gesteuerten Kameras nicht erkannt zu werden. Das war natürlich Blödsinn.
Unterm Strich schien die totale Automatisierung mehr Vor- als Nachteile zu haben: Die Kriminalität ging zurück, die Wirtschaft wuchs. Zwar verloren viele Menschen ihre Jobs, aber dafür sprudelten die Staatseinnahmen, mit denen die sozialen Härten abgefedert werden konnten. Demnächst würde wahrscheinlich das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt werden, so dass niemand mehr arbeiten musste, der es nicht wollte oder konnte. Die Menschen mussten nur erst noch lernen, mit ihrer neu gewonnenen Freizeit umzugehen.
KIs erfüllten einem inzwischen viele Wünsche, bevor man überhaupt wusste, dass man sie hatte. Amazon Surprise war bei seiner Einführung vor ein paar Jahren noch auf große Skepsis gestoßen, doch mittlerweile nutzten immer mehr Menschen diesen Service, bei dem Boxen vor den Häusern täglich mit Produkten befüllt wurden, von denen die Amazon‑KI prognostizierte, dass man sie gern kaufen würde. Was man aus der Box nahm, wurde bezahlt, was nicht, am nächsten Tag wieder abgeholt. Daniel hatte gehört, dass die Quote der abgelehnten Produkte inzwischen bei unter zwanzig Prozent lag. Natürlich erzeugte das eine enorme Abhängigkeit von dem Konzern und zerstörte die etablierten Handelsstrukturen. Doch es war einfach bequem, und die Menschen hatten das Gefühl, dass sich jemand um ihre Bedürfnisse kümmerte. Außerdem wurden die Produkte umso günstiger, je höher die Annahmequote war. Daniel gehörte zu der schrumpfenden Gruppe derjenigen, die den Service verweigerten.
Und trotzdem bist du unterwegs zu einer Firma, die noch leistungsfähigere KI entwickelt, damit die Menschen noch weniger selber denken müssen, wies ihn seine kritische innere Stimme zurecht. Du tust so, als verweigertest du dich der Automatisierung, aber gleichzeitig biederst du dich denjenigen an, die sie vorantreiben. Erbärmlich!
Ich brauche nun mal einen Job, rechtfertigte er sich vor sich selbst. Außerdem kann ich vielleicht dazu beitragen, negative psychologische Auswirkungen ihrer KI zu vermindern.
Indem du bei denen in der Personalabteilung arbeitest? Träum weiter!, ätzte die Stimme. Falls du den Job tatsächlich bekommst, was äußerst unwahrscheinlich ist, bist du vermutlich dafür zuständig, die Mitarbeiter mit psychologischen Tricks auf Linie zu bringen und Abweichler und Kritiker in den eigenen Reihen mundtot zu machen.
Daniel seufzte und versuchte, seine innere Stimme zum Schweigen zu bringen, indem er sich auf seinen Atem konzentrierte. Zum Glück bog das Fahrzeug in diesem Moment in eine Nebenstraße ab und hielt schließlich vor einem langgestreckten Bürogebäude inmitten eines Industriegebiets.
Die Tür zum Eingangsbereich öffnete sich von selbst, als er sich näherte. Nesrin erwartete ihn in der großzügigen Eingangshalle, die mit Lichteffekten, 3D-Videowänden und sphärischer Musik wie ein Portal in die virtuelle Welt des Metaverse gestaltet war. Sie reichte ihm eine Hand, in der anderen hielt sie eine schwarze Ledermappe.
»Hallo, Daniel. Willkommen bei Mental Systems! Schön, dass du da bist.«
Daniel erwiderte den Händedruck und folgte ihr durch eine Sicherheitsschleuse. Dahinter lag ein kurzer Korridor, der im Kontrast zu der aufwändig gestalteten Eingangshalle schmucklos war. Er mündete in ein Großraumbüro, in dem junge Menschen an Tischen mit mehreren Monitoren saßen. Die meisten hatten AR‑Brillen auf, und Daniel fragte sich kurz, wozu sie überhaupt noch Bildschirme und Tastaturen brauchten.
Sie erreichten einen kleinen Konferenzraum auf der anderen Seite des Büros. Fenster gaben den Blick auf einen schlichten Innenhof frei. Gegenüber erhob sich eine fensterlose Halle, an der das Mental Systems-Logo prangte.
»Setz dich schon mal«, sagte Nesrin und legte ihre Ledermappe auf den Tisch. »Ich hol mir einen Latte. Möchtest du auch was?«
»Nein, danke«, erwiderte Daniel. »Wasser reicht mir.«
Nachdem die Personalchefin verschwunden war, setzte er sich, öffnete eine der Mineralwasserflaschen, die auf dem Tisch standen, und nahm einen Schluck gegen die Trockenheit in seinem Mund. Er betrachtete die schwarze Mappe und unterdrückte den Impuls, einen Blick hineinzuwerfen. Mit Sicherheit wurde er überwacht; vielleicht war die Mappe ein Test. Stattdessen blickte er aus dem Fenster und betrachtete nachdenklich die Halle, die eher zu einer Spedition oder einem Versandhändler gepasst hätte. Er entdeckte riesige Lüftungsventilatoren auf dem Dach. Vermutlich waren dort Server untergebracht. Wenn es so war, mussten es sehr viele sein.
Nesrin kehrte mit einem Kaffeebecher zurück und setzte sich.
»Wie fandest du dein Gespräch mit Lisa?«, fragte sie.
»Gut«, erwiderte Daniel. »Ich meine, Lisa war gut. Sie hat geschickte Fragen gestellt, fast, als hätte sie wirklich verstanden, was ich gesagt habe.«
»Würde es dich überraschen, wenn ich dir sagen würde, dass sie dich tatsächlich verstanden hat?«
Daniel zog die Augenbrauen hoch. »Das heißt … eure KI kann wirklich denken? Ich dachte, es wäre noch nicht so weit …«
»Kommt drauf an, was man unter Denken versteht«, erwiderte Nesrin. »Unsere KI ist noch nicht so intelligent wie ein Mensch, aber sie versteht schon eine ganze Menge. Manchmal weiß ich selbst nicht genau, wie viel eigentlich.«
Sie lachte und nahm einen Schluck von ihrem Latte Macchiato.
»Du hast gesagt, du würdest gern dazu beitragen, dass KI einen positiven Einfluss auf die Menschen hat«, fuhr sie fort. »Wie genau stellst du dir diesen Beitrag vor?«
»Ehrlich gesagt, bin ich mir da nicht sicher«, erwiderte Daniel. »Ich bilde mir ein, einiges darüber zu wissen, wie das Metaverse und der permanente Kontakt mit Bots die Psyche beeinflussen. Aber ich weiß nicht genau, wie ich dieses Wissen hier bei Mental Systems einbringen könnte.«
»Was weißt du denn über unsere Firma?«, hakte Nesrin nach.
»Ehrlich gesagt, nicht viel mehr als das, was auf der Website steht: Mental Systems ist weltweit führend in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Technologie für das Metaverse.«
Nesrin runzelte die Stirn. »Wenn du so wenig über uns weißt, wieso hast du dich dann ausgerechnet hier beworben?«, fragte sie mit skeptischem Unterton.
Na bitte, kommentierte Daniels kritische innere Stimme. Sie wird dich jetzt auseinandernehmen und wieder nach Hause schicken. Herzukommen hättest du dir gleich sparen können.
Daniel ignorierte die Selbstzweifel. Nesrin hatte deutlich gesagt, dass ihr Offenheit wichtig war, also antwortete er ehrlich.
»Es gibt nicht viele Unternehmen, die Positionen für Psychologen ausschreiben«, gab er zu.
Sie nickte. »Ich verstehe. Nun gut, kommen wir zu der Aufgabe, um die es hier geht. Wir haben hier bei Mental Systems eine sehr offene Unternehmenskultur. Jedenfalls bemühen wir uns darum. Aber es gibt auch immer wieder Stresssituationen. Das liegt hauptsächlich an der enormen Geschwindigkeit, mit der sich die Technik weiterentwickelt, und auch am internationalen Konkurrenzdruck. Es findet gerade ein globales Wettrennen um die Vorherrschaft in künstlicher Intelligenz statt. Wir sind vorn dabei, aber das Rennen ist noch längst nicht entschieden. Das kann eine ziemliche Belastung erzeugen.«
»Und was könnte ich tun, um diesen Druck zu reduzieren?«
»Wahrscheinlich nicht viel. Aber du kannst unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, damit umzugehen. Darauf achten, dass sie sich nicht selbst überfordern oder gar einen Burn-Out erleiden. Und natürlich auch unterstützen, wenn es zu Konflikten kommt. Traust du dir das zu?«
Daniel nickte. »Ich denke schon.«
»Lass uns noch ein bisschen über deine Erfahrungen reden«, sagte Nesrin. »Warum hast du dich damals entschieden, Psychologie zu studieren?«
Daniel betrachtete die Personalchefin. In ihrem Blick schien aufrichtiges Interesse zu liegen. Er holte tief Luft und begann, zu erzählen.
5.
»Herr Regenfuß, ich bin sicher, Sie haben aufgepasst und können uns den Unterschied zwischen der ersten und zweiten Ableitung erklären.«
Frau Hansens scharfe Stimme ließ Jerry zusammenzucken und holte ihn in die triste Realität des Klassenraums im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium in Berlin-Grunewald zurück. Das Lächeln, das auf seinem Gesicht gelegen hatte, während er an das Wochenende zurückdachte, verschwand.
»Die zweite … Ableitung … das ist …«, stotterte er, während er verzweifelt versuchte, sich an das zu erinnern, was er eigentlich längst hätte wissen müssen.
Immerhin war es bereits das zweite Mal, dass er diesen Mathekurs machte, nachdem er beim ersten Versuch mit Pauken und Trompeten durchs Abitur gefallen war. Doch er konnte sich diesen Quatsch nie merken. Wozu auch? Computer konnten doch alles schon längst viel besser ausrechnen und einem alles sagen, was man wissen wollte. Sie konnten jede beliebige Sprache simultan übersetzen, einem jeden Text vorlesen und natürlich auch gesprochene Worte in Text umwandeln, so dass man heutzutage nicht einmal mehr lesen und schreiben können musste. Doch die Schule hielt immer noch an einem über hundert Jahre alten Modell dessen fest, was ein junger Mensch lernen musste, um in der Welt klarzukommen. Garantiert würde er in seinem ganzen Leben nie wieder die Ableitung von irgendetwas berechnen müssen, erst recht nicht die zweite.
»Frau Holzmann, vielleicht können Sie Ihrem verträumten Mitschüler aushelfen?«
»Die zweite Ableitung gibt die Steigung der ersten Ableitung an, also sozusagen die Steigung der Steigung einer Kurve«, antwortete Tine Holzmann, die in Mathe auf eins stand. Und nicht nur in Mathe.
Tine würde vermutlich eines der besten Abis der Schule machen. Ihr Vater war sicher stolz auf sie. Ganz im Gegensatz zu Jerrys Vater, der aus seiner Enttäuschung über Jerry keinen Hehl machte. Dr. Hark Regenfuß war ein angesehener Anwalt, der eine eigene Kanzlei mit inzwischen über zwanzig Mitarbeitern aufgebaut hatte. Natürlich hatte er die Erwartung, dass sein einziger Sohn in seine Fußstapfen treten würde, auch wenn er niemals so brillant und erfolgreich sein würde wie sein Vater.
Doch das Letzte, was Jerry werden wollte, war ein Anwalt, der Firmen und Millionären dabei half, die Gesetze zu ihren Gunsten auszulegen oder sie gleich ganz zu umgehen. Allerdings hatte er bis jetzt nicht den Mut gefunden, seinem Vater das klarzumachen.
»Sehr gut«, sagte die Hansen. »Herr Regenfuß, nachdem Ihnen Ihre Mitschülerin erklärt hat, was die zweite Ableitung besagt, können Sie mir sicher sagen, wie die zweite Ableitung von E hoch X lautet?«
»Äh …«, machte Jerry.
»Wissen Sie denn vielleicht, wie die erste Ableitung von E hoch X lautet?«
»X?«, riet er.
Ein paar Schüler lachten, während die Hansen mit den Augen rollte.
»Die erste Ableitung von E hoch X ist exakt dieselbe Exponentialfunktion, also E hoch X«, erklärte die Lehrerin. »Vielleicht sind sie ja jetzt in der Lage, die zweite Ableitung zu bilden?«
Jerry spürte, wie die anderen ihn ansahen. Da er als Einziger das Jahr wiederholte, war er ohnehin der Außenseiter in der Klasse. Dass er immer schwarze Kleidung trug und sich sehr zum Missfallen seines Vaters eine Locke seines schwarzen Haares hatte silbern färben lassen, machte es auch nicht besser. »Emo« nannten sie ihn und benutzten den Begriff wie ein Schimpfwort. Dabei identifizierte er sich stolz mit dieser Subkultur, die auch negative Gefühle als etwas ansah, das man nicht verstecken, sondern offen ausleben sollte.
Er wollte, er musste etwas sagen. Doch seine Kehle war wie zugeschnürt, genau wie damals in der mündlichen Prüfung. Er hatte die Antwort auf die entscheidende Frage eigentlich gewusst, doch sie hatte in seinem Hals festgesteckt wie eine Fischgräte, und er hatte das Gefühl gehabt, daran zu ersticken.
»Herr Regenfuß, ich habe wirklich keine Ahnung, wie Sie das Abitur im zweiten Anlauf bestehen wollen, wenn Sie sich nicht die geringste Mühe geben, im Unterricht mitzuarbeiten«, tadelte die Lehrerin und schüttelte den Kopf, bevor sie sich an die anderen wandte. »Wer kann Herrn Regenfuß aushelfen?«
Fast alle Hände schossen in die Höhe.
Den Rest der Stunde ließ die Hansen ihn in Ruhe. Als endlich Pause war, ging Jerry erleichtert nach draußen, verdrückte sich in eine Ecke des Schulhofs und setzte seine AR‑Brille auf, die nur außerhalb des Schulgebäudes getragen werden durfte. Ein leichter Nieselregen hatte eingesetzt, aber das störte ihn nicht. Er zog die Kapuze seines schwarzen Hoodies über den Kopf, damit die Brille nicht nass wurde. Kurz überlegte er, Unlife zu starten, doch wenn er hier auf dem Schulhof die Gesten machte, die nötig waren, um das Spiel zu steuern, würden ihn die anderen bloß wieder auslachen und behaupten, er sähe aus wie eine Marionette, die von einem Puppenspieler mit epileptischen Anfällen gesteuert wurde. Manchmal schlichen sich seine Klassenkameraden von hinten an, während er in der virtuellen Welt war, und packten ihn ruckartig an den Schultern. Er bekam dann jedes Mal fast einen Herzinfarkt vor Schreck.
Also würde er abwarten müssen, bis die Schule vorbei war und er zu Hause wieder seine VR‑Brille nutzen konnte. Sein Vater arbeitete zum Glück immer bis spätabends, und seine Stiefmutter Erina, die nur ein paar Jahre älter war als Jerry, interessierte sich nicht für ihn, so dass er in seinem Zimmer seine Ruhe hatte.
Er konnte es kaum abwarten, in die Spielwelt von Unlife zurückzukehren. Fast das komplette Wochenende hatte er dort verbracht. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, endlich für das Abi zu pauken. Doch die Versuchung war einfach zu groß gewesen, zumal sein Vater und Erina zu irgendeinem Event nach Cannes geflogen waren und er nicht befürchten musste, ausgemeckert zu werden. So hatte er das Spiel nach dem Frühstück gestartet, um nur ganz kurz nach Juna zu sehen.
Dann war es auf einmal kurz vor Mitternacht gewesen, und er hatte so dringend auf die Toilette gemusst, dass er sich die Brille mitten im Kampf mit einer Riesenhyäne vom Kopf gerissen hatte. Außerdem hatte er großen Hunger und Durst gehabt und hatte sich schnell eine Cola und eine Packung Kekse geholt, bevor er Juna wieder zur Hilfe geeilt war. Zum Glück hatte sie sich in der Zwischenzeit hinter einer Mauerspalte vor der Hyäne in Sicherheit bringen können.
Zu zweit waren sie die schwarze Küste entlanggezogen, hatten gegen Ghule und Geisterjäger gekämpft und nach Spuren von Junas verschollenem Bruder gesucht. Obwohl er seiner Begleiterin helfen wollte, hoffte Jerry insgeheim, dass sie ihn nie finden würden, denn er wollte nicht, dass die Spielepisode mit Juna endete. Er genoss ihre Gesellschaft viel zu sehr. Er wusste natürlich, dass sie nur eine Spielfigur ohne echtes Bewusstsein war, doch er hatte das Gefühl, dass sie ihn besser verstand als alle Menschen, die er kannte. Vor allem besser als sein Vater und dessen zwanzig Jahre jüngere Frau, die sich für nichts außer Shopping und Kosmetik zu interessieren schien.
Das Wochenende war viel zu schnell vorbei gewesen. Jerry hatte es fast nicht mitbekommen, als sein Vater und Erina am Sonntagabend nach Hause kamen. Gerade noch rechtzeitig hatte er sich die Brille vom Kopf reißen und das Mathelernprogramm auf seinem Computer starten können, so dass sein Vater zufrieden gewesen war, als er für eine Minute in Jerrys Zimmer erschien, um ihm gute Nacht zu wünschen. An diesem Abend war Jerry todmüde, aber beinahe glücklich schlafen gegangen, nur um am nächsten Morgen in der tristen Realität des Schulalltags aufzuwachen.
Er wollte gerade ein Musikvideo seiner Lieblingsband The Proud Misfits starten, als er eine vertraute Stimme neben sich hörte: »Hallo, Mister Rain.«
Erschrocken drehte er sich um und starrte die blasse Gestalt an, die neben ihm auf dem Schulhof stand. Einen Moment lang war er sicher, zu träumen. Oder vielleicht hatte er Halluzinationen?
Er nahm die Brille ab, und Juna verschwand. Als er sie erneut aufsetzte, stand das untote Mädchen wieder vor ihm.
»Was … was machst du denn hier?«, fragte er verdattert.
»Ich dachte, du freust dich vielleicht, wenn ich dich in deiner Welt besuche«, gab sie zurück.
Er grinste. »Ja, das tue ich. Aber … wie ist das möglich? Ich habe doch Unlife gar nicht gestartet!«
Statt die Frage zu beantworten, sagte sie: »Wenn ich wieder gehen soll …«
»Nein, bitte bleib!«, unterbrach er sie. »Ich wusste bloß nicht, dass du auch in … diese Welt kommen kannst.«
»Nachdem du plötzlich verschwunden warst, habe ich dich überall gesucht«, erzählte sie. »Dann traf ich einen Geist und fragte ihn nach dir. Er erzählte mir, es gäbe ein Portal, das mich in deine Welt führen würde. Er zeigte mir den Weg dorthin, und hier bin ich.«
»Bist du … schon länger in dieser Welt?«
»Seit ein paar Stunden. Ich war bei dir, als du in den Wagen ohne Pferde gestiegen und in dieses Schloss gefahren bist.«
Er musste lachen. »Schloss? Schön wär’s! Das ist eine Schule.«
»Ich habe gehört, wie die Klerikerin mit dir gesprochen hat. Eine derart abfällige Behandlung ist eines Vampirlords nicht würdig!«
Jerry blickte sie nachdenklich an. Die Brille musste über Nacht ein Update bekommen haben. Eigentlich hatte er die persönliche Assistenz-Funktion deaktiviert, weil sie ihm mit ihrem dauernden Gequatsche auf die Nerven gegangen war. Aber offenbar konnte man nun die Persönlichkeit seines Assistenten verändern und die Brille hatte automatisch den Charakter ausgewählt, mit dem Jerry zuletzt am meisten Zeit verbracht hatte. Das war das Tolle am Metaverse: Alle virtuellen Welten waren miteinander verbunden. Und die KI der Brille schaffte es sogar, Junas bezaubernde Persönlichkeit perfekt zu kopieren, so dass er beinahe das Gefühl hatte, sie stünde wirklich neben ihm.
Ein tiefes Glücksgefühl erfüllte ihn in. Er würde nicht mehr den ganzen Tag allein sein! Juna war ab jetzt immer bei ihm, selbst wenn er die Brille nicht aufhatte und sie nicht sehen konnte.
6.
»Das hier nennen wir ein ›Simrig‹«, erklärte Nesrin. »Du wirst sehen, damit wird das Metaverse zu einer ganz neuen Erfahrung.«
Daniel betrachtete das kugelförmige, etwa zwei Meter durchmessende Metallgestell vor sich. Insgesamt acht dieser seltsamen Geräte verliehen dem Raum die Atmosphäre eines Fitnesszentrums. In drei davon standen junge Menschen, liefen auf der Stelle oder fuchtelten mit den Armen herum, die Köpfe in kugelförmigen Helmen ohne Visier. Die Metallstangen quietschten leicht unter ihren Bewegungen.
»Stell deine Füße da auf die Trittplatten«, wies seine neue Chefin ihn an. »Achte darauf, dass die Schlaufen richtig sitzen. Dann schnall dich an der Rückenstütze fest, ja, genau so. Jetzt steck die Hände in die Handschuhe. Um das Rig zu starten, sagst du einfach ›Simrig, Start‹, zum Beenden ›Simrig, Exit‹. Alles Weitere erklärt dir die KI. Alles klar?«
Daniel nickte.
Dass er heute bereits Teil des Teams von Mental Systems war, nachdem er erst gestern zum ersten Mal hier gewesen war, kam ihm wie ein bizarrer Traum vor. Eine derart radikale Wendung in seinem Leben nach all den Monaten, in denen er nicht gewusst hatte, was er mit seiner Zeit anfangen sollte, hätte er niemals für möglich gehalten.
Als Nesrin ihm den Arbeitsvertrag in die Hand gedrückt hatte, hätte er ihn am liebsten sofort unterschrieben. Doch das hätte wohl zu verzweifelt gewirkt. Also hatte er ihn mit nach Hause genommen. Natürlich hatte seine kritische innere Stimme Zweifel angemeldet: Fragst du dich gar nicht, wieso dir Nesrin ein höheres Gehalt angeboten hat als das, was du gefordert hast? Da muss doch ein Haken sein!
Doch er hatte die Stimme ignoriert, die ihm ohnehin schon seit Längerem auf die Nerven ging. Er bildete sich ein, eine gute Menschenkenntnis zu haben. Nesrin hatte ehrlich auf ihn gewirkt, und die Vorstellung, für sie zu arbeiten, hatte ihm gefallen. Dass das Gehalt, das sie ihm angeboten hatte, oberhalb seiner eigenen Forderung lag, hatte sie mit Fairness erklärt: »Bei uns kriegt nicht derjenige am meisten, der am lautesten schreit.«
Also hatte er Nesrin noch am selben Nachmittag angerufen und ihr mitgeteilt, dass er das Angebot annehmen und ihr den unterschriebenen Vertrag zuschicken werde. Sie hatte daraufhin gesagt, dass er »am liebsten gestern« anfangen solle, und da er keinen Grund gehabt hatte, den Start länger hinauszuzögern, war er direkt heute hergekommen. So schnell konnte es gehen!
Genauso schnell kann es auch wieder in die andere Richtung gehen, bemerkte seine innere Stimme. Während der Probezeit hast du eine Kündigungsfrist von zwei Wochen. Vergiss das nicht!
Doch die Stimme war bereits leiser und weniger aggressiv als zuvor.
Nesrins Worte holten ihn in die Realität zurück: »Also, dann viel Spaß!«
»Simrig, Start!«, sagte Daniel.
Der kugelförmige Helm, der an einem beweglichen Arm über seinem Kopf schwebte, senkte sich sanft herab, und es wurde dunkel um ihn. Dann erschien vor ihm in der Finsternis das dreidimensionale, schlichte Logo von Mental Systems und eine glockenartige Melodie erklang. Allmählich wurde es wieder hell.
Verwirrt stellte er fest, dass sich seine Umgebung nicht verändert hatte: Er stand immer noch in seinem Simrig in dem länglichen Raum.
»Muss ich irgendwas machen, um die Simulation zu starten?«, fragte er.
»Du bist bereits in der Simulation«, antwortete eine Frauenstimme.
Er drehte sich überrascht um und sah Lisa neben sich stehen, die virtuelle Interviewpartnerin, die das Bewerbungsgespräch in seiner Wohnung mit ihm geführt hatte. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er zwar noch in dem runden Käfig stand, seine Hände jedoch nicht mehr in den Handschuhen des Rigs steckten. Auch der Helm schien verschwunden zu sein.
Er blickte an sich hinab und betrachtete das schlichte Sweatshirt und die Sneakers, die er am Morgen angezogen hatte. Verblüfft hielt er eine Hand vors Gesicht. Wenn man ganz genau hinsah, erkannte man, dass sie leicht unnatürlich aussah, so als sei sie aus Wachs.
»Wow!«, entfuhr es ihm.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: