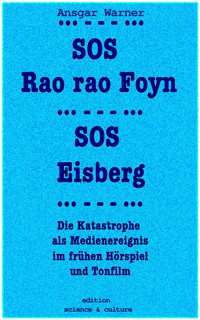1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die E-Books sind unter uns - und diesmal sind sie gekommen, um zu bleiben. Dank E-Reader, Smartphone und Tablet ist der Traum von der universalen Bibliothek zum Greifen nah: jedes Buch zu jeder Zeit an jedem Ort. Verlage und Buchhandel befürchten dagegen den Untergang der Gutenberg-Galaxis. Doch der Abschied vom gedruckten Buch hat längst begonnen. Bereits am 4. Juli 1971 tippte Michael S. Hart die amerikanische Unabhängigkeitserklärgung in das Terminal eines Mainframe-Rechners - zugleich die Geburtsstunde von E-Texten wie auch des Project Gutenberg. Bis in die Neunziger Jahre dauerte die Zeit der Experimente, vom Videotext über CD-Roms bis zur Hyperfiction. Mit World Wide Web und mobilen Lesegeräten gelang der kommerzielle Durchbruch. “Vom Buch zum Byte” erzählt die spannende Geschichte der elektronischen Bücher - von den Anfängen bis in die Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Vom Buch zum Byte
Kurze Geschichte des E-Books
von
Ansgar Warner
Copyright © 2024
krautpublishing
Dr. Ansgar Warner
Rungestr. 20 (V)
10179 Berlin
Veröffentlicht über Tolino Media
Covergestaltung: Susanne Weiß
This ebook was produced with http://pressbooks.com.
Zum Autor
Ansgar Warner (Jahrgang 1971) ist Chefredakteur und Herausgeber von E-Book-News, dem Online-Magazin rund um das Thema Elektronisches Lesen. Als Journalist wie als Literatur- und Kulturwissenschaftler war er immer schon an der Nahtstelle zwischen alten & neuen Medien unterwegs. 2006 Promotion an der HU Berlin zum Thema Radio-Essay der Fünfziger Jahre, danach folgte die journalistische Tätigkeit für Zeitungen (u.a. taz) wie auch Rundfunk (DLF/DRadio). Mittlerweile arbeitet er als freier Autor & Producer im Medienbüro Mitte (Berlin). Zuletzt erschienen: “Wer wob das Web? Kleine Personengeschichte von Internet und World Wide Web” (siehe Hinweis am Ende dieses Bandes).
Vorwort
Die E-Books sind unter uns. Dank E-Reader, Smartphone und Tablet ist der Traum von der universalen Bibliothek zum Greifen nah: Jedes Buch zu jeder Zeit an jedem Ort. Verlage und Buchhandel befürchten dagegen plötzlich den Untergang der Gutenberg-Galaxis.
Doch der Abschied vom gedruckten Buch hat längst begonnen. Bereits am 4. Juli 1971 tippte Michael S. Hart die amerikanische Unabhängigkeitserklärung in das Terminal eines Mainframe-Rechners – zugleich die Geburtsstunde von E-Texten wie auch des Project Gutenberg.
Bis in die Neunziger Jahre dauerte die Zeit der Experimente, vom Videotext über CD-Roms bis zur Hyperfiction. Mit World Wide Web und mobilen Lesegeräten gelang der kommerzielle Durchbruch. Spätestens seit dem Erfolg von Amazons Kindle ist klar: E-Books sind kein Hype mehr, sie sind gekommen, um zu bleiben.
In den folgenden Kapiteln erzähle ich die spannende Geschichte der elektronischen Bücher – von den Anfängen bis in die Gegenwart. Übrigens: Wer wissen möchte, wie die Geschichte weitergeht, schaut am besten regelmäßig auf E-Book-News.de vorbei. Dort blogge ich seit Anfang 2009 rund um das Thema elektronisches Lesen.
Berlin, 4. Juli 2012
Ansgar Warner
Der Traum von der universalen Bibliothek
Jedes Buch an jedem Ort zu jeder Zeit – was uns in Zeiten von E-Book und E-Reader fast schon selbstverständlich erscheint, galt vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert noch als reine Utopie. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es jedoch zu einer entscheidenden Wende. Den Traum von der universalen Bibliothek träumten plötzlich nicht mehr nur Schriftsteller und Bibliothekare, sondern auch Ingenieure. Und der Traum wurde öffentlich geträumt.
Das amerikanische Life-Magazine präsentierte seinen Lesern im November 1945 die Abbildung eines futuristischen High-Tech-Schreibtisches: „Auf der Schreibtischoberfläche befinden sich zwei angeschrägte, transparente Bildschirme, auf denen Material zur bequemen Lektüre angezeigt werden kann, sowie ein Reihe von Knöpfen und Hebeln“, erklärte die Bildunterschrift. Die Abbildung illustrierte einen Essay des Ingenieurs Vannevar Bush mit dem Titel „As we may think“ („Wir wir denken werden“). Die hybride Mischung aus klobigem Mikrofilm-Lesegerät und archaischem Personal Computer gilt mittlerweile als Ikone des anbrechenden Informationszeitalters. Die Öffentlichkeit erlebte die Epiphanie eines neuen Mediums, das allerdings erst mehr als dreißig Jahre später seine Inkarnation als gebrauchsfähige Hardware erleben sollte.
Bush taufte seine Maschine „Memex“, eine Abkürzung für „Memory Extender“. Das besondere an Memex war nämlich eine dem menschlichen Gehirn nachempfundene Erinnerungsfunktion. Die Maschine konnte „associative trails“ anlegen, also assoziative Verknüpfungen zwischen einzelnen Elementen anlegen. „Wenn verschiedene Elemente auf diese Weise miteinander zu einem Pfad verknüpft wurden, kann man sie sich in dieser Reihenfolge wieder anzeigen lassen, in dem man einen bestimmten Hebel umlegt“, beschreibt Bush das Verfahren.
Die Historiografen von Silicon Valley kürten „As we may think“ nicht zufällig auch gleich zur „Magna Charta“ von Hypertext und World Wide Web. Zugleich kann man Memex als Vorläufer von E-Readern sehen. Denn auch mit ihnen wird Wissen in Form von E-Books organisiert und zugänglich gemacht. Dabei war Bushs Memex natürlich weitaus mehr als ein reines Lesegerät. „Die Herstellung einer Verbindung zwischen zwei Elementen ist der entscheidende Vorgang“, postulierte Bush nicht ohne Grund. Die „assoziativen Pfade“ sollten dafür sorgen, dass in der perfekten Bibliothek der Zukunft nichts mehr verloren ging.
Doch der Traum von der universalen Bibliothek musste noch für eine Weile in den Schubladen der Ingenieure schlummern. Erst um 1967 gab es mit dem Hypertext Editing System (HES) einen ersten Prototypen, der einige der von Vannevar Bush skizzierten Ideen in die Wirklichkeit umsetzte. Zu den Erfindern gehörte eine Gruppe von Forschern an der privaten Brown-University (Rhode Island), darunter Andries von Dam sowie nicht zufällig auch der legendäre Hypertext-Theoretiker Ted Nelson (siehe Kapitel: Hyperfiction). Mit dem HES ließen sich am Computer-Bildschirm mit Hilfe von Tastatur und Light-Pen komplexe Textstrukturen aufbauen und nutzen, die Verweise in Form von Hyperlinks enthielten, denen man folgen konnte. In diesem Zusammenhang sprach Andries von Dam bereits von „electronic books“, also elektronischen Büchern.
Den Hypertext-Forschern der ersten Stunde war klar, welches Potential in dieser Technologie steckte. Im Jahr 1969, unmittelbar vor der ersten Mondlandung, berichteten sie an ihre Auftraggeber:
„Auf lange Sicht lässt sich voraussehen, dass solche Systeme wie das unsrige und seine Nachfolger wachsenden Nutzen für alle Formen der Textverarbeitung besitzen werden. Darüber, ob solche Systeme das gedruckte Wort ersetzen werden, möchten wir an dieser Stelle nicht spekulieren. Doch die praktische Durchführbarkeit und Brauchbarkeit wurde klar bewiesen.“
Allerdings ließ sich HES auf den damaligen Mainframe-Rechnern nicht wirklich komfortabel benutzen, und die weitere Verwendung wurde von den wichtigsten Investoren bestimmt – genauer gesagt IBM sowie der NASA. E-Books standen dabei erst einmal nicht auf der Tagesordnung. Während „Big Blue“ vor allem an der Grundlagenforschung für Textverarbeitung interessiert war, nutzte die Weltraumbehörde die später in „File Retrieving and Editing System“ (FRESS) umbenannte Technologie, um die Datenflut des Apollo-Programms in den Griff zu bekommen.
Die Öffentlichkeit bekam von alldem nur wenig zu sehen, wenn überhaupt, dann im Fernsehen. Denn der erste Bildschirm, der in praktisch jedem Haushalt vorhanden war, zeigte nicht statische Buchstaben an, sondern bewegte Bilder. Umso mehr brachte dieses elektronische Massenmedium die Gemüter der Kulturkritiker in Wallungen. Für den kanadischen Medientheoretiker Marshall McLuhan ergab das weltweite Geflimmere der Fernsehbildschirme genau das Gegenteil von der Utopie einer universalen Bibliothek:
„Anstatt sich in Richtung einer riesigen Bibliothek von Alexandria zu entwickeln, hat sich unsere Welt in einen Computer verwandelt, ein elektronisches Gehirn, fast wie ein infantiles Stück Science-Fiction“, schreibt McLuhan in seinem Klassiker „Die Gutenberg-Galaxis – Das Ende des Buchzeitalters“ (1962).
High-Tech sorgte gerade nicht für mehr Vernunft, sondern versprach den Massen Spiel, Spaß und Spannung. Die Kombination aus Emotionalisierung und Gleichschaltung hatte für den Medientheoretiker dabei etwas äußerst bedrohliches, denn sie schien den Mächtigen die Kontrolle großer Menschenmengen zu ermöglichen:
“Während unsere Sinne hinaus driften, kommt im Gegenzug Big Brother herein. Machen wir uns diese Dynamik nicht bewusst, geht die Reise in Richtung von Massenpaniken, wie es sich für eine Welt gehört, die regiert wird von Stammestrommeln, totaler gegenseitiger Abhängigkeit und erzwungener Koexistenz“.
Andere zeitgenössische Theoretiker konnten der „mobilisierenden Kraft“ der Massenmedien durchaus etwas Positives abgewinnen. So etwa Hans-Magnus Enzensberger. Besonders gefiel ihm die Netzwerk-Struktur der elektronischen Medien. Anders als bei Büchern oder Zeitungen hatte man es hier nicht mit reinen „Distributionsapparaten“ zu tun, sondern mit „Kommunikationsapparaten“. Zumindest besaßen sie das Potential kommunikativer Gleichberechtigung: „In ihrer heutigen Verfassung schleppen Funk, Film und Fernsehen bis zum Überdruß die autoritären und monologischen Züge mit, die sie von älteren Produktionsweisen ererbt haben“, beklagte sich Enzensberger in seinem legendären „Baukasten zu einer Theorie der Medien” (1970). „Hörerbriefe“ an den Intendanten mochten vielleicht möglich sein, dazwischenfunken dagegen galt als Straftat. Die Struktur der elektronischen Medien verlangte aber eigentlich nach etwas ganz anderem, nämlich nach direkter „Interaktion“.
Enzensberger interessierte sich vor allem für jene Massenmedien, die bereits in den Händen der Massen waren, etwa Fotokopierer, Kassettenrekorder oder Videokamera – mit diesen individuell verfügbaren Geräten konnte bereits in den 1970er Jahren eine neue, vernetzte Form von „Gegenöffentlichkeit“ produziert werden. Ein Jahrzehnt später sollte auch der Personal Computer dazukommen. Was gedruckte Bücher betraf, waren die Möglichkeiten des Self-Publishings allerdings noch ziemlich begrenzt, alleine schon aus Kostengründen.
Obwohl die Gutenberg-Presse den elektronischen Medien grundsätzlich unterlegen war, billigte Enzensberger dem Buch deswegen einen vorübergehenden Sonderstatus zu: „Zwar ist es weniger handlich und raumsparend als andere Speichersysteme, doch bietet es bisher einfachere Möglichkeiten des Zugriffs als beispielsweise der Mikrofilm oder der Magnetspeicher. Es dürfte als Grenzfall in das System der neuen Medien integriert werden und dabei die Reste seiner kultischen und rituellen Aura verlieren.“ Tatsächlich sollte einer der nachhaltigsten Schritte zur Entzauberung der gedruckten Lettern nur ein Jahr später beginnen.
1970er Jahre: „Born on the 4th of July“
Eine schönere Gründungslegende für das elektronische Buch kann man sich kaum vorstellen: pünktlich zum 4. Juli 1971 tippte Michael S. Hart den Text der „DECLARATION OF INDEPENDENCE“ in das Terminal einer Xerox Sigma V-Großrechenanlage der Universität von Illinois. Die Schreibweise ist in diesem Fall tatsächlich historisch – denn der begrenzte Zeichensatz enthielt nur Großbuchstaben. Begrenzt war auch der Zugang zu einem der wenigen Computer im „Material Research Lab“ der Universität. Doch freundliche Administratoren hatten dem Mathematik-Studenten zur Feier des Unabhängigkeitstages ein Account mit unbegrenzter Rechenzeit eingerichtet – was nach damaligen Standards einem Wert von mindestens 100 Millionen Dollar entsprach. Was konnte man mit solch einem Schatz anfangen?
„Michael kam zu dem Entschluss, dass er mit ‘normaler Rechnerarbeit’ nichts produzieren könnte, was der ihm geschenkten Menge an wertvoller Rechenzeit gleichkäme. Deswegen musste er einen Gegenwert in anderer Form schaffen. So verkündete er, der größte Wert einer Rechenmaschine wäre nicht das Rechnen, sondern das Speichern, Abrufen und Suchen der Informationen, die in unseren Bibliotheken gespeichert sind.“ (Michael Hart, The History and Philosophy of Project Gutenberg)
Bei der Verbreitung des ersten E-Books der Welt konnte sich Hart auf eine weitere technische Errungenschaft stützen. Das „Materials Research Lab“ der Universität von Illinois war nämlich einer von damals 15 Netzwerknoten im ARPANet, dem Vorgänger des Internets. Theoretisch hätte Hart das erste E-Book der Welt deswegen sogar schon per E-Mail verschicken können. Doch mit fünf Kilobytes war die Datenmenge so groß, dass eine Überlastung des Netzwerks drohte. Deswegen informierte Hart seine Kollegen auf dem Wege der elektronischen Post lediglich, wo die Textdatei abgelegt war. Daraufhin wurde das erste E-Book von sechs Personen heruntergeladen – für damalige Verhältnisse fast schon ein virales Ereignis. Damit war nicht nur technisch, sondern auch konzeptuell der Grundstein für das Project Gutenberg gelegt: Wenn alles, was in den Computer eingegeben wurde, sich in unendlicher Zahl vervielfältigen ließ, dann konnte man mit Hilfe dieser „Replikator-Technologie“ so viele Bücher wie möglich für so viele Menschen wie möglich verfügbar machen, und zwar kostenlos. Das enthusiastische Mission Statement lautete:
“Die Entstehung und Verbreitung von E-Books fördern.“ “Die Überwindung von Unwissen und Analphabetismus unterstützen.“ “Den Menschen so viele E-Books wie möglich geben.“
Die unbegrenzte Verbreitung funktionierte freilich nur bei Texten, die nicht mehr urheberrechtlich geschützt waren. Michael Hart war zwar kein Freund des Copyrights, aber auch kein Datenpirat. Somit bestand und besteht die virtuelle Bibliothek des Project Gutenberg vor allem aus Werken, die vor 1900 geschrieben wurden. Bei technischen Beschränkungen zeigte sich der Erfinder des E-Books allerdings kompromisslos. Um die elektronischen Texte buchstäblich auf 99 Prozent aller bestehenden und zukünftigen Hardware lesbar zu machen, setzte Hart auf den strengen Standard des ASCII-Codes ( American Standard Code for Information Interchange), scherzhaft auch „Plain Vanilla ASCII“ genannt. Kursivierungen, Fettdruck oder Unterstreichungen wurden in Großbuchstaben verwandelt.
Harts ambitioniertes Ziel bestand darin, bis zum Jahr 2000 mindestens 10.000 Bücher zu digitalisieren. Das schien Anfang der Siebziger Jahre reine Utopie , denn die Texte mussten mühsam abgetippt und auf Fehler überprüft werden. Bis 1987 kopierte der Gründer von Project Gutenberg in seinem modernen Skriptorium – zusammen mit fleißigen Helfern – auf diese Weise immerhin mehr als 300 Werke aus dem Bereich der Public Domain. Danach kamen dann auch Scanner und Texterkennungs-Software zum Einsatz. Doch letztlich sorgte erst das World Wide Web für genügend Manpower und technische Ressourcen, um das hochgesteckte Ziel (beinahe) zu erreichen. Die Zahl von 10.000 digitalisierten Klassikern wurde nämlich 2003 tatsächlich erreicht.
Zu diesem Zeitpunkt lag Micheal Harts Pioniertat technisch gesehen schon ein ganzes Zeitalter zurück. Ein Problem bereitete neben der manuellen Arbeit in der Startphase bereits der knappe Speicherplatz: „Als wir anfingen, mussten die Dateien sehr klein sein, denn bereits ein normales Buch mit 300 Seiten nahm ein Megabyte ein. Eine solche Menge an Speicherplatz besaß im Jahr 1971 niemand. So schien die Unabhängigkeitserklärung mit nur fünf Kilobyte ein guter Startpunkt zu sein. Als nächstes folgte die Bill of Rights, danach die gesamte US-Verfassung, als der Speicherplatz wuchs (zumindest in den Maßstäben von 1973). Dann war die Bibel an der Reihe, da ihre einzelnen Bücher nicht so umfangreich sind, dann Shakespeare, ein Stück nach dem anderen, dann viele weitere Werke aus der einfachen und anspruchsvolleren Literatur, sowie Nachschlagewerke.“
Die Bibel war für ein Projekt mit Gutenberg im Namen natürlich Pflichtprogramm – auch wenn Michael Hart sich der Unterschiede zwischen dem Druck mit beweglichen Lettern und den von ihm ins Leben gerufenen E-Texten bewusst war. Konnte man zu Gutenbergs Zeiten erstmals überhaupt Bücher zu einem vergleichsweise erschwinglichen Preis erwerben, so ermöglichten E-Books nun quasi zum Nulltarif den Besitz einer kompletten Bibliothek, die sich zudem auch noch bequem herumtragen ließ. Was mit der Verbreitung der „Declaration of Independence“ begonnen hatte, war damit natürlich zugleich eine bewusste Unabhängigkeitserklärung vom Print-Buch. Im Jahr 1998 formulierte Hart rückblickend:
„Wir halten den elektronischen Text für ein neues Medium, unabhängig vom Papier. Einzige Gemeinsamkeit ist, dass wir die selben Werke verbreiten. Aber ich glaube nicht, dass das Papier noch mit dem elektronischen Text konkurrieren kann, sobald die Menschen sich daran gewöhnt haben.“
1980er Jahre: Vom Text-Adventure zur CD-Rom
Für die Gewöhnung an elektronische Texte sorgte vor allem die Mikrocomputer-Revolution. Seit den späten Siebziger Jahren brachte sie PCs in die Büros und Heimcomputer ins Wohnzimmer. Doch schon kurz bevor die Fernsehgeräte zum Bildschirm für den Commodore VC 20 oder den Atari 800 umfunktioniert wurden, flimmerten die ersten Buchstaben in Form von Videotext über die Mattscheibe. Während die pixeligen Informationstafeln heute eher nostalgische Gefühle wecken, galten sie damals als ultramodern. Videotext nutzt die sogenannte Austastlücke des Röhrenfernsehers, eine winzige Pause zwischen den einzelnen Bildern. Techniker der BBC kamen schon um 1970 auf die Idee, diese Lücke mit Informationen zu füllen, die auf dem Bildschirm dargestellt werden sollten. Für jede Seite standen dabei 25 mal 40 Zeilen zur Verfügung, die mit Buchstaben, Zahlen oder Grafikelementen gefüllt werden konnten. Damit war der „Teletext” geboren. In Deutschland wurde diese Idee erstmals auf der IFA 1977 vorgestellt, drei Jahre später begann dann bei ARD und ZDF der ständige Testbetrieb. Beim Sender Freies Berlin nahm eine gemeinsame Redaktion am 1. Juni 1980 die Arbeit auf und produzierte täglich 75 Seiten. Aus namensrechtlichen Gründen musste in Deutschland allerdings die Bezeichnung Videotext gewählt werden.
Der Fernseher als elektronisches Lesemedium stieß nicht nur auf das geballte Interesse der Zuschauer. Beim Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger klingelten die Alarmglocken. Die elektronische Lektüre von Nachrichten am Bildschirm – war das nicht eine direkte Konkurrenz für die gedruckte Version? Ähnlich wie heute bei den Internet-Portalen von ARD oder ZDF oder etwa der Tagesschau-App sahen die großen Medienhäuser ihre Marktmacht gefährdet und setzten auf politischen Druck. Stoppen konnten sie die vermeintliche Konkurrenz in der Austastlücke allerdings nicht. Doch als Kompromiss durften die gewerblichen Nachrichtenhändler vorerst auf 15 Videotext-Seiten in einer Art Presseschau für ihre Print-Produkte werben. Erst als 1990 aus dem Test- ein Regelbetrieb wurde, endete diese Form der Kooperation zwischen Öffentlich und Privat. Mittlerweile wurden von ARD und ZDF mehr als 400 Seiten Videotext angeboten, heute sind es schon mehr als 800.
Unterhaltung mit einem Volkscomputer
Mit dem Commodore VIC 20 (in Deutschland als VC 20 bzw. Volkscomputer vermarktet) kam ab 1981 der erste echte Heimcomputer massenhaft in deutsche Haushalte. Er besaß nicht nur einen Joystick-Anschluss, sondern auch eine vollwertige QWERTY-Tastatur. Somit eignete er sich nicht nur für Videospiele, sondern auch für ernsthaftere Anwendungen, etwa BASIC-Programmierung oder Textverarbeitung. In den USA schaltete Commodore in der Weihnachtssaison 1980 Werbespots mit William Shatner alias Captain Kirk, der gerade Eltern den Mehrwert der Maschine nahebringen sollte: „Why buy just a videogame? Buy a real computer!“.
Außerdem gelang Commodore-Chef Jack Tramiel ein ganz besonderer Coup. Er engagierte den Adventure-Programmierer Scott Adams – damals bereits populär durch textbasierte Games wie „Voodoo Castle“ oder „Pirate Adventure“ für den Apple II – um unter dessen Namen eine Reihe von Adaptionen für den VC 20 zu produzieren. In diesen Adventures bewegte sich der Leser ähnlich wie bei einem Rollenspiel durch eine komplexe Geschichte, traf Entscheidungen, sammelte Informationen und benutzte bestimmte Gegenstände. Kern der „Unterhaltung“ mit dem Volkscomputer war der sogenannte „Parser“. Dessen Programmroutinen ermöglichten es mittels einfacher Wortkombinationen wie „Go north“, „Look around“ oder „Take sword“ direkt mit der Maschine zu interagieren. Ausgeliefert wurde die interaktive Lektüre auf Kompaktkassetten oder Cartridges.
Steve Jobs geht den nächsten Schritt
Zu den ersten PC-Anwendern, die in den Genuss von komfortablen elektronischen Büchern im engeren Sinne kamen, gehörte die kleine, aber feine NeXT-Gemeinde. Diese speziell für den Wissenschaftsbereich entwickelten High-End-Computer waren ein Vorzeigeprojekt von Steve Jobs, nachdem dieser Apple Mitte der 1980er Jahre im Streit verlassen hatte. Auf einem dieser technisch weit vorausweisenden Geräte entwickelte Tim Berners-Lee 1990 das World Wide Web. Immer auf der Suche nach einem weiteren Vermarktungsargument für die mit mehr als 6000 Dollar unglaublich teuren Rechner, hörte Steve Jobs 1986 davon, dass Oxford University Press gerade eine neue Shakespeare-Gesamtausgabe layoutete. Somit musste diese Edition also in elektronischer Form vorliegen und ließ sich in eine NeXT-Workstation integrieren. Der IT-Visionär schaffte es tatsächlich, den renommierten Verlag zu einer elektronischen Ausgabe zu überreden. „Das wird leicht verdientes Geld sein, und ihr werdet der gesamten Branche eine Nasenlänge voraus sein“, soll Jobs seinem Biografen Walter Isaacson zufolge argumentiert haben.
Das Angebot beinhaltete eine Pauschale von 2000 Dollar sowie 74 Cent Provision pro verkauftem NeXT-Computer. Bei Shakespeare alleine sollte es dann nicht bleiben. Die Workstations wurden mit Oxford Dictionary, Thesaurus sowie Dictionary of Quotations ausgeliefert. Wieder einmal hatte Steve Jobs Pionierarbeit geleistet, diesmal auf dem Gebiet voll durchsuchbarer elektronischer Bücher. Bei der NeXT-Premiere in der Konzerthalle der Philharmoniker von San Francisco ließ sich Jobs dieses Detail dann auch nicht entgehen. „Seit Gutenberg hat es keinen Fortschritt in der Technologie des Buchdrucks gegeben“, behauptete Jobs, und stellte fest: „Wir haben nun die ersten echten digitalen Bücher erschaffen.“
„The Book is Dead. Long live the CD-ROM“
Auf die Gutenberg-Galaxis hatten es zur selben Zeit allerdings auch andere abgesehen. Bill Gates etwa meinte Mitte der 1980er Jahre ebenfalls zu wissen, wie die Killer-Applikation aussehen würde: sie war rund, hatte einen Durchmesser von 12 cm, und in der Mitte ein Loch in der Größe einer niederländischen 10 Cent-Münze. Man nannte die silbern glänzende Scheibe Compact Disc Read-Only Memory, kurz: CD-ROM.
Der Microsoft-Gründer trieb nicht nur die Entwicklung der CD-Rom voran, sondern vor allem auch den Einbau von CD-Rom-Laufwerken in PCs – nicht nur, um CD-Roms zum Installationsmedium für das Betriebssystem Windows zu machen. Denn genau wie die Compact-Disc im Musiksektor das Ende der Vinylschallplatte eingeläutet hatte, versprach die (Daten-)CD-Rom nichts weniger als eine Revolution auf dem Buchmarkt. Anlass für diese Hoffnungen gab die unglaubliche Speicherfülle dieses auf Lasertechnik basierenden optischen Mediums. Mit bis zu 800 Megabyte ließ sich auf den Silberscheiben so viele Daten speichern wie auf fast 2000 Disketten. Das machte CD-Roms nicht nur für Software-Anbieter interessant, sondern auch für Verlage. Gerade für Nachschlagewerke, Gesetzestexte oder Zeitschriften-Archive schien sich ein völlig neuer Absatzmarkt zu entwickeln.
Zu den ersten veröffentlichten Titeln überhaupt gehörte Grolier’s Academic American Encyclopedia on CD-ROM im Jahr 1985. Sie enthielt 30.000 Artikel und insgesamt 9 Millionen Worte der gedruckten Ausgabe, allerdings keine Bilder. Im Gegensatz zu gedruckten Werken waren die CD-Rom-Versionen nicht nur günstiger, sie wurden auch einmal pro Jahr komplett aktualisiert.
Neben Text und Bildern ließen sich natürlich auch Töne und Videos einbinden. Ein Grund dafür, dass neben Universitätsbibliotheken und Anwaltskanzleien auch die Geeks das neue Medium entdeckten. Bereits 1988 stellte Kevin Kelly den Lesern des legendären „Whole Earth Catalogs“ diese neue Technologie in einer Sonderausgabe vor:
„Hier kommt eine exklusive Vorwarnung betreffs einer universellen neuen Speichertechnologie für Bilder, Texte, Video, Software. Sie stützt sich auf die selben Compact Discs (CDs), die in den letzten Jahren bereits die Musikindustrie auf den Kopf gestellt hat. Eine komplette Bibliothek wird auf die Größe eines Schuhkartons komprimiert, und alle enthaltenen Informationen lassen sich sofort aufrufen. Ob die Welt dieses neue Medium wirklich wünscht, ist noch nicht ganz klar, doch es lässt sich ohnehin nicht mehr aufhalten, und wird auf jeden Fall das Verlagswesen und die Bibliotheken von Grund auf verändern“.
Nicht zufällig fand sich in dieser Sonderausgabe zum Thema „Communication Tools for the Information Age“ auch ein Hinweis auf die erste CD-Rom-Version des Whole Earth Catalogues selbst.
Zu diesem Zeitpunkt war auch Microsoft schon mit der „Bookshelf“-Suite auf den Plan getreten. Die CD-ROM-Kollektion aus dem Jahr 1987 enthielt ein Dutzend Nachschlagewerke, so etwa „Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases“, das „American Heritage Dictionary of the English Language“, den „World Almanac and Book of Facts“, „Bartlett’s Familiar Quotations“ etc.
Auf Grundlage des Bookshelf-Interfaces brachte Microsoft 1993 mit „Encarta“ dann eine eigene multimediale Enzyklopädie auf CD-Rom heraus, die auf Hyperlinks setzte und sich intuitiv benutzen ließ.