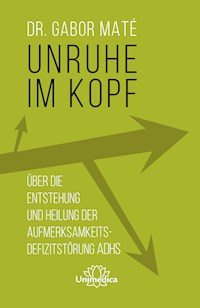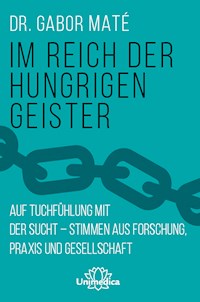14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der SPIEGEL-Bestseller jetzt im Taschenbuch: Gabor Matés bahnbrechende Untersuchung der Ursachen von Krankheit und wie daraus eine neue Sicht auf Gesundheit entstehen kann
»Gabor Maté nimmt uns mit auf eine epische Entdeckungsreise darüber, wie eng unser emotionales Wohlbefinden und unsere soziale Verbundenheit (kurz: die Art, wie wir leben) mit Gesundheit, Krankheit und Sucht verflochten sind … fesselnd und großartig geschrieben.« Bessel van der Kolk (Autor des Bestsellers Das Trauma in dir)
Wir neigen dazu, »Normalität« mit »Gesundheit« gleichzusetzen. Doch was ist eigentlich die Norm in westlichen Gesellschaften? In seinem aktuellen Bestseller zeigt der renommierte Arzt Gabor Maté eindrucksvoll, dass unser Verständnis dessen, was als gesundheitlich »normal« gilt, falsch ist, denn es vernachlässigt die Rolle von Trauma, Stress und Alltagsdruck auf Geist und Körper. Wir brauchen vielmehr eine neue Perspektive darauf, was Menschen krank macht und wie wir gängige körperliche, mentale und emotionale Beschwerden der Moderne lindern können.
In seinem lebensbejahenden Buch voller Fallgeschichten zeigt Gabor Maté, wie wahre Gesundheit möglich wird. Umfassend untersucht er die Ursachen von Krankheiten und verdeutlicht, wie unsere Gesellschaft diese hervorbringt und begünstigt. Und nicht zuletzt skizziert er, wie ein natürlicher Weg zu Gesundheit und Heilung aussehen kann.
»Dieses Buch ist eine Meisterleistung – ein Manifest darüber, wie sich Traumata nicht nur auf unseren individuellen Körper und unsere Psyche, sondern auf unsere gesamte Gesellschaft auswirken.« Lissa Rankin (Autorin von Mind over Medicine - Warum Gedanken stärker sind als Medizin)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 926
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wir neigen dazu zu glauben, dass Normalität mit Gesundheit gleichzusetzen ist. Doch was ist eigentlich die Norm in westlichen Gesellschaften?
Dieser Frage geht der renommierte Experte, Arzt und Bestsellerautor Gabor Maté in seinem neuen Buch nach. Er hat eine umfassende Untersuchung der Ursachen von Krankheiten zusammengestellt, die vor allem zeigt, wie unsere Gesellschaft diese hervorbringt und begünstigt, und wie ein natürlicher Weg zu Heilung aussehen kann.
In seinem lebensbejahenden Buch voller Fallgeschichten zeigt Maté wie wahre Gesundheit möglich wird, wenn wir die Rolle von Trauma, Stress und Alltagsdruck auf unseren Körper und Geist nicht weiter vernachlässigen.
Dr. Gabor Maté ist ein international renommierter Arzt aus Kanada, Autor und Experte für die Themen Sucht, Stress und kindliche Entwicklung. Seine Bücher sind Bestseller und in über 25 Sprachen übersetzt. Dr. Gabor Maté ist weltweit vernetzt und als gefragter Redner bei Tagungen und Seminaren tätig. Seine Arbeit und sein Lebenswerk wurden in der preisgekrönten Dokumentation »The Wisdom of Trauma – Der weise Schmerz der Seele« filmisch festgehalten.
Daniel Maté ist preisgekrönter Komponist sowie Theaterlyriker. Außerdem ist er Host des YouTube Programms »Lyrics To Go« und als »mental chiropractor« tätig.
DR. GABOR MATÉ
mit DANIEL MATÉ
Vom
Mythos
des
Normalen
Wie unsere Gesellschaft uns krank macht und traumatisiert – Neue Wege zur Heilung
Aus dem Englischen von Annegret Hunke-Wormser und Elisabeth Möller-Giesen
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die Empfehlungen in diesem Buch sind von den Autoren und dem Verlag sorgfältig geprüft. Sie bieten keinen Ersatz für medizinische, psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung und Diagnose. Alle Angaben in diesem Buch erfolgen ohne jegliche Gewährleistung oder Garantie seitens der Autoren und des Verlags. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht möglich gewesen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber. Kapiteln vorangestellte Zitate können als Destillat des jeweils nachfolgenden Kapitels gelesen werden.
Bei der Übersetzung haben wir uns bemüht, eine möglichst diverse Sprache zu verwenden und diskriminierende Begriffe oder Darstellungen zu vermeiden. In Einzelfällen wurden jedoch Fremdzuschreibungen übernommen, um Aussagen dem Originalzusammenhang oder historischen Kontext entsprechend wiederzugeben.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Myth of Normal. Trauma, Illness & Healing
in a Toxic Culture bei Avery, an imprint of Penguin Random House New York.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2022 by Gabor Maté
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München nach einer Originalvorlage von Penguin Random House US
Umschlagdesign: Pete Garceau
Umschlagmotiv: pressureUA / iStock.com
Redaktion: Jennifer Wagner
Fachliche Beratung: Mag. Sandra Teml
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-30037-1V001
www.koesel.de
Für meine liebste Rae, die Gefährtin meines Lebens, die mich verstanden hat, bevor ich mich selbst verstehen konnte, und die alles an mir geliebt hat, bevor ich mich überhaupt selbst lieben konnte. Ohne sie gäbe es keine meiner Arbeiten.
Und für unsere Kinder, die wir gemeinsam großgezogen haben – Daniel, Aaron und Hannah –, die unser Leben mit Licht erfüllen.
Der beste Arzt ist auch ein Philosoph.
Aelius Galenus (Galen von Pergamon)
Soll die Medizin ihre große Aufgabe wirklich erfüllen, so muss sie in das große politische und soziale Leben eingreifen. Sie muss die Hemmnisse angehen, welche der normalen Erfüllung der Lebensvorgänge im Wege stehen, und ihre Beseitigung erwirken.
Rudolf Virchow, deutscher Arzt des 19. Jahrhunderts
Wenn man zu überleben versucht, wird Krankheit zu einer Bewältigungsstrategie und Verlust zu einer Kultur.
Stephen Jenkinson
Hinweis des Autors
In diesem Buch gibt es keine fiktiven oder auf mehreren Charakteren beruhenden Figuren. Jede Geschichte in diesem Buch ist die Geschichte einer realen Person. Ihre Worte wurden aus Interviews transkribiert und zum besseren Verständnis gelegentlich bearbeitet, aber genau wiedergegeben. Wenn nur ein Vorname angegeben ist, handelt es sich auf Wunsch des oder der Befragten um ein Pseudonym zum Schutz der Privatsphäre. In solchen Fällen können auch einige biografische Daten leicht verändert worden sein.
Werden Vor- und Nachname angegeben, handelt es sich um eine echte Identität.
Sofern nicht anders vermerkt, stammt die Kursivschrift im Text von mir.
Ein Wort noch zur Urheberschaft: Dieses Buch habe ich gemeinsam mit meinem Sohn Daniel geschrieben. In der Regel wird das Wort »mit« bei mehreren Autoren zur Bestimmung eines Ghostwriters verwendet, der die Ideen des Hauptautors schriftlich festhält. Das war hier nicht der Fall: Die meisten Kapitel habe ich selbst geschrieben. Daniel hat den Text dann mit besonderem Augenmerk auf Stil, Tonfall, Klarheit der Argumente und Verständlichkeit nachgearbeitet und häufig seine eigenen Gedanken beigesteuert. Gelegentlich, wenn ich nicht weiterkam, weil ich nicht wusste, was oder wie ich es sagen sollte, schrieb er für eine Weile und übernahm einen bestimmten Abschnitt oder ein Kapitel auf der Grundlage des Materials, das ich gesammelt und verfasst hatte. In jedem Fall haben wir die Kapitel so lange ausgetauscht, bis wir beide zufrieden waren. Auch was die Struktur und den Ablauf des Buches betrifft, haben wir von der Vorbereitung des Buchvorschlags bis zum endgültigen Entwurf kontinuierlich zusammengearbeitet.
Die Urheberschaft des Buches ist zwar ungleichmäßig verteilt, weil es auf meiner Arbeit, Forschung, Analyse und Erfahrung beruht, es wurde aber in hohem Maße gemeinsam verfasst. Ohne Daniels brillante Mitarbeit hätte ich diese Aufgabe wirklich nicht meistern können.
Gabor Maté
Vancouver, B.C.
Inhalt
Einleitung: Warum Normalität ein Mythos ist (Und warum das von Bedeutung ist)
Teil I: Die vernetzte Natur des Menschen
Kapitel 1 Der letzte Ort, an dem man sein will: Facetten des Traumas
Kapitel 2 Das Leben in einer immateriellen Welt: Emotionen, Gesundheit und die Einheit von Körper und Geist
Kapitel 3 Du verdrehst mir den Kopf: Unsere hochgradig interpersonelle Biologie
Kapitel 4 Alles, was mich umgibt: Beiträge aus der neuen Wissenschaft
Kapitel 5 Meuterei im Körper: Das Mysterium eines rebellischen Immunsystems
Kapitel 6 Krankheit ist keine Sache: Krankheit ist ein Prozess
Kapitel 7 Ein traumatisches Spannungsverhältnis: Bindung versus Authentizität
Teil II: Die Verzerrung der menschlichen Entwicklung
Kapitel 8 Wer sind wir wirklich? Die menschliche Natur und die menschlichen Bedürfnisse
Kapitel 9 Ein stabiles oder brüchiges Fundament: Die unabdingbaren Bedürfnisse von Kindern
Kapitel 10 Probleme an der Schwelle: Bevor wir auf die Welt kommen
Kapitel 11 Welche Wahl bleibt mir da schon? Die Geburt in einer schulmedizinisch geprägten Kultur
Kapitel 12 Gartenbau auf dem Mond: Untergrabene Elternschaft
Kapitel 13 Das Gehirn wird in die falsche Richtung gedrängt: Sabotage der Kindheit
Kapitel 14 Vorprogrammierte Krisen: Wie unsere Kultur unseren Charakter formt
Teil III: Den Begriff des Abnormen neu denken: Leiden als Anpassung
Kapitel 15 Nur nicht man selbst sein: Die Entlarvung der Mythen über Sucht
Kapitel 16 Wer zählt zu den Süchtigen? Eine neue Betrachtungsweise der Sucht
Kapitel 17 Eine ungenaue Verortung unseres Schmerzes: Was wir bei psychischen Erkrankungen missverstehen
Kapitel 18 Der Verstand kann Erstaunliches vollbringen: Vom Wahnsinn zum Sinn
Teil IV: Das Toxische in unserer Kultur
Kapitel 19 Von der Gesellschaft zum Zellkern: Ungewissheit, Konflikte und Kontrollverlust
Kapitel 20 Raub der menschlichen Seele: Vereinzelung und ihre Auswirkungen
Kapitel 21 Es ist ihnen egal, ob es dich umbringt: Soziopathie als Strategie
Kapitel 22 Das angegriffene Selbstwertgefühl: Wie ethnische und soziale Herkunft unter die Haut gehen
Kapitel 23 Die Stoßdämpfer der Gesellschaft: Warum Frauen es schwerer haben
Kapitel 24 Wir empfinden ihren Schmerz: Unsere von Traumata geprägten Politiker
Teil V: Wege zur Ganzheit
Kapitel 25 Alle Dinge werden vom Geist vorhergesehen: Die Möglichkeit der Heilung
Kapitel 26 Vier Heilungsprinzipien und fünf Formen des Mitgefühls
Kapitel 27 Ein schreckliches Geschenk: Krankheit als Lehrmeisterin
Kapitel 28 Bevor der Körper Nein sagt: Erste Schritte auf dem Weg zum Selbst
Kapitel 29 Hinsehen heißt hinterfragen: Selbsteinschränkende Überzeugungen auflösen
Kapitel 30 Von Feinden zu Freunden: Mit den Heilungshindernissen arbeiten
Kapitel 31 Jesus im Tipi: Psychedelika und Heilung
Kapitel 32 Mein Leben als etwas Wahres: Den Geist berühren
Kapitel 33 Einen Mythos auflösen: Die Vision von einer gesünderen Gesellschaft
Danksagungen
Anmerkungen
Register
Einleitung
Warum Normalität ein Mythos ist
(Und warum das von Bedeutung ist)
»Die Tatsache, dass Millionen von Menschen die gleichen Laster haben, macht diese Laster noch nicht zu Tugenden; die Tatsache, dass sie so viele Irrtümer gemeinsam haben, macht diese Irrtümer noch nicht zu Wahrheiten; und die Tatsache, dass Millionen von Menschen die gleichen Formen psychischer Störungen aufweisen, heißt nicht, dass diese Menschen gesund seien.«1
Erich Fromm, Wege aus einer kranken Gesellschaft
In einer Gesellschaft, die gesundheitsbesessener ist als jemals zuvor, ist lange nicht alles gut.
Gesundheit und Wohlergehen sind zu einer modernen Fixierung geworden. Eine milliardenschwere Industrie baut auf die ständigen mentalen und emotionalen – ganz zu schweigen von den finanziellen – Investitionen der Menschen, die endlos danach streben, besser zu essen, jünger auszusehen, länger zu leben, mehr Elan zu haben oder einfach an weniger Krankheitssymptomen zu leiden. Zeitschriften, Fernsehsendungen, allgegenwärtige Werbeanzeigen und die tägliche Informationsflut im Internet überschütten uns ständig mit »bahnbrechenden News zur Gesundheit«, die uns allesamt zu dieser oder jener Methode der Selbstverbesserung drängen wollen. Wir tun unser Bestes, um Schritt zu halten: Wir nehmen Nahrungsergänzungsmittel ein, belegen Yogakurse, ändern immer wieder unsere Ernährung, zahlen viel Geld für Gentests, befolgen Strategien zur Vorbeugung von Krebs oder Demenz und suchen ärztlichen Rat oder alternative Therapien für körperliche, mentale und seelische Krankheiten.
Und doch wird unsere kollektive Gesundheit immer schlechter.
Was geschieht da? Wie ist es zu verstehen, dass in unserer modernen Welt, auf dem Höhepunkt medizinischer Entwicklung und Genialität, nicht nur chronische körperliche Krankheiten, sondern auch psychische Störungen und Suchterkrankungen immer mehr zunehmen? Wie ist es möglich, dass uns das, wenn wir es überhaupt bemerken, nicht in eine größere Alarmbereitschaft versetzt? Wie sollen wir den vielen Leiden, von denen wir geplagt werden, vorbeugen und sie heilen, selbst wenn man akute Katastrophen wie die Corona-Pandemie außer Acht lässt?
Das Spektrum meiner 30-jährigen Tätigkeit als Arzt reichte von der Entbindung von Säuglingen bis hin zur Leitung einer Palliativstation. Dabei war ich immer wieder beeindruckt von den Zusammenhängen zwischen dem Individuum und dem sozialen und emotionalen Kontext, in dem sich unser Leben abspielt und aus dem sich Gesundheit oder Krankheit ergeben. Diese Neugier, oder sollte ich besser sagen: diese Faszination, hat mich mit der Zeit dazu gebracht, mich intensiv mit dem neuesten Stand der Wissenschaft zu beschäftigen. Sie zeigt solche Zusammenhänge auf elegante Weise auf. In meinen früheren Büchern habe ich einige dieser Zusammenhänge erforscht. Sie äußern sich bei bestimmten Erkrankungen wie der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Krebs- und Autoimmunerkrankungen aller Art sowie Suchterkrankungen. Ich habe darüber hinaus über die kindliche Entwicklung, die prägendste Zeit in unserem Leben, geschrieben.2
In diesem Buch, Vom Mythos des Normalen, geht es um etwas viel Umfassenderes. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass hinter der gesamten Epidemie chronischer physischer und psychischer Krankheiten, die uns momentan plagt, etwas in unserer Kultur selbst nicht stimmt. Es trägt nicht nur zu den vielen Krankheiten bei, unter denen wir leiden, sondern auch, und das ist entscheidend, zu ideologisch blinden Flecken. Sie halten uns davon ab, unsere missliche Lage klar zu erkennen und, besser noch, etwas dagegen zu unternehmen. Diese blinden Flecken sind in unserer gesamten Kultur weit verbreitet, aber in einem tragisch hohen Maße in meiner eigenen Berufssparte zu finden. Sie sind dafür verantwortlich, dass wir keine Ahnung haben, wie unsere Gesundheit und unser soziales und emotionales Leben zusammenhängen.
Anders ausgedrückt: Chronische Krankheiten – ob psychischer oder physischer Natur – sind in hohem Maße ein Resultat oder ein Merkmal der bestehenden Umstände und keine Störung. Sie sind eine Folge unserer Lebensweise, kein mysteriöser Irrweg.
Spricht man von einer »toxischen Kultur«, kann sich das auf viele Dinge beziehen, zum Beispiel auf Umweltschadstoffe, die seit Beginn des Industriezeitalters so allgegenwärtig und der menschlichen Gesundheit so abträglich sind. Von Asbestpartikeln bis hin zu enormen Mengen schädigendem Kohlendioxid: An realen, physischen Giftstoffen in unserer direkten Umgebung mangelt es wirklich nicht. Wir könnten »toxisch« auch in seinem modernen und populär-psychologischen Sinn verstehen, wie es in der Verbreitung von Negativität, Misstrauen, Feindseligkeit und Polarisierung deutlich wird, die für die soziopolitische Gegenwart typisch sind. Wir können diese beiden Bedeutungen natürlich in unsere Diskussion einbeziehen, aber ich verwende den Begriff »toxische Kultur«, um etwas noch Umfassenderes und tiefer Verwurzeltes zu beschreiben: den gesamten Kontext aus sozialen Strukturen, Glaubenssystemen, Vermutungen und Werten, der uns umgibt und zwangsläufig jeden Aspekt unseres Lebens durchzieht.
Die Tatsache, dass sich unser soziales Leben auf unsere Gesundheit auswirkt, ist nicht neu, aber dieser Erkenntnis auch Beachtung zu schenken, war nie dringlicher erforderlich. Ich sehe darin das wichtigste und folgenreichste Gesundheitsrisiko unserer Zeit, das durch die Auswirkungen von zunehmendem Stress, Ungleichheit und die Klimakatastrophe, um nur einige Hauptfaktoren zu nennen, gefördert wird. Unser Konzept von Wohlbefinden muss sich vom Individuellen zum Globalen – in jedem Sinne dieses Wortes – wandeln. Das trifft vor allem in unserem Zeitalter des globalisierten Kapitalismus zu, der, um es mit den Worten des Historikers und Kulturkritikers Morris Berman auszudrücken, »zur totalen kommerziellen Umgebung geworden ist, die eine gesamte mentale Welt umfasst.«3Angesichts der Einheit von Körper und Geist, die in diesem Buch besonders hervorgehoben werden soll, würde ich hinzufügen, dass er auch eine totale physiologische Umgebung ausmacht.
Meiner Meinung nach erzeugt unsere soziale und wirtschaftliche Kultur ihrem Wesen nach chronische Stressfaktoren. Sie untergraben das Wohlbefinden auf sehr ernsthafte Weise so zunehmend, wie wir es in den letzten Jahrzehnten beobachten konnten.
Ich halte folgenden Vergleich für hilfreich: Eine Kultur in einem Labor ist eine biochemische Nährlösung, die speziell zur Förderung der Entwicklung eines bestimmten Organismus hergestellt wird. Vorausgesetzt, die betreffenden Mikroorganismen sind zu Beginn gesund und genetisch fit, ermöglicht eine passende und gut versorgte Kultur ihr glückliches, gesundes Wachstum und ihre Vermehrung. Wenn dieselben Mikroorganismen anfangen, in einem nie da gewesenen Ausmaß krank zu werden oder nicht mehr zu gedeihen, ist das entweder auf eine Verseuchung der Kultur zurückzuführen oder darauf, dass die Nährlösung von Anfang an falsch war. In beiden Fällen könnte man hier zu Recht von einer toxischen Kultur sprechen. Sie ist für die Lebewesen, die sie unterstützen soll, ungeeignet. Oder schlimmer noch: Sie gefährdet ihre Existenz. Mit menschlichen Gesellschaften verhält es sich ebenso. Der Rundfunkmoderator, Aktivist und Autor Thom Hartmann sagt dazu: »Kultur kann gesund oder toxisch, nährend oder mörderisch sein.«4
Unter dem Gesichtspunkt des Wohlergehens ist unsere gegenwärtige Kultur – als Laborexperiment – eine globalisierte Demonstration dessen, was aus den Fugen geraten kann. Inmitten aufsehenerregender wirtschaftlicher, technologischer und medizinischer Ressourcen führt sie dazu, dass zahllose Menschen an Krankheiten leiden, die durch Stress, Unwissenheit, Ungleichheit, Umweltzerstörung, Klimaveränderungen, Armut und soziale Isolation hervorgerufen werden. Sie lässt zu, dass Millionen Menschen vor der Zeit an Krankheiten sterben, die wir verhindern könnten, oder an Entbehrungen, für deren Beseitigung wir mehr als genug Ressourcen zur Verfügung haben.
In den Vereinigten Staaten, dem reichsten Land in der Geschichte der Welt und dem Epizentrum des globalisierten Wirtschaftssystems, leiden 60 Prozent der Erwachsenen an einer chronischen Störung wie Bluthochdruck oder Diabetes. Mehr als 40 Prozent weisen zwei oder mehr dieser Störungen auf.5Nahezu 70 Prozent aller US-Amerikanerinnen und -Amerikaner nehmen mindestens ein Medikament, und mehr als die Hälfte zwei verschreibungspflichtige Medikamente ein.6In meinem eigenen Land, in Kanada, wird in wenigen Jahren fast die Hälfte aller Babyboomer an Bluthochdruck leiden, wenn der derzeitige Trend anhält.7Bei Frauen ist ein unverhältnismäßig hoher Anstieg von Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose (MS), die möglicherweise zu Behinderungen führen, zu verzeichnen.8Bei jungen Menschen scheinen Krebserkrankungen zuzunehmen, die nicht durch das Rauchen verursacht werden. Die Adipositas-Raten und die zahlreichen damit verbundenen Gesundheitsrisiken steigen in vielen Ländern, darunter Kanada, Australien und die USA, wo mehr als 30 Prozent der Erwachsenen die Kriterien dafür erfüllen. Vor Kurzem hat Mexiko seinen nördlichen Nachbarn in dieser wenig beneidenswerten Kategorie überholt. Die Folge ist, dass stündlich bei achtunddreißig Mexikanern Diabetes diagnostiziert wird. Dank der Globalisierung holt Asien nun auf. »China ist mit schockierender Geschwindigkeit im Zeitalter der Fettleibigkeit angekommen«, berichtete Ji Chengye, ein Forscher auf dem Gebiet der Kindergesundheit.9
In der gesamten westlichen Welt nehmen die Diagnosen psychischer Krankheiten bei Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Menschen stark zu. In Kanada sind Depression und Angststörungen die am rasantesten steigenden Diagnosen. Im Jahr 2019 litten mehr als fünfzig Millionen US-Amerikaner – mehr als 20 Prozent der erwachsenen US-Bevölkerung – an einer psychischen Erkrankung.10In Europa sind den Autoren einer internationalen Studie neueren Datums zufolge psychische Störungen »zur größten gesundheitlichen Herausforderung des 21. Jahrhunderts geworden.«11Millionen nordamerikanischer Kinder und Jugendlicher werden mit Stimulanzien, Antidepressiva und sogar antipsychotischen Medikamenten behandelt. Deren langfristige Auswirkungen auf ein Gehirn, das sich noch in der Entwicklung befindet, sind noch nicht bekannt. Die chemische Kontrolle der Gehirne und des Verhaltens junger Menschen ist ein gefährliches soziales Experiment. Eine ernüchternde Schlagzeile auf der Webseite von ScienceAlert aus dem Jahr 2019 spricht für sich: »In den USA schießt die Zahl der Selbstmordversuche von Kindern in die Höhe, und niemand weiß warum.«12Im Vereinigten Königreich ist die Lage ähnlich erschreckend. Der Guardian berichtete im September 2019: »Britische Universitäten erleben eine Flut von Angstzuständen, psychischen Zusammenbrüchen und Depressionen unter Studierenden.«13Mit der zunehmenden Globalisierung halten solche Leiden, die bisher in »entwickelten« Ländern zu finden sind, Einzug in neue Gegenden der Welt. So gibt ADHS bei Kindern zum Beispiel in China »zunehmend Anlass zur Sorge für die öffentliche Gesundheit«.14
Die Klimakatastrophe, von der wir bereits betroffen sind, bringt eine völlig neue Gefahr für unsere Gesundheit mit sich, eine – wenn das überhaupt möglich ist – vergrößerte Version der existenziellen Bedrohung, die seit Hiroshima von einem Atomkrieg ausgeht. »Die Sorge über den Klimawandel ist verknüpft mit jungen Menschen, die das Gefühl haben, keine Zukunft zu haben, und dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist«, stellten die Autorinnen und Autoren einer Studie fest, die im Jahr 2021 unter mehr als zehntausend Personen in 42 Ländern eine Meinungsumfrage durchführten. Neben dem Gefühl, von Regierungen und Erwachsenen verraten und verlassen worden zu sein, seien eine derartige Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit »chronische Stressfaktoren, die schwerwiegende, lang anhaltende und zunehmend negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und jungen Menschen haben werden.«15
Wären wir selbst an der Stelle der Organismen in dem Laborbeispiel, würden diese und andere Anzeichen unmissverständlich darauf hinweisen, dass wir in einer toxischen, schädlichen Kultur leben. Schlimmer noch, wir haben uns an vieles, das uns zu schaffen macht, gewöhnt – oder vielleicht sollte man besser sagen akkulturiert. Es ist, in Ermangelung eines besseren Wortes, normal geworden.
In der medizinischen Praxis bezeichnet das Wort »normal« unter anderem den Zustand, den wir Ärzte anstreben: eine Grenzziehung zwischen Gesundheit und Krankheit. Bei der Anwendung von Behandlungen oder Medikamenten sind »normale Werte« und eine »normale Funktionsweise« unser Ziel. Darüber hinaus messen wir Erfolg oder Misserfolg an statistischen Normen. Wir versichern besorgten Patienten, dieses Symptom oder jene Nebenwirkung seien völlig normal, sozusagen »zu erwarten gewesen«. All dies sind spezielle und zulässige Verwendungen des Wortes, die dazu dienen, Situationen realistisch einzuschätzen, damit wir unsere Bemühungen auf unser Ziel ausrichten können.
Der Titel dieses Buches bezieht sich nicht auf diese Bedeutungen von »normal«, sondern auf eine heimtückischere Auslegung, die uns ganz und gar nicht zu einer gesünderen Zukunft verhelfen, sondern sie, im Gegenteil, verhindern wird.
In guten wie in schlechten Zeiten haben wir Menschen eine besondere Gabe, uns vor allem dann an etwas zu gewöhnen, wenn Veränderungen schrittweise stattfinden. Das neumodische Verb »normalisieren« bezieht sich auf den Mechanismus, durch den etwas, das von der Norm abgewichen ist, so normal wird, dass es unserem Radar entgeht. Auf gesellschaftlicher Ebene bedeutet »normal« oft: Hier ist nichts zu erkennen, alle Systeme funktionieren planmäßig, weitere Untersuchungen sind nicht erforderlich.
Die Wahrheit sieht meiner Meinung nach völlig anders aus.
Der verstorbene Autor und Essayist David Foster Wallace, ein Meister der Sprache, hat einmal eine Festrede mit einer amüsanten Parabel begonnen, die das Problem mit der Normalität gut veranschaulicht. In der Geschichte geht es um zwei Fische, die im Wasser einem älteren Artgenossen begegnen, der sie freundlich grüßt: »›Morgen, Jungs. Wie ist das Wasser?‹ Die beiden jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, bis schließlich einer von ihnen zum anderen sagt: ›Was zum Teufel ist Wasser?‹« Wallace wollte, dass seine Zuhörer darüber nachdachten, dass »die offensichtlichsten, allgegenwärtigsten und wichtigsten Realitäten oft diejenigen sind, die am schwersten zu sehen und zu formulieren sind«. Oberflächlich betrachtet, räumte er ein, mag das wie eine »banale Plattitüde« klingen, aber »in den alltäglichen Schützengräben des Erwachsenendaseins können banale Plattitüden Leben oder Tod bedeuten«.
Er hätte die These dieses Buches formulieren können. Tatsächlich ist das Leben, und der Tod, einzelner Menschen – seine Qualität und in vielen Fällen seine Dauer – eng mit den Aspekten der modernen Gesellschaft verbunden, die »am schwersten zu sehen und zu formulieren sind«. Es geht um Phänomene, die, wie das Wasser für die Fische, zu gewaltig und zu nah sind, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Anders ausgedrückt: Die Elemente des täglichen Lebens, die uns als normal erscheinen, sind genau die, die unbedingt von uns überprüft werden sollten. Genau dies ist mein zentrales Anliegen. Folglich ist es mein wichtigstes Ziel, einen neuen Weg zu finden, diese Phänomene zu sehen und zu diskutieren, indem wir sie aus den Kulissen und auf die Bühne holen, um die dringend erforderlichen Lösungen schneller zu finden.
Ich werde Argumente dafür aufzeigen, dass vieles von dem, was in unserer Gesellschaft als normal gilt, weder gesund noch natürlich ist. Außerdem werde ich zeigen, dass Normalität in der modernen Gesellschaft häufig die Anpassung an Anforderungen bedeutet, die in Bezug auf unsere naturgegebenen Bedürfnisse zutiefst anormal sind – das heißt ungesund und schädlich auf körperlicher, geistiger und sogar spiritueller Ebene.
Wir sollten viele Krankheiten nicht als grausame Wendungen des Schicksals oder boshafte Mysterien sehen, sondern eher als eine erwartete und deshalb normale Konsequenz anormaler, unnatürlicher Umstände. Das würde sich auf revolutionäre Weise auf unseren Umgang mit unserer Gesundheit auswirken. Die kranken Körper und Seelen würden nicht länger als Ausdruck eines individuellen Krankheitsbildes angesehen, sondern als lebendes Alarmsignal. Sie würden unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken, wo unsere Gesellschaft aus dem Ruder gelaufen ist. Dorthin, wo unsere derzeit herrschenden Gewissheiten und Vermutungen rund um die Gesundheit in Wirklichkeit Fiktion sind. Würde man sie klar erkennen, würden sie uns vielleicht auch Hinweise darauf geben, was getan werden müsste, um die Richtung zu ändern und eine gesündere Welt zu schaffen.
Weitaus mehr als der Mangel an technologischem Wissen, ausreichenden finanziellen Mitteln oder neuen Erkenntnissen ist die verzerrte Vorstellung von Normalität in unserer Kultur die größte Hemmschwelle für eine gesündere Welt. Sie hält uns sogar davon ab, das zu beachten, was wir bereits wissen. Ihre verschleiernde Wirkung ist auf dem Gebiet besonders ausgeprägt, auf dem ein klarer Blick am nötigsten wäre: in der Medizin.
Dem heutigen medizinischen Modell liegt eine scheinbar wissenschaftliche Überzeugung zugrunde, die in gewisser Weise mehr einer Ideologie als empirischem Wissen ähnelt. Daher unterläuft ihr ein doppelter Fehler: Es reduziert komplizierte Ereignisse auf ihre Biologie und trennt den Körper vom Geist. Es befasst sich fast ausschließlich mit dem einen oder dem anderen und bringt kein Verständnis für die grundlegende Einheit der beiden auf. Dieses Versäumnis erklärt weder die unbestritten fantastischen Errungenschaften der Medizin für nichtig noch die guten Absichten so vieler Menschen, die sie praktizieren. Aber es schränkt die guten Dinge, die die Medizin bewirken könnte, stark ein.
Eine der hartnäckigsten und verheerendsten Unterlassungen, die unsere Gesundheitssysteme behindert, ist – entweder aus Nichtwissen oder echtem, aktivem Ignorieren – die Ignoranz dessen, was die Wissenschaft bereits bewiesen hat. Ein typisches Beispiel sind die zahlreichen und zunehmenden Belege dafür, dass menschliche Wesen nicht in einzelne Organe und Systeme zerlegt werden können, nicht einmal in »Geist« und »Körper«. Alles in allem war die medizinische Welt nicht gewillt oder nicht in der Lage, diese Belege zu verarbeiten. Sie konnte ihre Vorgehensweise nicht anpassen. Die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse – von denen viele vom Konzept her nicht allzu neu sind – müssen ihren Weg in das Medizinstudium erst noch finden. Also tappen viele wohlwollende Ärzte weiterhin im Dunkeln. Viele von ihnen müssen sich die Zusammenhänge am Ende selbst erschließen.
Für mich begann das Herstellen von Zusammenhängen vor einigen Jahrzehnten: Ich stellte meinen Patientinnen und Patienten aufgrund einer Vermutung nicht nur die üblichen trockenen medizinischen Fragen zu ihren Symptomen und ihrer Krankheitsgeschichte. Ich befragte sie stattdessen auch nach dem größeren Kontext: ihrem Leben. Ich bin dankbar für alles, was diese Männer und Frauen mich gelehrt haben – durch ihr Leben und Sterben, durch ihr Leiden und ihre Genesung sowie durch die Geschichten, die sie mit mir teilten. Der Kern des Ganzen deckt sich völlig mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen: Gesundheit und Krankheit sind keine zufälligen Zustände eines bestimmten Körpers oder Körperteils. Sie sind vielmehr Ausdruck eines gesamten gelebten Lebens, eines Lebens, das wiederum nicht losgelöst verstanden werden kann: Es wird von einem Netzwerk aus Umständen, Beziehungen, Ereignissen und Erfahrungen beeinflusst – oder, besser noch, es entsteht daraus.
Natürlich haben wir allen Grund, nicht nur die erstaunlichen medizinischen Errungenschaften der letzten beiden Jahrhunderte zu feiern, sondern auch die unermüdliche Kraft und intellektuelle Brillanz derjenigen, deren Arbeit zu enormen Fortschritten in vielen Bereichen der menschlichen Gesundheit geführt hat. Um nur ein Beispiel zu nennen: Kinderlähmung. Eine grauenhafte Krankheit, die noch vor zwei oder drei Generationen zahllose Kinder tötete oder verstümmelte, ist nach Angaben des US-Centers for Disease Control and Prevention (CDC) seit 1988 um mehr als 99 Prozent zurückgegangen. Heute haben die meisten Kinder vermutlich noch nie von dieser Krankheit gehört.16Selbst die jüngere HIV-Epidemie wurde für Erkrankte in einem relativ kurzen Zeitraum von einem Todesurteil zu einer kontrollierbaren chronischen Krankheit – zumindest für diejenigen mit Zugang zu den richtigen Behandlungsmethoden. Und so verheerend die Corona-Pandemie bis jetzt auch war, kann die schnelle Entwicklung von Impfstoffen als Triumph der modernen Wissenschaft und Medizin angesehen werden.
Das Problem mit solchen guten Nachrichten ist, dass sie der beruhigenden Überzeugung Nahrung geben, dass wir, im Großen und Ganzen, Fortschritte in Richtung eines gesünderen Lebensstandards machen. Deshalb verharren wir in einer falschen Passivität. Die Realität sieht ganz anders aus. Wir sind weit davon entfernt, uns den derzeitigen gesundheitlichen Herausforderungen zu stellen. Wir halten mit den meisten von ihnen kaum Schritt. Das Beste, das wir tun können, ist häufig, die Symptome zu lindern, ob chirurgisch, mit Medikamenten oder beidem. So willkommen medizinische Durchbrüche auch sein mögen und so fruchtbar Forschung sein kann – das grundlegende Problem ist kein Mangel an Fakten, Technologie oder Techniken, sondern eine veraltete Sichtweise, die nicht erklären kann, was wir sehen. Mein Ziel ist es, eine neue Perspektive aufzuzeigen, die meiner Ansicht nach enorme Möglichkeiten für einen gesünderen Weg mit sich bringt: eine neue Vision von Normalität, die das Beste in uns fördert.
Der Aufbau dieses Buches folgt den konzentrischen Kreisen von Ursache, Verbindung und Folgen, die beeinflussen, wie gesund oder ungesund wir sind. Wir beginnen im Inneren auf der Ebene der Biologie des Menschen. Dann untersuchen wir die engen Beziehungen, innerhalb derer sich unsere Körper, unsere Gehirne und unsere Persönlichkeiten entwickeln. Schließlich bewegen wir uns nach außen, zu den Makrodimensionen unserer kollektiven Existenz, das heißt, zu den sozioökonomischen und den politischen Ebenen. Ich werde aufzeigen, wie eng unsere körperliche und geistige Gesundheit mit dem verwoben ist, wie wir uns fühlen, wie wir uns selbst und die Welt wahrnehmen oder über sie denken. Darüber hinaus wird es darum gehen, wie das Leben unsere nicht verhandelbaren menschlichen Bedürfnisse erfüllt oder nicht. Da traumatische Erlebnisse eine grundlegende Erfahrungsebene des modernen Lebens sind, die weitgehend ignoriert oder falsch verstanden wird, beginne ich mit einer Arbeitsdefinition, um eine Basis für alles Folgende zu schaffen.
Meine Aufgabe ist es, in jeder Phase den Schleier des Allgemeinwissens und der herkömmlichen Denkweisen zu lüften und dabei zu berücksichtigen, was die Wissenschaft und aufmerksames Beobachten uns lehren. Mein Ziel ist es, Licht in die Mythen zu bringen, die dazu beitragen, dass wir im Status quo verharren. Wie in meinen früheren Büchern auch, werden die Wissenschaft und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit anhand von Geschichten aus dem echten Leben und Fallstudien von Menschen verdeutlicht, die so großzügig waren, einige ihrer Erfahrungen mit mir zu teilen. Sie reichen von wenig überraschend bis wahrhaftig unglaublich, von herzzerreißend bis inspirierend.
Ja, inspirierend. Denn es gibt eine erfreuliche Begleiterscheinung all dieser schwierigen Neuigkeiten. Wenn wir nüchtern betrachten können, was wir in unserer Kultur in Bezug auf Gesundheit und Krankheit zur Norm erklärt haben, und uns klarmachen, dass diese Dinge im Grunde genommen nicht beabsichtigt oder vorherbestimmt sind, ergibt sich die Möglichkeit, zu dem zurückzukehren, was die Natur schon immer für uns geplant hat. Daher das Wort »Heilung« im Untertitel dieses Buches. In seinem Ursprung bedeutet es »Rückkehr zur Ganzheit«. Wenn wir beschließen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, kann der Heilungsprozess beginnen. Diese Aussage enthält kein Versprechen auf eine Wunderheilung, sondern schlicht die Erkenntnis, dass wir alle bislang ungeahnte Möglichkeiten des Wohlergehens in uns tragen. Diese Möglichkeiten zeigen sich dann, wenn wir den irreführenden Mythen17 über Normalität, an die wir uns gewöhnt haben, ins Auge sehen und sie entlarven. Wenn das für uns als Individuen zutrifft, muss es auch für uns als Spezies zutreffen.
Es gibt keine Garantie auf Heilung, aber sie ist verfügbar. Man kann, ohne zu übertreiben, sagen, dass sie an diesem Punkt der Geschichte der Erde auch erforderlich ist. Alles, was ich im Laufe der Jahre gesehen und gelernt habe, gibt mir die Zuversicht, dass wir dazu in der Lage sind.
Teil I
Die vernetzte Natur des Menschen
Ein nach einem Foto aus dem Jahr 1944 (oben links auf dem Gemälde zu sehen) von meiner Frau Rae gemaltes Bild zeigt mich im Alter von drei Monaten mit meiner Mutter Judith. Der gelbe Stern, den sie trägt, ist das Kennzeichen der Schande, das Juden in Ungarn wie auch in anderen von den Nazis besetzten Gebieten tragen mussten. Rae fängt den verstörten Blick und die Angst in meinen Kinderaugen eindrucksvoll ein. Acryl auf Leinwand, 101,6 × 76,2 cm, 1997, www.raemate.com
Kapitel 1
Der letzte Ort, an dem man sein will
Facetten des Traumas
»Ein von traumatischen Erfahrungen gänzlich unberührter Lebensweg ist kaum vorstellbar – und die meisten Menschen wissen nicht, wie sie mit dem Trauma umgehen sollen.«
Mark Epstein, Psychiater, buddhistischer Meditationslehrer und Autor, The Trauma of Everyday Life
Stellen Sie sich Folgendes vor: Im zarten Alter von 71 Jahren, sechs Jahre vor dem Schreiben dieser Zeilen, komme ich von einem Vortrag in Philadelphia zurück nach Vancouver. Der Vortrag war ein Erfolg, die Zuhörerschaft war begeistert, meine Botschaft über die Auswirkungen von Sucht und Traumata auf das Leben der Menschen wurde positiv aufgenommen. Ich bin mit unerwartetem Komfort gereist, da ich dank einer Gefälligkeit von Air Canada ein Upgrade in die Business-Class bekommen habe. Beim Landeanflug auf Vancouver mit einem vom Meer bis zum Himmel makellosen Panorama sitze ich in kindlicher Seligkeit in meiner Ecke und strahle – erfüllt von dem Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Als wir nach der Landung zum Gate rollen, leuchtet eine SMS von meiner Frau Rae auf dem kleinen Bildschirm meines Handys auf: »Tut mir leid, ich bin noch zu Hause. Willst du trotzdem, dass ich dich abhole?« Ich werde ganz starr und alle Zufriedenheit verwandelt sich augenblicklich in Wut. »Schon gut«, diktiere ich schroff in das Telefon. Verbittert steige ich aus, gehe durch den Zoll und nehme ein Taxi nach Hause, von Tür zu Tür eine Fahrt von zwanzig Minuten. (Ich gehe davon aus, dass die Lesenden das Buch bereits in mitfühlender Empörung über die Demütigung des Autors fest umklammert halten.) Als ich Rae sehe, knurre ich ein Hallo, das mehr Vorwurf als Begrüßung ist, würdige sie aber kaum eines Blickes. Tatsächlich nehme ich in den nächsten vierundzwanzig Stunden selten Blickkontakt auf. Wenn sie mich anspricht, gebe ich kaum mehr als ein kurzes, monotones Grunzen von mir. Mein Blick ist abgewandt, der obere Teil meines Gesichts ist angespannt und starr, mein Kiefer ist permanent verkrampft.
Was ist nur los mit mir? Ist das die Reaktion eines reifen Erwachsenen in seinem achten Lebensjahrzehnt? Nur dem Anschein nach. In solchen Momenten ist nur wenig vom erwachsenen Gabor im Spiel. Der Großteil ist in den Fängen der fernen Vergangenheit verhaftet, am Anfang meines Lebens. Diese körperlich-emotionale Zeitverzerrung, die mich daran hindert, den Moment im Hier und Jetzt zu erleben, ist eine der Hinterlassenschaften des Traumas. Von diesem Thema sind zahllose Menschen unseres Kulturkreises betroffen. Es ist so tief verborgen, dass viele von uns nicht wissen, dass es da ist.
Das aus dem Griechischen stammende Wort »Trauma« bedeutet »Wunde«. Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht: Es sind unsere emotionalen Wunden oder die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, die einen Großteil unseres Handelns diktieren. Sie beeinflussen unsere sozialen Verhaltensmuster und prägen unser Weltbild. Sie können sogar Einfluss darauf nehmen, ob wir in den wichtigsten Fragen unseres Lebens überhaupt zu rationalem Denken fähig sind oder nicht. Bei vielen von uns zeigen sich diese Wunden in unseren engsten Partnerschaften und verursachen allerlei Unheil in unseren Beziehungen.
Im Jahr 1889 beschrieb der bahnbrechende französische Psychologe Pierre Janet das traumatische Gedächtnis zum ersten Mal als »automatisierte Aktionen und Reaktionen, Empfindungen und Geisteshaltungen ..., die in Form von viszeralen Empfindungen wiedergegeben und nachgespielt werden.«18 Im gegenwärtigen Jahrhundert schrieb der renommierte Psychotraumatologe und Heiler Peter Levine, dass bestimmte Belastungen des Organismus »das biologische, psychische und soziale Gleichgewicht einer Person in einem solchen Ausmaß beeinträchtigen können, dass die Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis alle darauffolgenden Erfahrungen beeinflusst und überschattet und so die Wertschätzung des gegenwärtigen Moments vereitelt«.19 Levine nennt das »die Tyrannei der Vergangenheit«.
In meinem Fall findet sich die Quelle meiner feindseligen Reaktion auf Raes Nachricht in einem Tagebuch. Meine Mutter hat es während meiner ersten Jahre im Budapest der Kriegs- und Nachkriegszeit in fast unleserlichem Gekrakel und nur sporadisch geführt. Nachfolgend übersetze ich ihren Eintrag vom 8. April 1945, als ich vierzehn Monate alt war, aus dem Ungarischen:
Lieber kleiner Mann, erst nach vielen langen Monaten nehme ich wieder den Stift in die Hand, um dir kurz die unsagbaren Schrecken einer Zeit zu skizzieren, deren Einzelheiten ich dir ersparen will ... Es war am 12. Dezember, als uns die Pfeilkreuzler20 in das eingezäunte Budapester Ghetto trieben, aus dem wir nur mit größter Mühe entkamen und in einem von der Schweiz geschützten Haus Zuflucht fanden. Von dort aus schickte ich dich nach zwei Tagen fort. Eine völlig Fremde brachte dich zu deiner Tante Viola, weil ich einsehen musste, dass dein kleiner Organismus die Lebensbedingungen in diesem Haus unmöglich ertragen konnte. Nun begannen die furchtbarsten fünf oder sechs Wochen meines Lebens, in denen ich dich nicht sehen konnte.
Dank der Güte und des Mutes der unbekannten Christin habe ich überlebt. Meine Mutter vertraute mich ihr auf der Straße an und sie brachte mich zu Verwandten, die unter relativ sicheren Bedingungen versteckt lebten. Nachdem die sowjetische Armee die Deutschen in die Flucht geschlagen hatte, kam ich wieder zu meiner Mutter – und sah sie mehrere Tage lang nicht einmal an.
Einer der großen britischen Psychiater und Psychologen des 20. Jahrhunderts, John Bowlby, war mit derartigem Verhalten bestens vertraut. Er bezeichnete es als Ablösung (detachment). In seiner Klinik beobachtete er zehn kleine Kinder, die aufgrund unkontrollierbarer Umstände eine längere Trennung von ihren Eltern erdulden mussten. »Bei der ersten Begegnung mit der Mutter nach tage- oder wochenlanger Abwesenheit zeigte jedes der Kinder einen gewissen Grad an Ablösung«, stellte Bowlby fest. »Zwei Kinder schienen die Mutter nicht zu erkennen. Die anderen acht wandten sich ab oder gingen sogar von ihr weg. Die meisten von ihnen weinten entweder oder waren den Tränen nahe, bei einigen war der Gesichtsausdruck abwechselnd weinerlich und ausdruckslos.«21 Es mag unlogisch erscheinen, aber diese reflexartige Ablehnung der liebenden Mutter ist eine Anpassung: »Es hat mich so verletzt, dass du mich verlassen hast«, sagt der Verstand des kleinen Kindes, »dass ich mich nicht wieder mit dir verbinden will. Ich kann mich diesem Schmerz nicht noch einmal aussetzen.« Bei vielen Kindern – und ich war mit Sicherheit eines von ihnen – verankern sich frühe Reaktionen wie diese im Nervensystem, im Geist und im Körper. Sie beeinträchtigen zukünftige Beziehungen. Sie tauchen im Laufe des Lebens als Reaktion auf jedes Ereignis auf, das dem ursprünglichen Erlebnis auch nur annähernd ähnelt – oft ohne dass man sich an die auslösenden Umstände erinnern könnte. Meine bockige und defensive Reaktion auf Rae signalisierte, dass alte, in der Kindheit programmierte, emotionale Schaltkreise in den Tiefen meines Gehirns die Regie übernommen hatten – während die rationalen, besonnenen, selbstregulierenden Teile offline gegangen waren.
»Alle Traumata sind präverbal«, schrieb der Psychiater Bessel van der Kolk.22 Seine Aussage ist in zweierlei Hinsicht zutreffend. Erstens werden uns die psychischen Wunden, die wir erleiden, oft zugefügt, bevor unser Gehirn irgendeine Art von verbalem Narrativ formulieren kann – so wie in meinem Fall. Zweitens: Selbst nachdem wir sprachfähig geworden sind, hinterlassen manche Wunden Spuren in Regionen unseres Nervensystems, die nichts mit Sprache oder Begrifflichkeiten zu tun haben. Dazu gehören natürlich Teile des Gehirns, aber auch des übrigen Körpers. Sie sind in Regionen von uns gespeichert, zu denen Worte und Gedanken keinen direkten Zugang haben – man könnte diese Ebene der traumatischen Kodierung auch als »subverbal« bezeichnen. Peter Levine erklärt es folgendermaßen: »Die bewusste explizite Erinnerung ist nur die sprichwörtliche Spitze eines sehr tiefen und mächtigen Eisbergs. Sie deutet die unterirdischen Schichten erster impliziter Erfahrungen, die uns in einer Weise bewegen, die der bewusste Verstand nur andeutungsweise erahnen kann, lediglich an.«23
Was nicht unerwähnt bleiben sollte: Meine Frau würde es nicht akzeptieren, wenn ich die ganze Schuld für meinen Wutanfall, der von dem kleinen Ankunftsdebakel ausgelöst wurde, auf Nazis, Faschisten und mein Kindheitstrauma schieben würde. Ja, die Vorgeschichte verdient Mitgefühl und Verständnis – und beides habe ich bei ihr im Überfluss bekommen –, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem »Hitler ist schuld« einfach nicht mehr zieht. Verantwortung kann und muss übernommen werden. Nach vierundzwanzig Stunden kalter Schulter hatte Rae genug. »Oh, hör schon auf«, sagte sie. Und das tat ich auch – ein Anzeichen für Fortschritt und relative Reife meinerseits. Früher hätte ich Tage oder länger gebraucht, um »aufzuhören«. Um meinen Ärger herunterzuschlucken und mein Inneres aufzutauen, meine Miene zu lockern, meine Stimme weicher klingen zu lassen und meinen Blick bereitwillig und liebevoll meiner Lebenspartnerin zuzuwenden.
»Mein Problem ist, dass ich mit jemandem verheiratet bin, der mich versteht«, habe ich schon oftmals gemurrt – nur zum Teil im Scherz. In Wahrheit ist es natürlich ein großer Segen für mich, mit jemandem mit gesunden Grenzen verheiratet zu sein, der mich sieht, wie ich bin, und der keinerlei Lust hat, die Last meiner langen und ungeplanten Besuche in der fernen Vergangenheit zu tragen.
Was Traumata sind und was sie bewirken
Traumatische Prägungen sind weiter verbreitet, als uns bewusst ist. Das mag verwunderlich klingen, denn »Trauma« ist in unserer Gesellschaft zu einer Art Schlagwort geworden. Es besitzt eine Reihe umgangssprachlicher Bedeutungen, die seine eigentliche Bedeutung verwässern. Eine klare und umfassende Definition ist geboten, und zwar insbesondere im gesundheitlichen Bereich, aber auch in praktisch allen anderen gesellschaftlichen Belangen, da die unterschiedlichen Lebensbereiche eng miteinander verknüpft sind.
Die übliche Vorstellung von Traumata beschwört Bilder von katastrophalen Ereignissen herauf: Orkane, Missbrauch, grobe Vernachlässigung und Krieg. Das hat den unbeabsichtigten und irreführenden Effekt, dass Traumata in den Bereich des Abnormalen, Unüblichen, Außergewöhnlichen verwiesen werden. Wenn es eine spezielle Gruppe von Menschen gibt, die wir als »traumatisiert« bezeichnen, muss das bedeuten, dass die meisten von uns es nicht sind. Damit schießen wir weit am Ziel vorbei. Traumata durchdringen unsere gesamte Kultur: vom individuellen Erleben über soziale Beziehungen bis hin zu Bereichen wie Erziehung, Bildung, Popkultur, Wirtschaft und Politik. Tatsächlich wäre jemand, der nicht von einer traumatischen Erfahrung geprägt ist, ein Sonderfall in unserer Gesellschaft. Wir würden der Sache näherkommen, wenn wir fragen würden: Wo lässt sich jeder von uns im breiten und erstaunlich umfassenden Traumaspektrum verorten? Welche der zahlreichen Auswirkungen traumatischer Erfahrungen hat jeder von uns (fast) sein ganzes Leben lang mit sich herumgetragen? Wie haben sie sich ausgewirkt? Welche Möglichkeiten würden sich eröffnen, wenn wir uns ihnen annähern, vielleicht sogar mit ihnen vertraut werden würden?
An erster Stelle steht eine grundlegendere Frage: Was ist ein Trauma? Für mich ist ein »Trauma« eine psychische Wunde, ein dauerhafter Bruch oder ein Riss im Selbst aufgrund belastender oder verletzender Ereignisse. Nach dieser Definition ist mit Trauma in erster Linie das gemeint, was sich infolge schwieriger oder schmerzhafter Ereignisse im Inneren eines Menschen abspielt – nicht aber die Ereignisse selbst. »Ein Trauma ist nicht das, was einem zustößt, sondern das, was in einem vorgeht«, so möchte ich es formulieren. Denken Sie an einen Autounfall, bei dem sich jemand eine Gehirnerschütterung zuzieht: Der Unfall ist das, was passiert ist – die Verletzung ist das, was bleibt. Gleichermaßen ist ein Trauma eine psychische Verletzung. Es bleibt noch lange nach dem auslösenden Ereignis in unserem Nervensystem, unserem Geist und unserem Körper zurück und kann jederzeit wieder Schmerzen verursachen. Es besteht aus einem Geflecht von Widrigkeiten, das sich aus der Wunde selbst und den zurückbleibenden Lasten zusammensetzt, die unsere Verletzung unserem Körper und unserer Seele aufbürdet: Sie beschert uns unverarbeitete Emotionen; sie schreibt uns Bewältigungsstrategien vor; wir leben tragische, dramatische oder neurotische Verhaltensmuster aus – unwissentlich, aber unweigerlich. Nicht zuletzt verlangt all das unserem Körper einen Tribut ab.
Wenn eine Wunde nicht von selbst heilt, gibt es zwei Möglichkeiten: Sie kann entweder offen bleiben oder, was häufiger der Fall ist, durch eine dicke Schicht Narbengewebe ersetzt werden. Als offene Wunde ist sie eine permanente Leidensquelle und eine Stelle, an der wir selbst durch den kleinsten Reiz immer wieder verletzt werden können. Sie zwingt uns zu ständiger Wachsamkeit – sozusagen zur ständigen Pflege unserer Wunden. Sie schränkt uns in unserer Fähigkeit ein, uns flexibel zu bewegen und zuversichtlich zu handeln, um nicht erneut verletzt zu werden. Die Narbe ist die bessere Alternative, denn sie bietet Schutz und hält das Gewebe zusammen. Aber sie hat auch Nachteile: Sie ist straff, hart, unbeweglich und wachstumsunfähig. Sie ist ein tauber Fleck. Das ursprüngliche gesunde, lebendige Gewebe wird nicht regeneriert.
Ob offene Wunde oder Narbe, ein ungelöstes Trauma ist eine Verengung des Selbst, sowohl physisch als auch psychisch. Es hemmt unsere angeborenen Fähigkeiten und erzeugt eine dauerhafte Verzerrung unserer Sicht auf die Welt und auf andere Menschen. Solange wir ein Trauma nicht aufgearbeitet haben, hält es uns in der Vergangenheit gefangen. Es beraubt den gegenwärtigen Augenblick seines Potenzials und schränkt uns in unserer persönlichen Entfaltung ein. Indem es uns dazu zwingt, verletzte und unliebsame Bestandteile unserer Psyche zu unterdrücken, zerteilt es unser Selbst in Bruchstücke. Solange wir es nicht sehen und anerkennen, hemmt es unser geistiges Wachstum. In vielen Fällen, wie zum Beispiel in meinem, beeinträchtigt es das Selbstwertgefühl, vergiftet Beziehungen und schmälert die Wertschätzung für das Leben als solches. In der frühen Kindheit kann es sogar eine gesunde Entwicklung des Gehirns beeinträchtigen. Und wie wir noch sehen werden: Ein Trauma kann Vorläufer und Mitverursacher von Krankheiten aller Art sein, und zwar im Verlauf des gesamten Lebens.
Zusammengenommen stellen diese Faktoren ein wesentliches und grundlegendes Hindernis für das Wohlergehen und Gedeihen vieler, vieler Menschen dar. Um noch einmal Peter Levine zu zitieren: »Traumata sind vielleicht die am meisten gemiedenen, ignorierten, verharmlosten, verleugneten, missverstandenen und unbehandelten Ursachen menschlichen Leidens.«24
Zwei Formen von Trauma
Bevor wir fortfahren, sollten wir zwei Formen von Trauma unterscheiden. Die erste wird üblicherweise von Klinikern und Lehrenden wie Levine und van der Kolk verwendet. Sie umfasst automatische Reaktionen und Anpassungen von Körper und Geist auf spezifische, identifizierbare, verletzende und überwältigende Ereignisse, sei es in der Kindheit oder später. Meine medizinische Arbeit hat mich gelehrt und die Forschung hat hinreichend belegt, dass zahlreichen Kindern schmerzhafte Dinge passieren: von offenem Missbrauch oder schwerer Vernachlässigung in der Herkunftsfamilie bis hin zu Armut, Rassismus oder Unterdrückung, die in vielen Gesellschaften zum Alltag gehören. Die Folgen können schrecklich sein. Solche Traumata sind weitaus häufiger, als gemeinhin angenommen wird. Sie führen zu einer ganzen Reihe von Symptomen und Syndromen sowie Zuständen, die als körperlich oder geistig pathologisch diagnostiziert werden. Dieser Zusammenhang wird in den Augen der Schulmedizin und der Psychiatrie kaum wahrgenommen. Es sei denn, es handelt sich um spezifische »Krankheiten« wie die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Diese Art der Verletzung wird mitunter als »Trauma mit großem T« bezeichnet. Sie liegt einem Großteil der Phänomene zugrunde, die als psychische Erkrankungen bezeichnet werden. Darüber hinaus schafft sie eine Anfälligkeit für körperliche Beschwerden. Sie begünstigt neben zahlreichen anderen Wirkmechanismen Entzündungen, erhöht das physiologische Stresslevel und beeinträchtigt die gesunde Funktion der Gene. Zusammengefasst kann man also sagen, dass ein Trauma mit großem T dann auftritt, wenn empfindsamen Menschen Dinge widerfahren, die nicht hätten passieren dürfen, wie z. B. die Misshandlung eines Kindes, Gewalt in der Familie, eine bittere Scheidung oder der Verlust eines Elternteils. All das sind Kriterien, die in den bekannten Studien über belastende Kindheitserfahrungen (Adverse Childhood Experiences, ACE) aufgestellt werden. Noch einmal: Die traumatischen Ereignisse selbst sind nicht mit dem Trauma – der Verletzung des Selbst – gleichzusetzen, das in der unmittelbaren Folge bei der betroffenen Person auftritt.
Es gibt noch eine andere Form von Trauma, die ich als nahezu universell in unserer Kultur bezeichne, und die manchmal als »Trauma mit kleinem t« bezeichnet wird. Ich habe oft erlebt, welche lang anhaltenden Spuren scheinbar alltägliche Ereignisse in der Psyche eines Kindes hinterlassen können. Ein bahnbrechender Forscher hat sie treffend als die »weniger denkwürdigen, aber schmerzhaften und weitaus häufigeren Unglücksfälle in der Kindheit« bezeichnet.25 Darunter fallen beispielsweise Mobbing durch Altersgenossen, die beiläufigen, aber wiederholten schroffen Kommentare eines wohlmeinenden Elternteils oder auch das Fehlen einer ausreichenden emotionalen Verbindung zu den betreuenden Erwachsenen.
Kinder, insbesondere hochsensible Kinder, können auf verschiedenste Weise verletzt werden: durch Schlimmes, das ihnen widerfährt, aber auch durch Gutes, das ihnen vorenthalten wird. Dazu gehört z. B. dass man sich nicht auf ihre Befindlichkeiten einstellt oder sie sich selbst von liebevollen Eltern nicht gesehen und akzeptiert fühlen. Ein derartiges Trauma setzt kein offenkundiges Leid oder Unglück der vorgenannten Art voraus. Es kann aber zu einer schmerzhaften Abkopplung vom Selbst führen, die dadurch entsteht, dass zentrale Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Der britische Kinderarzt D. W. Winnicott beschreibt diese Nicht-Ereignisse so: »Als etwas Positives hätte passieren können, passierte gar nichts« – ein Thema, auf das wir zurückkommen werden, wenn wir die menschliche Entwicklung in Augenschein nehmen. »Die Traumata des alltäglichen Lebens können uns leicht das Gefühl geben, ein mutterloses Kind zu sein«, schreibt der Psychiater Mark Epstein.26
Das »Trauma mit dem großen T« wird trotz jahrzehntelang vorhandener Belege nur in Ansätzen auf medizinischen Radarschirmen registriert. Das »Trauma mit dem kleinen t« hingegen verursacht noch nicht einmal ein Aufflackern. Wir unterscheiden zwar zwischen Traumata »mit großem T« und »kleinem t«. Trotzdem sollten wir angesichts des lückenlosen Zusammenhangs und des breiten Spektrums menschlicher Erfahrungen nicht vergessen, dass die Grenzen im täglichen Leben fließend, nicht leicht zu ziehen und nicht rigide festzulegen sind. Was die beiden Formen gemeinsam haben, hat Bessel van der Kolk kurz und bündig zusammengefasst: »Trauma ist, wenn wir nicht gesehen und verstanden werden.«
Es gibt drastische Unterschiede in der Art und Weise, wie die beiden Formen des Traumas das Leben und die Funktionsweise von Menschen beeinträchtigen können: Die Variante mit großem T ist im Allgemeinen weitaus belastender und behindernder. Trotzdem gibt es auch viele Überschneidungen. Beide stellen eine Zerrüttung des Selbst und der Beziehung zur Welt dar. Diese Zerrüttung ist das Wesen des Traumas. Wie Peter Levine schreibt, geht es bei einem Trauma »um den Verlust der Verbindung zu uns selbst, unseren Familien und der Welt um uns herum. Dieser Verlust ist schwer zu erkennen, da er langsam, geradezu schleichend geschieht. Wir passen uns, manchmal ohne sie zu bemerken, an diese subtilen Veränderungen an«.27 Wenn die verlorene Verbindung verinnerlicht wird, prägt sie unser Bild von der Realität: Unser Weltbild beginnt, dem zu entsprechen, was wir durch die zerbrochene Linse sehen. Es ist ernüchternd, zu erkennen, dass unser Selbstbild und die Art und Weise, wie wir uns gewohnheitsmäßig verhalten, oftmals zumindest teilweise aus traumatischen Verlusterfahrungen resultieren. Das schließt viele unserer scheinbaren »Stärken« ein, die funktionalsten sowie die dysfunktionalsten Aspekte unseres »normalen« Selbst. Für viele von uns mag auch der Gedanke befremdlich sein, dass wir, so glücklich und ausgeglichen wir uns auch fühlen mögen, möglicherweise dennoch irgendwo auf dem Traumaspektrum zu verorten sind, wenn auch weit entfernt vom Extrem des Traumas mit großem T. Letztlich scheitern alle Vergleichsversuche. Es spielt keine Rolle, ob wir auf andere Menschen verweisen können, die scheinbar stärker traumatisiert sind als wir, denn Leid lässt sich nicht mit dem Leid anderer vergleichen. Es ist auch alles andere als sinnvoll, unser eigenes Trauma zu instrumentalisieren, um uns über andere zu stellen – »Du hast nicht so gelitten wie ich« – oder es als Keule zu benutzen, um die berechtigten Vorwürfe anderer abzuschmettern, wenn wir uns destruktiv verhalten. Jeder von uns erträgt seine Wunden auf seine eigene Weise.
Was kein Trauma ist
Die meisten von uns haben schon einmal jemanden, vielleicht sogar sich selbst, so etwas sagen hören wie: »Oh mein Gott, der Film gestern Abend war so verstörend, dass ich total traumatisiert aus dem Kino kam.« Oder wir haben einen (typischerweise abwertenden) Nachrichtenartikel über Studierende an der Universität gelesen, die sich für »Inhaltswarnungen« einsetzen, damit sie nicht durch das, was sie zu hören bekommen, »retraumatisiert« werden. In all diesen Fällen ist die Verwendung des Begriffs zwar nachvollziehbar, aber unangebracht. Was die Menschen in diesen Beispielen tatsächlich meinen, ist Stress – körperlicher und/oder emotionaler Natur. Peter Levine stellt treffend fest: »Sicherlich sind alle traumatischen Ereignisse stressig, aber nicht alle stressigen Ereignisse sind traumatisch.«28
Ein Ereignis ist nur dann (re)traumatisierend, wenn es zu einer Beeinträchtigung führt, das heißt: zu einer anhaltenden psychischen (oder physischen) Einschränkung im Vergleich zum vorherigen Zustand. Vieles im Leben, auch in der Kunst, im gesellschaftlichen Umgang oder in der Politik, kann beunruhigend, erschütternd, ja sogar sehr schmerzhaft sein, ohne traumatisierend zu wirken. Das heißt nicht, dass alte traumatische Reaktionen, die nichts mit dem gegenwärtigen Geschehen zu tun haben, nicht durch aktuelle Stressfaktoren ausgelöst werden können – siehe zum Beispiel die Heimkehr eines gewissen Autors von einem Vortrag. Es ist aber nicht dasselbe wie eine Retraumatisierung, es sei denn unser Gefühl der Beklemmung verstärkt sich durch ein solches Erlebnis langfristig.
Die folgende Checkliste für ein Ausschlussverfahren ist recht zuverlässig. Es handelt sich nicht um ein Trauma, wenn die folgenden Punkte auf lange Sicht bestehen bleiben:
Es schränkt oder engt Sie nicht ein, verringert nicht Ihre Fähigkeit zu fühlen oder zu denken, sich selbst zu vertrauen oder sich zu behaupten, Leid zu empfinden, ohne in Verzweiflung zu verfallen oder es mit Anteilnahme zu durchleben.Es hindert Sie nicht daran, Ihren Schmerz, Ihre Trauer und Ihre Angst auszuhalten, ohne überwältigt zu werden und ohne dass Sie sich gewohnheitsmäßig in Arbeit oder auf irgendeine Weise in eine zwanghafte Selbstberuhigung oder Selbststimulation flüchten müssen.Sie sind nicht dem Zwang ausgesetzt, sich entweder selbst zu verherrlichen oder abzuwerten, um Akzeptanz zu finden oder um Ihre Existenz zu rechtfertigen.Ihre Fähigkeit, Dankbarkeit für die Schönheit und das Wunder des Lebens zu empfinden, wird nicht beeinträchtigt.Wenn Sie allerdings diese chronischen Zwänge bei sich selbst wiedererkennen, könnten sie durchaus den Schatten eines Traumas auf Ihrer Psyche darstellen und auf das Vorhandensein einer unverheilten emotionalen Wunde, ob mit großem oder kleinem T, hindeuten.
Trauma entkoppelt uns von unseren Körpern
»Sobald jemand in dich eingedrungen ist, gehört dein Körper nicht mehr dir«, erklärte mir die Schriftstellerin V, vormals bekannt als Eve Ensler. Sie erinnerte sich an den sexuellen Missbrauch durch ihren Vater, der ihr als junges Mädchen angetan wurde (siehe Kapitel 6). »Es ist ein Szenario des Schreckens, des Verrats, des Leids und der Grausamkeit. Der letzte Ort, an dem man sein möchte, ist der eigene Körper. Und so fängst du an, in deinem Kopf zu leben. Du fängst an, hier oben zu leben, ohne jede Chance, deinen Körper zu schützen, deinen Körper kennenzulernen. Ich hatte einen Tumor von der Größe einer Avocado in mir, und ich hatte keine Ahnung davon – so sehr war ich mir selbst fremd.« Obwohl die Details meiner Vergangenheit stark von Vs abweichen, weiß ich doch, wovon sie spricht. Viele Jahre lang war die schwierigste Frage, die man mir stellen konnte: »Was fühlst du?« Meine übliche Antwort war ein irritiertes »Woher soll ich das wissen?«. Bei der Frage nach meinen Gedanken hatte ich dieses Problem nie, sondern fühlte mich als ausgewiesener Kenner. Nicht zu wissen, wie oder was man fühlt, ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man sich von seinem Körper distanziert hat.
Wie kommt es zu einer solchen Entkopplung? In meinem Fall bedarf die Antwort keiner Spekulation. Als Kleinkind im Ungarn der Kriegszeit litt ich unter chronischem Hunger und Durchfall: Zustände akuten Unbehagens, die schon für Erwachsene bedrohlich und beängstigend sind, ganz zu schweigen von einem Einjährigen. Außerdem habe ich den Schrecken und die unablässige emotionale Not meiner Mutter in mich aufgesogen. Wenn keine Linderung in Sicht ist, besteht die natürliche – eigentlich die einzige – Reaktion eines jungen Menschen darin, die mit dem Leiden verbundenen Gefühle zu verdrängen und sich von ihnen zu lösen. Man erkennt den eigenen Körper nicht mehr. Sonderbarerweise kann sich diese Selbstentfremdung später im Leben in Form einer scheinbaren Stärke manifestieren, zum Beispiel in meiner Fähigkeit, bei Hunger, Stress oder Müdigkeit Höchstleistungen zu erbringen. Ich werde mir meines Bedürfnisses nach Pausen, Nahrung oder Ruhe nicht bewusst. Bei manchen Menschen äußert sich die Entfremdung von ihrem Körper auch darin, dass sie nicht wissen, wann sie aufhören sollen zu essen oder zu trinken – das Signal »genug« kommt nicht bei ihnen an.
In welcher Form auch immer: Die Selbstentfremdung ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebenserfahrung traumatisierter Menschen und ein zentraler Aspekt traumatischer Konstellationen. Wie in Vs Fall ist sie zunächst ein natürlicher Bewältigungsmechanismus des Organismus, der zwingend erforderlich ist. V hätte die Schrecken ihrer Kindheit nicht überleben können, wenn sie sich ihrer körperlichen und emotionalen Qualen in jedem einzelnen Moment bewusst gewesen wäre, wenn sie alles, was geschehen ist, in vollem Umfang wahrgenommen hätte. Und so kommen diese Bewältigungsmechanismen sozusagen auf den Schwingen der Gnade dahergeflogen: Sie retten uns auf kurze Sicht das Leben. Mit der Zeit jedoch, wenn sie nicht aufgearbeitet werden, verankern sie sich unauslöschlich in der Psyche und dem Körper. Die konditionierten Reaktionen verhärten sich zu festen Mechanismen, die der neuen Situation nicht mehr gerecht werden. Das Ergebnis ist chronisches Leid – und häufig, wie wir noch sehen werden, sogar Krankheiten.
»Das Bemerkenswerte an meiner Begegnung mit dem Krebs, an dieser ganzen Reise, war«, so V, »dass ich beim Aufwachen nach einer neunstündigen Operation und dem Verlust mehrerer Organe und siebzig Knoten – ich wachte mit Beuteln und Schläuchen auf, die aus mir herausragten – zum ersten Mal in meinem Leben ein Körper war ... Es war schmerzhaft, aber es war auch erhebend. ›Ich bin ein Körper. Oh mein Gott, ich bin hier. Ich bin in diesem Körper.‹« Ihre Schilderung des plötzlichen Gefühls, sich in ihrem physischen Körper zu Hause zu fühlen, steht exemplarisch dafür, wie Heilung funktioniert: Wenn sich die Fesseln des Traumas zu lösen beginnen, finden wir bereitwillig zu den entfremdeten Teilen unseres Selbst zurück.
Trauma nimmt uns den Instinkt
In Vs früher Notlage hätte die Natur einem Durchschnittsmenschen den Rat gegeben, zu fliehen oder sich gegen den Missbrauch ihres Körpers und die Angriffe auf ihre Seele zu wehren. Aber genau da ist der Haken: Beide Möglichkeiten stehen einem kleinen Kind nicht zur Verfügung, da es dadurch in noch größere Gefahr geraten würde. Aus diesem Grund greift die Natur auf Plan C zurück: Beide Impulse werden unterdrückt, indem die Emotionen, die diese Reaktionen bewirken würden, ausgeschaltet werden. Diese Unterdrückung ist mit der Schockstarre vergleichbar, die Lebewesen oft an den Tag legen, wenn weder Kampf noch Flucht möglich sind. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass das Opossum, sobald der Falke verschwunden ist, seinen Geschäften wieder nachgehen kann, da seine Überlebensstrategie erfolgreich war. Ein traumatisiertes Nervensystem hingegen ist nicht in der Lage, die Schockstarre einfach so hinter sich zu lassen.
»Der Zweck von Emotionen besteht darin, uns zu vermitteln, was unser Überleben begünstigt und was unserem Überleben entgegenwirkt«, hat der verstorbene Neurowissenschaftler Jaak Panksepp einmal gesagt. Emotionen, so betonte er, entstünden nicht aus dem denkenden Gehirn, sondern aus alten Gehirnstrukturen, die mit dem Überleben zusammenhingen. Sie sind Motor und Garant für Leben und Entwicklung. Intensive Wut mobilisiert zum Kampf, extreme Angst zur Flucht. Wenn also die Umstände vorschreiben, dass diese natürlichen, gesunden Impulse (sich zu verteidigen oder zu fliehen) unterdrückt werden müssen, müssen auch die als Bauchgefühl empfundenen Signale – die Gefühle selbst – unterdrückt werden. Kein Alarm, keine Mobilisierung. Wenn das selbstzerstörerisch zu sein scheint, so ist es das nur in einem begrenzten Sinn: Auf existenzieller Ebene ist eine solche Reaktion unter allen Optionen das »geringste Übel«, da sie die einzig verfügbare ist, die das Risiko weiterer Schäden senkt.
Im Ergebnis wird die eigene Gefühlswelt gedämpft und, als zusätzlicher Schutz, die eigene psychische Schale verhärtet. Ein anschauliches Beispiel liefert die Schriftstellerin Tara Westover in ihren Memoiren, dem Bestseller Befreit. Darin erinnert sie sich an die Auswirkungen des Missbrauchs durch ein Geschwisterteil, der von ihren Eltern mutwillig ignoriert wurde:
»Darin sah ich mich als unbrechbar, als empfindlich wie ein Stein. Anfangs glaubte ich das nur, aber dann wurde es eines Tages zur Wahrheit. Dann konnte ich mir ohne zu lügen sagen, dass es mich nicht berührte, dass er mich nicht berührte, weil nichts mich berührte. Ich verstand nicht, wie recht ich damit hatte und wie krank das war. Wie ich mich ausgehöhlt hatte. Obwohl ich von den folgen jenes Abends so besessen war, hatte ich doch die wesentliche Wahrheit missverstanden: Dass es mich nicht berührte, das war ihre Wirkung.«29 (Kursivschrift im Original)
Traumata beeinträchtigen die Reaktionsflexibilität
Eine Rückblende zur tragischen Eröffnungsszene unseres Kapitels, nur diesmal in einem Paralleluniversum, in dem meine traumatische Prägung nicht den Ton angibt: Das Flugzeug landet und Raes Text erscheint auf meinem Display. »Hmm, damit habe ich nicht gerechnet«, sage ich zu mir selbst. »Aber ich verstehe es: Sie ist wahrscheinlich in ihre Malerei vertieft. Das wäre nicht das erste Mal – und auch nichts, das ich persönlich nehmen müsste. Eigentlich kann ich das gut nachempfinden: Wie oft war ich schon so in meine Arbeit vertieft, dass ich die Zeit vergessen habe? Okay, ich nehme einfach ein Taxi.« Es kann gut sein, dass ein Gefühl der Enttäuschung in mir aufsteigt. In diesem Fall erlaube ich mir, es zuzulassen, bis es vorübergeht – statt der Opferrolle wähle ich die Verwundbarkeit. Wenn ich zu Hause ankomme, bin ich nicht aufgebracht, ziehe mich nicht emotional zurück und schmolle nicht. Vielleicht mache ich ein paar harmlose Sticheleien, aber alles innerhalb der Grenzen des liebevollen Humors und mit intakter Zuneigung.
Ich hätte damit an den Tag gelegt, was man als Reaktionsflexibilität bezeichnet: Die Fähigkeit zu wählen, wie wir mit den unvermeidlichen Höhen und Tiefen des Lebens, seinen Enttäuschungen, Erfolgen und Herausforderungen umgehen. »Zur menschlichen Freiheit gehört die Fähigkeit, zwischen Stimulus und Reaktion innezuhalten und in dieser Pause diejenige Reaktion zu wählen, auf die wir uns einlassen wollen«, schreibt der Psychologe Rollo May.30 Ein Trauma beraubt uns dieser Freiheit.
Die Reaktionsflexibilität ist eine Funktion des mittleren Frontallappens unserer Großhirnrinde. Kein Säugling wird mit dieser Fähigkeit geboren: Das Verhalten von Säuglingen wird durch Instinkt und Reflex gesteuert, nicht durch bewusste Entscheidungen. Die Entscheidungsfreiheit entfaltet sich mit der Entwicklung des Gehirns. Je früher ein Trauma einsetzt und je schwerwiegender es ist, desto weniger Gelegenheit hat die Reaktionsflexibilität, sich in den entsprechenden Gehirnschaltkreisen zu verankern, und desto schneller wird sie deaktiviert. Man verfällt in vorhersehbare, automatisierte Abwehrreaktionen, vor allem wenn man Stressfaktoren ausgesetzt ist. Sowohl emotional als auch kognitiv verengt sich unser Bewegungsspielraum. Je schwerer das Trauma ist, desto enger sind die Grenzen gesetzt. Die Vergangenheit kapert und vereinnahmt wieder und wieder die Gegenwart.
Traumata erzeugen ein schambehaftetes Selbstbild
Einer der traurigsten Briefe, die ich je erhalten habe, stammte von einem Mann aus Seattle. Er hatte mein Buch über Süchte, Im Reich der hungrigen Geister, gelesen. Darin lege ich dar, dass eine Sucht eine Folge kindlicher Traumata sein kann – nicht die einzig mögliche, aber eine weit verbreitete. Neun Jahre lang war er nüchtern, hatte aber immer noch Probleme, war seit zehn Jahren nicht mehr berufstätig und wurde wegen einer Zwangsstörung behandelt. Obwohl er das Buch faszinierend fand, schrieb er: »Ich widerstehe der Versuchung, meiner Mutter die Schuld zu geben. Ein Stück Scheiße bin ich wegen mir ganz allein.« Ich musste seufzen: Selbstverletzende Scham