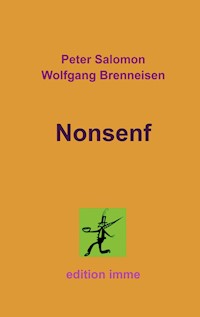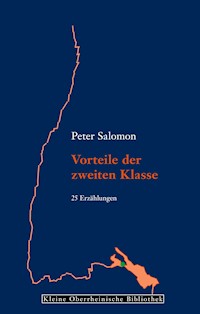
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünfundzwanzig autobiographisch grundierte Kurzgeschichten des bedeutenden Dichters vom Bodensee. Der Lebensstoff seiner Jugendjahre in Berlin und der späteren Zeit in Konstanz wird so erzählt, dass exemplarische Bilder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstehen. Salomons Blick auf die Dinge des Alltags offenbart immer auch deren Komik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die folgenden Erzählungen beruhen auf wahren Begebenheiten.
Bei Wolfgang Luber (Berlin) bedanke ich mich für zahlreiche Details zur Geschichte »Attentate«. Gleichzeitig bitte ich um Nachsicht, falls er seine Informationen nicht wiedererkennt. Die Namen lebender Personen wurden verändert, nur bei Prominenten nicht.
Gelegentliche Wechsel von Perspektive und Tempi innerhalb der Geschichten sind Absicht.
Inhalt
Die erste Erinnerung
Eine schwierige Geburt
Sonderwünsche
Mein Vater
Diekmann
Das Ende meiner Gefangenschaft
Immer gut
Dööfi
Hasenbraten
Bubi Scholz und Thomas Mann
Sonntage
Meine Investitionen 1957
Bericht über eine Reise nach Tunesien
Die kleine Puseratze
Auf dem Hornberg
Samuel Beckett
Meyerbeer
Attentate
Drei Leute
Autorenlesung in Überlingen
Der Aktenbock
Vorteile der zweiten Klasse
Richard Möhring
Müller und Freud
Erfindungen
Die erste Erinnerung
Dies ist meine erste Erinnerung: Ich stehe neben einem Stuhl und halte mich am Stuhlbein fest. Manchmal bin ich auch unter dem Stuhl, so klein bin ich. Der Stuhl steht an einem runden oder ovalen Tisch. Um den Tisch herum stehen noch andere Stühle, auf denen Leute sitzen. Auf dem Stuhl, an dem ich mich festhalte, sitzt mein Vater. Die Leute auf den Stühlen reden laut und durcheinander. Ich vermute heute, es war eine Skatrunde. Vater hatte Freunde oder Bekannte zum Skat eingeladen oder einfach bloß zum Trinken und Reden. Aber ich meine, es waren keine Frauen dabei. Ich stand an Vaters Stuhl, und niemand beachtete mich. Skatspielen war fesselnd und aufregend, sie redeten laut durcheinander. Übrigens hasse ich Skatspielen beziehungsweise: Ich kann es gar nicht. Die Männer redeten und redeten, das heißt, sie schrien sich über den Tisch hinweg an. Ich verstand aber nichts. Ich dachte:
»Was haben die Erwachsenen bloß immer so viel zu reden.« Das dachte ich wirklich, dabei war ich höchstens vier Jahre alt, eher noch jünger, kleiner.
Wie kommt es, daß man glaubt, »eine erste Erinnerung« zu haben? Also wirklich die erste, nicht »eine ganz frühe«, die zweite oder dritte, sondern unumstößlich die erste. Haben diese Phantasie nur Leute, die schon viele Autobiographien gelesen haben? Die Autobiographie von Charles Bukowski, Das Schlimmste kommt noch, beginnt zum Beispiel so:
»Meine erste Erinnerung ist, daß ich unter etwas war. Es war ein Tisch, ich sah ein Tischbein, die Beine von Menschen und ein Stück herabhängendes Tischtuch.«
Ich finde, das ist ziemlich ähnlich wie meine erste Erinnerung, außer daß Bukowski nichts gedacht hat. Ich schwöre aber, daß ich meine schon hatte und notiert habe, ehe ich das Buch von Buk las. Irgendwie blöd, daß meine nicht origineller ist als die von Buk! Ist es etwa so, daß bei allen Menschen die erste Erinnerung unter einem Stuhl oder unter einem Tisch stattfindet?
Vielleicht haben aber nur Schriftsteller eine sogenannte erste Erinnerung, weil sie wissen, wie man Bedeutung herstellt. Eine erste Erinnerung ist ja entschieden besser als keine erste Erinnerung. Nur der sprachlose Alltagspöbel hat keine erste Erinnerung.
Wie entsteht denn das Bewußtsein von Chronologie?
Haben nicht die expressionistischen Dichter die Simultandichtung erfunden, den Simultanismus? Sie haben dem Weltgefühl der Gleichzeitigkeit nachgespürt und zeitlich verschiedenes einfach aneinandergereiht. Das war nach 1911 modern, aber sicher schon von den Griechen übernommen.
Lieber Jakob van Hoddis, lieber Alfred Lichtenstein – was war denn euer erstes Erlebnis, äh, eure erste Erinnerung? Dazu haben die Herren nichts beigetragen.
Ich schwöre, daß alles so gewesen ist, wie meine Erinnerung es festgehalten hat. Der Meineid ist nur strafbar, wenn man vorsätzlich falsches Zeugnis ablegt. Irrtum ist entschuldigt, wenn man sich Mühe gegeben hat. Außerdem wird kein Staatswalt gegen mich ermitteln, weil meine Erinnerung ja Literatur geworden ist, da ist ein Schwur gar nicht wirklich.
Ich bin stolz darauf, eine erste Erinnerung zu haben. Bloß an die zweite Erinnerung oder an die dritte oder an die siebzehnte kann ich mich nicht erinnern. Aber ich will es versuchen. Vielleicht sollte ich ein Buch schreiben: »Meine 833 schönsten Erinnerungen« – Sie können sich schon darauf freuen.
Eine schwierige Geburt
Er wurde am 4. September 1947 in Berlin-Schöneberg geboren – also nicht lange nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es war ein Donnerstag gegen 13 Uhr im Franziskus-Krankenhaus in der Burggrafen-Straße. Es soll eine schwierige Geburt gewesen sein, langwierig und schmerzhaft (bis heute).
Das Franziskus war ein Krankenhaus der katholischen Kirche, und das weibliche Personal arbeitete in Nonnentracht. Die Eltern waren damals noch pro forma evangelisch, hatten aber sonst keinen Bezug zur Religion. Mein Vater war praktischer Arzt, das war die Bezeichnung für Ärzte ohne Facharztausbildung; heute nennen sie sich Facharzt für Allgemeinmedizin. Die medizinische Versorgung in Berlin war schlecht, die Krankenhäuser ausgebombt, beschädigt, mit defekten oder geplünderten Gerätschaften. »Es fehlte an allem«, sagte der Vater. Er hatte das Franziskus deshalb für die anstehende Geburt ausgewählt, weil es das modernste und am besten ausgestattete war. Die Katholische Kirche, sagte er, hatte Beziehungen zu den Alliierten und verfügte nach dem Krieg über Geld und die besten Krankenhäuser – jedenfalls in technischer Hinsicht. Und als Arzt hatte er schließlich auch Beziehungen, seine Praxis war in der Nachbarschaft.
Als die Wehen einsetzten, waren die Eltern im Kino in der nahe gelegenen Courbierstraße. Dort lief der Film »Der Graf von Monte Christo«, die Verfilmung von 1943. Sie konnten ihn nicht bis zum Ende ansehen und gingen vor Schluß nach Hause, um sich für den Gang zum Krankenhaus bereit zu machen. Es war ein beschwerlicher Fußweg, immer wieder unterbrochen von Wehen-Attacken, die zum Anhalten zwangen. Der Wind heulte durch die stehengebliebenen Mauern der Ruinen. Schöneberg war der am meisten zerstörte Berliner Stadtteil. Zuhause hatte man schon eine gepackte Tasche mit allem Nötigen für den Krankenhausaufenthalt bereitstehen. Die Eltern tranken Tee und lasen, nebenher dudelte das Radio. Die Wehen kamen und gingen. Plötzlich durchrasten Feuerwehr- und Polizei-Autos mit Signallichtern und Sirenen die sonst leeren Straßen.
Die Musik wurde durch eine Sondermeldung unterbrochen, die besagte, daß im Courbier-Kino die Saaldecke eingestürzt war. Es war im Erdgeschoß gelegen, darüber war das Haus ausgebombt worden, und ein großer Trümmerberg lag noch auf der Decke des Kinos. Die Trümmer waren erst teilweise abgeräumt worden. Man war der Meinung, die Decke würde den Rest tragen und man könne sich erst einmal Wichtigerem zuwenden. In den Sitzreihen zehn bis zwölf, wo auch die Eltern gesessen hatten, hatte es Tote gegeben und Schwerverletzte. Die Mutter sagte oft im späteren Leben:
»Wenn wir noch zwanzig Minuten länger geblieben wäre, wären wir alle tot gewesen – und du wärst gar nicht geboren worden!«
Die Radiohörer wurden aufgefordert, zum Blutspenden zu kommen.
Nun wurden die Wehen unerträglich. Der Vater nahm die gepackte Tasche und führte die Mutter zum Krankenhaus. Dort begann sogleich die Geburt; sie hat sechzehn Stunden gedauert. Der Vater verlangte, daß der Mutter Schmerzmittel gegeben werden. Das wurde ihm mit religiöser Begründung abgeschlagen. Später hat er einen Kaiserschnitt vorgeschlagen. Man hat ihn darauf hingewiesen, daß man hier in einer konfessionellen Klinik sei, wo eine Geburt so stattzufinden habe, wie der Herr es wolle. Künstliche Geburtshilfe wurde dort nicht praktiziert. Schmerzmittel waren Tabu, Kaiserschnitt war Sünde. Die Mutter war halb bewußtlos vor Schmerzen. Sie konnte aber noch denken. Sie dachte:
»Das überlebe ich nicht.«
Als er dann da war, dachte sie:
»Nie wieder!« Daran kann sie sich erinnern, davon sprach sie später immer wieder. Und das wiederholte sie bei jeder passenden Gelegenheit:
»Wenn du ein behindertes Kind gewesen wärst, hätte ich dich in ein Heim gegeben, ich hätte das nicht gekonnt.«
Das hörte er nicht gerne.
Über die schlechten Umstände bei seiner Geburt wurde lebenslang geklagt. Man war überzeugt, daß »die im Krankenhaus« von vornherein etwas gegen die Eltern gehabt hätten.
»Die wußten, daß wir nicht katholisch waren, sondern daß wir das Krankenhaus-Bett nur durch Vaters Beziehungen bekommen haben; die wollten eigentlich nur Katholen behandeln, und mich haben sie das spüren lassen.«
»Außerdem, was war Dein Vater denn für ein Arzt, der nicht mal ein paar Schmerztabletten in seiner Jackentasche hatte? Warum hat er das vergessen? Die hätten doch gar nicht gemerkt, wenn er mir ein paar Tabletten in den Mund gesteckt hätte. Wie kann man nur so gedankenlos sein?«
Der Vater hielt sich bei diesem Thema jahrzehntelang zurück, er ließ die Mutter reden.
»Erst an seinem achtzigsten Geburtstag hat er mich angemeckert, ich hätte mich auch extrem blöde angestellt. Er habe früher schon bei hunderten Geburten assistiert und noch keine Frau gesehen, die sich so dämlich angestellt habe. Ich sollte mich entspan nen, aber auch pressen, das sei die ganze Kunst.«
Das vergißt sie nie und vergibt sie ihm nie. So ungerecht ist er gewesen – entspannen und pressen gleichzeitig – das hätte ER mal machen sollen!
Und zu ihm, Hugo, sagte sie:
»Du warst eine schwierige Geburt. Ich habe mir geschworen: Einmal und nie wieder! Und das habe ich eisern durchgezogen. Deshalb bist Du ein Einzelkind geblieben.«
Sechzehn Stunden hatte das Einzelkind in Scheiße, Urin, Blut und Schleim festgesteckt. Er war ein braves Kind, kein Geschrei nachts, immer freundlich.
Sonderwünsche
Ich hatte immer Sonderwünsche und suchte nach Gründen, damit sie mir erfüllt wurden.
Zum Beispiel gefiel es mir, das Klassenzimmer verlassen zu dürfen, während die Mitschüler weiter im Unterricht gefangen waren. Es war ein Genuß, während der Unterrichtszeit durch die Tür zu treten und alleine durch die menschenleeren Flure zu gehen. Vor dem Unterricht oder nach dem Unterricht oder in den Unterrichtspausen erlebte man die Flure der Schule ja immer nur als Teil einer lauten, wuseligen Masse.
Ein Grund für eine Sondererlaubnis sah so aus:
»Ich habe in der Pause vergessen, die Dose mit den Regenwürmern wieder zu schließen. Ich muß nachschauen, damit die Viecher nicht in der Gegend rumkriechen.« Oder waren es Mehlwürmer? Ich hatte eine Zeit lang das Amt, die Fische im Aquarium zu füttern, das auf der mittleren Galerie des Lichthofs stand.
»Na dann geh mal und fang die Biester wieder ein«, sagte der Lehrer. Ich schloß die Klassentür hinter mir und trat langsam auf die Galerie. Ich ging nicht gleich nach links zur Haupttreppe, sondern rechts herum, damit ich den ganzen Lichthof umrunden konnte. Kein Mensch außer mir war unterwegs, nicht mal ein Lehrer. Aus den Klassenzimmern drangen Stimmen, teils auch Gelächter. Bei meiner Umrundung schaute ich irgendwann über das Geländer der Galerie. Ganz unten auf dem Boden des Lichthofs lag ein kleiner Schüler auf dem Bauch, etwas komisch verrenkt. Um ihn herum hatte sich eine dunkle Flüssigkeit ausgebreitet. Ich schaute in aller Ruhe herunter. Es stimmte, es war ein Schüler, und er bewegte sich kein bißchen.
Sollte ich wieder in die Klasse zurückgehen und Herrn Hensel alarmieren? Oder laut um Hilfe rufen? Ich entschloß mich, meinen Weg fortzusetzen und mir das Unglück erst mal selbst aus der Nähe anzusehen. Denn ich nahm an, daß der Schüler von einer Galerie über das Geländer gefallen war – und zwar zu einer Zeit wie jetzt, als alle Welt in den Klassenzimmern war und Unterricht hatte. Er war offenbar vor mir alleine unterwegs gewesen.
Als ich die drei Treppen herunter gegangen war, beugte ich mich zu dem Körper herunter. Der Kopf war zur Seite gedreht, und ich konnte das Gesicht sehen. Es war ein Schüler, den ich vom Sehen kannte, er hieß Klaus. Er war mir immer wieder aufgefallen, weil ich ihn auffällig hübsch fand. Etwas älter als ich, sehr schlank, leuchtend blond. Aber wir hatten nie miteinander gesprochen.
Dann kam der Hausmeister und brüllte wie ein Irrer herum. Dann kamen Lehrer, die Mühe hatten, die neugierigen Schüler wegzudrängen. Die am meisten gebrüllten Sätze waren:
»Bleibt weg! Bleibt weg hier! Das ist nichts für Kinder!«
»Bleibt weg, Kinder, hier gibt’s nichts zu kucken!«
Mich zog jemand am Oberarm weg.
Die Feuerwehr holte Klaus ab. Er war tot.
Es hieß, er sei von der obersten Galerie gesprungen. Bei einem anderen Sonderausflug ging ich da hoch und kuckte von der vermuteten Absprungstelle runter. Ich mußte meine Phantasie nicht sonderlich anstrengen. Ich sehe ihn heute noch ganz deutlich da unten liegen, jederzeit. Ich bekam die Sondererlaubnis, mit meinen Eltern außerhalb der Ferienzeit eine Flugreise nach Tunesien zu machen, drei Wochen.
Mein Vater
Mein Vater war kein guter Geschäftsmann. Als einer der ersten Soldaten kam er aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Zu Fuß war er bis nach Berlin geflüchtet. Es war der 14. Juli 1945, ein heißer Sommertag. Meine Mutter schaute vom Balkon der Wohnung Motzstraße 25, wo sie mit ihrer Mutter ein Sonnenbad nahm. Ihr Blick ging geradeaus in die Kalckreuthstraße, die hier in die Motzstraße mündet. Und da sah sie ihn. Er lief ganz normal wie ein Spaziergänger auf ihr Haus zu. Das war sein Ziel.
Schon am 1.1.1946 eröffnete er schräg gegenüber, Kalckreuthstraße 10 / Ecke Motzstraße, seine Arztpraxis. Es gab kaum Ärzte zu dieser Zeit. Den ganzen Tag über saßen vierzig Kranke im Wartezimmer, darüber hinaus wurden sie weggeschickt. Eine Frau, der man ansah, daß sie einmal sehr dick gewesen war, weil Haut und Fettgewebe schlaff an ihr runterhingen, sagte:
»Ich bin Emmy Göring.« Mein Vater, der Arzt, sagte:
»Doch hoffentlich nicht die Frau des alten Nazi-Fettsacks?«
»Ja«, sagte sie, »der Generalfeldmarschall ist mein Mann.«
Er lebte damals noch. Sie drehte sich um, rauschte raus, die Praxistür knallte. Einen besonderen Rochus hatte er auf Patienten, die wegen kleiner Wehwehchen krankgeschrieben werden wollten. Trotz des Männer- und Ärztemangels hatte mein Vater bald nur noch eine Praxis mittleren Zuschnitts. Die verbliebenen Patienten mochte er wie Familienmitglieder, und sie blieben ihm über Generationen treu. Anfangs lebte ich ja noch nicht, aber später kannte ich auch viele, sogar mit Namen, weil er immer beim Mittagessen von ihnen erzählte. Alle hatten sie Angst vor dem Sterben, besonders Herr Mölter. Herr Mölter fragte meinen Vater jede Woche:
»Herr Doktor, meinen Sie daß ich dieses Jahr noch sterben werde?«
»Dabei ist er das blühende Leben«, sagte der Vater und lachte mit vollem Mund.
Die Angst vor dem Tod, das war die Hauptkrankheit seiner Patienten. So schien es mir, und so erzählte es mein Vater. Und das ist auch meine Hauptkrankheit geworden.
Diekmann
Der Antiquariatskatalog Nr. 15 von Marcus Haucke (Berlin) ist auf der Vorderseite ganz bekritzelt. Meine Schrift ist schlecht zu lesen. Sie bedeckt die Reproduktion eines gezeichneten Entwurfs von Friedrich Schröder-Sonnenstern, zwei phantastisch anmutende Figuren. Mit meiner Krakel-Schrift dar über sieht das richtig gut aus, als gehörten Bild und Schrift zusammen. Links oben in der Ecke steht: »tel. Mutter 9.7.00, 17.00«. Sie hat mir da also etwas erzählt, und ich habe mir dazu paar Notizen gemacht. Hier habe ich die Langfassung wiederhergestellt.
Herr Diekmann war nicht Zahnarzt, sondern Dentist. Also ein Zahnklempner mit Schmalspurausbildung. Der war ein so netter Mann. Unsere ganze Familie ist immer bei ihm Patient gewesen. Wir wohnten Kalckreuthstraße 10, die Diekmanns schräg links gegenüber. Vati war aus der russischen Gefangenschaft geflohen und schon am 14.7.1945 in Berlin angekommen, der erste Kriegsheimkehrer aus Russland sozusagen. Mutter stand auf dem Balkon der Wohnung ihrer Eltern in der Motzstraße 25, das ist an der Stelle, wo die Kalckreuthstraße einmündet, die Nummer 10 ist das Eckhaus an der selben Kreuzung, diagonal gegenüber. Es war schönes Wetter, und sie schaute die Kalckreutstraße hoch. Und wer kommt da langgelaufen? Ihr Mann, später mein Vater. Er war ein paar Tausend Kilometer gelaufen, erst aus Rußland nach Köln, wo seine Eltern lebten und von dort dann weiter nach Berlin. Tolle Sache, was!