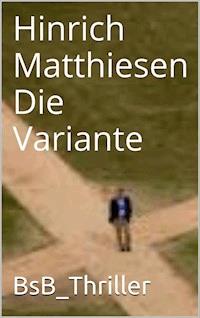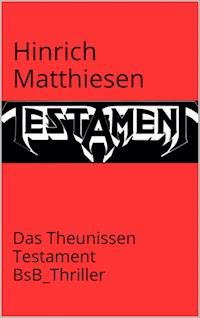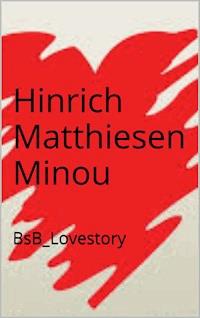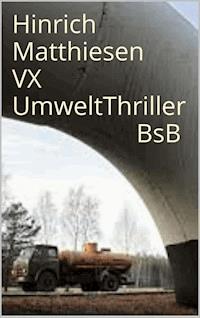
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Best Select Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hinrich Matthiesen Werkausgabe Die Romane
- Sprache: Deutsch
VX – hinter diesen beiden so harmlos aussehenden Buchstaben verbirgt sich eines der gefährlichsten Giftgase, die der Mensch jemals zu Vernichtungszwecken erfunden hat. Als der Landwirt Frank Golombek, an dessen Acker ein Giftgasdepot der Amerikaner grenzt, entdeckt, in welch todbringender Nachbarschaft er lebt, beschließt er, ein Signal zu setzen. Er will seiner Umgebung und auch der Öffentlichkeit beweisen, dass sich auch ohne Kriegsfall jeden Tag eine Katastrophe ereignen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinrich Matthiesen
Jahrgang 1928, auf Sylt geboren, wuchs in Lübeck auf. Die Wehrmacht holte ihn von der Schulbank. Zurück aus der Kriegsgefangenschaft, studierte er und wurde Lehrer, viele Jahre davon an deutschen Auslandsschulen in Chile und Mexico. Hier entdeckte er das Schreiben für sich.
1969 erschien sein erster Roman: MINOU. Dreißig Romane und einige Erzählungen folgten. Die Kritik bescheinigte seinem Werk die glückliche Mischung aus Engagement, Glaubwürdigkeit, Spannung und virtuosem Umgang mit der Sprache. Die Leser belohnten ihn mit hohen Auflagen.
Immer stehen im Mittelpunkt seiner Romane menschliche Schicksale, Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Hinrich Matthiesen starb im Juli 2009 auf Sylt, wo er sich Mitte der 1970er Jahre als freier Schriftsteller niedergelassen hatte.
»Zum literarischen Markenzeichen wurde der Name Matthiesen nicht zuletzt durch die Kunst, in eine pralle Handlung Aussagen zu verweben, die außer dem aktuellen stets auch einen davon unabhängigen Bezug haben. Gedankliche Strenge, sprachliche Disziplin und ein offensichtlich unauslotbarer verbaler Fundus lassen Matthiesen zu einem Kompositeur in Prosa werden.«
Deutsche Tagespost
»Matthiesen ist zu beneiden um seine Fähigkeiten: Kompositionstalent, menschliche Einfühlung, scharfe Beobachtungsgabe – und vor allem um seinen Stil«
Deutsche Welle
»Matthiesen ist für seine genauen Recherchen bekannt. Seine Bücher weichen nicht einfach in exotische Abenteuer aus, sondern befassen sich immer wieder mit deutscher Vergangenheit und Gegenwart. Unterhaltsam sind sie allemal.«
FAZ-Magazin
Werkausgabe Romane Band 20
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Der Roman
VX – hinter diesen beiden so harmlos aussehenden Buchstaben verbirgt sich eines der gefährlichsten Giftgase, die der Mensch jemals zu Vernichtungszwecken erfunden hat. Als der Landwirt Frank Golombek, an dessen Acker ein Giftgasdepot der Amerikaner grenzt, entdeckt, in welch todbringender Nachbarschaft er lebt, beschließt er, ein Signal zu setzen. Er will seiner Umgebung und auch der Öffentlichkeit beweisen, dass sich auch ohne Kriegsfall jeden Tag eine Katastrophe ereignen kann.
Titelverzeichnis der Werkausgabe in 31 Bänden am Ende des Buches
Hinrich Matthiesen
VX
Roman
:::
BsB_BestSelectBook_Digital Publishers
Werkausgabe Romane
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Band 20
1.Teil
1.
Frank Golombek lag bäuchlings auf einem Strohschober und hielt den Feldstecher auf den etwa zweihundert Meter entfernten Kontrollturm gerichtet. Das Stahlgerüst in seinem Fadenkreuz erinnerte ihn an den Hochsitz im Jagdrevier des Großvaters, zumal auch jetzt die Zeit der Äsung war, fünf Uhr am Morgen. Er dachte daran, wie er damals, eingeschmiegt in die Lodenjacke des alten Mannes, das Wild beobachtet hatte. Ganz deutlich kam ihm das gut vierzig Jahre alte Bild vor Augen: Der Nebel auf den tiefliegenden Wiesen und die aus dem wattigen Weiß herausragenden Köpfe der Rehe. Es hatte ausgesehen, als badeten die Tiere in Milch. Sogar seine Nase erinnerte sich. In dem schweren olivgrünen Stoff der Jacke hatte immer ein ganz eigentümlicher Geruch gesteckt, ein bisschen Stalldunst, ein bisschen Tabakrauch und dazu der ätzende Duft von Mottenkugeln, eine scheußliche Mixtur, die der Zehnjährige aber bereitwillig auf sich genommen hatte, weil es eine so große Sache war, hoch oben neben dem Großvater zu sitzen und die im Nebel stehenden Rehe zu zählen.
Er legte das Glas auf die schwarze Folie, die das Stroh schützte, wischte die Erinnerung weg, sah wieder hinüber zu dem etwa sieben Meter hohen Turm, den er nun, mit bloßem Auge, kaum noch von den ringsum aufragenden Bäumen unterscheiden konnte. Er wusste, das Männer auf der stählernen Plattform standen, die nicht Ausschau hielten nach Tieren, sondern nach Menschen, und die strikten Schießbefehl hatten.
Erneut nahm er den Feldstecher auf, schwenkte ihn ganz langsam herum, ließ den Blick wandern, vom Turm weg auf den daneben befindlichen Maschendrahtzaun, dessen obere, aus einem Stachelgeflecht bestehende Kante nach außen gebogen war. Und dieser Umstand, das die Neigung außen bestand und nicht innen, hätte ihm, wäre es seine erste Inspektion gewesen, sicher verraten, worum es bei der Barriere ging: Es kam nicht darauf an, Menschen am Hinauskommen zu hindern, sondern am Eindringen. Doch das wusste er längst, wie er überhaupt eine ganze Menge wusste über das vor ihm liegende, mit Wald, Buschwerk und zahlreichen Gebäuden bestandene Areal, von dem selbst die Rehe sich fernhielten.
So war ihm bekannt, dass es außer dem Turm, der nur einer von vielen war, und dem drei Meter hohen Zaun noch einiges mehr gab, das ein Eindringen verhindern sollte, zum Beispiel im Boden vergrabene Sensoren, die jede Erschütterung des Untergrundes, ob nun von Füßen oder von Fahrzeugen hervorgerufen, festhielten und damit die Männer in der Wachzentrale alarmierten. Und auch, dass ein aus der Luft kommender Eindringling durch Raketenbeschuss abgewehrt werden konnte, wusste Frank Golombek. Ja, er kannte sich aus, soweit das möglich war bei einem Objekt, das zu dentop-secretsderNATOgehörte und über dessen Existenz die deutsche Bundesregierung sich in Schweigen hüllte.
Der Diemen, auf dem er lag, war nicht der einzige Platz, von dem aus er dann und wann das Camp der Amerikaner in Augenschein nahm. Auf jedem seiner Felder lag mindestens eines dieser Strohbündel, und eigentlich hätte es in die Scheune gehört, aber er wollte das ganze Jahr über die Möglichkeit haben, seine Beobachtungen von erhöhtem Standort aus vorzunehmen. Meistens allerdings geschah das von seinem Haus aus, denn es stand keine hundert Meter vom Zaun entfernt. Er legte Wert darauf, das verhasste Objekt von allen Seiten unter Kontrolle zu halten, und dazu boten seine rund um das Depot liegenden Ländereien genügend Möglichkeiten, die er vorwiegend in den ersten Morgenstunden nutzte. Er war Frühaufsteher, lebte überhaupt einen sportlichen Stil. Das hing mit seinem Beruf zusammen. Als Inhaber eines Gestüts saß er jeden Tag im Sattel. Sein schmales Gesicht war wettergebräunt, sein Körper schlank und beweglich. Man sah ihm nicht an, dass er schon dreiundfünfzig Jahre alt war.
Er schwenkte das Fernglas ein kleines Stück weiter, blickte auf den Eingang des Reservats. Links und rechts neben der Einfahrt stand je ein Turm. Dazwischen versperrte ein Schlagbaum die Straße. Vor dem Schlagbaum ging, mit geschulterter MP, ein Posten auf und ab. Ein weiterer ebenfalls bewaffneter Mann musste vor dem Schilderhäuschen stehen; ihn sah er jetzt nicht, aber er wusste von dieser zusätzlichen Wache, weil er schon zweimal bis an den Schlagbaum vorgedrungen war, nicht heimlich, sondern während einer vom Gemeinderat durchgeführten Begehung. Bei der Gelegenheit hatte er auch gesehen, dass einer der Türme, die hier nicht aus Metall, sondern aus Beton waren, in ein langgestrecktes zweistöckiges Gebäude überging. Es war das Herzstück der Kontrollanlagen. Hier saßen rund um die Uhr Männer an Telefonen und Monitoren. Sie waren mit den Wachmannschaften verbunden, und bei ihnen gingen auch die Signale der im Vorfeld des Camps vergrabenen Sensoren ein.
Nein, dachte er, da hinein komme ich nie! Es sei denn, es gelingt mir, Kontakt zumColonelaufzunehmen, dem das Lager untersteht. Vielleicht sollten wir ihn einfach mal einladen. Ich werde das mit Katharina besprechen. Falls er kommt, wird er über sein geheimesNATO-Nest natürlich nicht viel erzählen, aber möglicherweise hält der Kontakt an, vertieft sich sogar, und in ein paar Wochen nimmt er mich mit bis hinter den Zaun.
Er schob sein Fernglas ins Etui, kroch zurück, glitt langsam vom Stroh herunter, machte sich auf den Weg. Als er die Landstraße erreicht hatte, stieg er in seinen Jeep und startete.
Er fuhr sehr langsam. Nach zehn Minuten erreichte er Wasloh, sah auf das kleine gelbe Schild mit dem Ortsnamen und dann auf das große weiße daneben, dessen Text er auswendig kannte: »Willkommen in Wasloh, dem Ort, der Sie wieder jung werden lässt! Bleiben Sie und besuchen Sie unsere Heilquellen! Baden Sie sich gesund in unserem berühmten Thermalwasser! Nähere Informationen, auch über Ihre Hotelunterkunft, erteilt Ihnen unser Fremdenverkehrsamt im Rathaus.«
Er fuhr durch die Hauptstraße, dachte: Es ist Mitte Mai, und doch sind unsere Gästehäuser fast leer! Sein Blick streifte die erst kürzlich erneuerte ockerfarbene Fassade des Hotels »Zur alten Sägemühle«. Ein schönes, gepflegtes Haus, dachte er, aber in seinen Betten liegen nur ein paar Greise. In zwei oder drei Stunden stehen sie auf und beginnen ihr Regenerationsprogramm. Am Nachmittag schleppen sie ihre rheumatischen Knochen durch unsere Straßen, trinken hier einen Schonkaffee, fotografieren dort einen alten Hausgiebel, vorausgesetzt, sie können ihren Fotoapparat noch halten, reden von nichts anderem als von ihren Gebrechen und kippen abends erschöpft in die Betten. Ja, diese Veteranen kommen auch jetzt noch, weil sie entweder von dem nahen US-Depot nichts wissen oder ihre Therapie ihnen wichtiger ist als alles andere. Oder ganz einfach, weil sie sich sagen: Nach uns die Giftflut! Ein echter Gästestamm jedenfalls, wie jeder Kurort ihn braucht, sind sie nicht.
Er verließ das Städtchen, fuhr an Wiesen und Kornfeldern entlang, die zu seinem Hof gehörten. Es war guter, kraftvoller Boden. Die Gerste stand schon ziemlich hoch, und ihr Anblick ließ ihn erneut an das Gift denken, dasColonelBraden in seinem Depot verwaltete. Noch einmal ging ihm der ganze Zynismus auf, mit dem die Menschen dieser Gegend es zu tun hatten: Immer wieder predigten die Naturschützer, die Politiker und tausend Leute mehr, man solle die Verwendung von Insektiziden nach Möglichkeit einschränken, und nur einen Steinwurf von seinen Feldern entfernt, ganz nah dem idyllischen Wasloh mit seinen elftausend Einwohnern, lagerten, versteckt in unterirdischen Bunkern, riesige Mengen von Kampfstoffen, die nicht für die Vertilgung von Insekten, sondern für die von Menschen vorgesehen waren. Rund ein Dutzend Mal schon hatten die Wasloher gegen »McRonalds Giftküche«, wie sie das amerikanische Depot nannten, demonstriert, mit Särgen, so als ginge es bereits um die Bestattung der Opfer, mit Spruchbändern und Schildern, die das allen bekannte Symbol zeigten: den Totenkopf über zwei gekreuzten Knochen. Einige der Demonstranten hatten sogar Gasmasken getragen. Doch die Proteste hatten nichts erbracht außer einem Schaden, den die Menschen dieser Region mehr und mehr zu spüren bekamen. Über die Demonstrationen wurde in den Medien berichtet, und die Folge davon war, dass das landschaftlich reizvolle Gebiet, das vor allem wegen seiner noch weitgehend unbeschädigten Waldbestände und seiner zahlreichen Heilquellen für Ferien- und Kuraufenthalte genutzt wurde, in Verruf geriet. Die Gästezahlen gingen drastisch zurück, und innerhalb weniger Jahre mussten nicht weniger als siebzehn Hotelbesitzer Konkurs anmelden. Die Immobilienpreise rutschten auf einen Stand hinab, der es kaum einem Verkäufer erlaubte, sich von dem Erlös irgendwo anders in Deutschland eine neue Existenz aufzubauen, und so hatten einige der wohlhabenden Wasloher Familien ihre Besitzungen nicht verkauft, sondern nur verlassen in der Hoffnung, in nicht allzu ferner Zeit werde das Giftlager geräumt und man könne zurückkehren. Immerhin wurde seit langem über die Abschaffung von Chemie-Waffen debattiert.
Er erreichte die Einfahrt, fuhr auf dem planierten Weg an der Langen Wand der Reitbahn entlang, hielt vor den Stallungen, stieg aus. Er winkte den beiden jungen Männern zu, die die erste Fütterung besorgten, und ging dann ins Haus.
Er war überrascht, zu so früher Stunde Marianne anzutreffen. Sie saß am Küchentisch, trank Kaffee. Er beugte sich über sie, küsste ihr die Stirn. »Schon aufgestanden?«
»Ja, Vater. Ich konnte nicht schlafen. Und du? Warst du mal wieder auf einem deiner Strohdiemen?«
»Ja, das Übliche: Hinfahren, Sehen, Nichtsmachenkönnen, Bösewerden, Wiedernachhausefahren. Ist auch ein Kaffee für mich da?«
»Klar. Setz dich!«
»Ich zieh’ mir nur schnell was anderes an.«
Er verließ die Küche, ging ins Obergeschoss, verhielt sich leise, um seine Frau nicht zu wecken. Während er sich umzog, dachte er an Marianne, die sicher mal wieder – ähnlich wie er selbst – von Unruhe und Angst aus dem Bett getrieben worden war. Sie hatte ihr eigenes Problem. Sechsundzwanzig Jahre war sie jetzt alt, und sechsundzwanzig Jahre alt war auch das deprimierende Bild, das sie ihren Eltern, ihrer Umwelt, vor allem aber sich selber bot. Ein »Horrorbild«. Dieses Wort hatte er, der Vater, nach ihrer Geburt aus sich herausgeschrien. Zwar hatten die Ärzte Katharina und ihn gründlich darauf vorbereitet, aber eben nur mit Worten, und die hatten nicht ausgereicht, ihm und seiner Frau eine Vorstellung zu geben von dem, was sie erwartete. Er hatte sich abgewendet von der hundertfünfzig Jahre alten Bauernwiege, in der schon viele Golombeks gelegen hatten, Jungen und Mädchen, blonde und dunkelhaarige und auf jeden Fall immer ganz normal aussehende Babys. An jenem 4. Dezember des Jahres 1961, als er seine Tochter zum ersten Mal sah, hatte er für die großen dunklen Augen und das dunkelblonde, seidig schimmernde Haar zunächst keinen Blick. Er kehrte sich gleich wieder ab, schrie das fürchterliche Wort vom »Horrorbild« aus sich heraus und hatte Mühe, auf den Beinen zu bleiben.
Dem kleinen Mädchen fehlten beide Arme. Dort, wo sie hätten sein sollen und auch zu finden gewesen wären, wenn nicht irgendwelche Chemiker mit Thalidomid experimentiert und daraus das Contergan entwickelt hätten, saßen – wie Seehundsflossen – die beiden Fragmente. Die Hände waren da, jede mit fünf Fingern, aber sie waren aus den Schultern herausgewachsen. Als er sich dann zum zweiten Mal der Wiege näherte und auf sein Kind sah, begriff er nicht, dass es ganz friedlich dalag, mit offenen Augen. Es wollte ihm nicht in den Schädel, dass ein Menschenkind so betrogen auf die Welt gekommen war und nicht sofort mit allem, was es an Stimme nur haben mochte, protestierte, sondern ergeben in seinen Kissen ruhte. Und obwohl es selten geschieht, dass wenige Stunden alte Säuglinge lächeln, sah er sein Kind lächeln, und in diesem Augenblick war die Liebe da.
Ja, das war der 4. Dezember des Jahres 1961 gewesen, und nun, sechsundzwanzig Jahre später, saß unten in der Küche eine schöne junge Frau, die ihr Abitur gemacht hatte und nach einer gründlichen Ausbildung vier Fremdsprachen nahezu perfekt beherrschte. Und was links und rechts aus ihren Ärmellöchern herausguckte, waren für ihn keine monströsen Seehundsflossen, nein, er nannte sie Engelsflügel.
Als er wieder zu Marianne trat, hatte sie ihm den Kaffee schon eingeschenkt. Dass sie die Kanne ergreifen, sie ruhig halten und den Kaffee in eine Tasse gießen und noch vieles, vieles mehr konnte, war in der Familie längst kein Gesprächsthema mehr. Sie konnte es. Punktum.
»Warum hast du so schlecht geschlafen?«, fragte er.
»Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich auf eine Nachricht von Alejandro warte. Ich möchte endlich wissen, ob er sein Examen bestanden hat.«
Der junge Chilene Alejandro war Mariannes Brieffreund und wohl auch etwas mehr. Alle vierzehn Tage lag ein blassblauer Umschlag mit dem AufdruckCorreo Aereound den turbulenten Schriftzügen im Briefkasten. Schon seit anderthalb Jahren korrespondierten die beiden miteinander. Sie hatten sich nie gesehen, aber jeder besaß das Foto des anderen. Alejandros Bild stand auf Mariannes Schreibtisch. Eine Aufnahme im Freien. Der junge Mann unter den Palmen vor derUniversidad Católicavon Valparaíso. Sie dagegen hatte ihm ein Passbild geschickt. Es war zwar auf Postkartenformat gebracht worden, zeigte jedoch nur den Kopf.
Der Vater griff über den Tisch, strich seiner Tochter durchs Haar. »Mit Sicherheit hat er sein Examen bestanden und ist jetzt ein frischgebackener Referendar. Du weißt doch: Wenn es mal etwas länger dauert mit der Post von drüben, liegt es an den Unruhen, die das Land seit Jahren durchmacht.«
Sie nickte. »Hast wahrscheinlich recht, aber die Ungeduld kriegt man auch mit den stichhaltigsten Erklärungen nicht weg. Ich wachte heute früh um vier auf, und dann stellte ich mir vor, wie er von seinen Prüfern mit Fragen bombardiert wird. Bei mir war es ja nicht so. Erstens hatte ich davor kaum etwas anderes gemacht als gelesen und gelernt, und zweitens: Wer lässt schon eine wie mich durchfallen!«
»Kind, er hat es bestimmt geschafft. Du darfst ihn gern anrufen. Denk nur an den Zeitunterschied. Drüben ist es jetzt Mitternacht.«
»Danke, Vater. Anrufen lieber doch nicht. Wir haben es ja einmal gemacht, und das war für mich fast so, als hätte ich vor ihm gestanden. Das ist das Schöne an den Briefen: Sie verbinden uns, und zugleich geben sie mir den Schutz, den ich nun mal brauche.«
»Beim Telefonieren würde er dich zwar auch nicht sehen, aber ich versteh’ dich schon.«
Sie stand auf. »Ich reite jetzt aus. Wenn ich zurück bin, ist ja vielleicht ein Brief aus Chile da.«
2.
Sie hieß Zayma und war innerhalb der Gruppe schon fast eine Kultfigur. Sah ein Mann sie zum ersten Mal, so dachte er an die Märchen aus »Tausendundeiner Nacht« und träumte davon, wenn auch nicht gleich die ganzen tausend, so doch wenigstens die eine einzelne mit ihr zu verbringen. Doch keinem der fünf Männer derVITANOVAwar es bislang vergönnt gewesen, auch nur einen Flirt mit ihr zu haben. Sie war sehr wählerisch, hielt alle auf Distanz. Ihr letztes intimes Erlebnis hatte sie vor sechs Wochen in Stockholm gehabt, als die Gruppe den neuen Auftrag entgegennahm.
Sie war vierundzwanzig Jahre alt und hatte schwarzes Haar, dunkelbraune Augen und einen für eine Nordafrikanerin ungewöhnlich hellen Teint. Trotz ihrer kleinen und zierlichen Gestalt wirkte sie nicht zerbrechlich, im Gegenteil, die Geschmeidigkeit ihrer Bewegungen ließ sie stark und sicher erscheinen, grad so, wie ein Raubtier grazil und dennoch seinen Gegnern überlegen sein kann. Hilario, der Südamerikaner in der Gruppe, hatte ihr den NamenLa Panteragegeben, die Pantherin.
Sie war eine Kabylin mit französischem Einschlag und stammte aus der Cyrenaika. In der Organisation raunte man, sie sei vom Vater her eine direkte Nachfahrin des sagenhaften Berberfürsten Abd-el-Kader. Sie hatte das nie bestätigt, nur eines Abends ihren Gefährten eine Geschichte erzählt, die dazu angetan war, dem Geraune Nahrung zu geben. Nach einem gelungenen Waffenraub aus einer Bundeswehrkaserne hatte sie den um sie versammelten Männern und Frauen den Verlauf der legendären, vor über hundert Jahren bei Constantine geschlagenen Berberschlacht so detailliert und anschaulich beschrieben, als wäre sie dabei gewesen. Mit gekreuzten Beinen hatte sie auf dem Fußboden gesessen und durch Worte, Gesten und Blicke die Zuhörer in ihren Bann gezogen. Sie hatte jede Gelegenheit genutzt, das Gemetzel in seiner ganzen Grausamkeit auszumalen. Vor allem war es ihr darauf angekommen, die blutrünstigen Berberfrauen des Marabuts Bou Ziane zu schildern, die den herannahenden Feinden, so sie ihrer nur habhaft werden konnten, den Garaus machten: Sie zogen die Männer nackt aus, fesselten sie und stachen mit Messern auf sie ein, töteten sie aber zunächst nicht, um ihnen die mörderischen Qualen so lange wie möglich zu erhalten. Zum Schluss schälten sie ihnen – wie es lange davor auch die Azteken mit ihren Opfern getan hatten – die Herzen aus den Leibern. Die brieten sie sich und hielten dann Mahlzeit. Unter Zaymas damaligen Zuhörern war auch ein siebzehnjähriger Deutscher gewesen. Er hatte es nicht fassen können, dass eine so schöne Frau eine so schreckliche Geschichte fast genüsslich zum Besten gab, und sein Entsetzen auch offen bekannt. Darauf hatte sie nur geantwortet: »Der Kampf gegen die Ungläubigen kannte keine Einschränkung der Mittel. Die Feinde zu strafen, war Dienst an Allah.«
An dem Morgen, an dem Frank Golombek von seinem Strohschober aus das US-Depot beobachtet hatte, wollte die junge Libyerin nach Kellbach, und wenn sie eine Stunde früher unterwegs gewesen wäre, hätte sie ihm begegnen können, denn sie befand sich in einem schon vor mehreren Wochen in Frankreich gestohlenenTOYOTAauf derselben Straße, die er benutzt hatte, durchfuhr ebenfalls, wenn auch in entgegengesetzter Richtung, den Ort Wasloh, kam an dem Strohschober vorbei, kehrte dann aber dem Depot den Rücken, indem sie links abbog. Um Viertel nach sieben erreichte sie Kellbach. Sie durchfuhr den Ort, und als sie auf der jenseitigen Ausfallstraße einige hundert Meter zurückgelegt hatte, scherte sie aus und gelangte auf den zu dieser frühen Stunde noch fast leeren Parkplatz des Tennisclubs.
Sie hielt, zog den Schlüssel ab und sah in den Spiegel, prüfte Haar und Make-up. Wie jedes Mal beim Besuch des Clubs trug sie eine blonde Perücke. Innerhalb der Gruppe hatten sie lange überlegt, ob es in Anbetracht der beim Tennis unvermeidlichen heftigen Bewegungen und der verstärkten Schweißbildung nicht sinnvoller wäre, das Haar zu färben. Schließlich aber hatte Zayma sich dann doch für die Perücke entschieden; der mehrfache Rollenwechsel mit eingefärbtem Haar wäre zu umständlich geworden. Sie hatte, damit das für ihren Schutz so wichtige Requisit nicht ins Rutschen geriet, ein Haftmittel benutzt und dort, wo der Perückenrand verlief, zusätzlich ein besonders festes Stirnband angelegt.
Die Prüfung ergab, dass das Haar gut lag, die Bräune in ihrem Gesicht jedoch ein bisschen scheckig aussah. Sie griff in ihren Campingbeutel, der auf dem Beifahrersitz stand, holte die flache, dunkelblaue Plastikflasche mit derEmulsion Faciale Teintéeheraus, schraubte den Deckel ab und drückte sich ein wenig von der braunen Paste in die Hand, blickte wieder in den Spiegel und verrieb die Schminke auf ihrem Gesicht, kontrollierte das Ergebnis, war zufrieden, legte die Flasche wieder in den Campingbeutel. Dann steckte sie sich ein Kaugummi in den Mund. Sie verabscheute Kaugummi, aber Robert, der Chef derVITANOVA, hatte gesagt: »Nimm so ein Ding und schieb es, während du Tennis spielst, tüchtig hin und her! Das ist amerikanisch. Außerdem ist es geil. Es zeigt diesem Braden, was dein Mund alles kann. Und wir wissen ja, der Kerl steht auf so was.« Also hatte sie ihren Widerwillen überwunden und sich ein Päckchen Kaugummi besorgt.
Es war heute das vierte Mal, dass sie so früh am Morgen den Club besuchte. Zwei Tennisstunden pro Woche hatte sie mit demColonelvereinbart, eine dienstags, eine freitags, jeweils von halb acht bis halb neun. Und wirklich, schon bei der dritten Begegnung hatte der fünfzigjährige, etwas dickliche Ami mit ihr anzubändeln versucht. Er hatte es, vielleicht tatsächlich ermuntert von dem lasziv hin und her geschobenen Kaugummi, sehr direkt und frivol angestellt, hatte ihr im Vorraum zum Sanitärbereich des Clubs auf den Hintern geklopft, dann auf die Tür zu den Herrenduschen gezeigt und gesagt: »Komm doch da mit rein!«
»Nein«, hatte sie ihm geantwortet, dabei aber gelächelt, denn es sollte ja noch ein nächstes Mal geben.
Dann hatte er gedrängt: »Wir sind allein! So früh am Morgen spielt hier kein Mensch außer uns beiden.«
Darauf hatte sie ihm die verheißungsvolle Antwort gegeben: »Heute bitte nicht.«
Das war am Dienstag gewesen, und nun dachte sie: Diesmal wird er es wohl etwas energischer betreiben, und das ist gut. Sie nahm ihren Campingbeutel auf, stieg aus dem Wagen und ging zum Clubhaus.
Braden war schon da. Er saß auf einem Hocker, erhob sich, als er sie sah, kam auf sie zu und gab ihr die Hand. Dabei sagte er: »Ruth Silbermann, du trittst ein, und der mieseste Morgen wird schön.«
Sie hatte sich als Tochter eines jüdischen Fabrikanten ausgegeben, der mit seiner Familie eine Kur in Wasloh machte. Um Nachfragen in den Hotels vorzubeugen, hatte sie demColonelerzählt, ihre Eltern hätten ein Privathaus gemietet.
»Danke«, sagte sie, »das ist ein schönes Kompliment.«
Sie sprachen englisch miteinander. Er kehrte sofort, wie sie es erwartet hatte, zu seiner Aufdringlichkeit zurück: »Dienstag sagtest du: ›Heute bitte nicht!‹ Nun haben wir Freitag.« Es klang, als wäre mit dieser Feststellung alles Weitere abgesteckt.
»Ja«, antwortete sie, »aber ich muss um neun Uhr meinen Vater abholen. Er hat einen Termin beim Arzt und fährt nicht gern selbst.«
»Dann spielen wir nicht bis halb neun, sondern machen nur einen schnellen Satz.«
Wieder lächelte sie. »Und danach?«
»Duschen wir, von mir aus auch ohne Wasser.«
»Dann schon lieber mit.«
Jeder ging in seinen Umkleideraum, und wenige Minuten später trafen sie sich auf dem Platz. Sie spielten etwa gleich gut. Er hatte die Sonne gegen sich, aber sie nutzte seinen Nachteil nicht aus, war nicht ganz bei der Sache oder – im Grunde genommen – doch bei der Sache, dachte, während der Ball hin und her flog, an ihren Auftrag und an ein paar Einzelheiten, die die Recherche über denColonelMatthew Braden ergeben hatte: Fünfzig Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Die beiden Söhne auch schon beim Militär. Der ältere war Marine-Arzt, und der jüngere diente in Texas bei derUS-Air-Force.Mrs. Braden und die siebzehnjährige Tochter Dorothée lebten in Boston. Seit drei Jahren leitete Braden das Giftdepot von Wasloh, das alsNATO-Einrichtung den US-Code GY 350 führte. Dort lagerten laut Nachforschungen derVITANOVAneben Tabun, Sarin und Soman auch fünfhundert Tonnen des Nervengases VX.
»Sorry!«, rief Braden. Er hatte einen Passierball gelandet, den sie nicht mehr erwischte, und sie sagte sich: Seinsorryist natürlich nur die Höflichkeit des Mannes vor dem Beischlaf.
Etwas später, als sie eigentlich die Plätze hätten wechseln müssen, er aber darauf bestand, weiterhin gegen die Sonne zu spielen, legte sie ihm auch das als einen Winkelzug aus, als den wohlüberlegt eingesetzten Charme, mit dem er ans Ziel wollte. Und sie dachte: Ich will auch ans Ziel!
Es war warm. Sie begann zu schwitzen, zog ihren langärmeligen Baumwollpullover aus. Noch am Morgen hatte sie das seit dem Dienstag schon wieder nachgewachsene tiefschwarze Achselhaar ausrasiert und die beiden Stellen überpudert. Das war wichtig gewesen, denn wie sie selbst und ihre Leute, so waren auch Männer wie derColonelgeeicht auf alles, was aus der Reihe fiel, und Hellblond und Tiefschwarz an ein und demselben Körper hätten ihn mit Sicherheit stutzig gemacht.
Sie war froh, dass dieser Pykniker aus Boston da vor ihr hin und her hüpfte, ohne am Platzrand seineBodyguardpostiert zu haben. Als Robert gesagt hatte, es sei nur über den Tennisclub zu schaffen, hatten die anderen gemeint, auch dort habe er vermutlich ein paar Gorillas bei sich. Also hatte sie sich zunächst nur zur Beobachtung nach Kellbach begeben, hatte dann gesehen, dass der Fahrer denColonelzum Clubhaus brachte und gleich wieder verschwand. Bei einem weiteren Besuch hatte sie erkundet, dass der Wagen um elf Uhr zurückkam, der am Steuer sitzende GI jedoch eine Dreiviertelstunde lang draußen warten musste, bis nämlich sein Boss das Gespräch mit den anderen Spielern beendet hatte. Beim dritten Mal schließlich hatte sie sich an den Tresen gesetzt und von Braden ansprechen lassen. Das Ergebnis war die Verabredung zum Tennisspiel gewesen. Als Clubmitglied hatte er das Recht, externe Spieler einzuladen. Aber sie hatte gleich gesagt: »Ich kann nur morgens um halb acht.« Und er hatte geantwortet: »Das macht nichts. Ich steh’ sowieso jeden Morgen um sechs Uhr auf; also dreh’ ich meinen Tagesplan ein bisschen um.«
Die Wahl der frühen Stunde hatte sich dann bewährt. Fast immer waren sie allein. Nur ein junger Spanier, der zum Personal gehörte, war ihnen hin und wieder unter die Augen gekommen. Er hatte Papier aufgesammelt oder die weißen Markierungen auf den Nachbarplätzen erneuert, und beim letzten Mal hatte er hinter der Theke gestanden und Gläser gespült.
Ihr flog ein scharfer Ball gegen die Brust. Sofort lief Braden ans Netz, kletterte sogar darüber hinweg, und diesmal sagte er: »So sorry!« Dassoklang zum Gotterbarmen. Doch sie hatte in ihrer Heimat eine harte Ausbildung durchlaufen, und ein Tennisball war schließlich kein Stein. Sie wehrte Bradens Beflissenheit ab, nahm seine Hand, die partout die getroffene Stelle streicheln wollte, schob sie allerdings nicht brüsk weg, sondern hielt sie eine Weile fest, was zwar immer noch Abwehr bedeutete, aber auch Kontakt. »Not here«, sagte sie, und das war mindestens so verheißungsvoll wie dasnot todayvom letzten Mal. Glücklich kehrte er zu seiner Grundlinie zurück.
Um kurz vor acht hörten sie auf. Er hatte sechs zu vier gewonnen. Sie gingen ins Clubhaus, und im Vorraum zu den Duschen entspann sich dann wieder der kleine, tändelnde Dialog, den sie ganz bewusst lenkte, indem sie behutsam Abweisendes einflocht. Auch das hatten sie in der Gruppe oft erörtert: dass die als Köder eingesetzten Frauen manchmal alles verpatzten, weil im entscheidenden Augenblick ihre Bereitschaft plötzlich durchschaubar wurde. Ein falsches Wort, eine zu rasche Geste, und der andere war gewarnt, zog sich sofort zurück. Zayma hatte nicht nur die Bewältigung physischer Anforderungen erlernt, sie war auch psychologisch geschult worden und besaß überdies einen untrüglichen Instinkt hinsichtlich der richtigen Wahl und Dosierung ihrer Mittel.
»Aber…, aber… wenn nun doch plötzlich jemand hier erscheint?«
»Das ist ausgeschlossen! Ich hab’ vorhin im Plan nachgesehen. Die nächsten sind Dr. Wegener und seine Frau, und die spielen erst um neun, werden also frühestens um Viertel vor neun hier sein.«
»Wir könnten doch auch… irgendwann mal… vielleicht in einem Hotel…«
»Das geht nicht. Man kennt mich hier.«
»Ich meine ja auch weiter weg.«
»Das ist dann schon wieder eine Zeitfrage. Außerdem möchte ich es jetzt. Bitte!«
Sie schickte einen hilflosen Blick zur Decke.
»Bitte!«, sagte er noch einmal.
»Aber die Duschkabinen haben keine Türen, jedenfalls bei uns nicht. Es sind nur gekachelte Nischen, und bei euch wird es genauso sein.«
»Falls wirklich jemand kommt, versteckst du dich hinter meinem Rücken; der ist breit genug. Aber du kannst sicher sein: Es kommt keiner! Los!« Er ergriff ihre Hand, doch sie befreite sich, und dann sagte sie: »Okay. Geh schon vor! Stell auch schon die Dusche an, sonst ist es mir zu…, na ja, zu direkt.«
»Und wenn du dann nicht kommst und ich mir am ganzen Körper eine Waschhaut hole?«
Ist das die Klippe?, überlegte sie. Was geht jetzt hinter seiner Stirn vor? Kommt ihm womöglich die Idee, das Ganze könnte eine Falle sein, von langer Hand vorbereitet? Schnell entschloss sie sich zu einer Geste, die sie eigentlich hatte vermeiden wollen. Sie griff an den unteren Rand ihres T-Shirts, zog es in die Höhe, erst langsam, dann mit einem Ruck bis hinauf zum Hals, erlaubte dem ungeduldigen Mann einen Blick auf ihre kleinen, festen Brüste.
»Glaubst du mir jetzt, dass ich komme?«
Er wollte mit beiden Händen zupacken, aber rasch schob sie das T-Shirt wieder herunter und wich zurück, ließ jedoch der optischen Frivolität die verbale folgen: »Ich bring’ dir die beiden gleich vorbei.«
Er lachte laut auf. »Wirklich alle beide?«, fragte er.
»Wirklich.«
»Okay. Wie lange wird es dauern?«
»Nicht lange. Ich zieh’ mich nur schnell aus und komm’ dann im Bademantel. Dem sieht man, wenn er bei euch hängt, nicht an, ob er männlich oder weiblich ist.«
»Okay«, sagte er noch einmal und rieb sich sogar die Hände. »Bis gleich!«
»Bis gleich!«
Er verschwand. Sie lauschte durch die geschlossene Verbindungstür, wartete, bis sie den Wasserstrahl hörte. Dann ging sie in den Umkleideraum, wechselte die Kleidung, öffnete ihren Campingbeutel, nahm ein Frotteetuch heraus und legte es auf die Bank. Sie griff noch einmal in den Beutel und hielt gleich darauf das lindgrüne Kunststoffgehäuse eines Föhns in der Hand. Aber es war, obwohl mit Schnur und Stecker versehen, kein Rohr für ein Heißluftgebläse, sondern eine Attrappe. Sie klappte sie auf, holte eineWALTHER PPKhervor, griff ein drittes Mal in den Beutel und fischte diesmal eine Regenschirmhülle heraus, entnahm ihr einen Schalldämpfer und setzte ihn auf den Lauf. Dann entsicherte sie die Waffe und wickelte sie in ihr Handtuch. Sie schob die Föhn-Attrappe und das Regenschirmfutteral in den Beutel zurück und ging, in der Linken den Beutel, in der Rechten das Tuch mit derWALTHER, in den Vorraum. Dort setzte sie den Beutel ab, öffnete kurz die Flurtür, sah den Gang entlang, der zum Clubraum führte, entdeckte niemanden, schloss die Tür wieder.
Von nun an leistete sie sich keine Verzögerung mehr, trat rasch ein in den Duschraum der Männer, hörte jetzt das Rauschen sehr laut, sah den Dampf, ging sofort auf die letzte der fünf Duschen zu und stellte sich vor den nackten Colonel. Der sagte: »Hallo!« Dann blieb ihm eine halbe Sekunde, um durch den Dampfschleier hindurch das schwarze, auf ihn gerichtete Rohr zu erkennen, und die reichte natürlich nicht zum Reagieren. Zweimal ertönte in rascher Folge das »Plop«. Braden griff sich an die Brust, sackte in sich zusammen. Zayma sah noch, wie sich das in den Abfluss laufende Rinnsal des Duschwassers rot färbte. Sie brauchte sich nicht davon zu überzeugen, dass der Mann tot war, denn auch das Schießen hatte sie gelernt, und diesmal hatte die Distanz weniger als einen Meter betragen.
Sie schob die Waffe in das gefaltete Handtuch und verließ den Duschbereich. Im Vorraum wollte sie gerade ihren Beutel öffnen, da ging die Flurtür auf. Es war der Spanier. Er hatte einen Werkzeugkasten in der Hand und sagte, als er eingetreten war und die Tür hinter sich geschlossen hatte, auf Deutsch: »Bitte, entschuldigen Sie, ich muss hier ein Waschbecken reparieren.«
Sie antwortete nicht. Diese Situation hatten sie in der Theorie viele Male durchgespielt: das Auftauchen des unbeteiligten, des zufälligen Zeugen oder auch einer Person, die mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb von Sekunden zum Zeugen werden konnte. Das Rezept dafür war brutal, aber es gab kein anderes, es sei denn, man gefährdete sich selbst. Und hier, das wusste sie, war das Risiko so groß, dass sie möglicherweise nicht mal mehr den Weg zu ihremTOYOTAschaffen würde. So war diesmal sie es, die »sorry!« sagte.
Sie zog das Handtuch weg, und dann lief es ähnlich ab wie bei demColonel. Ehe der Spanier überhaupt begriffen hatte, was die blondeseñoritada in ihrer kleinen Hand hielt, war schon das zweimalige »Plop« ertönt. Es gab ein furchtbares Getöse, weil der schwere Werkzeugkasten auf die Fliesen krachte. Auch der Spanier griff sich an die Brust, knickte dann ein, sank auf die Knie und kippte zur Seite.
Schnell steckte sie Waffe und Handtuch in den Beutel und umrundete den vor der Tür liegenden Toten, wollte verschwinden. Doch da kam ihr eine Idee. Natürlich, dachte sie, wird man den Hausmeister bald vermissen, wird nach ihm rufen, ihn suchen, und vielleicht wird man im Sanitärbereich nur die Tür zum Vorraum öffnen und, wenn er dort nicht ist, zunächst woanders weitersuchen. Sie legte noch einmal ihre Sachen ab, bückte sich, schleifte den Spanier zu den Herrenduschen, zog ihn in die vorletzte Nische. Dann trug sie auch seinen Werkzeugkasten dorthin, wischte im Vorraum die Blutspuren weg und machte sich auf den Weg.
Sie lief nicht, sondern ging mit ganz normalen Schritten durch das Clubhaus und dann hinaus auf den Parkplatz, setzte sich in den Wagen und fuhr los. Als sie aus Kellbach heraus war, beschleunigte sie, fuhr schließlich mit hundertvierzig Stundenkilometern.
Neun Minuten nach Verlassen des Tennisclubs hatte sie den Wasloher Forst erreicht. Sie bog in einen Waldweg ein, hielt, nahm die Perücke ab, stieg, den Beutel in der Hand, aus. Dann lief sie hinein in den Wald, lief eine Viertelstunde ohne Unterbrechung, bis sie auf eine schmale Straße stieß. An der ging sie entlang, hielt sich dabei im Schutz der Bäume. Nach drei Minuten hatte sie eine Abzweigung erreicht, auf der, hinter einer Kurve, ihr VW-Käfer stand. Sie setzte sich hinters Lenkrad, startete, näherte sich vorsichtig wieder der Straße und vergewisserte sich, dass keine anderen Autos kamen. Schnell bog sie auf die Fahrbahn und fuhr mit mäßigem Tempo weiter.
Die Tarnung ihres Wagens war pittoresk. Nicht das Unauffällige, sondern das Auffallende schützte ihn. Es war ein typischesYoungster-Auto mit bunter Bemalung und vielen Aufklebern. Zwei der Etiketten hafteten an der Scheibe des Rückfensters. Das eine war ein weißer Streifen, und seine Aufschrift lautete: »Schon eine einzige Atombombe kann dir den ganzen Tag versauen!« Das andere war rund, zeigte ein Gespenst, und darunter standen die Worte: »Geisterfahrer haben etwas sehr Entgegenkommendes!«
Sie fuhr mit ihrem Papageienvehikel vierzig Minuten, kam durch sieben Ortschaften. In der achten, in Neuenburg, hielt sie vor einem grauen Mietsblock. Sie stieg aus und ging ins Haus. Im vierten Stock öffnete sie mit ihrem Schlüssel eine Wohnungstür.
Im Flur stand Robert, und aus einem der Zimmer kam Hilario dazu.
»Und?«, fragte Robert.
»Es war einmal einColonel«, antwortete Zayma.
Sie sprachen, wie immer innerhalb der Gruppe, deutsch.
»Sehr gut!« Robert klopfte ihr auf die Schulter.
»Ging alles glatt?«, wollte Hilario wissen.
»Nicht so ganz. Grad als ich den Vorraum verlassen wollte, kam der Hausmeister, um ein Waschbecken zu reparieren.«
»Verdammt!« Robert schlug mit der Faust gegen die Wand. »Das gibt es doch gar nicht! Hast du dich denn nicht genügend abgesichert?«
»Es war Zufall, und…«
»Ach was, Zufall! Der hat euch vorher rumknutschen sehen und gedacht: Ich guck’ mir mal an, was die jetzt unter der Dusche machen! Das war ein Spanner. Kann das sein?«
»Schon möglich.«
»Na und? Nun sag schon, was hast du gemacht?«
»Es war einmal ein Hausmeister. Oder ein Spanner. Oder was immer der war.«
3.
Schon um zehn Uhr kam die Meldung über den Rundfunk. Frank Golombek und seine Frau Katharina saßen auf der Terrasse und frühstückten. Diese spätmorgendliche Zusammenkunft war bei ihnen seit vielen Jahren Gewohnheit, und fast immer hörten sie dann zunächst die Nachrichten.
Der Sprecher verkündete:
»Heute früh ist der amerikanische Oberst Matthew Braden, Chef einer in der Bundesrepublik stationierten US-Sondereinheit, im Duschraum des Kellbacher Tennisclubs erschossen aufgefunden worden. Er wurde das Opfer eines Terroranschlags, bei dem außer ihm ein Angestellter des Clubs, der siebenundzwanzigjährige Spanier Sergio Valdés, ums Leben kam. Zu dem Doppelmord bekannte sich kurz nach der Tat die als extrem militant geltende OrganisationVITANOVA. Der Mann, der um neun Uhr fünfundvierzig in der Redaktion desWESTKURIERʼs anrief, erklärte, der Colonel habe als Vertreter einer aggressiven imperialistischen Macht auf der Liquidationsliste gestanden. Der Spanier, so hieß es weiter in der Erklärung der Terroristen, sei als zufälliger Zeuge zum Mitopfer geworden und die Organisation bedaure seinen Tod. DasBKAhat die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet eng mit den in der Bundesrepublik anwesenden amerikanischen Sicherheitsbehörden zusammen. Es wird bereits nach einer jungen Frau gefahndet, die in letzter Zeit mehrmals mit dem Colonel im Kellbacher Club Tennis gespielt hat und möglicherweise als Täterin in Frage kommt. Sie ist Anfang Zwanzig, etwa einen Meter sechzig groß, blond, schlank. Sie trat unter dem – mit hoher Wahrscheinlichkeit falschen – Namen Ruth Silbermann auf und fuhr einen dunkelgrauenTOYOTAmit Kölner Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise, die zur Klärung des Falles beitragen können und auf Wunsch vertraulich behandelt werden, nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!